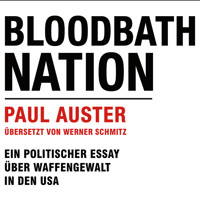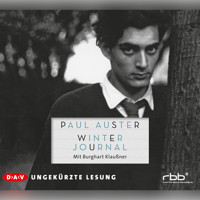9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2017
Paul Auster, der bekannte amerikanische Bestsellerautor, legt in Gestalt eines Rätselspiels sein bisher umfangreichstes Werk und Opus magnum vor: die vierfach unterschiedlich erzählte Geschichte eines jungen Amerikaners in den fünfziger und sechziger Jahren des 20. Jahrhunderts – ein Epos voll mit Politik, Zeitgeschichte, Liebe, Leidenschaft und dem wechselvollen Spiel des Zufalls. «4 3 2 1» – das sind vier Variationen eines Lebens: Archibald Ferguson, von allen nur Archie genannt, wächst im Newark der fünfziger Jahre auf. «Was für ein interessanter Gedanke», sagt er sich als kleiner Junge, «sich vorzustellen, wie für ihn alles anders sein könnte, auch wenn er selbst immer derselbe bliebe. Ja, alles war möglich, und nur weil etwas auf eine bestimmte Weise geschah, hieß das noch lange nicht, dass es nicht auch auf eine andere Weise geschehen konnte.» Im Verein mit der höheren Macht einer von Paul Auster raffiniert dirigierten literarischen Vorsehung entspinnen sich nun vier unterschiedliche Versionen von Archies Leben: provinziell und bescheiden; kämpferisch, aber vom Unglück verfolgt; betroffen und besessen von den Ereignissen der Zeit; künstlerisch genial begabt und nach den Sternen greifend. Und alle vier sind vollgepackt mit Abenteuern, Liebe, Lebenskämpfen und den Schlägen eines unberechenbaren Schicksals … «4 3 2 1» ist ein faszinierendes Gedankenspiel und ein Höhepunkt in Austers Schaffen. Seine großen Themen, das Streben nach Glück, die Rolle des Zufalls, Politik und Zeitgeschichte von Hiroshima bis Vietnam – alle sind hier versammelt und verdichtet in den hoffnungsvollen Lebenswegen eines jungen Mannes, der sein Glück in der Welt zu finden sucht. (Einige Kapitel mit Nummerierung, aber ohne Text in diesem Buch sind künstlerische Absicht des Autors, keine technischen Fehler.)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1714
Ähnliche
Paul Auster
4 3 2 1
Roman
Aus dem Englischen von Thomas Gunkel, Werner Schmitz, Karsten Singelmann und Nikolaus Stingl
Über dieses Buch
Paul Auster, der bekannte amerikanische Bestsellerautor, legt in Gestalt eines Rätselspiels sein bisher umfangreichstes Werk und Opus magnum vor: die vierfach unterschiedlich erzählte Geschichte eines jungen Amerikaners in den fünfziger und sechziger Jahren des 20. Jahrhunderts – ein Epos voll mit Politik, Zeitgeschichte, Liebe, Leidenschaft und dem wechselvollen Spiel des Zufalls.
«4 3 2 1» – das sind vier Variationen eines Lebens: Archibald Ferguson, von allen nur Archie genannt, wächst im Newark der fünfziger Jahre auf. «Was für ein interessanter Gedanke», sagt er sich als kleiner Junge, «sich vorzustellen, wie für ihn alles anders sein könnte, auch wenn er selbst immer derselbe bliebe. Ja, alles war möglich, und nur weil etwas auf eine bestimmte Weise geschah, hieß das noch lange nicht, dass es nicht auch auf eine andere Weise geschehen konnte.»
Im Verein mit der höheren Macht einer von Paul Auster raffiniert dirigierten literarischen Vorsehung entspinnen sich nun vier unterschiedliche Versionen von Archies Leben: provinziell und bescheiden; kämpferisch, aber vom Unglück verfolgt; betroffen und besessen von den Ereignissen der Zeit; künstlerisch genial begabt und nach den Sternen greifend. Und alle vier sind vollgepackt mit Abenteuern, Liebe, Lebenskämpfen und den Schlägen eines unberechenbaren Schicksals …
«4 3 2 1» ist ein faszinierendes Gedankenspiel und ein Höhepunkt in Austers Schaffen. Seine großen Themen, das Streben nach Glück, die Rolle des Zufalls, Politik und Zeitgeschichte von Hiroshima bis Vietnam – alle sind hier versammelt und verdichtet in den hoffnungsvollen Lebenswegen eines jungen Mannes, der sein Glück in der Welt zu finden sucht.
(Einige Kapitel mit Nummerierung, aber ohne Text in diesem Buch sind künstlerische Absicht des Autors, keine technischen Fehler.)
Vita
Paul Auster wurde 1947 in Newark, New Jersey, geboren. Er studierte Anglistik und vergleichende Literaturwissenschaften an der Columbia University und verbrachte nach dem Studium einige Jahre in Frankreich. International bekannt wurde er mit seinen frühen Romanen «Im Land der letzten Dinge» und der «New-York-Trilogie». Heute lebt er in Brooklyn. Er ist mit der Schriftstellerin Siri Hustvedt verheiratet und hat zwei Kinder. Sein umfangreiches, vielfach preisgekröntes Werk umfasst neben zahlreichen Romanen auch Essays und Lyrik sowie Übersetzungen zeitgenössischer französischer Lyrik.
Für Siri Hustvedt
1.0
Der Familienlegende zufolge verließ Fergusons Großvater, versehen mit hundert Rubeln, die ins Futter seines Jacketts eingenäht waren, zu Fuß seine Heimatstadt Minsk, gelangte über Warschau und Berlin nach Hamburg und buchte dort die Überfahrt auf einem Schiff namens Kaiserin von China, das bei rauen Winterstürmen den Atlantik überquerte und am ersten Tag des zwanzigsten Jahrhunderts im New Yorker Hafen einlief. Auf Ellis Island, beim Warten auf die Befragung durch einen Einwanderungsbeamten, kam er mit einem anderen russischen Juden ins Gespräch. Der Mann riet ihm: Vergiss den Namen Reznikoff. Der wird dir hier nichts nützen. Du brauchst einen amerikanischen Namen, einen, der sich gut amerikanisch anhört. Da das Englische für Isaac Reznikoff im Jahr 1900 noch eine Fremdsprache war, bat er seinen älteren, erfahreneren Landsmann um einen Vorschlag. Sag ihnen, du heißt Rockefeller, sagte der Mann. Damit kannst du nichts falsch machen. Eine Stunde verging, und noch eine, und als der neunzehnjährige Reznikoff endlich bei dem Einwanderungsbeamten an die Reihe kam, hatte er den Namen, zu dem der Mann ihm geraten hatte, längst wieder vergessen. Ihr Name?, fragte der Beamte. Der müde Einwanderer schlug sich verzweifelt an die Stirn und platzte auf Jiddisch heraus: Ich hob fargessen! Und so begann Isaac Reznikoff sein neues Leben in Amerika als Ichabod Ferguson.
Er hatte es schwer, besonders zu Anfang, aber auch, als von Anfang keine Rede mehr sein konnte, lief für ihn in seiner Wahlheimat nichts so, wie er es sich vorgestellt hatte. Zwar fand er eine Frau, die er kurz nach seinem sechsundzwanzigsten Geburtstag heiratete, und diese Frau, Fanny, geborene Grossman, schenkte ihm drei stramme und gesunde Söhne, aber das Leben in Amerika blieb für Fergusons Großvater ein einziger Kampf, von dem Tag an, als er das Schiff verließ, bis zum Abend des 7. März 1923, an dem ihn mit zweiundvierzig Jahren ein früher, unerwarteter Tod ereilte – niedergeschossen bei einem Überfall auf das Lederwarendepot in Chicago, wo er als Nachtwächter gearbeitet hatte.
Kein Foto ist von ihm erhalten, aber dem Vernehmen nach war er ein Hüne mit starkem Rücken und riesigen Händen, ein ungebildeter, ungelernter Arbeiter, das Musterbild eines ahnungslosen Greenhorns. An seinem ersten Nachmittag in New York begegnete er einem Straßenhändler, der so rote, runde, makellose Äpfel feilbot, wie er noch nie welche gesehen hätte. Er konnte nicht widerstehen, kaufte einen und biss gierig hinein. Aber nicht süß war, was er zu schmecken bekam, sondern bitter und ungewohnt. Schlimmer noch, der Apfel war widerlich weich, und kaum hatten seine Zähne die Schale durchdrungen, ergoss ein blassroter, mit einer Schrotladung Kerne versetzter Saft sich auf seinen Mantel. Dies war die erste Kostprobe von New York, seine erste, unvergessliche Begegnung mit einer Jersey-Tomate.
Also kein Rockefeller, sondern ein breitschultriger Hilfsarbeiter, ein hebräischer Riese mit absurdem Namen und zwei rastlosen Füßen, der sein Glück in Manhattan und Brooklyn versuchte, in Baltimore und Charleston, in Duluth und Chicago, als Hafenarbeiter, als Leichtmatrose auf einem Tanker, der die Großen Seen befuhr, als Tierpfleger bei einem Wanderzirkus, als Fließbandarbeiter in einer Blechdosenfabrik, als Lastwagenfahrer, Grabengräber und Nachtwächter. Trotz aller Mühen verdiente er nie mehr als ein bisschen Kleingeld, und so hinterließ der arme Ike Ferguson seiner Frau und seinen drei Söhnen nichts anderes als die Geschichten, die er ihnen vom Vagabundenleben seiner Jugend erzählt hatte. Auf lange Sicht sind Geschichten vielleicht nicht weniger wert als Geld, fürs Erste aber sind ihre Möglichkeiten beschränkt.
Der Lederwarenhersteller zahlte Fanny eine kleine Entschädigung für ihren Verlust, und sie verließ Chicago und zog mit ihren Jungen nach Newark, New Jersey, auf Einladung von Verwandten ihres Mannes, die ihr gegen eine äußerst niedrige Miete die Wohnung im Dachgeschoss ihres Hauses im Central Ward überließen. Ihre Söhne waren vierzehn, zwölf und neun Jahre alt. Aus Louis, dem ältesten, war längst Lew geworden. Aaron, der mittlere, hatte sich, nachdem er auf dem Schulhof in Chicago allzu oft verprügelt worden war, den Namen Arnold zugelegt, und Stanley, der Neunjährige, wurde von allen Sonny genannt. Um über die Runden zu kommen, nahm ihre Mutter Wäsche an und besserte Kleider aus, doch bald trugen auch die Jungen zum Haushaltseinkommen bei, mit kleinen Jobs nach der Schule, von denen sie jeden Penny bei der Mutter ablieferten. Es waren harte Zeiten, und die Drohung völliger Verarmung hing in den Zimmern der Wohnung wie ein dichter, alles verhüllender Nebel. Vor der Angst gab es kein Entrinnen, und nach und nach übernahmen die drei Jungen die düsteren ontologischen Einsichten ihrer Mutter über den Sinn des Lebens. Arbeiten oder verhungern. Arbeiten oder das Dach überm Kopf verlieren. Arbeiten oder sterben. Die einfältige Vorstellung des «Alle für einen und einer für alle» gab es für die Fergusons nicht. In ihrer kleinen Welt galt «Alle für alle – oder nichts».
Als seine Großmutter starb, war Ferguson noch nicht einmal zwei, sodass er keine bewusste Erinnerung an sie hatte, doch der Familienlegende zufolge war Fanny eine schwierige, sprunghafte Frau, die nicht selten in heftige Schreikrämpfe oder manisches, unbändiges Schluchzen ausbrach, die ihre Söhne, wenn sie ungezogen waren, mit dem Besen schlug und etliche Geschäfte, in denen sie allzu lautstark um Preise gefeilscht hatte, nicht mehr betreten durfte. Niemand wusste, wo sie geboren war, aber angeblich war sie als vierzehnjährige Waise in New York gelandet und hatte auf der Lower East Side jahrelang in einer fensterlosen Dachbodenstube als Hutmacherin gearbeitet. Fergusons Vater, Stanley, sprach selten mit seinem Sohn über seine Eltern und antwortete auf Fragen des Jungen nur äußerst vage, kurz angebunden und zurückhaltend, und was immer der Junge über seine Großeltern väterlicherseits in Erfahrung bringen konnte, kam fast ausschließlich von seiner Mutter, Rose, der mit Abstand jüngsten der drei Ferguson-Schwägerinnen der zweiten Generation, die wiederum die meisten Einzelheiten von Millie, der Frau von Lew, wusste, einer klatschsüchtigen Frau, deren Mann weitaus weniger verschwiegen und weitaus gesprächiger war als Stanley oder Arnold. Als Ferguson achtzehn war, erzählte ihm seine Mutter eine von Millies Geschichten weiter, angeblich nur ein Gerücht, eine durch nichts bewiesene Vermutung, die möglicherweise den Tatsachen entsprach – oder aber auch nicht. Nach dem, was Lew Millie erzählt hatte beziehungsweise angeblich erzählt hatte, gab es ein viertes Ferguson-Kind, ein Mädchen, das drei oder vier Jahre nach Stanley geboren worden war, in der Zeit, als die Familie in Duluth lebte und Ike sich um eine Anstellung als Leichtmatrose auf den Großen Seen bemühte, im Verlauf von Monaten, die die Familie in äußerster Armut verbrachte; und weil Ike nicht da war, als Fanny das Kind zur Welt brachte, und weil die Geburt in Minnesota und mitten im Winter stattfand, einem besonders kalten Winter in einem besonders kalten Landstrich, und weil das Haus, in dem sie wohnten, nur mit einem einzigen Holzofen beheizt werden konnte und weil gerade zu der Zeit so wenig Geld da war, dass Fanny und die Jungen mit nur einer Mahlzeit am Tag auskommen mussten, erfüllte sie der Gedanke, sich um noch ein weiteres Kind kümmern zu sollen, mit solcher Angst, dass sie ihre neugeborene Tochter in der Badewanne ertränkte.
Stanley erzählte seinem Sohn wenig von seinen Eltern, aber auch von sich selbst sprach er nicht viel. Das erschwerte es Ferguson, ein klares Bild davon zu gewinnen, wie sein Vater als kleiner oder größerer Junge oder junger Erwachsener gewesen sein mochte, bevor er zwei Monate nach seinem dreißigsten Geburtstag Rose geheiratet hatte. Aus beiläufigen Bemerkungen, die seinem Vater gelegentlich von den Lippen kamen, gelang es Ferguson doch, immerhin Folgendes zusammenzutragen: dass Stanley von seinen älteren Brüdern oft gehänselt und herumgeschubst worden war, dass er als der Jüngste der drei und deshalb derjenige, der den geringsten Teil seiner Kindheit mit einem lebenden Vater verbracht hatte, wie eine Klette an Fanny gehangen hatte, dass er ein fleißiger Schüler und von den drei Brüdern mit Abstand der beste Sportler gewesen war, dass er im Footballteam der Central High gespielt hatte und in der Leichtathletikmannschaft die Vierhundert Meter gelaufen war, dass sein Talent für Elektronik ihm nach Abschluss der Highschool im Sommer 1932 dazu verholfen hatte, eine kleine Radioreparaturwerkstatt zu eröffnen (ein Mauseloch an der Academy Street in Newark, wie er das nannte, kaum größer als ein Schuhputzerstand), dass er mit elf bei einer der Besenattacken seiner Mutter am rechten Auge verletzt worden war (mit teilweisem Verlust der Sehkraft, sodass er im Zweiten Weltkrieg als untauglich ausgemustert wurde), dass er den Spitznamen Sonny nicht ausstehen konnte und unmittelbar nach Verlassen der Schule abgelegt hatte, dass er gern tanzte und Tennis spielte, dass er nie ein schlechtes Wort über seine Brüder sagte, ganz gleich wie blöd oder geringschätzig sie ihn behandelten, dass er als Kind nach der Schule Zeitungen ausgetragen hatte, dass er ernsthaft vorhatte, Jura zu studieren, den Plan jedoch aus Geldmangel wieder aufgab, dass er in seinen Zwanzigern als Frauenheld bekannt war und mit Dutzenden junger Jüdinnen anbandelte, ohne die Absicht, eine von ihnen zu heiraten, dass er in den Dreißigern, als Havanna die Welthauptstadt der Sünde war, mehrere Spritztouren nach Kuba gemacht hatte und dass sein größter Ehrgeiz darin bestand, Millionär zu werden, ein Mann so reich wie Rockefeller.
Lew und Arnold heirateten beide mit Anfang zwanzig und nur, um so schnell wie möglich Fannys verrücktem Haushalt zu entkommen, der kreischenden Monarchin zu entfliehen, die seit dem Tod ihres Mannes 1923 über die Fergusons geherrscht hatte, Stanley hingegen, noch ein Teenager, als seine Brüder Reißaus nahmen, hatte keine Wahl und musste bleiben. Schließlich war er gerade erst mit der Highschool fertig, aber dann vergingen elf Jahre, eins nach dem anderen, und unerklärlicherweise blieb er weiter in Fannys Dachwohnung und durchlebte mit ihr die Weltwirtschaftskrise und die erste Hälfte des Krieges, vielleicht aus Trägheit oder Faulheit, vielleicht aus Verantwortungsbewusstsein oder Schuldgefühlen seiner Mutter gegenüber, falls nicht all dies zusammen es ihm unmöglich machte, sich auch nur vorzustellen, dass er anderswo leben könnte. Lew und Arnold zeugten Kinder, aber Stanley gab sich offenbar mit seinen ständig wechselnden Affären zufrieden und verwandte den Großteil seiner Energie darauf, aus seinem kleinen Geschäft ein größeres zu machen, und da er, selbst als er tänzelnd auf die dreißig zuschritt, keinerlei Heiratsabsichten erkennen ließ, zweifelte kaum jemand daran, dass er für den Rest seines Lebens Junggeselle bleiben würde. Dann, im Oktober 1943, keine Woche nachdem die fünfte US-Armee Neapel von den Deutschen zurückerobert hatte, mitten in dieser hoffnungsvollen Phase, als der Krieg sich endlich zugunsten der Alliierten zu wenden begann, lernte Stanley bei einem Blind Date in New York die einundzwanzig Jahre alte Rose Adler kennen, und mit einem Schlag war der Reiz eines lebenslangen Junggesellendaseins ein für alle Mal verblasst.
So hübsch war sie, Fergusons Mutter, so bezaubernd mit ihren graugrünen Augen und den langen braunen Haaren, so ungekünstelt, munter und stets vergnügt, so prächtig gebaut auf der ganzen Länge der ihr zugeteilten hundertachtundsechzig Zentimeter, dass Stanley, als er ihr zum ersten Mal die Hand gab, der reservierte und sonst so kühle Stanley, der neunundzwanzig Jahre alte Stanley, der noch nie zuvor das Feuer der Liebe gespürt hatte, in Rose’ Gegenwart schier zu vergehen glaubte, so als wäre ihm die Luft aus den Lungen gepumpt worden, so als könnte er nie wieder einen Atemzug tun.
Auch sie war das Kind von Einwanderern, ihr Vater aus Warschau und ihre Mutter aus Odessa, beide noch nicht einmal drei Jahre alt, als sie nach Amerika kamen. Folglich waren die Adlers besser integriert als die Fergusons, und Rose’ Eltern sprachen von Kindesbeinen an ohne jeden ausländischen Akzent. Aufgewachsen waren sie in Detroit und Hudson, New York, und das Jiddisch, Polnisch und Russisch ihrer Eltern hatte einem fließenden, fehlerfreien Englisch Platz gemacht, wohingegen Stanleys Vater bis zum Tag seines Todes mit seiner zweiten Sprache gerungen hatte, und seine Mutter las noch jetzt, 1943, fast ein halbes Jahrhundert entfernt von ihrer osteuropäischen Heimat, den Jewish Daily Forward und nicht die amerikanischen Zeitungen und artikulierte sich in einer seltsam vermanschten Sprache, die ihre Söhne Jinglisch nannten, einem nahezu unverständlichen Patois, das in fast jedem Satz, der ihren Lippen entfloh, jiddische und englische Elemente miteinander vermengte. Dies war einer der wesentlichen Unterschiede zwischen Rose’ und Stanleys Vorfahren, noch wichtiger aber als die Frage, wie sehr oder wie wenig ihre Eltern sich an das amerikanische Leben angepasst hatten, war die Sache mit dem Glück. Rose’ Eltern und Großeltern waren von grausamen Wendungen des Schicksals, wie sie die vom Pech verfolgten Fergusons heimgesucht hatten, verschont geblieben, in ihrer Familiengeschichte gab es keine Opfer von Raubüberfällen, keine Armut bis kurz vorm Hungertod und Verzagen, keine in der Badewanne ertränkten Säuglinge. Der Detroiter Großvater hatte als Schneider, der Hudsoner Großvater als Barbier gearbeitet, und mochten auch Kleidermachen und Haareschneiden nicht zu den Jobs gehören, die einem zu Reichtum und irdischem Erfolg verhalfen, so sorgten sie doch für ein gleichmäßiges Einkommen, mit dem sich das Essen auf dem Tisch und die Kleidung für die Kinder bestreiten ließen.
Rose’ Vater Benjamin, auch als Ben und Benjy bekannt, verließ Detroit 1911, einen Tag nachdem er die Highschool abgeschlossen hatte, und ging nach New York, wo ein entfernter Verwandter ihm eine Stelle als Verkäufer in einem Kleidergeschäft besorgt hatte, aber der junge Adler gab den Job binnen zwei Wochen auf, denn seiner Überzeugung nach war es nicht sein Schicksal, die kurze Zeit auf Erden mit dem Verkauf von Herrensocken und Unterwäsche zu vergeuden, und zweiunddreißig Jahre später, nach Episoden als Klinkenputzer für Haushaltsreiniger, Großhändler für Grammophonplatten, Soldat im Ersten Weltkrieg, Autoverkäufer und Mitinhaber eines Gebrauchtwagengeländes in Brooklyn, verdiente er jetzt seinen Lebensunterhalt als einer von drei minderheitsbeteiligten Partnern in einem Manhattaner Maklerbüro, mit einem Einkommen, das es ihm 1941, sechs Monate vor Amerikas Eintritt in den Krieg, ermöglicht hatte, mit seiner Familie aus Crown Heights in Brooklyn in ein neues Gebäude an der West 58th Street umzuziehen.
Nach dem, was man Rose erzählt hatte, lernten ihre Eltern sich bei einem sonntäglichen Picknick nördlich von New York kennen, nicht weit vom Haus ihrer Mutter in Hudson, und schon nach einem halben Jahr (im November 1919) waren die beiden verheiratet. Wie Rose später ihrem Sohn gestand, sei diese Ehe ihr immer ein Rätsel gewesen, denn selten habe sie zwei Menschen gesehen, die weniger zueinander passten als ihre Eltern, und dass die Ehe über vier Jahrzehnte lang gehalten habe, sei zweifellos eins der großen Mysterien in den Annalen menschlicher Paarbildung. Benjy Adler war ein geschwätziger Besserwisser, ein stürmischer Plänemacher mit hundert Projekten in der Tasche, ein Witzeerzähler, ein Mann, der immer im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit stehen wollte, und bei jenem sonntäglichen Picknick nördlich von New York musste er sich in ein schüchternes Mauerblümchen namens Emma Bromowitz verlieben, ein dralles dreiundzwanzigjähriges Mädchen mit großem Busen, kalkig weißer Haut und üppigem rotem Haar, so jungfräulich, so unerfahren, so viktorianisch in ihrem Gebaren; auf den ersten Blick war zu erkennen, dass ihre Lippen noch nie von denen eines Mannes berührt worden waren. Die Heiratspläne der beiden erschienen absurd, alles wies darauf hin, dass sie zu einem Leben voller Konflikte und Missverständnisse verurteilt waren, und doch heirateten sie, und wenn Benjy nach der Geburt ihrer Töchter (Mildred 1920, Rose 1922) auch Schwierigkeiten hatte, Emma treu zu bleiben, hielt er in seinem Herzen immer an ihr fest, und sie, die vielfach Betrogene, konnte sich nie dazu durchringen, ihm den Rücken zuzukehren.
Rose betete ihre ältere Schwester an, aber dass es sich andersherum genauso verhielt, kann man nicht gerade sagen, denn die erstgeborene Mildred hatte die ihr von Gott geschenkte Rolle als Prinzessin des Haushalts wie selbstverständlich angenommen, und der kleinen Rivalin, die da plötzlich den Schauplatz betreten hatte, musste – notfalls immer wieder – die Lektion erteilt werden, dass die Adler’sche Wohnung in der Franklin Avenue nur einen Thron zu vergeben hatte, einen Thron für nur eine Prinzessin, und dass jeder Versuch, diesen Thron zu besteigen, eine Kriegserklärung nach sich ziehen würde. Womit nicht gesagt sein soll, dass Mildred Rose gegenüber offen feindselig war, doch maß sie ihre Freundlichkeiten mit dem Teelöffel ab, nur immer ein kleines bisschen pro Minute, Stunde oder Monat, und stets mit einem Hauch hochnäsiger Herablassung erteilt, wie es sich für eine Person von königlichem Rang gehörte. Die kalte, umsichtige Mildred, die warmherzige, nachlässige Rose. Als die Mädchen zwölf und zehn waren, zeigte sich schon deutlich, dass Mildred einen außerordentlichen Verstand besaß, dass ihr Erfolg in der Schule nicht nur das Ergebnis fleißigen Lernens war, sondern auch auf überragenden intellektuellen Gaben beruhte, und obwohl auch Rose recht klug war und ordentliche Noten nach Hause brachte, erschien sie im Vergleich zu ihrer Schwester doch nur unter ferner liefen. Ohne ihre Motive zu durchschauen, ohne bewusst darüber nachzudenken oder einen Plan zu fassen, hörte Rose allmählich einfach auf, sich mit Mildred zu messen, vielleicht aus der instinktiven Erkenntnis heraus, dass jeglicher Versuch, es ihrer Schwester gleichzutun, nur in einem Fiasko enden konnte und sie also, wenn sie jemals glücklich sein wollte, einen anderen Weg einschlagen musste.
Die Lösung für sie hieß arbeiten, sich durch Geldverdienen einen Platz erobern, und sobald sie vierzehn und damit alt genug war, um Arbeitspapiere zu beantragen, fand sie ihren ersten Job, dem rasch eine Reihe weiterer folgten, und mit sechzehn arbeitete sie tagsüber in Vollzeit und ging abends auf die Highschool. Mochte Mildred sich in das Kloster ihres mit Büchern vollgestopften Hirns zurückziehen, aufs College entschweben und jedes einzelne Buch lesen, das in den vergangenen zweitausend Jahren geschrieben worden war, Rose sehnte sich nach Wirklichkeit, das war ihre Welt, der Lärm und Trubel der New Yorker Straßen, das Gefühl, selbst verantwortlich zu sein und ihren eigenen Weg zu gehen. Wie die unerschrockenen, schlagfertigen Heldinnen in den Kinofilmen, die sie sich zwei- oder dreimal die Woche ansah, wie Claudette Colbert, Barbara Stanwyck, Ginger Rogers, Joan Blondell, Rosalind Russell und Jean Arthur schlüpfte sie in die Rolle eines jungen, entschlossenen Karrieremädchens und behielt sie bei, so als lebte sie selbst in einem Film, Die Geschichte von Rose Adler, jenem langen, unendlich komplizierten Streifen, der gerade erst begonnen hatte, aber für die kommenden Jahre noch manches Große verhieß.
Als sie Stanley im Oktober 1943 kennenlernte, arbeitete sie seit zwei Jahren bei dem Porträtfotografen Emanuel Schneiderman, dessen Atelier an der West 27th Street unweit der Sixth Avenue lag. Angefangen hatte Rose dort als Empfangsdame, Sekretärin und Buchhalterin in einer Person, dann aber, als Schneidermans Assistent im Juni 1942 in den Krieg zog, dessen Stelle übernommen. Der alte Schneiderman, ein deutschjüdischer Einwanderer, inzwischen Mitte sechzig, war nach dem Ersten Weltkrieg mit Frau und zwei Söhnen nach New York gekommen, ein mürrischer, verschrobener Zeitgenosse, der sehr ausfallend werden konnte, mit der Zeit aber eine widerwillige Zuneigung zu der schönen Rose fasste, und da ihm nicht entgangen war, wie aufmerksam sie ihn von Anfang an bei der Arbeit im Atelier beobachtet hatte, beschloss er, sie zu seinem Lehrling zu machen und ihr alles beizubringen, was er über Kameras, Beleuchtung und das Entwickeln von Filmen wusste – alles an Kunst und Handwerk, was sein Geschäft ausmachte. Rose, die bis dahin nie so recht gewusst hatte, wohin es mit ihr gehen sollte, die in wechselnden Bürojobs nur des Geldes wegen, soll heißen, ohne Hoffnung auf innere Befriedigung, gearbeitet hatte, erschien es so, als hätte sie plötzlich eine Berufung gefunden – nicht bloß irgendeinen Job, sondern eine neue Art, auf der Welt zu sein: anderen ins Gesicht sehen, Tag für Tag andere Gesichter, vormittags und nachmittags neue Gesichter, jedes Gesicht anders als alle anderen Gesichter, und binnen kurzem stellte sie fest, dass sie es liebte, anderen ins Gesicht zu sehen, und dass sie dieser Arbeit niemals überdrüssig werden würde.
Stanley arbeitete inzwischen mit seinen Brüdern zusammen, die ebenfalls beide vom Militärdienst befreit worden waren (Plattfüße und Kurzsichtigkeit), und nach mehreren Um- und Ausbauten war die 1932 gegründete Radioreparaturwerkstatt herangewachsen zu einem ansehnlichen Geschäft für Möbel und Haushaltsgeräte in der Springfield Avenue, das mit sämtlichen dem damaligen amerikanischen Einzelhandel zur Verfügung stehenden Lockmitteln und Kinkerlitzchen aufwartete: langfristigen Ratenplänen, Zwei-zum-Preis-von-einem-Angeboten, halbjährlichen Ausverkäufen, Beratungsservice für Frischvermählte, Sonderaktionen zum Tag der US-Flagge. Arnold, der ungeschickte, nicht besonders helle mittlere Bruder, der etliche Jobs als Verkäufer verloren und große Schwierigkeiten hatte, seine Frau und die drei Kinder über Wasser zu halten, war als Erster dazugestoßen, und zwei Jahre später schloss Lew sich den beiden an, nicht weil er sich für Möbel oder Haushaltsgeräte interessierte, sondern weil Stanley soeben zum zweiten Mal in fünf Jahren seine Spielschulden beglichen und ihn gezwungen hatte, zur Bekundung seines guten Willens und seiner Zerknirschung in das Geschäft einzutreten, wobei stillschweigend vorausgesetzt war, Widerstand vonseiten Lews werde zur Folge haben, dass er bis an sein Lebensende keinen Penny mehr von ihm bekommen würde. Und damit war Three Brothers Home World geboren, das bekannte Unternehmen, das im Grunde nur von einem Bruder, nämlich Stanley, geleitet wurde, dem jüngsten und ehrgeizigsten von Fannys Söhnen, der aus der verdrehten, aber unerschütterlichen Überzeugung heraus, Familienloyalität schlage alle anderen menschlichen Eigenschaften, bereitwillig die Last auf sich genommen hatte, zwei erfolglose Geschwister mitzuschleppen, die ihre Dankbarkeit ihm gegenüber dadurch zum Ausdruck brachten, dass sie immer wieder zu spät zur Arbeit erschienen, Zehner und Zwanziger aus der Kasse klauten, wann immer sie nichts in der Tasche hatten, und in den warmen Monaten nach der Mittagspause das Feld räumten und Golf spielen gingen. Auch wenn es ihn ärgern mochte, Stanley beklagte sich nicht über dies Treiben, denn die Gesetze des Universums verboten es, über die eigenen Brüder zu klagen, und mochten die Gewinne von Home World auch ein bisschen niedriger ausfallen, als sie es ohne die Ausgaben für Lews und Arnolds Gehälter gewesen wären, schrieb das Geschäft doch schwarze Zahlen, und als der Krieg nach ein, zwei Jahren vorbei war, hellte sich das Bild noch weiter auf, denn jetzt trat das Fernsehen seinen Siegeszug an, und die Brüder waren die Ersten, die die neuen Apparate im Angebot hatten. Nein, noch war Stanley kein reicher Mann, aber seit einiger Zeit hatte sein Einkommen stetig zugenommen, und als er Rose an jenem Oktoberabend im Jahr 1943 kennenlernte, war er zuversichtlich, dass seine beste Zeit noch vor ihm lag.
Im Gegensatz zu Stanley hatte Rose schon einmal im Feuer leidenschaftlicher Liebe gebrannt. Ohne den Krieg, der ihr diese Liebe genommen hatte, wären die beiden sich nie begegnet, denn dann wäre sie lange vor jenem Oktoberabend mit jemand anderem verheiratet gewesen, aber ihr junger Verlobter, David Raskin, der in Brooklyn geborene zukünftige Arzt, dessen Bekanntschaft sie mit siebzehn gemacht hatte, war bei einer tragischen Explosion während der Grundausbildung in Fort Benning in Florida ums Leben gekommen. Die Nachricht hatte sie im August 1942 ereilt, und noch viele Monate danach hatte Rose Trauer getragen, stumm und erbittert, ausgelaugt, hoffnungslos, halb verrückt vor Gram, voller Hass auf den Krieg, wenn sie nachts in ihr Kopfkissen schrie, unfähig, sich damit abzufinden, dass David sie nie wieder berühren würde. Das Einzige, was sie in diesen Monaten aufrecht hielt, war ihre Arbeit mit Schneiderman, die immerhin ein bisschen Trost, ein bisschen Freude, einen kleinen Anlass bot, morgens aus dem Bett zu steigen, aber die Lust, unter die Leute zu kommen oder andere Männer kennenzulernen, war ihr vergangen, und so wurde ihr Leben zu einer bloßen Routine aus Arbeit, Wohnung und Kinobesuchen mit ihrer Freundin Nancy Fein. Nach und nach jedoch, vor allem in den vergangenen zwei oder drei Monaten, hatte Rose dann doch zu sich zurückgefunden und zum Beispiel wiederentdeckt, dass Essen einen Geschmack hatte, wenn man es in den Mund nahm, dass der Regen nicht allein auf sie, sondern auf die ganze Stadt niederging, dass jeder, ob Mann, Frau oder Kind, über dieselben Pfützen springen musste wie sie. Nein, sie würde Davids Tod nie verwinden, er würde für immer als heimlicher Geist neben ihr hergehen, während sie in die Zukunft stolperte, aber einundzwanzig war noch kein Alter, sich von der Welt abzuwenden, und sie wusste, wenn sie sich nicht die Mühe machte, in diese Welt zurückzukehren, würde sie umfallen und sterben.
Es war Nancy Fein, die ihr das Blind Date mit Stanley verschaffte, die geistreiche, sarkastische Nancy mit dem großen Gebiss und den dünnen Armen, Nancy, Rose’ beste Freundin seit der gemeinsamen Kindheit in Crown Heights. Nancy hatte Stanley bei einem Tanzabend in Brown’s Hotel in den Catskills kennengelernt, einem dieser gutbesuchten Wochenendvergnügen für ledige, aber aktiv suchende junge Juden aus der Stadt, koscherer Fleischmarkt, wie Nancy das nannte, und obwohl Nancy selbst nicht aktiv suchte (sie war mit einem im Pazifik stationierten Soldaten verlobt, der nach aktuellem Stand noch unter den Lebenden weilte), war sie nur so zum Spaß mit einer Freundin dort hingegangen und hatte ein paarmal mit Stanley, einemJungen aus Newark, das Tanzbein geschwungen. Er wollte sie wiedersehen, erzählte Nancy, doch als sie ihm sagte, sie habe ihre Unschuld bereits jemand anderem versprochen, lächelte er, machte eine komische kleine Verbeugung und wollte schon gehen, als sie ihm von ihrer Freundin Rose zu erzählen begann, Rose Adler, das hübscheste Mädchen diesseits der Donau, die netteste Person diesseits von überall. So dachte Nancy wirklich von Rose, und als Stanley begriff, wie ernst es ihr damit war, ließ er sie wissen, dass er diese ihre Freundin gern einmal kennenlernen wolle. Nancy entschuldigte sich bei Rose, ihren Namen aufs Tapet gebracht zu haben, aber Rose zuckte nur mit den Schultern, sie wusste ja, dass Nancy es nicht böse gemeint hatte, und fragte dann: Und, wie ist er? Nancy zufolge war Stanley Ferguson ungefähr eins achtzig groß, gutaussehend, ein bisschen alt, knapp dreißig, alt also nur in ihren einundzwanzigjährigen Augen, selbständiger Kaufmann und anscheinend gut im Geschäft, charmant, höflich, ein sehr guter Tänzer. Nachdem Rose sich das angehört hatte, überlegte sie kurz, ob sie der Herausforderung eines Blind Date gewachsen wäre, und während sie noch darüber nachdachte, kam ihr plötzlich in den Sinn, dass David schon seit über einem Jahr tot war. Ob sie wollte oder nicht, die Zeit war reif, den Blick wieder über den Tellerrand zu heben. Sie sah Nancy an und sagte: Vielleicht sollte ich mir diesen Stanley Ferguson mal ansehen, was meinst du?
Jahre später, als Rose ihrem Sohn von den Ereignissen jenes Abends erzählte, verschwieg sie den Namen des Restaurants, in dem sie und Stanley sich zum Essen verabredet hatten. Aber wenn Ferguson sich nicht täuschte, war es irgendwo in Manhattan, East Side oder West Side, auf alle Fälle ein elegantes Lokal mit weißen Tischtüchern und Kellnern mit Fliege und kurzer schwarzer Jacke, was nur bedeuten konnte, dass Stanley sich vorgenommen hatte, ihr zu imponieren, ihr zu zeigen, dass er sich einen Luxus wie diesen jederzeit leisten konnte, und, ja, sie fand ihn äußerlich anziehend, sie war beeindruckt von seiner leichtfüßigen Art, von seinen anmutigen, flüssigen Bewegungen, von seinen Händen, von der Größe und Kraft seiner Hände, das bemerkte sie sofort, und von den sanften, friedfertigen Augen, die sie unablässig ansahen, braune Augen, weder groß noch klein, unter dichten schwarzen Brauen. Nichts ahnend von dem ungeheuren Eindruck, den sie auf ihren überwältigten Tischgenossen machte, von dem Händedruck, bei dem Stanleys Inneres sich schier aufgelöst hatte, war sie ein bisschen befremdet, wie wortkarg er sich zu Beginn der Mahlzeit gab, und hielt ihn deshalb für einen übertrieben schüchternen Menschen, was nicht ganz den Tatsachen entsprach. Da sie selbst nervös war und da Stanley weiterhin kaum ein Wort hervorbrachte, sprach sie schließlich für sie beide, soll heißen, sie redete zu viel, und je länger sie redete, desto entsetzter war sie über sich selbst, über ihr einfältiges Plappermaul, das unter anderem von ihrer Schwester prahlte, was für eine glänzende Studentin Mildred sei, summa cum laude vergangenen Juni am Hunter College und jetzt im Masterstudiengang an der Columbia, die einzige Frau in der anglistischen Fakultät, eine von nur drei Juden, man stelle sich vor, wie stolz die Familie auf sie sei, und kaum erwähnte sie die Familie, fing sie von ihrem Onkel Archie an, dem jüngeren Bruder ihres Vaters, Archie Adler, Pianist im Downtown Quintet, das zurzeit in Moe’s Hideout an der 52nd Street gastiere, und wie inspirierend es sei, einen Musiker in der Familie zu haben, einen Künstler, einen Rebellen, der noch an anderes denke als nur ans Geldverdienen, ja, sie liebe ihren Onkel Archie, er sei mit Abstand ihr Lieblingsverwandter, woraufhin sie unvermeidlich auf ihre Arbeit bei Schneiderman zu sprechen kam und alles aufzählte, was er ihr in den zurückliegenden anderthalb Jahren beigebracht habe, der griesgrämige, grobklotzige Schneiderman, der sie an Sonntagnachmittagen in die Bowery mitnehme, wo er nach alten Stadtstreichern und Säufern Ausschau halte, kaputten Geschöpfen mit weißen Bärten und langen weißen Haaren, großartigen Köpfen, den Köpfen uralter Propheten und Könige, und Schneiderman gebe diesen Männern Geld, dass sie in sein Atelier kämen und für ihn posierten, meistens im Kostüm, die alten Männer ausstaffiert mit Turbanen, langen Gewändern und Roben aus Samt, genau wie Rembrandt im siebzehnten Jahrhundert die Stadtstreicher von Amsterdam ausstaffiert habe, und auch das Licht, in dem sie diese Männer fotografierten, sei das Licht von Rembrandt, hell und dunkel, tiefe Schatten, fast nur Schatten mit leisen Andeutungen von Licht, und inzwischen sei Schneiderman hinreichend von ihrem Können überzeugt, sodass er das Ausleuchten der Szenen ihr allein überlasse, inzwischen habe sie Dutzende dieser Porträts selbst angefertigt, und dann benutzte sie das Wort chiaroscuro, merkte aber gleich, dass Stanley keine Ahnung hatte, wovon sie redete, dass sie genauso gut japanisch hätte sprechen können, auch wenn er sie immer noch ansah, ihr hingerissen lauschte, stumm und vom Donner gerührt.
Sie führte sich erbärmlich auf, peinlich, dachte sie. Zum Glück wurde ihr Monolog vom Eintreffen des Hauptgangs unterbrochen, was ihr ein bisschen Zeit verschaffte, ihre Gedanken zu ordnen, und als sie zu essen begannen (was genau, ist unbekannt), hatte sie sich halbwegs beruhigt und erkannt, dass sie mit ihrer untypischen Weitschweifigkeit nur vermieden hatte, von David zu erzählen, denn dies war das einzige Thema, über das sie nicht reden wollte, über das sie auf keinen Fall reden wollte, und nur um sich von dieser Wunde nichts anmerken zu lassen, hatte sie so lächerlich viel Aufwand betrieben. Stanley Ferguson hatte damit nichts zu tun. Er schien ein anständiger Mann zu sein, und es war nicht seine Schuld, dass die Army ihn nicht hatte haben wollen, dass er in maßgeschneidertem Anzug in diesem Restaurant speiste und nicht im Schlamm irgendeines fernen Schlachtfelds herumrobbte oder während der Grundausbildung in Stücke gerissen wurde. Nein, es war nicht seine Schuld, und es wäre herzlos von ihr, ihm vorzuwerfen, dass er verschont geblieben war, und doch, wie nicht diesen Vergleich anstellen, wie an der Frage vorbeikommen, warum dieser Mann lebte und David nicht?
Trotz alledem lief das Essen ganz gut. Nachdem Stanley sich von seinem anfänglichen Schock erholt hatte und wieder atmen konnte, erwies er sich als liebenswürdiger Kerl, nicht so stark von sich eingenommen wie viele andere Männer, sondern aufmerksam und kultiviert, vielleicht nicht gerade ein besonders heller Kopf, aber einer, der Humor hatte und lachte, wenn sie etwas auch nur entfernt Komisches sagte, und als er von seiner Arbeit und seinen Plänen für die Zukunft erzählte, erkannte Rose in ihm einen durchaus soliden und verlässlichen Menschen. Nur schade, dass er Geschäftsmann war und sich weder für Rembrandt noch für Fotografie interessierte, aber wenigstens war er für FDR (ein wesentlicher Punkt) und ehrlich genug, zuzugeben, dass er von vielen Dingen wenig oder nichts verstand, wozu eben auch die Malerei des siebzehnten Jahrhunderts und die Kunst des Fotografierens zählten. Er gefiel ihr. Sie fühlte sich wohl in seiner Nähe, aber mochte er auch alle oder die meisten Eigenschaften eines sogenannten guten Fangs besitzen, so wusste sie doch, dass sie niemals so in Liebe zu ihm entbrennen würde, wie Nancy es erhoffte. Nach dem Essen im Restaurant schlenderten sie eine halbe Stunde lang durch die Straßen, kehrten auf einen Drink in Moe’s Hideout ein, wo sie Onkel Archie zuwinkten, der die Tasten seines Pianos bearbeitete (er antwortete augenzwinkernd mit einem feisten Lächeln), und dann begleitete Stanley sie zur Wohnung ihrer Eltern in der West 58th Street. Er fuhr sogar noch im Aufzug mit ihr nach oben, aber sie bat ihn nicht hinein. Sie reichte ihm zum Abschied die Hand (geschickt einen verfrühten Kuss abwehrend), dankte ihm für den wunderbaren Abend und wandte sich ab, schloss die Tür auf und ging in die Wohnung, nahezu sicher, dass sie ihn nie wiedersehen würde.
In Stanley sah es natürlich anders aus, ganz anders schon seit den ersten Sekunden dieses ersten Rendezvous, und da er nichts von David Raskin und Rose’ Herzeleid wusste, nahm er an, er werde rasch handeln müssen, denn ein Mädchen wie Rose gehörte nicht zu denen, die lange ledig blieben, zweifellos wurde sie von Männern umschwärmt, unwiderstehlich wie sie war, von Kopf bis Fuß nichts als Anmut, Schönheit und Güte, und zum ersten Mal in seinem Leben beschloss Stanley, das Unmögliche zu wagen, die stetig wachsende Schar ihrer Freier in die Schranken zu weisen und Rose für sich zu erobern, denn für ihn stand fest, sie war die Frau, die er heiraten würde, und sollte nicht Rose seine Frau werden, dann würde es auch keine andere.
In den kommenden vier Monaten besuchte er sie häufig, nicht oft genug, um lästig zu werden, aber regelmäßig, beharrlich, unbeirrt und entschlossen, wobei er sich einbildete, die nur in seiner Phantasie vorhandenen Konkurrenten mit strategischer Schläue aus dem Feld zu schlagen, während es in Wahrheit gar keine ernstzunehmenden Konkurrenten gab, nur zwei oder drei andere, mit denen sie von Nancy nach dem Oktoberrendezvous mit Stanley zusammengebracht worden war, die sie aber einen nach dem anderen gewogen und für zu leicht befunden hatte, weshalb sie weitere Einladungen ausschlug und sich in Geduld fasste, sodass Stanley einem Ritter glich, der über ein von Phantomfeinden wimmelndes Schlachtfeld stürmte. Rose’ Gefühle für ihn hatten sich nicht geändert, trotzdem war sie lieber in Stanleys Gesellschaft, als einsam in ihrem Zimmer oder nach dem Essen mit ihren Eltern vor dem Radio zu sitzen, und so sagte sie selten nein, wenn er sie auf einen Abend einlud, zum Schlittschuhlaufen, Bowlen und Tanzen (ja, er war ein phantastischer Tänzer), zu einem Beethoven-Konzert in der Carnegie Hall, zwei Broadway-Musicals und mehrmals ins Kino. Schnell wurde ihr klar, dass Stanley sich nichts aus Dramen machte (bei Das Lied von Bernadette und Wem die Stunde schlägt schlief er ein), während er bei Komödien stets aufmerksam blieb, Immer mehr, immer fröhlicher, zum Beispiel, einer schmackhaften kleinen Schmonzette über die Wohnungsknappheit in Washington zu Kriegszeiten, die sie beide zum Lachen brachte, mit Joel McCrae (ein hübscher Mann) und Jean Arthur (eine von Rose’ Lieblingsschauspielerinnen) in den Hauptrollen, aber den stärksten Eindruck machte auf sie die Bemerkung eines anderen Schauspielers, eine Bemerkung aus dem Mund von Charles Coburn, der eine Art Cupido in Gestalt eines alten amerikanischen Fettsacks spielte, eine Bemerkung, die er im Lauf des Films ständig wiederholte: ein reputabler, adretter, netter junger Kerl – wie eine Beschwörungsformel zum Lob der Art von Ehemann, die jede Frau sich wünschen sollte. Stanley Ferguson war adrett, nett und noch relativ jung, und wenn reputabel aufrecht, wohlwollend und gesetzestreu bedeutete, so traf auch all dies auf ihn zu, doch war Rose sich gar nicht sicher, ob es dabei um Tugenden ging, an denen ihr etwas lag, nicht nach der Liebe, die sie mit dem lebhaften, unbeständigen David Raskin erfahren hatte, einer Liebe, die manchmal anstrengend gewesen war, aber feurig und immer wieder neu in stets wechselnden Gestalten, wohingegen Stanley so sanft, berechenbar und zuverlässig wirkte, und sie fragte sich, ob eine solche Charakterfestigkeit eigentlich eine Tugend oder ein Makel war.
Andererseits drangsalierte er sie nicht, forderte keine Küsse, von denen er wusste, sie wollte sie ihm nicht gewähren, auch wenn inzwischen jeder sehen konnte, dass er von ihr bezaubert war und sich bei jedem ihrer Treffen sehr zusammenreißen musste, sie nicht zu berühren, zu küssen, zu drangsalieren.
Andererseits reagierte er, als sie einmal bemerkte, wie schön sie Ingrid Bergman finde, mit einem geringschätzigen Lachen, sah ihr in die Augen und erklärte mit einer Bestimmtheit, die gefasster nicht sein konnte, Ingrid Bergman könne ihr nicht das Wasser reichen.
Andererseits gab es jenen kalten Tag Ende November, als er unangemeldet in Schneidermans Atelier auftauchte, um sich porträtieren zu lassen – nicht von Schneiderman, sondern von ihr.
Andererseits fand er bei ihren Eltern Anklang, nicht weniger bei Schneiderman, und selbst Mildred, die Herzogin von Snob, verlieh ihrer günstigen Meinung dadurch Ausdruck, dass sie erklärte, Rose hätte es wahrhaftig sehr viel schlechter treffen können.
Andererseits hatte er seine beschwingten Momente, unerklärliche Ausbrüche von Wildheit, in denen zeitweise etwas in ihm freigesetzt wurde und er sich in einen ulkigen, tollkühnen Schlingel verwandelte, wie etwa an dem Abend, als er sich in der Küche der Wohnung ihrer Eltern vor ihr aufspielte, indem er mit drei rohen Eiern jonglierte, die er verblüffend flink und präzise gut zwei Minuten lang durch die Luft kreisen ließ, bevor ihm eins entglitt und auf dem Boden zerplatzte, woraufhin er die beiden anderen absichtlich fallen ließ und sich dann für die Schweinerei mit dem stummen Achselzucken eines Komikers und einem einzigen Wort entschuldigte: Ups.
In diesen vier Monaten sahen sie sich ein- oder zweimal die Woche, und obwohl Rose Stanley ihr Herz nicht so schenken konnte, wie er ihr das seine geschenkt hatte, war sie ihm dankbar, dass er sie vom Boden aufgelesen und wieder auf die Füße gestellt hatte. Unter sonst gleichen Umständen wäre sie es zufrieden gewesen, noch eine Zeitlang so weiterzumachen, doch gerade als sie Sympathie für ihn und Freude an ihrem gemeinsamen Spiel zu entwickeln begann, änderte Stanley abrupt die Regeln.
Es war Ende Januar 1944. In Russland hatten die neunhundert Tage der Belagerung Leningrads ein Ende gefunden, bei Monte Cassino wurden die Alliierten von den Deutschen aufgehalten, im Pazifik bereiteten die Amerikaner einen Angriff auf die Marshall-Inseln vor, und an der Heimatfront, am Rand des Central Park in New York City, machte Stanley Rose einen Heiratsantrag. Eine freundliche Wintersonne strahlte auf sie herunter, der wolkenlose Himmel leuchtete in einem tiefen Blau, jenem kristallinen Blau, das sich nur an bestimmten Januartagen über New York ergießt, und an diesem sonnenhellen Sonntagnachmittag, Tausende Kilometer entfernt vom blutigen Gemetzel des nicht enden wollenden Krieges, legte Stanley ihr dar, nichts anderes als die Ehe käme für ihn in Frage, er bete sie an, noch nie habe er solche Gefühle für eine Frau empfunden, seine ganze Zukunft beruhe einzig und allein auf ihr, und wenn sie ihn abweise, wolle er sie nie wiedersehen, denn die Vorstellung, sie dann wiederzusehen, gehe schlicht über seine Kräfte, ihm werde deshalb nichts anderes übrigbleiben, als für immer aus ihrem Leben zu verschwinden.
Sie bat um eine Woche Bedenkzeit. Das komme so plötzlich, sagte sie, so unerwartet, darüber müsse sie erst einmal nachdenken. Selbstverständlich, sagte Stanley, nimm dir eine Woche Bedenkzeit, er werde sie kommenden Sonntag anrufen, heute in einer Woche, und dann, als sie am 59th-Street-Eingang des Parks voneinander Abschied nahmen, küssten sie sich zum ersten Mal, und zum ersten Mal, seit sie sich kennengelernt hatten, sah Rose in Stanleys Augen Tränen glitzern.
Der Ausgang ist hinlänglich bekannt. Nicht nur gibt es den Eintrag in der alles umfassenden, autorisierten Ausgabe des Buches vom irdischen Leben, man kann es auch im Manhattaner Stadtarchiv nachlesen, in dem geschrieben steht, dass Rose Adler und Stanley Ferguson am 6. April 1944, exakt zwei Monate vor der Landung der Alliierten in der Normandie, den Bund der Ehe geschlossen haben. Wir wissen also, wie Rose sich entschieden hat, aber wie und warum sie zu ihrer Entscheidung fand, ist eine komplizierte Angelegenheit. Zahlreiche Faktoren waren daran beteiligt, jeder von ihnen gemeinsam mit und konträr zu allen anderen, und da sie über jeden einzelnen im Zwiespalt war, durchlebte Fergusons zukünftige Mutter eine aufreibende, qualvolle Woche. Erstens: Sie wusste, Stanley war ein Mann, der zu seinem Wort stand, und die Vorstellung, ihn nie wiederzusehen, erfüllte sie mit Schrecken. Und wie man es drehen und wenden wollte, er war jetzt, neben Nancy, ihr bester Freund. Zweitens: Sie war schon einundzwanzig, noch jung genug, um als jung zu gelten, aber nicht so jung, wie damals die meisten Bräute zu sein pflegten, war es in jenen Jahren doch nichts Ungewöhnliches, mit achtzehn oder neunzehn das Hochzeitskleid anzulegen, und unverheiratet bleiben war das Letzte, was Rose wollte. Drittens: Nein, sie liebte Stanley nicht, aber es war erwiesen, dass nicht alle Liebesheiraten zu guten Ehen wurden, und nach dem, was sie einmal irgendwo gelesen hatte, waren die in traditionsbewussten anderen Kulturen weitverbreiteten arrangierten Ehen nicht glücklicher oder unglücklicher als Ehen im Westen. Viertens: Nein, sie liebte Stanley nicht, aber die Wahrheit war, dass sie niemanden lieben konnte, nicht mit der großen Liebe, die sie für David empfunden hatte, denn die große Liebe erfährt ein Mensch nur einmal im Leben, und schon deshalb würde sie, wenn sie den Rest ihrer Tage nicht allein verbringen wollte, einige Abstriche hinnehmen müssen. Fünftens: Nichts an Stanley störte sie oder missfiel ihr. Die Vorstellung, Sex mit ihm zu haben, stieß sie nicht ab. Sechstens: Er liebte sie abgöttisch und behandelte sie freundlich und respektvoll. Siebtens: Nur zwei Wochen zuvor hatte er ihr bei einem hypothetischen Gespräch über die Ehe erklärt, Frauen sollten die Freiheit haben, ihren eigenen Interessen nachzugehen, ihr Leben sollte nicht ausschließlich um ihren Gatten kreisen. Ob er von Arbeit rede?, fragte sie. Ja, Arbeit, antwortete er – unter anderem. Was bedeutete, dass sie, mit Stanley verheiratet, ihre Tätigkeit bei Schneiderman nicht würde aufgeben müssen, dass sie sich weiter zur Fotografin ausbilden lassen konnte. Achtens: Nein, sie liebte Stanley nicht. Neuntens: Er hatte vieles, was sie bewunderte, keine Frage, seine guten Eigenschaften überwogen die nicht so guten bei weitem, aber warum schlief er im Kino jedes Mal ein? War er müde von der langen Arbeit in seinem Geschäft, oder war das Zufallen seiner Augen ein Hinweis auf mangelnde Anteilnahme an den Gefühlen anderer? Zehntens: Newark! Würde sie dort leben können? Elftens: Newark war eindeutig ein Problem. Zwölftens: Es wurde Zeit, dass sie bei ihren Eltern auszog. Sie war zu alt, um weiter in dieser Wohnung zu bleiben, und sosehr ihr an Mutter und Vater lag, die Heuchelei der beiden war ihr zuwider – die schamlose Schürzenjägerei ihres Vaters, die Unaufrichtigkeit, mit der ihre Mutter darüber hinwegzusehen vorgab. Erst vor kurzem hatte Rose rein zufällig, auf dem Weg zu dem Automatenrestaurant nicht weit von Schneidermans Atelier, ihren Vater Arm in Arm mit einer Frau erspäht, die sie noch nie gesehen hatte, einer Frau, die fünfzehn, zwanzig Jahre jünger war als er, und war darüber so in Zorn geraten, dass sie zu ihrem Vater hätte hinlaufen und ihn ins Gesicht schlagen mögen. Dreizehntens: Wenn sie Stanley heiratete, wäre sie Mildred endlich einmal in einem Punkt voraus, auch wenn nicht klar war, ob Mildred überhaupt jemals heiraten wollte. Vorläufig jedenfalls schien es ihrer Schwester zu genügen, von einer kurzen Affäre zur nächsten zu springen. Schön für Mildred, aber Rose hatte kein Interesse an einem solchen Leben. Vierzehntens: Stanley verdiente viel Geld, und nach dem Stand der Dinge würde er mit der Zeit noch sehr viel mehr Geld verdienen. Ein tröstlicher Gedanke, der aber auch Sorgen bereitete. Wer Geld machen wollte, durfte an nichts anderes denken als an Geld. Konnte man mit einem Mann leben, der immer nur sein Bankkonto im Kopf hatte? Fünfzehntens: Stanley hielt sie für die schönste Frau von New York. Sie wusste, das war sie nicht, zweifelte aber nicht daran, dass Stanley aufrichtig davon überzeugt war. Sechzehntens: Es war niemand sonst in Sicht. Auch wenn aus Stanley nie ein zweiter David werden konnte, war er den wehleidigen Jammerlappen, die Nancy ihr zugespielt hatte, haushoch überlegen. Stanley war immerhin erwachsen. Stanley beklagte sich nie. Siebzehntens: Stanley war nicht mehr oder weniger Jude als sie, ein loyaler Angehöriger des Stammes, aber nicht daran interessiert, die Religion zu praktizieren oder Gott ewige Treue zu schwören, was ein von Ritualen und Aberglauben unbelastetes Leben bedeuten würde, allenfalls Geschenke zu Hanukkah, Matzen und die vier Fragen einmal jährlich im Frühling, Beschneidung für einen Sohn, falls sie einen bekommen sollten, aber keine Gebete, keine Synagogen, kein geheuchelter Glaube an etwas, an das sie nicht glaubte, an das sie beide nicht glaubten. Achtzehntens: Nein, sie liebte Stanley nicht, aber Stanley liebte sie. Vielleicht war das für den Anfang genug, ein erster Schritt. Was danach käme, wer konnte das sagen?
Die Flitterwochen verbrachten sie in einem Badeort in den Adirondacks, eine siebentägige Einweihung in die Geheimnisse des Ehelebens, kurz, aber endlos, da die pure Neuheit von allem, was sie da durchexerzierten, jedem Augenblick das Gewicht einer Stunde oder sogar eines Tages verlieh, eine Zeit voller Anspannung und scheuer Anpassungsversuche, kleiner Siege und intimer Enthüllungen, eine Zeit, in der Stanley Rose die ersten Fahrstunden gab und ihr die Anfangsgründe des Tennisspiels beibrachte, und dann kehrten sie nach Newark zurück und bezogen die Wohnung, in der sie die ersten Jahre ihrer Ehe verbringen sollten, eine Dreizimmerwohnung am Van Velsor Place im Stadtteil Weequahic. Schneiderman hatte ihr zur Hochzeit einen Monat bezahlten Urlaub geschenkt, und in den drei Wochen, bevor sie wieder zur Arbeit ging, brachte Rose sich hektisch das Kochen bei, wobei sie sich ausschließlich auf das voluminöse alte Handbuch der amerikanischen Küche verließ, das sie von ihrer Mutter zum Geburtstag bekommen hatte, das Settlement Cook Book mit dem Untertitel «Der Weg zum Herzen deines Gatten», ein von Mrs. Simon Kander zusammengestellter Wälzer von sechshundertdreiundzwanzig Seiten, dem «Bewährte Rezepte aus Schulküchen von Milwaukee, hauswirtschaftlichen Bildungsanstalten sowie von maßgeblichen Ernährungsfachleuten und erfahrenen Hausfrauen» zu entnehmen waren. Anfangs ging manches ziemlich daneben, doch Rose war immer eine gute Schülerin gewesen, und hatte sie sich einmal etwas in den Kopf gesetzt, brachte sie es meistens auch mit einigem Erfolg zuwege, aber selbst in diesen ersten Wochen des Herumprobierens, in denen sie Stanley mit zerkochtem Fleisch und laschem Gemüse, klebrigem Kuchen und klumpigem Kartoffelbrei aufwartete, kam von ihm kein einziges Wort des Tadels. So miserabel das Essen sein mochte, das sie ihm hinstellte, er schob sich jeden einzelnen Bissen seelenruhig in den Mund und kaute mit sichtbarem Vergnügen, und jeden Abend, unfehlbar jeden Abend, blickte er dann auf und sagte, es sei köstlich gewesen. Manchmal fragte Rose sich, ob er sie auf den Arm nahm oder ob er einfach zu zerstreut war zu bemerken, was sie ihm vorgesetzt hatte, aber wie mit dem Essen, das sie zubereitete, verhielt es sich auch mit allem anderen, das ihr gemeinsames Leben betraf, und als Rose einmal darauf zu achten begann, soll heißen, als sie einmal alles zusammentrug, was möglicherweise Zwietracht zwischen ihnen säen könnte, gelangte sie zu dem verblüffenden, geradezu unglaublichen Ergebnis, dass Stanley nie Kritik an ihr übte. In seinen Augen war sie perfekt, eine perfekte Frau, eine perfekte Ehefrau, und deshalb war − wie in einem theologischen Lehrsatz, der die unabdingbare Existenz Gottes behauptete – alles, was sie tat und sagte oder dachte, notwendigerweise perfekt, konnte nicht anders als perfekt sein. Nachdem sie sich die meiste Zeit ihres Lebens ein Zimmer mit Mildred geteilt hatte, mit eben der Mildred, die an ihren Kommodenschubladen Schlösser angebracht hatte, um zu verhindern, dass die jüngere Schwester sich ihre Kleider auslieh, mit eben der Mildred, die sie als Strohkopf beschimpft hatte, weil sie so oft ins Kino ging, teilte sie jetzt das Schlafzimmer mit einem Mann, der sie für perfekt hielt, mit einem Mann zudem, der in eben diesem Schlafzimmer zusehends lernte, sie auf genau die grobe Weise anzupacken, die sie am liebsten mochte.
Newark war langweilig, aber die Wohnung war geräumiger und heller als die ihrer Eltern auf der anderen Seite des Flusses, und alle Möbel waren neu (das Beste, was Three Brothers Home World zu bieten hatte, was vielleicht nicht das Allerbeste war, aber fürs Erste gut genug), und als sie dann wieder bei Schneiderman arbeiten ging, war die Stadt von neuem der wichtigste Teil ihres Lebens, das geliebte, schmutzige, alles verschlingende New York, die Hauptstadt menschlicher Gesichter, das horizontale Babel menschlicher Zungen. Den täglichen Weg zur Arbeit bewältigte sie mit einem langsamen Bus zum Zug, einer zwölfminütigen Fahrt von einer Penn Station zur anderen und einem kurzen Marsch zu Schneidermans Atelier, aber das machte ihr nichts aus, wo sie doch unterwegs so viele Leute beobachten konnte, und vor allem liebte sie den Augenblick, wenn der Zug nach New York hineinfuhr, anhielt und sekundenlang sich gar nichts tat, so als hielte die Welt in stiller Erwartung den Atem an, und dann gingen die Türen auf, und alles strömte hinaus, aus sämtlichen Waggons ergossen die Passagiere sich auf den plötzlich wimmelnden Bahnsteig, und sie labte sich an der Hast und Zielstrebigkeit dieser Massen, die allesamt in dieselbe Richtung eilten, und sie mittendrin, ein Teil davon, auf dem Weg zur Arbeit wie alle anderen. Das gab ihr ein Gefühl der Unabhängigkeit, verbunden mit Stanley, zugleich aber auf eigenen Füßen, ein neues Gefühl, ein gutes Gefühl, und dann ging sie die Rampe hinauf, reihte sich draußen in die Richtung West 27th Street strebenden Massen ein und stellte sich die verschiedenen Leute vor, die an diesem Tag ins Atelier kommen würden, die Mütter und Väter mit ihren neugeborenen Kindern, die kleinen Jungen in ihren Baseballtrikots, die alten Paare, die sich eng beieinandersitzend für ihren vierzigsten oder fünfzigsten Hochzeitstag porträtieren ließen, die grinsenden Mädchen mit ihren Mützen und schicken Kleidern, die Frauen aus den Frauenclubs, die Männer aus den Männerclubs, die frischgebackenen Polizisten in ihren blauen Uniformen, und natürlich die Soldaten, täglich mehr und mehr Soldaten, manchmal mit Frau oder Freundin oder Eltern, meistens aber allein, einsame Soldaten, auf Urlaub in New York oder zurück von der Front oder auf dem Weg in den Einsatz, um zu töten oder getötet zu werden, und sie betete für sie alle, betete, dass sie lebend und mit vollzähligen Gliedmaßen nach Hause zurückkämen, betete jeden Morgen auf dem Weg von Penn Station zur West 27th Street, dass der Krieg bald vorbei sein möge.
Also kein ernsthafter Grund zur Klage, keine quälenden nachträglichen Zweifel an der Richtigkeit der Entscheidung, Stanleys Antrag anzunehmen, trotzdem brachte die Ehe so manche Unannehmlichkeiten mit sich, die man zwar nicht direkt Stanley anlasten konnte, aber immerhin hatte sie nicht nur ihn geheiratet, sondern seine Familie gleich mit, und jedes Mal, wenn sie mit diesem kindsköpfigen Trio von Sonderlingen zusammentraf, fragte sie sich, wie Stanley es bloß geschafft hatte, seine Kindheit zu überleben, ohne so verrückt zu werden wie diese drei. An erster Stelle die Mutter, die immer noch vitale Fanny Ferguson, inzwischen Mitte bis Ende sechzig und kaum größer als eins siebenundfünfzig, eins achtundfünfzig, weißhaarig und sauertöpfisch, eine von hektischem Argwohn getriebene, missmutig dreinblickende Frau, die bei Familientreffen immer allein auf einem Sofa saß und vor sich hin brummte, allein, weil niemand sich in ihre Nähe wagte, besonders ihre fünf Enkel nicht, Alter sechs bis elf, die geradezu Todesangst vor ihr zu haben schienen, denn Fanny fand nichts dabei, ihnen eine Kopfnuss zu verpassen, wann immer sie sich danebenbenahmen (falls man Vergehen wie Lachen, Kreischen, Herumhüpfen, An-Möbel-Stoßen und lautes Rülpsen als «daneben» bezeichnen kann), und wenn ihr Arm nicht lang genug war, ihnen einen Schlag zu versetzen, ließ sie ein Donnerwetter vom Stapel, dass die Lampenschirme wackelten. Als Rose sie zum ersten Mal sah, kniff Fanny sie in die Wange (so fest, dass es weh tat) und erklärte, sie sei ein hübsches Ding. Dann aber nahm sie bis zum Ende des Besuches keine Notiz mehr von ihr, und bei allen weiteren Besuchen gab es nur noch nichtssagende Förmlichkeiten wie hallo und auf Wiedersehen, aber da Fanny sich gegenüber ihren beiden anderen Schwiegertöchtern, Millie und Joan, genauso gleichgültig verhielt, nahm Rose es nicht persönlich. Fanny interessierte sich nur für ihre Söhne, die Söhne, die für sie sorgten und sich jeden Freitagabend gehorsam bei ihr zum Essen einstellten, während die Frauen, die ihre Söhne geheiratet hatten, für sie kaum mehr als Schatten waren, an deren Namen sie sich meistens nicht einmal erinnerte. Nichts davon störte Rose, die nur selten und unregelmäßig mit Fanny zu tun hatte, aber mit Stanleys Brüdern sah die Sache schon anders aus, denn sie arbeiteten bei ihm, er sah sie jeden Tag, und nachdem sich erst einmal ihre Verblüffung darüber gelegt hatte, dass sie zu den attraktivsten Männern zählten, die sie jemals gesehen hatte, Göttergestalten, die Errol Flynn (Lew) und Cary Grant (Arnold) zum Verwechseln ähnlich sahen, entwickelte sie eine heftige Abneigung gegen die beiden. Sie erschienen ihr seicht und unehrlich, der ältere Lew nicht unintelligent, aber deformiert von seiner Schwäche für Football- und Baseball-Wetten, der jüngere Arnold fast schon halb schwachsinnig, ein Lustmolch mit gläsernem Blick, der zu viel trank und keine Gelegenheit ausließ, sie an Armen oder Schultern zu berühren, ihre Arme und Schultern zu drücken, der sie Puppe und Babe oder Schönste nannte und ihr einen stetig zunehmenden Abscheu einflößte. Es war ihr zuwider, dass Stanley die beiden in seinem Geschäft arbeiten ließ, und es war ihr zuwider, wie sie sich hinter seinem Rücken und manchmal offen ins Gesicht hinein über ihn lustig machten, über den guten Stanley, der als Mann hundertmal besser war als sie, aber Stanley ließ sich das schweigend gefallen, er nahm ihre Niedertracht und Faulheit und ihre Sticheleien ohne Widerrede und mit solcher Nachsicht hin, dass Rose sich fragte, ob sie etwa versehentlich einen Heiligen geheiratet hatte, einen dieser raren Sterblichen, die niemals schlecht von anderen dachten, aber andererseits, dachte sie weiter, war er vielleicht nur ein Schwächling, einer, der nie gelernt hatte, sich selbst zu verteidigen. Mit wenig oder gar keiner Hilfe seiner Brüder hatte er aus Three Brothers Home World eine gewinnbringende Firma gemacht, ein großes, neonhelles Warenhaus, in dem es Sessel und Radios, Esstische und Kühlschränke, Schlafzimmereinrichtungen und Mixer zu kaufen gab, ein umsatzstarkes Unternehmen, das vor allem bei Leuten mit mittlerem und niedrigem Einkommen beliebt war, einen Marktplatz des zwanzigsten Jahrhunderts, aber nachdem sie ihn in den Wochen nach der Hochzeitsreise mehrmals dort besucht hatte, ging Rose schließlich nicht mehr in den Laden – nicht nur, weil sie selbst wieder arbeitete, sondern auch, weil sie sich dort unbehaglich fühlte, unglücklich, absolut fehl am Platz unter Stanleys Brüdern.
Was ihre Enttäuschung über die Familie ein bisschen milderte, waren die Frauen und Kinder der Brüder, die Fergusons, die eigentlich keine Fergusons waren, die nicht wie Ike und Fanny und deren Sprösslinge von Katastrophen heimgesucht worden waren, und bald hatte Rose in Millie und Joan neue Freundinnen gefunden. Beide Frauen waren etliche Jahre älter als sie (vierunddreißig und zweiunddreißig), hatten sie aber am Tag der Hochzeit als gleichwertiges Mitglied in ihrem Stamm willkommen geheißen, was ihr unter anderem das Recht verlieh, in alle Geheimnisse der Schwägerinnen eingeweiht zu werden. Besonders beeindruckte Rose die zungenfertige Millie, die ununterbrochen rauchte und so schlank war, als hätte sie statt Knochen eher Drähte unter der Haut, eine ebenso kluge wie rechthaberische Person, die ganz genau wusste, was für einen Mann sie sich mit Lew eingehandelt hatte, aber dass sie ihrem intriganten, lasterhaften Gatten stets loyal zur Seite stand, hinderte sie nicht daran, unablässig ironische Giftpfeile auf ihn abzuschießen, derart bissige, geistreiche Bemerkungen, dass Rose manchmal das Zimmer verlassen musste, aus Angst, sich buchstäblich kaputtzulachen. Verglichen mit Millie war Joan geradezu eine dumme Gans, aber vor lauter Warmherzigkeit und Großmut war ihr immer noch nicht aufgegangen, dass sie einen Hohlkopf geheiratet hatte, und doch, was war sie für eine gute Mutter, fand Rose, so zärtlich, geduldig und liebevoll, wohingegen Millies spitze Zunge sie oft mit ihren Kindern aneinandergeraten ließ, die nicht so gut erzogen waren wie die von Joan. Millies zwei waren der elfjährige Andrew und die neunjährige Alice, Joans drei der zehnjährige Jack, die achtjährige Francie und die sechsjährige Ruth. Sie alle gefielen Rose, jedes auf seine Weise, außer Andrew vielleicht, der etwas Grobes und Streitsüchtiges hatte, was ihm häufig Schelte von Millie einbrachte, wenn er seine kleine Schwester geschlagen hatte, am liebsten aber hatte Rose Francie, eindeutig Francie, sie konnte sich einfach nicht helfen, so schön war das Kind, so außerordentlich lebendig, und als sie sich kennenlernten, war es beiderseits Liebe auf den ersten Blick, und Francie, schon groß und mit kastanienbraunem Haar, warf sich ihr in die Arme und rief: Tante Rose, meine neue Tante Rose, wie hübsch du bist, so hübsch, so ungeheuer hübsch, wir wollen für immer Freundinnen sein. So fing es an, und so ging es weiter mit der gegenseitigen Faszination, und es gab, fand Rose, kaum etwas Schöneres auf der Welt als die Augenblicke, wenn Francie ihr, während sie alle um den Tisch saßen, auf den Schoß kletterte und von der Schule erzählte oder von dem letzten Buch, das sie gelesen hatte, oder von der Freundin, die etwas Hässliches zu ihr gesagt hatte, oder von dem Kleid, das ihre Mutter ihr zum Geburtstag schenken wollte. Die Kleine ließ sich förmlich in Rose’ weichen Körper sinken, und während sie erzählte, streichelte Rose ihr den Kopf, die Wange, den Rücken und hatte alsbald das Gefühl zu schweben, so als hätten sie und Francie das Zimmer und das Haus und die Straße verlassen und schwebten zusammen im Himmel umher. Ja, diese Familientreffen konnten grauenhaft sein, aber es gab auch Entschädigungen, unerwartete kleine Wunder in den unwahrscheinlichsten Augenblicken, denn die Götter, befand Rose, handelten irrational und verteilten ihre Gaben, wann und wo es ihnen gefiel.
Rose wollte Mutter sein, ein Kind zur Welt bringen, schwanger sein, ein zweites Herz in sich schlagen haben. Nichts zählte mehr als das, nicht einmal ihre Arbeit bei Schneiderman, nicht einmal der langfristige und bis jetzt kaum durchdachte Plan, sich eines Tages als Fotografin selbständig zu machen, ein Atelier mit ihrem Namen auf dem Schild über der Tür zu eröffnen. Das alles war nichts gegen den schlichten Wunsch, einen neuen Menschen in die Welt zu setzen, sei es Sohn oder Tochter, ihr Kind, und diesem Menschen bis an ihr Lebensende Mutter zu sein. Stanley trug das Seine dazu bei, schlief ohne Verhütung mit ihr und schwängerte sie dreimal in den ersten achtzehn Monaten ihrer Ehe, aber dreimal erlitt Rose eine Fehlgeburt, dreimal im dritten Monat dieser drei Schwangerschaften, und als sie im April 1946 ihren zweiten Hochzeitstag feierten, waren sie immer noch kinderlos.