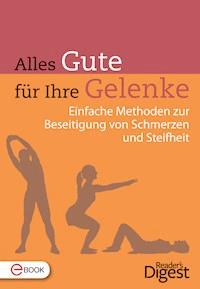
Alles Gute für ihre Gelenke E-Book
24,99 €
Mehr erfahren.
Hier finden Sie zahlreiche Tipps und konkrete Hilfestellungen, wie Sie Gelenkbeschwerden vorbeugen, Ihre Schmerzen lindern und Ihre Beweglichkeit wiedererlangen können. Mithilfe der einfachen kurzen Übungen schützen Sie Ihre Gelenke und fördern die Beweglichkeit. Gleichzeitig geben Ihnen Rezepte Hilfestellungen für die richtige Ernährung zur Vorbeugung von Gelenkproblemen und zur positiven Beeinflussung und Linderung von Beschwerden. Welche Behandlungsmethode für Sie die Richtige ist, finden Sie im Überblick zu schulmedizinischen und alternativen Heilmethoden heraus.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 338
Ähnliche
INHALTSVERZEICHNIS
Zur Stichwortsuche verwenden Sie bitte die Suchfunktion Ihres Ebook-Readers.
WIE DIE GELENKE FUNKTIONIEREN
TRAINIEREN SIE IHRE GELENKE
GELENKERKRANKUNGEN
DIAGNOSE UND BEHANDLUNG
NAHRUNG FÜR DIE GELENKE
ALTERNATIVE MEDIZIN
ANHANG
GLOSSAR
IMPRESSUM
WIE DIE GELENKE FUNKTIONIEREN
Wir bewegen uns ganz selbstverständlich und denken nicht darüber nach, weshalb wir zum Beispiel aufrecht gehen oder eine Leiter erklimmen können. Durch die unglaubliche Beweglichkeit unseres Skeletts sind wir sogar zu akrobatischen Höchstleistungen in der Lage. Wer genau weiß, wie seine Gelenke funktionieren, wird künftig besser auf sie achten, um so die Gesundheit seiner Gelenke und seine Mobilität bis ins hohe Alter zu bewahren.
DIE VERSCHIEDENEN GELENKFORMEN
Verbindung zwischen den Knochen
Das Skelett, das unseren Körper stützt und zusammenhält, wird durch knöcherne und knorpelige Skelettelemente verbunden. Die Skelettmuskulatur bewegt die einzelnen Teile des Skeletts oder fixiert diese in einer bestimmten Lage oder Stellung. Skelett und Muskulatur bilden zusammen den Bewegungsapparat. Die einzelnen Bausteine des Skeletts sind durch Gelenke verbunden.
Die Beweglichkeit des menschlichen Körpers wird durch seine Gelenke ermöglicht, welche unterschiedliche Funktionen haben: Sie müssen Druckstöße und Zugkräfte auffangen, abschwächen und verteilen. Sie haben aber auch die Aufgabe, Krafteinwirkungen auf andere Skelettbestandteile zu übertragen.
Im menschlichen Körper gibt es über 100 solcher Verbindungsstellen, die ganz unterschiedlich konstruiert sein können. Diese verschiedenen Gelenkarten sind notwendig, damit wir die einzelnen Körperteile so bewegen können, wie wir es wünschen. Ein Knie soll sich beugen und strecken lassen, während das Hüftgelenk in alle Richtungen bewegt werden kann. Jede Gelenkart ist also für bestimmte Funktionen ausgelegt. Die Bewegungsfreiheit der Gelenke wird zudem durch Sehnen, Bänder und Muskeln eingeschränkt. Dies ist notwendig, um durch das komplexe Zusammenspiel aller Gelenke erst eine koordinierte Bewegung zu ermöglichen.
Man unterscheidet unechte Gelenke, die nur eingeschränkte Bewegungen erlauben, und echte Gelenke, die dank eines Hohlraums zwischen den Knochenenden einen größeren Bewegungsradius aufweisen.
Unechte Gelenke: die Synarthrosen
Unechte Gelenke – in der Fachsprache nennt man sie Synarthrosen – sind nicht beweglich, verleihen dem Skelett jedoch seinen festen Halt. Zwei Knochen werden dabei von Bindegewebe, Knorpelmasse oder Knochengewebe zusammengehalten. Ein Beispiel für die Verbindung durch Bindegewebe ist der noch nicht durch knorpelige Strukturen umfasste Bereich des Schädels eines Neugeborenen, die sogenannten Fontanellen. Das Kreuzbein ist dagegen ein Beispiel für die Verbindung von Knochen durch Knochengewebe. Es besteht zunächst aus fünf Einzelwirbeln, die im Laufe des menschlichen Wachstums miteinander zu einem Ganzen verschmelzen.
Echte Gelenke: Diarthrosen und Amphiarthrosen
Die echten oder freien Gelenke werden auch Diarthrosen genannt. Sie sind sehr beweglich und lassen sich mindestens in einer Richtung hin- und herbewegen. Der Aufbau der echten Gelenke ist kompliziert und auf deren Funktion ausgerichtet. In der Gelenkhöhle liegen die Knochenenden, die sogenannten Gelenkkörper. Begrenzt wird die Gelenkhöhle durch die Gelenkkapsel. Diese besteht aus einer äußeren Bindegewebsschicht und einer elastischen Innenhaut, die stark durchblutet ist.
Damit der Knochenabrieb bei Bewegungen unterbunden wird, sind die Enden der Knochen mit durchsichtigem Knorpel überzogen. Diese glatte Knorpelschicht gleicht Unregelmäßigkeiten der Knochenstruktur aus und wirkt als elastisches Polster, das Krafteinwirkungen dämpft und gleichmäßig über das ganze Gelenk verteilt. Der Knorpel setzt sich zu 95 % aus Knorpelmatrix und zu 5 % aus Knorpelzellen – den Chondrozyten – zusammen. Die Chondrozyten sorgen für den Auf- und Abbau der Knorpelmatrix.
Die Reibung in der Gelenkhöhle wird zusätzlich durch eine zähflüssige Substanz, der Gelenkflüssigkeit, vermindert. Hergestellt wird diese Schmierflüssigkeit – oder Synovia – von der Gelenkinnenhaut. Sie bildet einen Gleitfilm auf den Gelenkflächen. Kommt es zu einer Druckbelastung innerhalb des Gelenks, trägt die Synovia zur Stoßdämpfung bei.
Die Gelenkflüssigkeit hat jedoch noch eine andere wichtige Aufgabe: Sie versorgt den Knorpel mit Nährstoffen und hilft dabei, Abbauprodukte aus diesem abzutransportieren. Die Nährstoffe gelangen durch die Blutgefäße der Gelenkinnenhaut in die Gelenkflüssigkeit und durch Diffusionsvorgänge in den Knorpel selbst. Dieser Nährstofftransport wird durch die Gelenkbewegungen in Gang gesetzt. Ist das Gelenk entlastet, saugt der Knorpel gewissermaßen nährstoffreiche Flüssigkeit auf, ist das Gelenk belastet, werden die Abbauprodukte aus dem Knorpel gepresst und mit dem Blut abtransportiert.
Ein gesunder Knorpel verteilt die Druckbelastung über die gesamte Gelenkfläche; dies bedeutet auch, dass jede Stelle des Knorpels ausreichend mit Nährsubstanzen versorgt und von Abbauprodukten befreit wird.
In der Gruppe der freien Gelenke unterscheidet man außerdem noch Amphiarthrosen, die sogenannten straffen Gelenke. Sie weisen eine nur eingeschränkte Beweglichkeit auf. Ein Beispiel für ein solches Gelenk ist das Gelenk zwischen Kreuzbein und Darmbein, das in der Fachsprache auch als Iliosakralgelenk bezeichnet wird und beispielsweise bei der Geburt eines Kindes eine sehr wichtige Rolle spielt.
DAS RÄT DER EXPERTE
Bewegung ist wichtig
Der komplizierte Austausch von Nährsubstanzen und biochemischen Abbauprodukten zwischen Gelenkinnenhaut und Knorpel macht deutlich, wie wichtig es für Ihre optimale Gelenkgesundheit ist, die Gelenke stets in Bewegung zu halten. Wenn Sie Ihre Gelenke zu sehr „schonen“, kann nämlich die Versorgung des Knorpels mit Nährsubstanzen und die Beseitigung von giftigen Stoffwechselprodukten empfindlich gestört werden. Das allseits bekannte Sprichwort „Wer rastet, rostet“ stimmt also durchaus.
Koordiniertes Zusammenspiel aller Gelenke
Der Mensch benötigt für seine komplexen Skelettbewegungen unterschiedliche Gelenkfunktionen. Sehnen, Bänder und Muskeln spielen dabei gleichermaßen eine wichtige Rolle. Sie begrenzen die Bewegungsfreiheit der Gelenke und ermöglichen erst das komplexe Zusammenspiel aller Einzelbewegungen. Die Richtung der Gelenkbewegungen wird durch die Anordnung der Muskulatur und der Bänder bestimmt. Man bezeichnet die Gelenke deshalb auch als kraftschlüssig; das bedeutet, dass Muskelkräfte die Gelenke zusammenhalten und diese wiederum die Art der Bewegung und die Richtung derselben bestimmen. Gestoppt wird die Bewegung mithilfe von Knochen, Muskulatur, Bändern oder Weichteilen. Jede Gelenkbewegung erfolgt um eine Bewegungsachse und zwar immer in zwei entgegengesetzte Richtungen. Zum Beispiel „beugen – strecken“ wie beim Hüftgelenk oder „nach vorne neigen – nach rückwärts neigen“ wie bei der Wirbelsäule.
Je nach Funktion und Beweglichkeit unterscheidet man folgende Gelenkarten:
•Plane Gelenke: Diese Gelenke – man bezeichnet sie auch als ebene Gelenke – findet man beispielsweise bei den kleinen Wirbelgelenken. Plane Gelenke erlauben nur eine Verschiebung in einer Ebene und eine Drehbewegung.
•Eigelenke: Ein Eigelenk – oder Ellipsoidgelenk – besitzt zwei eiförmige (ellipsoide) Gelenkteile: die konkave Gelenkpfanne und einen konvexen Gelenkkopf. Als Beispiel kann hier das Handgelenk zwischen Speiche und Handwurzelknochen dienen. Dieses Gelenk lässt sich nicht kreisförmig, wie das Hüftgelenk, sondern nur in zwei Ebenen bewegen. Ein Eigelenk besitzt zwei Achsen, wodurch Bewegungen in zwei Hauptrichtungen möglich sind: Es lässt sich daher sowohl seitwärts bewegen als auch strecken und beugen. Das Eigelenk ähnelt einem Kugelgelenk, besitzt aber statt des runden einen eiförmigen Gelenkkopf.
•Scharniergelenke: Bei dieser Gelenkart greift ein walzenförmiger Gelenkkopf in eine rinnenähnliche Vertiefung eines hohlen Skelettelements, das zylinderförmig ist. Deshalb wird diese Gelenkart auch als Walzengelenk bezeichnet. Der Gelenkkopf wird meist zusätzlich von straffen Seitenbändern stabilisiert. Scharniergelenke besitzen nur eine Bewegungsachse mit zwei Hauptbewegungen. So kann man beispielsweise das Ellbogengelenk nur nach vorne in Richtung Körper beugen; will man es nach hinten beugen, kommt es wie bei einem Scharnier zu einem Bewegungsstopp. Scharniergelenke kommen bei den Fingern zum Einsatz.
•Sattelgelenke: Das Sattelgelenk erlaubt eine Bewegung in zwei senkrecht zueinander stehenden Achsen. Es sind also sowohl seitliche Bewegungen als auch solche nach vorne und hinten möglich. Dabei sind jeweils beide Gelenkflächen wie ein Reitsattel geformt. Ein Beispiel ist das Daumensattelgelenk zwischen dem ersten Mittelhandknochen und einem Handwurzelknochen. Werden die Bewegungen in beiden Hauptachsen kombiniert, ist beispielsweise ein Kreisen des Daumens möglich.
•Rad- oder Zapfengelenke: Diese Gelenke findet man u.a. zwischen Elle und Speiche. Das Rad- oder Zapfengelenk ist nicht besonders beweglich. Der Gelenkkopf hat die Form einer Walze, während die Gelenkpfanne rinnenförmig ausgebildet ist. Wird das Gelenk bewegt, dreht sich eine Gelenkfläche in der anderen. Beim Radgelenk ist daher nur die Bewegung um eine Achse möglich. Da diese in Richtung des Knochens zapfenförmig verläuft, können mit diesem Gelenk nur Drehbewegungen um die Längsachse ausgeführt werden.
•Kugelgelenke: Das Kugelgelenk ist das am perfektesten ausgebildete Gelenk. Es ist ein echtes Multifunktionsgelenk: Ein kugelförmiger Gelenkkopf sitzt in einer ausgehöhlten Gelenkpfanne, die man auch als Kugelpfanne bezeichnet. Deshalb ist ein Kugelgelenk prinzipiell in alle Richtungen beweglich (dreiachsig). Beispiele für Kugelgelenke sind das Schulter- oder Hüftgelenk und die Fingergrundgelenke (mit Ausnahme des Daumens). Da dieses Gelenk so wichtig für die Beweglichkeit ist, werden mittlerweile verschlissene oder beschädigte Kugelgelenke als Prothese aus Edelstahl nachgebaut und operativ an der jeweiligen Stelle eingesetzt.
KOPF- UND KIEFERGELENK
Beweglichkeit von Kopf und Kiefer
Unter den Kopfgelenken versteht man die Verbindungen, die das Hinterhauptbein des Schädels mit dem ersten Halswirbel sowie den ersten mit dem zweiten Halswirbel verbinden. Sie sorgen für die Beweglichkeit des Kopfes. Das Kiefergelenk ist die Verbindung zwischen dem Unterkiefer und dem übrigen Kopf.
Das Kopfgelenk
Das Gelenk zwischen dem ersten Halswirbel und dem Hinterhauptbein des Kopfes ist ein Eigelenk, das sich vor allem nach oben und nach unten bewegen lässt und geringfügig eine Seitenneigung zulässt. Es sorgt dafür, dass wir nicken können. Das Gelenk, das für die Drehung des Kopfes zuständig ist, liegt zwischen dem ersten und zweiten Halswirbel. Der zweite Halswirbel verfügt zudem über einen zapfenförmigen Fortsatz, der in das Wirbelloch des ersten Halswirbels hineinragt und mit diesem ein Radgelenk bildet. Durch das Zusammenspiel dieser beiden knöchernen Anteile können wir den Kopf drehen.
Regelmäßige Dehnübungen steigern auch im Kopf- und Kieferbereich die Beweglichkeit.
Das Kiefergelenk
Das Kiefergelenk besteht aus einem Gelenkkopf am Unterkiefer und einer Gelenkgrube am Schläfenbein. Sowohl der Gelenkkopf als auch die -grube des Kiefergelenks sind mit Knorpel überzogen. Im Spalt zwischen den beiden Gelenkteilen liegt eine Scheibe aus Knorpel, die auch als Diskus bezeichnet wird. Sie ist mit dem Gelenkkopf verbunden. Vom Kiefergelenk in der Einzahl zu sprechen, ist eigentlich falsch, denn sowohl an der linken als auch an der rechten Seite des Kopfes sind Unterkiefer und Schläfenbein durch jeweils ein Gelenk miteinander verbunden. Bei jeder Bewegung des Unterkiefers verschieben sich beide Gelenke. Öffnet sich der Mund, geht der Unterkiefer nach unten, und die Gelenkköpfe bewegen sich nach vorn. Schließt sich jedoch der Unterkiefer wieder, gehen auch die Gelenkköpfe zurück. Diese Bewegung wird als Scharnierbewegung bezeichnet. Beim Kauen bewegt sich dagegen der Gelenkkopf der einen Seite nach unten, während der andere sich dreht. So entsteht eine mahlende Bewegung.
TEST: WIE INTAKT SIND IHRE KOPFGELENKE?
TESTAUSWERTUNG:
Zählen Sie nun, wie oft Sie mit Ja geantwortet haben, und lesen Sie die Auswertung.
0–1 Ja
Ihre Beschwerden können von den Kopfgelenken herrühren, doch wahrscheinlicher ist eine andere Ursache, z. B. Muskelverspannungen.
2–3 Ja
Veränderungen der Kopfgelenke als Ursache für Ihre Beschwerden können nicht ausgeschlossen werden. Gehen Sie zum Arzt.
4–5 Ja
Möglicherweise rühren Ihre Beschwerden von den Kopfgelenken her. Lassen Sie sich zu einem Orthopäden überweisen.
TEST: SIND IHRE KIEFERGELENKE IN ORDNUNG?
TESTAUSWERTUNG:
Zählen Sie nun, wie oft Sie mit Ja geantwortet haben, und lesen Sie die Auswertung.
0–2 Ja
Akute Schmerzen, Probleme mit der Beweglichkeit des Unterkiefers und Schwellungen deuten auf Entzündungen hin. Suchen Sie den Arzt auf.
3–4 Ja
Kommen mehrere Symptome zusammen, handelt es sich wahrscheinlich um Probleme mit dem Kiefergelenk. Gehen Sie unbedingt zum Arzt.
DIE WIRBELSÄULE
Stütze und Schutz für den Körper
Die Wirbelsäule stützt den Rumpf – ohne sie und ihre doppelte S-Form könnten wir nicht aufrecht gehen. Ihre Form federt beim Gehen und natürlich auch bei anderen Bewegungen zudem einen gewissen Anteil der Stöße ab, die sonst zu Erschütterungen des Gehirns führen würden.
Wirbel und Bandscheiben helfen uns z. B. beim Aufrichten.
Die Abschnitte der Wirbelsäule
Die Wirbelsäule besteht aus 24 beweglichen und neun oder zehn starren Wirbeln, darunter
• sieben Halswirbel (Halswirbelsäule),
• zwölf Brustwirbel (Brustwirbelsäule),
• fünf Lendenwirbel (Lendenwirbelsäule),
• fünf Kreuzbeinwirbel (Kreuzbein),
• vier bis fünf Steißbeinwirbel (Steißbein).
Die gegeneinander beweglichen Wirbel – mit Ausnahme von den zwei oberen Wirbeln der Halswirbelsäule – sind durch eine Bandscheibe, einer Scheibe aus Bindegewebe mit einem Gallertkern, miteinander verbunden. Die insgesamt 23 Bandscheiben fangen Stöße ab und helfen zudem dabei, dass sich die Wirbelsäule bewegen kann, dass wir uns also vorbeugen, bücken oder aufrichten können.
Nicht alle Wirbel der Wirbelsäule sehen gleich aus, gemeinsam ist ihnen jedoch, dass sie aus einem Wirbelkörper, einem Wirbelbogen, Fortsätzen für Bänder und Sehnen sowie Fortsätzen in Richtung der nebenliegenden Wirbel bestehen. Durch das Wirbelloch in jedem Wirbel zieht sich das Rückenmark. Es leitet die Befehle des Gehirns mithilfe von ihm abgehender Nerven an die Muskeln, Organe und anderen Strukturen des Körpers weiter. Stabilisiert und gehalten wird die Wirbelsäule durch Bänder, Sehnen und Muskeln. In gewissem Maße schützt daher eine starke Rückenmuskulatur auch vor Rückenschmerzen. Im Alter treten zwar Verschleißerscheinungen an den Wirbeln auf, sie müssen jedoch nicht unbedingt zu körperlichen Problemen führen.
TEST: IST IHRE WIRBELSÄULE INTAKT?
SCHULTERGÜRTEL UND SCHULTERGELENK
Bindeglied und Garant für Beweglichkeit
Das Schultergelenk ist das beweglichste aller Kugelgelenke des Körpers. Es sorgt dafür, dass wir die Arme über den Kopf, aber auch seitlich und waagerecht vor den Rumpf heben können. So können wir die Arme sogar kreisen lassen und sie hinter den Rücken führen.
Schultergelenk und Schultergürtel helfen uns dabei, dass wir unsere Arme bewegen können.
Wie sehen der Schultergürtel und das Schultergelenk aus?
Der Kugelkopf des Oberarmknochens und die Gelenkpfanne des Schulterblatts bilden die knöchernen Elemente dieses Gelenks. Das Schulterdach – oder Schulterhöhe – ist ein Teil des Schulterblatts und liegt wie ein Dach über dem eigentlichen Schultergelenk. Doch nicht nur Oberarm und Schulterblatt tragen zur Beweglichkeit unserer Schultern bei, sondern auch das Schultereckgelenk, das aus Schulterhöhe und einer Seite des Schlüsselbeins besteht. Das Schlüsselbein wiederum ist durch das sogenannte Sternoklavikulargelenk am Brustbein befestigt und bildet zusammen mit Schulterblatt und Rabenschnabelfortsatz den Schultergürtel. Der Schultergürtel ist also eine Verbindung zwischen Schultern und Rumpf.
Beweglich, aber verletzlich
Der Grund für die Beweglichkeit des Schultergelenks ist seine spezielle Konstruktion sowie die Tatsache, dass vor allem Muskeln, Sehnen und Bänder es an Ort und Stelle halten. Gleichzeitig sorgen diese Gewebe natürlich auch dafür, dass sich der Arm bewegen kann. Zwischen den einzelnen Teilen der Schulter liegen zudem Schleimbeutel. Sie verhindern, dass die verschiedenen Gewebe bei Bewegungen gegeneinanderstoßen oder -reiben.
Seine große Beweglichkeit macht das Schultergelenk zugleich jedoch sehr verletzungsanfällig. Bewegungseinschränkungen können ihre Ursache daher sowohl in rheumatischen Beschwerden, im Gelenkverschleiß, aber auch in Verletzungen von Knochen, Muskeln, Sehnen und Schleimbeuteln haben.
TEST: FUNKTIONIERT IHRE SCHULTER RICHTIG?
TESTAUSWERTUNG:
Zählen Sie nun, wie oft Sie mit Ja geantwortet haben, und lesen Sie die Auswertung.
0–1 Ja
Nach größeren Anstrengungen (z.B. ungewohnter Überkopfarbeit) kann eine Schulter schon mal wehtun, und auch zeitlich begrenzte Bewegungseinschränkungen sind dann keine Seltenheit. Ursache kann z.B. Muskelkater sein. Halten die Symptome jedoch über einen längeren Zeitraum an, werden sie vielleicht sogar schlimmer, kann dies auch andere Ursachen haben. Gehen Sie daher zum Arzt, wenn Ihre Beschwerden nicht abklingen oder sich verstärken.
2–3 Ja
Bei Ihnen kann unter Umständen eine Funktionseinschränkung des Schultergelenks vorliegen. Diese ist womöglich nur vorübergehend, doch suchen Sie zur Abklärung Ihrer Beschwerden besser den Arzt auf. Nur er kann genau sagen, ob Muskelverspannungen an den Symptomen schuld sind oder eine rheumatische Erkrankung oder – seltener im Bereich der Schulter – eine Arthrose vorliegt.
4–9 Ja
Sie scheinen schon länger stärkere Schulterbeschwerden zu haben. Sollten Sie bislang noch nicht beim Arzt gewesen sein, holen Sie das jetzt nach. Je eher eine Behandlung erfolgt, umso schneller sind Sie wieder fit.
DAS ELLBOGENGELENK
Gelenk aus drei Bausteinen
Das Ellbogengelenk besitzt drei knöcherne Anteile: den Oberarmknochen sowie die zwei Unterarmknochen Elle und Speiche. Durch das Zusammenspiel dieser drei Elemente können wir den Unterarm strecken, beugen und drehen.
Die drei Gelenke des Ellbogens
Das Ellbogengelenk setzt sich eigentlich aus drei Gelenken zusammen:
•Oberarm-Ellengelenk: Dieses Scharniergelenk besteht aus der Rolle des Oberarmknochens und dem sich darin einfügenden Anteil der Elle. Es lässt nur die Beugung und Streckung zu.
•Oberarm-Speichengelenk: Das Kugelgelenk ist in seiner Beweglichkeit eingeschränkt, da die Speiche durch Bindegewebe fest mit der Elle verbunden ist.
•Ellen-Speichengelenk: Mithilfe dieses Radgelenks können wir beispielsweise den Unterarm drehen.
Alle drei Elemente sind von einer gemeinsamen Gelenkkapsel umhüllt. Bewegt wird das Gelenk durch die Muskeln des Oberarms und auch durch die des Unterarms. Verschiedene Bänder halten dabei das Gelenk in Position.
Hinter Schmerzen im Ellbogengelenk steckt häufig eine Überbeanspruchung der Sehnen.
Probleme mit dem Ellbogengelenk
Ein Verschleiß des Ellbogengelenks tritt eher selten auf, denn im Normalfall wird das Gelenk weniger stark belastet – es sei denn, es ist durch Stürze oder andere Unfälle vorbelastet oder aber man übt eine Sportart aus, bei der das Gelenk stark belastet wird (z.B. Gewichtheben).
Von einer rheumatoiden Arthritis ist das Ellbogengelenk dagegen häufiger betroffen. Die Probleme fallen oft nicht sofort ins Auge, da Hand- und Schultergelenk Probleme mit dem Ellbogengelenk noch eine Weile kompensieren können.
Nicht selten sind in diesem Bereich jedoch Probleme mit den Sehnen. Der Grund: Am Ellbogen entspringen die Sehnen von Muskeln, die an Hand- und Fingerbewegungen beteiligt sind. Kommt es nun zu einer Überbeanspruchung der Sehnen, können diese verschleißen und zu heftigen Schmerzen führen.
TEST: WIE GUT FUNKTIONIERT IHR ELLBOGENGELENK?
HAND- UND FINGERGELENKE
Beweglichkeit durch zahlreiche Gelenke
Wenn wir vom Handgelenk sprechen, meinen wir in aller Regel die Gelenke zwischen Unterarm und Handwurzel. Doch die Hand besitzt noch eine Vielzahl weiterer Gelenke.
Das Handgelenk
Das Handgelenk besteht eigentlich aus zwei Gelenken. Das dem Körper näher gelegene Gelenk (proximale Handwurzelgelenk) ist die Verbindung zwischen dem als Speiche bezeichneten Knochen des Unterarms und dreier Handwurzelknochen. Das proximale Handwurzelgelenk ermöglicht sowohl Beugung und Streckung der Hand als auch Bewegungen zu den Seiten. Als distales Handwurzelgelenk wird dagegen das Gelenk bezeichnet, das sich zwischen den Handwurzelknochen befindet, die näher am Körper liegen, und denen, die vom Körper weiter entfernt sind. Der Gelenkspalt zwischen diesen Knochen hat in etwa die Form des Buchstabens S. Das distale Handwurzelgelenk besteht aus mehreren Gelenken, die jedoch als Einheit zusammenwirken. Es ist kaum beweglich, weil es durch Bänder eng zusammengehalten wird.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!





























