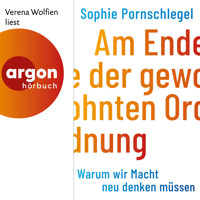17,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Droemer eBook
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2023
Wer die Welt gestalten will, muss über Macht sprechen: Aufruf für ein neues Politikverständnis. Klima-Krise, Krieg, Rechtspopulismus – es ist anstrengend geworden, sich mit Politik zu beschäftigen. Die politischen Herausforderungen auf nationaler und internationaler Ebene sind so zahlreich, dass konstruktive Lösungen aus dem Blick geraten. Denn auf die Aggressionen Russlands und Chinas findet der Westen keine langfristigen Antworten, die Klima-Krise verschärft sich, und die alte internationale Ordnung insgesamt weist immer mehr Risse auf. Um Lösungen für die multiplen Krisen zu finden, so Politikwissenschaftlerin Sophie Pornschlegel, braucht es vor allen anderen Dingen eines: einneues Verständnis von Macht. Nur mit klarem Blick dafür, was Macht ist, was sie leistet, wer sie hat, und wann sie gefährlich wird, kann die Zukunft gestaltet werden. - Mut zur Gestaltung erfordert Macht – aber wieso tut Deutschland sich so schwer, über Macht zu sprechen? - Warum treten Rechtspopulisten auf als »starke Männer«, denen die Verteidiger*innen der liberalen Ordnung scheinbar machtlos ausgesetzt sind? - Wie können demokratisch legitimierte Staaten autokratischen Regimen machtvoll gegenübertreten, ohne sich selbst zu verleugnen?Um die Schwächen der derzeitigen Macht-Strukturen anzugehen, bedarf es eines radikalen Umdenkens, so Pornschlegel, die als politische Analystin in Brüssel seit Jahren eine gefragte Expertin zum Thema internationale Ordnungen und Macht-Politik ist. Sie analysiert, wie wir in Deutschland, Europa und global zu einem demokratischeren Macht-Verständnis gelangen, das Handlungsoptionen offenhält. Denn nur mit einem neuen Blick auf politische und gesellschaftliche Macht können wir die Probleme der nächsten Jahrzehnte lösen. Und ein demokratisches Gemeinwesen verteidigen, das Menschlichkeit und Respekt in den Mittelpunkt rückt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 348
Ähnliche
Sophie Pornschlegel
Am Ende der gewohnten Ordnung
Warum wir Macht neu denken müssen
Knaur eBooks
Über dieses Buch
Klima-Krise, Krieg, Rechtspopulismus – es ist anstrengend geworden, sich mit Politik zu beschäftigen. Die politischen Herausforderungen auf nationaler und internationaler Ebene sind so zahlreich, dass konstruktive Lösungen aus dem Blick geraten. Denn auf die Aggressionen Russlands und Chinas findet der Westen keine Antworten, die Klima-Krise verschärft sich, und die alte internationale Ordnung insgesamt immer mehr Risse auf. Um Lösungen für die multiplen Krisen zu finden, braucht es vor allen anderen Dingen eines: ein neues Verständnis von Macht. Nur mit klarem Blick dafür, was Macht ist, was sie leistet, wer sie hat, und wann sie gefährlich wird, kann die Zukunft gestaltet werden. Sophie Pornschlegel analysiert, wie wir in Deutschland, Europa und global zu einem selbstbewussten demokratischen Machtverständnis gelangen, das Menschlichkeit und Respekt in den Mittelpunkt rückt.
Weitere Informationen finden Sie unter: www.droemer-knaur.de
Inhaltsübersicht
Widmung
Vorwort
Die Dauerkrise als neue Normalität
Zwischen Herrschaften
Die heutige Dauerkrise als Interregnum
Verzahntes Krisengeschehen: Bezahlen wir Wohlstand mit Sicherheit?
Maßlose Überforderung auf allen Entscheidungsebenen
Ein dauerhafter Ausnahmezustand?
Was das Interregnum nicht ist
Die morbiden Symptome des Spätkapitalismus
Der Überwachungskapitalismus und sein expansiver Charakter
Die Klimakrise: Wissen schützt nicht vor Zerstörung
Das reichste Prozent: wirtschaftliche Ordnung vs. sozialer Frieden
Keine Neuorientierung trotz Dauerkrisen
Marktkonforme Demokratie oder demokratiekonforme Märkte?
Die internationale Unordnung und der Machtverlust des Westens
»Wo bleibt die UN?«: die schwindende Bedeutung internationaler Organisationen
Der Westen zieht sich zurück
Europas Souveränität ist gefährdet
Die (Un-)Ordnung der globalen Wirtschafts- und Handelspolitik
Krieg ist kein Relikt der Vergangenheit: die Rückkehr der Realpolitik
Weshalb verliert der Westen an Macht?
Eine »post-hegemoniale Ära«?
Das kulturelle Interregnum als Wettbewerb der Werte
Der Sieg des Liberalismus und das vermeintliche »Ende der Geschichte«
Auf der Suche nach Orientierung: die ideologische Sinnkrise
Das Zeitalter des Hyperliberalismus
Die Folgen: Kulturrelativismus und autoritärer Libertarismus
Ist ein Paradigmenwechsel in Sicht?
Die liberale Demokratie im Krisenmodus
Übergangen: Politikverdrossenheit und Vertrauensverlust
Hate speech statt Debatte: Polarisierung und Radikalisierung
Rechte überall: die autoritäre Wende
Wie »wehrhaft« ist die Demokratie?
Geht der Verfassungszyklus Demokratie zu Ende?
Die Demokratie braucht ein neues Machtverständnis
Das Problem: unser Machtverständnis
»Solange du ihnen Gutes erweist, sind sie dir völlig ergeben«: Machiavellis Erbe
Was ist Macht?
Macht ist keine Einbahnstraße
»Wenn du in den Abgrund blickst«: das Ungeheuer der Macht
Machtkontrolle gegen Machtmissbrauch
Fehlende Gegenmächte
Welche Interessen werden vertreten?
Die Professionalisierung der Politik und ihre Folgen
Mangelnde »innere Demokratie« im Vorraum der Macht
Mangelnde Fehlerkultur und Rechenschaftspflicht
Erinnerung an »früher«: Macht als negativ konnotierter Begriff
Die Ohnmacht der Politik
»Wer Visionen hat, soll zum Arzt gehen«: die Falle des Status-quo-Erhalts
Entpolitisierung durch Bürokratisierung
Machtabgabe an private Akteure
Die ungleiche Verteilung der Macht
Macht neu denken
Politik als Gestaltungsmacht
Demokratische Macht braucht (viele) Narrative
Wie stärkt man die kollektive Macht?
Moralische Macht: Das ist kein Widerspruch
Ansätze für einen neuen Führungsstil
Der Beginn einer neuen Ordnung?
Utopien, Dystopien und kollektive Visionen
Demokratie braucht Streit: die Macht des zivilen Widerstands
Der Weg des Wandels: Revolution oder Reform?
Die Transformation fängt bei uns selbst an
Danksagung
Meinen verstorbenen Großeltern, die auf beiden Seiten des Rheins die schlimmsten Auswüchse politischer Macht erlebt haben.
Vorwort
Ein Buch über politische Macht zu schreiben, ist kein einfaches Unterfangen. Das Thema ist allgegenwärtig und gleichzeitig schwer greifbar. Zahlreiche Philosoph*innen und Denker*innen wie Max Weber, Hannah Arendt oder Michel Foucault haben sich bereits mit dem Thema auseinandergesetzt. Dennoch wird es in der Politik nach wie vor oft tabuisiert, insbesondere in Deutschland.
Wenn Macht nicht tabuisiert wird, hat sie oft negative Konnotationen: Macht führt in ihrer schlimmsten Form zu Gewalt; angeblich sind Menschen mit Macht meist gierig, empathielos und kalt; Macht wird oft missbraucht, weil mächtige Menschen immer nach noch mehr Macht streben. Dabei ist Macht ein fester Bestandteil unseres Alltags. Wir können uns von ihr nicht trennen, denn eine machtfreie Gesellschaft existiert nicht. Sobald es soziale Beziehungen gibt, wird es zwangsläufig auch Machtverhältnisse geben, sei es im privaten oder öffentlichen Leben. Insbesondere im Umfeld der Politik ist Macht auf besondere Weise präsent – trotzdem wird nur selten über das Thema gesprochen. Vielmehr scheint man Macht als selbstverständliches Phänomen hinzunehmen. Dabei lohnt es sich, unser Machtverständnis zu überdenken und regelmäßig zu prüfen, ob es mit unseren demokratischen Werten übereinstimmt.
Obwohl ich seit Jahren im politischen Umfeld arbeite, war Macht an und für sich nie Thema von Projekten, an denen wir arbeiteten. Bis zu einem Tag im Januar 2022. Zu jener Zeit waren die meisten meiner Kolleg*innen im Homeoffice, die Corona-Pandemie war noch allgegenwärtig. Das European Policy Centre organisierte ein Online-Treffen, in dem wir Themen für das 25-jährige Jubiläum der Organisation diskutierten – Themen, bei denen es um die Zukunft der Europäischen Union gehen sollte. In diesem Zusammenhang wurde die Frage aufgeworfen, ob die EU überhaupt genügend politische Macht hat, um den zahlreichen Herausforderungen zu begegnen, denen sie sich stellen muss – und wenn ja, welche Art der Macht die EU ausüben sollte.
Besonders interessant waren dabei die unterschiedlichen nationalen Perspektiven der Kolleg*innen aus Belgien, den Niederlanden, Finnland, Italien, Portugal, Deutschland und Rumänien. So verschieden die Länder, so unterschiedlich waren die Konzeptionen und Visionen zur Macht der EU. Viele Kolleg*innen waren überzeugt, dass die EU ihre Macht nicht voll ausnutzt, aus Angst, die Mitgliedsländer zu brüskieren bzw. ihnen das Gefühl zu geben, dass sie nicht mehr am längeren Hebel sitzen. Andere stellten fest, dass die EU im Bereich der Wirtschafts- und Handelspolitik ein mächtiger Akteur geworden sei, der den Mitgliedsländern die Möglichkeit gibt, auf internationaler Ebene eine viel größere Rolle zu spielen. Schließlich gab es auch Kolleg*innen, die die Diskussion des Konzepts »Macht« in diesem Zusammenhang generell unpassend fanden, da die EU historisch als Reaktion auf die Ausuferungen einer dezidiert gewaltsamen Machtpolitik gewachsen ist: Nach dem Zweiten Weltkrieg sollte dank Dialog, Verhandlungen und Kompromissen der egoistische Nationalismus in Europa eingehegt werden. Schon daher könne die EU das Konstrukt »Macht« generell nicht positiv deuten.
Während dieser Diskussionen wurde mir bewusst, wie unterschiedlich die Perspektiven auf Macht sein können. Einige Kolleg*innen verknüpften Macht mit Nationalismus, Unterdrückung und Gewalt; andere hingegen verstanden Macht als Mittel zur Veränderung im neutralen oder sogar positiven Sinne.
Vor allem wurde mir klar: Trotz der Arbeit nahe am politischen Geschehen hatten wir bisher nie über die Essenz von Politik gesprochen. Ob in Berlin oder Brüssel: Der Begriff der Macht war bisher meist tabuisiert worden. »Macht« – das klingt in vielen Ohren wie eine simple Tatsachenbeschreibung, die oft als wenig gehaltvoller Erklärungsansatz für alle möglichen Herausforderungen herangezogen wird. Vielfach wird ein Vokabular genutzt, das Macht umschreibt, aber nicht beim Namen nennt. Dann spricht man von Governance-Strukturen, Kosten-Nutzen-Analysen, Entscheidungsprozessen, Verantwortung – höchstens wird noch das Wort »Gestaltungsmacht« genutzt, um darzustellen, dass Macht hier nicht als Selbstzweck dient. Dabei geht es eigentlich immer nur um eines: Macht. Wer sie hat, wer sie nutzt und wie sie genutzt wird.
Nur wenige Wochen nach unserer Diskussion am European Policy Centre rollten russische Panzer über die ukrainische Grenze. Die Rückkehr der konventionellen Kriegsführung auf den europäischen Kontinent machte deutlich, dass Machtpolitik kein Relikt des 20. Jahrhunderts ist, sondern fester Bestandteil unserer Gegenwart. Bereits in den Jahren zuvor hatten wir beobachten können, wie die regelbasierte Ordnung erodierte und nationale Interessen zunehmend unilateral und ohne Rücksicht auf andere durchgesetzt wurden. Spätestens seit der Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten und dem Brexit-Referendum (beides im Jahr 2016) ist deutlich, dass »der Westen« nicht mehr ist, was er einmal war. Damals begann die Ära von »America first« bzw. »Take back control«, zwei Ideologien, die seitdem immer mehr Anhänger*innen fanden. Sogar vermeintlich pro-europäische und demokratische Regierungen in Europa waren nicht mehr vor dem »nationalistischen Reflex« geschützt und verhielten sich zunehmend isolationistisch: Asylsuchende wurden abgeschoben, an den Grenzen Europas wurden mit Steuergeldern Zäune gegen Flüchtende errichtet, und während der Pandemie schlossen fast alle Länder ihre Grenzen. Solidarität wurde zwar gepriesen, aber selten umgesetzt. Fakt ist: Die autoritäre Wende hat ein traditionelles Machtverständnis in die Politik zurückgebracht. Die »Machtpolitik« scheint gekommen, um zu bleiben. Schon allein deshalb ist es wichtig, sich mit diesem Thema näher zu befassen.
In unserer Gesellschaft wird Macht oftmals sehr machiavellistisch gedacht, unabhängig davon, ob man sich selbst politisch rechts oder links verortet. Zu viele Menschen begegnen dem Thema mit Zynismus: »Die da oben« seien ja doch nur daran interessiert, ihre eigene Macht auszuweiten. Andere Menschen werden nicht als potenzielle Verbündete im Kampf um Macht gesehen, sondern immer nur als Konkurrent*innen, die der eigenen Machterweiterung im Weg stehen. Schließlich verstehen wir Macht oft als Gegensatz zu Werten oder Moral: Wer sich moralisch verhält, wird in unserer Gesellschaft bestraft, so die landläufige Ansicht; wer »über Leichen geht«, setzt sich durch. Leider erweist sich das allzu oft als sich selbst erfüllende Prophezeiung.
Doch dieses Machtverständnis ist nicht in Stein gemeißelt, sondern von kollektiven und individuellen Vorstellungen geprägt. Entsprechend lässt es sich ändern. Mit diesem Buch möchte ich vor allem die Leser*innen dazu bringen, ihr eigenes Machtverständnis zu überdenken. Welchen Personen übereignen wir Macht? Welche Machtformen – kollektive oder individuelle Macht, politische oder marktwirtschaftliche Macht – möchten wir stärken? Welche Instrumente der Macht finden wir in der Politik angebracht, welche verurteilen wir, und welchen Mechanismen wird womöglich zu wenig Beachtung geschenkt? Das sind nur einige der Fragen, die ich mit diesem Buch aufwerfen möchte, um einen Beitrag zu einer Diskussion zu leisten, die in Deutschland bisher noch zu wenig stattfindet.
Meistens wird die Existenz bestimmter Machtstrukturen in der Politik als selbstverständlich vorausgesetzt. Doch nur, weil die derzeitigen Strukturen so sind, wie sie sind, heißt es nicht, dass sie gerecht sind und verteidigt werden müssen. Deshalb ist es wichtig, Machtverhältnisse sichtbar zu machen – und zu verstehen, warum es einen stärkeren Widerstand gegen einen positiven Wandel gibt als gegen einen negativen (z.B. den wachsenden Rechtsextremismus). Es ist bisher ein recht undemokratisches Verständnis von Politik verbreitet, das davon ausgeht, dass politische Macht nicht ausschließlich auf Legitimität und Kompetenz basiert, sondern auch oder sogar vor allem auf gesellschaftlichen Privilegien. Dieses Machtverständnis ist in einer Monarchie sicherlich nachvollziehbar, aber nicht in einer Demokratie. Sofern man Wahlen gewonnen hat und die demokratischen Grundprinzipien respektiert, sollte man politische Macht ausüben können – egal welche Hautfarbe, sozio-ökonomischer Hintergrund oder Geschlecht. Ein privilegienbasiertes Machtverständnis ist nicht kompatibel mit den Grundwerten einer Demokratie und führt zu einer Schwächung unseres politischen Systems.
Mit diesem Buch geht es mir auch darum, politische Macht zu rehabilitieren, denn wenn wir Antworten auf die Herausforderungen der Zukunft finden wollen, brauchen wir einen starken demokratischen Staat und eine von der Bevölkerung legitimierte Politik. Wenn die Politik keine Macht hat, dann werden sich andere Akteur*innen diese Macht aneignen – Akteur*innen, die nicht gewählt wurden und entsprechend keine demokratische Legitimität besitzen. Dabei sollte politische Macht vor allem eines sein: demokratisch. Deshalb müssen wir Macht neu denken.
Kapitel 1
Die Dauerkrise als neue Normalität
Bereits 1986 dachten The Smiths über die Leere nach, die der Tod der britischen Regentin hinterlassen würde (»The Queen is dead, boys / And it’s so lonely on a limb«1). 36 Jahre später wurde diese Befürchtung Wirklichkeit: Am Abend des 8. September 2022 starb die britische Königin Elisabeth II. in ihrer schottischen Residenz Balmoral. Der Nachfolger, ihr Sohn Charles, wurde mit ihrem Tod automatisch zum neuen König des Vereinigten Königreichs. Zwei Tage später wurde er vom Accession Council zum König proklamiert. Es gab somit in Großbritannien kein Interregnum, keine Zeit zwischen zwei Herrschaften, in der die alte Garde nicht mehr an der Macht ist, die neuen Herrscher aber noch nicht ernannt oder gewählt wurden. Die britische Monarchie vermied somit ein Machtvakuum, das potenziell zu Instabilität führen kann. Eine Zeit ohne klare Herrschaftsverhältnisse ist meist eine Zeit der Unsicherheit, in der andere die Herrschaft für sich beanspruchen können. Denn Machtpositionen bleiben nie lange unbesetzt.
Das Prinzip »Der König ist tot, lang lebe der König« soll für klare Machtverhältnisse sorgen, wenn es ein Interregnum gibt. Es beruht auf einer Theorie des Historikers Ernst Kantorowicz, der Theorie der »zwei Körper des Königs«, die besagt: Sofern die physische Repräsentation der Macht in der Figur des Monarchen nicht mehr existiert, muss sie von einer rechtlichen symbolischen Macht ersetzt werden, die auch gilt, wenn die Person verstorben ist.2 Der König oder die Königin hat sozusagen zwei »Körper«: einen physischen und einen juristisch-symbolischen. Wenn die Person, die die Monarchie verkörpert, stirbt, besteht die juristisch-symbolische Repräsentation der Macht weiter.
Trotz der geregelten Machtübergabe an Charles III. markierte der Tod Elisabeths II. das Ende einer 70-jährigen Ära. Die Queen stand in den letzten Jahrzehnten vor allem für Kontinuität und Stabilität in turbulenten Zeiten, sowohl in der britischen Innenpolitik als auch auf internationaler Ebene. König Charles III. wird die symbolische Rolle seiner Mutter sicherlich nicht so schnell ersetzen können. Auch wenn die Herrschaftsverhältnisse formal geklärt sind, gibt es ein symbolisches Interregnum, denn die britische Monarchie hat an Strahlkraft verloren. Dieses Beispiel zeigt, dass Machtverhältnisse zwar offiziell geklärt sein können, aber trotzdem nicht von allen Betroffenen gleichermaßen akzeptiert werden. Macht hat eine symbolische und gesellschaftliche Komponente. Macht ist nichts, das potenzielle Herrschende sich einfach so greifen können, wenn sie sie haben möchten – Macht muss geschenkt werden. Gerade in einem Interregnum stellt sich die Frage, wem die Macht geschenkt wird – der »alten Garde« oder womöglich neuen Personen, die noch nicht an der Macht waren. Ein Interregnum ist von Natur aus eine unsichere und disruptive Zeit.
Zwischen Herrschaften
Neben der ursprünglichen Definition des Interregnums in Monarchien kann der Begriff auch eine Zeit definieren, in der das alte politische System klare Ermüdungszeichen aufweist, aber die neue Ordnung noch nicht feststeht. Diese Definition des Interregnums wurde vom italienischen Denker Antonio Gramsci geprägt, der als engagierter Kommunist die Jahre von 1929 bis 1935 im Gefängnis verbrachte. Während dieser Zeit schrieb Gramsci die »Gefängnishefte«, eine Sammlung von philosophischen und politischen Gedanken, die heute als sein Hauptwerk gelten. Gramsci definiert das Interregnum wie folgt: »Die Krise besteht gerade darin, dass das Alte stirbt und das Neue nicht geboren werden kann: In diesem Interregnum treten die vielfältigsten morbiden Erscheinungen auf.«3 Viel weiter umschreibt er das Konzept nicht. Es ist aber wahrscheinlich, dass er von den geschichtlichen Ereignissen spricht, die während seiner Gefängniszeit im Gange waren.
Ende der 1920er-Jahre und Anfang der 1930er-Jahre vollzogen sich enorme ideologische, wirtschaftliche, politische Umbrüche. In Europa kämpften zahlreiche ideologische Strömungen um die Deutungshoheit: Kommunismus, Faschismus, Nationalliberale und verschiedene Strömungen der Sozialdemokratie, um die wichtigsten zu nennen. Nach dem Ersten Weltkrieg versuchten kommunistische Bewegungen in Westeuropa an die Macht zu kommen, scheiterten aber kläglich. Anders in Russland: Mit der Oktoberrevolution 1917 kamen die kommunistischen Bolschewiki an die Macht, mit Lenin an ihrer Spitze; 1922 wurde die Sowjetunion gegründet. In Deutschland wurde 1918 die Weimarer Republik ausgerufen, ein erster Versuch in Sachen Demokratie, der aber von Instabilität und einflussreichen Militärs geprägt war. Adolf Hitler gelangte 1933 durch Wahlen an die Macht, mit der Unterstützung des damaligen Reichspräsidenten Paul von Hindenburg. In diesem Kontext war die »Dolchstoßlegende« allgegenwärtig, die besagte, die Juden und die Sozialdemokraten – die »Vaterlandsverräter« – hätten für die Niederlage Deutschlands im Ersten Weltkrieg gesorgt. In Frankreich gab es in den 1920er-Jahren zwar eine Weiterführung der Dritten Republik, die seit 1870 existierte, doch die politischen Verhältnisse waren nach dem Ersten Weltkrieg besonders instabil und das Land wirtschaftlich am Boden. Frankreich pochte auf Reparationen und besetzte 1923 das Ruhrgebiet. In Italien errichteten die Faschisten bereits 1925 eine Einparteiendiktatur, die mit Mussolini an der Spitze bis 1942 andauern sollte – das sogenannte ventenniofascista, die »zwei schwarzen Jahrzehnte«. 1929 folgte die globale Wirtschaftskrise, die auch in Europa zerstörerische Auswirkungen hatte und große Teile der Bevölkerung in die Armut trieb. Inflation und Arbeitslosigkeit führten zum Erstarken faschistischer Bewegungen.
Gramsci war insbesondere vom rasanten Aufstieg des Faschismus in Europa geprägt: 1922 wurde Mussolini, der bereits seit 1919 von Faschist*innen »Il Duce« genannt wurde, zum Ministerpräsidenten Italiens ernannt. In seiner Haft erlebte Gramsci die Machtübernahme Hitlers 1933 und das Ende der Weimarer Republik. Diese Machtübernahme wurde durch die vorherigen politischen Verhältnisse erst ermöglicht; wie der Nazi-Staatsrechtler Carl Schmitt in Bezug auf das Ende der Demokratie in Deutschland schrieb: »Keine Verfassung der Erde hat einen Staatsstreich so leicht legalisiert wie die Weimarer Verfassung.«4 Gramscis Konzept des Interregnums war geprägt von einer Zeit, in der sich keine ideologische Strömung durchzusetzen vermochte – bis die Faschist*innen und Kommunist*innen endgültig an die Macht kamen und klare Herrschaftsverhältnisse schufen. Gramsci beschrieb diesen Zustand wie folgt: »Eine Krise findet statt – manchmal dauert sie Jahrzehnte. Die außergewöhnliche Länge bedeutet, dass sich die unheilbaren strukturellen Widersprüche bemerkbar gemacht haben (reif geworden sind) und dass trotz allem die politischen Kräfte – die Schwierigkeiten haben, die existierende Struktur zu wahren und zu verteidigen – wenig Aufwand betreiben, diese Gegensätze zu beseitigen und zu überwinden.«5
Das Konzept des Interregnums, also der Zwischenherrschaft, ist in der Politikwissenschaft noch nicht umfassend erforscht worden, vielleicht weil es der linearen Geschichtsschreibung widerspricht. Meist werden die »vollkommenen« Ideologien und Staatsformen analysiert, ob Faschismus, Kommunismus oder Demokratie. Das Interregnum hingegen wird als Transitionsphase verstanden, als eine Art »Warteraum der Geschichte«. Doch die Geschichte bleibt nicht stehen, nur weil die politischen Machtverhältnisse ungeklärt sind. Vielmehr sind genau diese Transitionsphasen entscheidend im Kampf um politische Macht, wirtschaftliche Vorherrschaft und kulturelle Deutungshoheit. Es ist erstaunlich, wie wenig Augenmerk auch heute noch auf das Interregnum gerichtet wird. Dabei können diese Transitionsphasen mehrere Jahre, ja sogar Jahrzehnte dauern und sind entscheidend dafür, zu verstehen, welche Machtverhältnisse in Zukunft herrschen werden. Gerade deshalb lohnt es sich, durch diese konzeptuelle Brille auf die Gegenwart zu schauen.
Die heutige Dauerkrise als Interregnum
Die aktuellen politischen Verhältnisse in Europa weisen viele Merkmale eines Interregnums auf, so wie Gramsci es beschrieben hat.6 Insbesondere nach dem 24. Februar 2022 würden nur noch die wenigsten behaupten, dass die Dreifaltigkeit von Wohlstand, Sicherheit und Frieden in Europa weiterhin gewahrt ist. Unser wirtschaftliches System ist in einem fragilen Zustand; das Versprechen, dass von wirtschaftlichem Wachstum alle profitieren, hat sich als Illusion herausgestellt. International hat die Erosion des Multilateralismus zu einer multipolaren Welt geführt, in der die früheren Spielregeln nicht mehr gelten. Unsere Gesellschaft ist höchst polarisiert: Verschiedene Ideologien kämpfen um die Deutungshoheit, ohne dass die Politik es schafft, diese Gegensätze zu überwinden. Der Liberalismus, die dominante Ideologie der letzten Jahrzehnte, befindet sich in einer Sinnkrise: das Freiheitskonzept hat sich zunehmend in einen individualistischen Egoismus gewandelt; die individuellen Freiheiten sind zu Identitätskämpfen umgemünzt worden. Reichsbürger*innen, Impfgegner*innen und Gelbwesten sind bloße Symptome eines Systems, das an Macht verliert. Skurrile Verschwörungserzählungen – ob über Echsen-Menschen, Bill-Gates-Mikrochips oder »gestohlene« Wahlen – überzeugen immer mehr Menschen. Es fehlt eine ideologische Kohäsion innerhalb der Gesellschaft, und unser politisches System, das die Lösungen auf solche Herausforderungen finden soll, weist klare Ermüdungszeichen auf. Zwar haben existierende Institutionen weiterhin Macht, aber sie verlieren an Strahlkraft und werden von immer mehr Menschen in Frage gestellt. Der wachsende Zuspruch von rechts- und linksextremen Kräften, die die Legitimität der politisch Mächtigen anzweifeln, ist ein typisches Beispiel für diese Infragestellung der »führenden Meinung«. Sie zweifeln an, dass die politische Elite das Wohl der Menschen im Sinne hat.
Die Lösungsansätze für diese verschiedenen Krisen könnten unterschiedlicher nicht sein. Skurrile und antidemokratische Ideen haben zugenommen, und im demokratischen Lager hat die Kohäsion abgenommen. Insbesondere nach der Corona-Pandemie sind wachsende Teile der Bevölkerung skeptisch, ob die Regierung effektive Arbeit leistet und die Interessen der Mehrheit vertritt.7 Aus verständlichen Gründen fragen sich die Menschen, ob (nationale) Regierungen in der Lage sind, globale Pandemien zu bekämpfen; ob sie Antworten auf die Klimakrise finden können; und ob die digitale Transformation erfolgreich gemeistert werden kann. Gleichzeitig fehlt eine klare Richtungsvorgabe seitens der Politik. Es gibt keine Debatte darüber, was wir unter Fortschritt verstehen. Die Parteien sind sich höchst uneinig, wie man Klimaneutralität erreichen soll. So vorteilhaft ein Pluralismus in einer Demokratie auch ist, so problematisch ist es, wenn es keine gemeinsamen Grundwerte mehr gibt, auf die sich politische Antworten stützen können. Genau das können wir seit einigen Jahren beobachten: Die Politik verfällt in eine Stagnationsphase, aus Angst, bestimmte Teile der Bevölkerung zu »verlieren«. Ab 2015 war dieser Stillstand bei der Migrationspolitik zu beobachten, aus Angst, bestimmte Wähler*innen an die Rechtsextremen zu verlieren; ähnlich ist es heute mit der Klimapolitik. Antonio Gramsci nennt solche Ermüdungserscheinungen »morbide Symptome«. Eben diese Symptome möchte ich in den folgenden Kapiteln genauer unter die Lupe nehmen.
Verzahntes Krisengeschehen: Bezahlen wir Wohlstand mit Sicherheit?
Seit fast 15 Jahren taumelt Europa von einer Krise in die nächste, ohne dass ein Ende in Sicht wäre. Die Krisen häufen sich so sehr, dass Expert*innen inzwischen von einer »Permakrise« sprechen.8 Die Betrachtung der europäischen Politik in den letzten zehn Jahren zeigt deutlich, dass das Krisengeschehen inzwischen fast zur Normalität geworden ist: Auf die globale Finanz- und Wirtschaftskrise 2007/2008 folgte die Eurokrise 2011/2012, die mit den »Bail-outs« Griechenlands ihren Höhepunkt fand. Kurz darauf schlitterten die Europäer*innen in die »Flüchtlingskrise«, in der insbesondere Griechenland und Italien, aber auch Deutschland und Schweden im Fokus waren. 2016 folgte ein Höhepunkt der Krise der Demokratie: Im Juni stimmten die Briten nach einer schamlosen Kampagne voller populistischer Lügen für den Brexit; im November wurde Donald Trump zum neuen US-Präsidenten gewählt, mit weitreichenden Folgen für die amerikanische Demokratie. Die USA und Großbritannien verabschiedeten sich damit von ihrer Vorreiterrolle als liberale Demokratien. Auch in Ungarn und Polen wird seit 2010 bzw. 2015 die Demokratie von den dortigen Regierungen aktiv ausgehöhlt. Dann folgte die Corona-Pandemie, die Anfang 2020 von China aus Europa erreichte. Noch bevor die Pandemie komplett überstanden war, kam es zur nächsten schwerwiegenden Krise: Am 24. Februar 2022 rollten russische Panzer über die ukrainische Grenze und läuteten das vorläufige Ende des Friedens auf dem europäischen Kontinent ein.
Die Politik hat kaum mehr Zeit, sich von einer Krise zu »erholen«, schon steht die nächste Krise vor der Tür, und das führt zu einer Schwächung der gesamten Ordnung. So geschehen mit dem Ausbruch des russischen Angriffskriegs: Die europäische Wirtschaft, die bereits durch die Lockdowns der Corona-Pandemie stark angeschlagen war, musste sich auf umfassende Wirtschaftssanktionen gegen Russland einstellen. Dabei war die europäische Wirtschaftsordnung schon im Vorfeld der Pandemie angeschlagen, denn nach der Eurokrise sind die strukturellen Probleme der Wirtschafts- und Währungsunion nicht nachhaltig gelöst worden. Die Konsequenzen der Krisen werden immer gewichtiger, weil Notlösungen die strukturellen Probleme nicht angehen. Entsprechend wirken viele Bereiche der Politik wie ein Flickenteppich, dessen Nähte sich langsam lösen.
Hinzu kommt, dass die Krisen Wechselwirkungen haben. Wenn eine politische Lösung auf eine Krise gefunden wird, kann es gut sein, dass damit eine andere Krise ausgelöst oder verstärkt wird. Das erschwert die Arbeit der Entscheidungsträger*innen, die nach möglichst einfach umsetzbaren Lösungen suchen. 2022 wurde klar, wie eng unsere Energiepolitik mit der Sicherheitspolitik zusammenhängt. Das »Abschalten des Gashahns« durch den russischen Präsidenten Putin als Reaktion auf die EU-Sanktionen hat gezeigt, wie gefährlich unsere Energieabhängigkeit von Russland für unsere Sicherheit war. Die schmerzliche Realität erläuterte Außenministerin Annalena Baerbock wie folgt: »Wir haben jeden Kubikmeter russisches Gas doppelt und dreifach mit unserer nationalen Sicherheit bezahlt.«9 Gleichzeitig ist die Energiepolitik nicht nur mit der Sicherheitspolitik verbunden, sondern auch ein wichtiges Instrument gegen die Klimakrise. Unsere energiepolitischen Entscheidungen bestimmen das Ausmaß der aktuellen und zukünftigen Klimakatastrophen. Wenn sich Europa weiterhin auf fossile Energien verlässt, wird es seine Klimaziele nicht rechtzeitig erreichen. So rückt die Lösung einer Krise weiter in die Ferne, weil eine andere Krise gerade Priorität hat und man nach kurzfristigen Lösungen sucht.
Angesichts der Komplexität der Herausforderungen und der Wechselwirkungen verschiedener Krisen hat es die Politik nicht einfach, die »richtigen« Lösungen zu finden. Das führt zu Fehlentscheidungen. Im Sommer 2022 beschloss Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck die sogenannte »Gas-Umlage«, die die Energieversorgung im Winter gewährleisten und Insolvenzen von Energieunternehmen vermeiden sollte. Der Ansatz dieser Initiative war lobenswert, aber letztlich hätte diese politische Entscheidung fragwürdige Auswirkungen gehabt: Unternehmen, die bereits von der Krise profitierten, hätten ihren Profit weiter gesteigert, während auf Einzelpersonen horrende Energie-Rechnungen zugekommen wären. Diese Maßnahme entsprach dem »Gießkannenprinzip« – in Krisenzeiten entscheidet sich die Politik gerne für diese Methode, um alle ein bisschen zu unterstützen. In der Theorie führt es dazu, dass alle ein wenig zufriedener sind, aber in der Praxis verschärft es oft bestehende Ungerechtigkeiten und führt bei vielen Bürger*innen zu einer wachsenden Frustration. Menschen in Not bekommen kaum Geld, andere, die die Hilfen eigentlich gar nicht brauchen, werden dennoch unterstützt. Das sah der Bundeswirtschaftsminister glücklicherweise schnell ein und beschloss, die Gas-Umlage noch einmal zu verändern. Indem sich Habeck einsichtig zeigte, verstieß er gegen eine der üblichen Spielregeln der politischen Kommunikation – dass Politiker*innen stets recht behalten. Trotzdem beleuchtete diese Entscheidung die wachsende Ohnmacht der Politik, die zunehmend Schwierigkeiten hat, die richtigen Antworten auf immer komplexer werdende Krisen zu finden.
Maßlose Überforderung auf allen Entscheidungsebenen
Unsere Entscheidungsträger*innen müssen derzeit hauptsächlich akute Brandherde löschen, kurzfristige Antworten auf schwere Krisen finden und sicherstellen, dass es nicht zu allzu großen Disruptionen kommt. Sie sollen dafür sorgen, dass wir im Winter weiterhin unsere Wohnungen heizen können, dass möglichst keine russischen Bomben auf EU-Gebiet abgeworfen werden und dass unsere Wirtschaft einigermaßen stabil bleibt. Die Dauerkrise ist zur Normalität geworden. Aufgrund des Krisenmanagements hat die Politik immer weniger Zeit, Themenbereiche aktiv zu gestalten und ihre Parteiprogramme in die Tat umzusetzen. Statt Transformationsprozesse und Reformpläne gibt es vor allem Notfallpläne, Übergangslösungen und kurzfristige Maßnahmen.
Dass das Krisenmanagement der neue Modus Operandi der Politik ist, führt dazu, dass viele wichtige Entscheidungen nicht getroffen werden und dass die Fehler im System der Demokratie nicht angegangen werden. Der niederländische Autor Luuk van Middelaar fasst es in Bezug auf die EU wie folgt zusammen: »Die großen Krisen der Jahre 2008 bis 2022 haben die (Europäische) Union gezwungen, die heiligen Grundsätze ihres Ewigkeitsdenkens preiszugeben und im unmittelbaren Hier und Jetzt zu handeln, um drohende Katastrophen zu beherrschen und zu überleben.«10 Dieser Analyse schließen sich viele Politiker*innen an. Zwei Tage nach Beginn der russischen Invasion der Ukraine hielt Bundeskanzler Olaf Scholz im Bundestag eine Rede, die als »Zeitenwende-Rede« in die Annalen der deutschen Politik einging. Er erklärte: »Die Welt erlebt eine Zeitenwende. Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine bedeutet das Ende einer Ära.« Mit seiner Analyse war er nicht allein. Nur ein paar Monate später hielt der französische Staatspräsident ebenfalls eine ernüchternde Rede, in der es hieß: »Ich glaube, dass wir derzeit eine große Umwälzung erleben. (…) Wir erleben das Ende des Überflusses der Produkte und Technologien, die uns für immer zugänglich schienen, die Disruption von Lieferketten; neue Knappheiten werden entstehen, z.B. beim Wasser. Darauf müssen wir uns vorbereiten.«11 Die Koinzidenz dieser Reden ist kein Zufall. Beide deuten an, dass die Zeit der Sorglosigkeit vorbei ist. Der Frieden ist nicht mehr gewährleistet; der Wohlstand ist nicht mehr gesichert; unsere politischen Systeme sind fragil. All das sind Anzeichen eines Interregnums.
Die politischen Antworten auf diese »neue Ära« lassen allerdings zu wünschen übrig. Besonders deutlich wurde die Überforderung der Politik im Kontext der »Zeitenwende-Rede«: Der Bundeskanzler verkündete, die Bundeswehr werde ein Sondervermögen von 100 Mrd. Euro erhalten, um handlungsfähiger zu werden; Deutschland werde endlich die NATO-Vorgabe einhalten, 2 % des Bruttoinlandsproduktes in die Verteidigung zu investieren; und man werde die Energieabhängigkeit von Russland reduzieren. Ein Jahr später ist von den vollmundigen Ankündigungen noch wenig umgesetzt. Aufgrund der Inflation kann nun doch nicht so viel in die Bundeswehr investiert werden; es ist eher unwahrscheinlich, dass Deutschland mit dem jetzigen Bundeshaushalt das 2 %-Ziel erreichen wird; und die Energieabhängigkeit wurde reduziert, aber nicht auf Betreiben der Bundesregierung, sondern weil Putin unilateral die Gaslieferungen nach Europa eingestellt hat. Die deutsche Politik war im letzten Jahr nicht die Gestaltungsmacht, die sie hätte sein müssen. Statt zu handeln, wurde in vielen Fällen nichts entschieden oder sogar zurückgerudert. Aus dieser Krise scheint die Bundesregierung bisher wenig gelernt zu haben: Deutschland ist weiterhin stark von China abhängig, obwohl sich das Land derzeit vom Partner hin zum Rivalen entwickelt.
Auf europäischer Ebene stoßen die Entscheidungsträger*innen ebenfalls an ihre Grenzen. Die EU wurde in den letzten Krisen mit neuen Aufgaben konfrontiert, auf die die EU-Institutionen ursprünglich überhaupt nicht ausgelegt sind. Luuk van Middelaar erklärt: »Bei den großen Krisen seit 2008 ging es nicht um Ziegenkäse, Rasenmäher oder Getreidepreise – die Themen des gemeinsamen Marktes –, nein, es ging um Milliarden Euro und Solidarität, Krieg und Frieden, um Identität und Souveränität, um Leben und Tod.«12 Insbesondere das Einstimmigkeitsprinzip im Rat, wo sich die 27 Staats- und Regierungschefs treffen, war im Zuge des russischen Angriffskrieges eine Hürde, die die Handlungsfähigkeit der EU eingeschränkt hat. Das lag in erster Linie am autoritären Premierminister Ungarns, Viktor Orbán, der sich anscheinend zum Ziel gesetzt hat, die EU von innen auszuhöhlen. Er blockierte das Ölembargo gegen Russland, eine Mindestbesteuerung von Großunternehmen und die Nominierung eines europäischen Kandidaten für die Wahl des UN-Berichterstatters für die Kriegsverbrechen im ukrainischen Isjum. Trotzdem wird eine Reform dieser Entscheidungsstrukturen von den anderen Mitgliedsländern nicht unterstützt. Der Grund ist einfach: keine*r der 27 Entscheidungsträger*innen – auch nicht das Bundeskanzleramt – möchte die (nationale) Macht durch eine stärkere EU einschränken, auch wenn sich dadurch Krisen besser lösen ließen. Es ist für die meisten Politiker*innen einfacher, die EU als Sündenbock anzusehen und Erfolge sich selbst zuzuschreiben, selbst wenn sie gar nicht dafür verantwortlich sind. Das führt dazu, dass die EU weiter an Handlungsfähigkeit einbüßt, und darunter leidet letztlich die Bevölkerung.
Doch nicht nur die EU ist nicht mehr in der Lage, Entscheidungen zu treffen – auf internationaler Ebene wird die mangelnde Handlungsfähigkeit besonders deutlich, so z.B. bei den endlosen Klimaverhandlungen auf der COP-Konferenz, die zuletzt in Sharm-El-Sheikh in Ägypten stattfand. Die Klimakrise kann nur global gelöst werden, doch die Vereinten Nationen und die COP-Konferenzen sind politisch zu schwach, um bindende Ziele festzulegen. Kein Wunder, dass der Ausstoß weltweiter Treibhausgas-Emissionen weiterhin jedes Jahr ansteigt.13 Unternehmen planen offiziell damit, dass wir immer mehr verbrauchen und entsprechend immer mehr Energie und Rohstoffe benötigen werden. Nicht einmal die EU, die sich gerne damit brüstet, Europa solle der klimafreundlichste Kontinent der Welt werden, hat ausreichende Erfolge zu verzeichnen. Die Treibhausgas-Emissionen sind 2021 nach der Pandemie wieder angestiegen.14 Auch die Chancen eines Rückgangs um 55 % bis 2030, wie es im europäischen Klimagesetz beschlossen wurde, stehen schlecht. Deutschland ist dabei als größte Wirtschaft in der EU auch der größte Umweltverschmutzer und für 22 % der Emissionen der EU verantwortlich.15
Überall häufen und beschleunigen sich die Krisen. Die politischen Antworten hingegen werden immer komplexer, und Maßnahmen sind immer schwieriger durchzusetzen. Kurzfristiges Krisenmanagement übertrumpft strategische Erwägungen. Die politischen Strukturen, die diese Lösungen erarbeiten sollten, sind immer weniger handlungsfähig. Insbesondere der europäischen und internationalen Ebene fehlt es an politischer Macht, um zu Lösungen zu gelangen. Die Politik ist mit dem Interregnum überfordert.
Ein dauerhafter Ausnahmezustand?
Eine übliche Antwort auf eine Krise war bisher, den Ausnahmezustand auszurufen. Das tat z.B. die US-Regierung nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001 und schränkte mit dem »Patriot Act« die Grundrechte für Bürger*innen, die als verdächtig galten, drastisch ein. Nach den Terroranschlägen vom 13. November 2015 wurde in Frankreich ebenfalls ein Ausnahmezustand (»état d’urgence«) verhängt. Die dortigen Maßnahmen blieben zwei Jahre lang in Kraft, bis sie in die reguläre Gesetzgebung überführt wurden. Demokratische »checks and balances«, insbesondere zu Rechtsstaatlichkeit und Versammlungsfreiheit, wurden somit auf demokratischem Wege ausgehebelt. Auch die Corona-Pandemie führte zu Notfallplänen, die aus gesundheitlichen Gründen absolut nachvollziehbar waren. Trotzdem nutzten viele Regierungen die Gelegenheit, um die Macht der Exekutiven zu erweitern und demokratische Prinzipien auszuhöhlen. Ein besonders drastisches Beispiel war Ungarn. Viktor Orbán missbrauchte den Ausnahmezustand dazu, die Medienfreiheit in seinem Land noch weiter einzuschränken und die Rechtsstaatlichkeit noch weiter auszuhöhlen.16 Auch demokratische Länder wie Deutschland beschlossen, die innereuropäischen Grenzen zu schließen und somit das Schengener Abkommen unilateral außer Kraft zu setzen. Die Bundesregierung entschied sich auch gegen eine Unterstützung Italiens im schlimmsten Moment der Pandemie. Die EU-Kommission rügte Deutschland dafür, man habe Italien lebenswichtiges medizinisches Material verweigert und somit gegen EU-Recht gehandelt. Diese Verstöße gegen demokratische Grundprinzipien und das EU-Recht zeigen, dass die rechtliche Ordnung in Krisensituationen zunehmend missachtet wird. Dass Krisen zu politischen Ausnahmesituationen führen, ist verständlich; problematisch wird es, wenn der Ausnahmezustand zur Normalität wird.
Für die US-amerikanische Wissenschaftlerin Naomi Klein ist der politische Ausnahmezustand eine »natürliche Verformung des Neoliberalismus«: Mit dem Krisenmanagement werden autoritäre Maßnahmen eingeführt und politisch legitimiert. Als Beispiel nennt sie die Privatisierung des Bildungssystems in New Orleans nach dem Hurrikan Katrina im Jahr 2005. Republikaner*innen nutzten die Gelegenheit, um das öffentliche Schulsystem zu privatisieren – mit den entsprechenden Auswirkungen für die ärmeren Einwohner*innen der Stadt.17 Im Zuge der Umweltkatastrophe und dem daraufhin ausgerufenen Ausnahmezustand wurden ideologisch motivierte Ziele durchgesetzt, die sich wahrscheinlich ohne diesen Ausnahmezustand nicht hätten durchsetzen lassen.18 Dass Ausnahmezustände die Machtverhältnisse deutlich machen, wusste bereits Carl Schmitt, der spätere Staatsrechtler der Nationalsozialisten, als er 1922 schrieb: »Souverän ist, wer über den Ausnahmezustand entscheidet. (…) Der Ausnahmefall offenbart das Wesen der staatlichen Autorität am klarsten. (…) Die Autorität beweist, dass sie, um Recht zu schaffen, nicht Recht zu haben braucht.«19 Schmitt macht damit klar, dass Macht und Recht in einem engen Verhältnis stehen – der bestehende Rechtsrahmen ist ein Ausdruck bestimmter Machtverhältnisse – und das Aussetzen dieser Bestimmungen kann nur durch jene entschieden werden, die Macht besitzen. Ist der Ausnahmezustand eine Rückkehr zum »Naturzustand«, wie von Thomas Hobbes in Leviathan beschrieben? Oder ist der Ausnahmezustand noch Teil der politischen Ordnung? Der italienische Philosoph Giorgio Agamben erklärte Ausnahmezustände als paradoxe Situationen, in denen »rechtliche Vorkehrungen getroffen werden, die auf der Ebene des Rechts nicht begriffen werden können, weil sie die Folge politischer Krisenperioden sind und deshalb auf dem Gebiet der Politik und nicht juristischem oder verfassungsrechtlichem Boden begriffen werden.«20 Fest steht, dass das Krisengeschehen zu Ausnahmezuständen führt, die sich rechtlich in einer Grauzone befinden. Durch diese Ausnahmezustände werden die existierenden Machtverhältnisse verdeutlicht – nur die, die an der Macht sind, können Ausnahmezustände ausrufen.
Was das Interregnum nicht ist
In einem Interregnum werden Grundsätze und Regeln zunehmend in Frage gestellt. Krisen häufen sich, politische Reaktionen bleiben aus; Ausnahmezustände werden zur Norm. Doch die Erosion von Grundsätzen in einem Interregnum führt nicht zwangsläufig zu einem nihilistischen Alptraum, in dem es keine Werte und keine politischen Ideen mehr gibt. Im Gegenteil: Es gibt keine klar dominierende Ideologie mehr, die von der herrschenden Klasse durchgesetzt wird, sondern einen wachsenden Wettbewerb an verschiedenen Ideen. Keine dieser Ideologien kann als »führend« bezeichnet werden. »Das Interregnum ist nicht von einem Mangel an ideologischen Projekten definiert«, so der dänische Wissenschaftler Rune Møller Stahl, »sondern von einer Vielzahl an Projekten, die im Wettbewerb stehen und genügend Unterstützung in der Bevölkerung erhalten, so dass kein hegemonisches Projekt genügend Konsens innerhalb der Elite herstellen kann.«21
Darüber hinaus bedeutet der Verlust einer dominierenden Ideologie nicht, dass sofort neue hegemoniale Verhältnisse entstehen. Es gibt in einem Interregnum keine »konsensfähige Gegenhegemonie«. Beispielsweise wäre kein Staatsstreich möglich, bei dem die neuen Herrscher*innen sofort die Unterstützung einer Mehrheit hätten – die verdutzten Reaktionen auf den geplanten Coup der Reichsbürger*innen im Dezember 2022 waren somit verständlich. Der Mangel an einer »konsensfähigen Gegenhegemonie« birgt allerdings gewisse Risiken, weil, so Gramsci, »das Feld frei ist für die Gewaltlösungen, für die Aktivität obskurer Mächte, repräsentiert durch die Männer der Vorsehung oder mit Charisma.«22 Mit seiner »Rückkehr des starken Mannes« schien Gramsci die Terrorherrschaft der Nationalsozialisten auf unheimliche Weise geahnt zu haben. Auch fast ein Jahrhundert später klingen diese Sätze noch sehr aktuell, wenn man an Herrscher wie Wladimir Putin, Xi Jinping oder Recep Tayyip Erdoğan denkt.
Drittens sind in einem Interregnum nicht alle bisherigen Regeln und Grundsätze plötzlich verschwunden. Zwar wächst die Unsicherheit, doch ein bestimmter Rahmen bleibt weiterhin erhalten. In dieser Zeit beweist sich auch die Resilienz bestimmter Ideen. So sahen Anfang der 2000er-Jahre viele Intellektuelle das Ende des Nationalstaates voraus. Der Politologe Colin Crouch sprach von der »Postdemokratie«; einige wünschten sich die Auflösung der europäischen Nationalstaaten in einem Bundesstaat. Nichts davon ist geschehen – vielmehr hat der Nationalstaat während der letzten Krisen eher noch an Macht hinzugewonnen. Nirgendwo auf der Erde wird das Konzept des Nationalstaats in Frage gestellt, ob in Demokratien oder Autokratien. Diese Tatsache ist unabhängig von der Entwicklung der Handlungsfähigkeit des Staates oder des Zustands des Demokratie als politisches System. Dasselbe gilt für den Kapitalismus: Nach der Weltwirtschaftskrise 2007/2008 wurde konstatiert, dass sich der Kapitalismus in einer Spätphase befinde und bald kollabieren werde. Es stimmt zwar, dass die heutige Ausprägung des Kapitalismus alles andere als nachhaltig ist und maßgeblich zur Klimakatastrophe beiträgt. Trotzdem werden kapitalistische Prinzipien – Profitmaximierung, die Suche nach neuen Absatzmärkten, Kapitalakkumulation – nicht in Frage gestellt. Auch das Patriarchat hat sich als resilientes Unterdrückungssystem herausgestellt, das sich trotz der zahlreichen Krisen und des großen Leids, das es allen Menschen zufügt, hartnäckig hält.
Das Interregnum bringt also keine vollständige Unordnung mit sich. Bestimmte Konzepte der »alten Ordnung« bleiben erhalten, ob Nationalstaat, Kapitalismus oder Patriarchat. Trotzdem gibt es einen größeren Wettbewerb an Ideen und politischen Konzepten. In dieser Transitionsphase ist unklar, welche Ideen, Ordnungen und Konzepte in Zukunft dominieren, welche Ideen an Deutungshoheit gewinnen werden. Daher stellt sich die Frage: Was soll vom »Alten« erhalten bleiben, und was gehört abgeschafft? In den folgenden Kapiteln möchte ich verschiedene Aspekte des Interregnums beleuchten. In Kapitel 2 geht es um die wirtschaftlichen Missstände des Spätkapitalismus. Kapitel 3 beschäftigt sich mit der internationalen Unordnung und dem Ende des Multilateralismus. Kapitel 4 ist dem »kulturellen Interregnum« gewidmet, also dem Kampf um Werte und Ideologien. In Kapitel 5 gehe ich auf die wichtigste aller Krisen ein: die der politischen Ordnung. Die Erosion der Demokratie hat einen besonderen Charakter, denn wenn die Ordnung, die die Probleme lösen soll, selbst nicht mehr funktioniert, stehen wir vor einer systemischen Herausforderung. Ohne funktionierende politische Ordnung werden wir die wichtigen Transformationsprozesse nicht meistern, also keine Antworten auf die zahlreichen anderen Krisen finden können. Diese Krise ist der Grund, warum wir dringend an den Stellschrauben des politischen Systems drehen müssen.
Das führt mich zur Hauptthese meines Buches: Um das Interregnum zu gestalten, statt es bloß über sich ergehen zu lassen, bedarf es einer Rehabilitierung politischer Macht. In Kapitel 6 beschreibe ich das überholte Machtverständnis, das aktuell die politische Landschaft prägt und die Politik handlungsunfähig macht, wie ich in Kapitel 7 darlege. Abschließend stelle ich in Kapitel 8 und 9 neue Ansätze vor, wie sich Macht neu denken lässt.
Kapitel 2
Die morbiden Symptome des Spätkapitalismus
Im November 2022 fand in dem ägyptischen Touristenort Sharm-El-Sheikh die 27. UN-Klimakonferenz (COP27) statt. Wie der Name bereits erahnen lässt, versuchte man dort zum 27. Mal, eine gemeinsame weltweite Antwort auf die Klimakrise zu finden. Vergebens. Der weltweite Kohlenstoff-Ausstoß steigt von Jahr zu Jahr weiter, nur 2020 ging er aufgrund der Pandemie leicht zurück.23 Die Berichte des Weltklimarats werden indessen immer pessimistischer, die Erderwärmung schreitet immer schneller voran, und alle Warnungen vor den drastischeren Konsequenzen der Klimakrise verhallen. Das hinderte aber niemanden daran, Coca-Cola als Hauptsponsor auszusuchen; der größte Plastikverschmutzer der Welt konnte sich so ein klimafreundliches Image geben – ein hervorragendes Beispiel für »Greenwashing«.24 Aber es kommt noch schlimmer: Die bevorstehende COP28 wird der Chef eines der weltweit größten Ölkonzerne, der Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC), leiten. Es ist, als würde man einen Tabakhersteller eine weltweite Anti-Raucher-Kampagne ausrichten lassen.25
Die Rahmenbedingungen der COP-Konferenz sind nur eine der vielen Perversitäten des Spätkapitalismus. Viele ähnliche Phänomene sind, wenn man sie mit ein wenig Abstand betrachtet, geradezu obszön, aber die Bevölkerung hat sich schon so sehr daran gewöhnt, dass sie sie als gegeben hinnimmt. Die Kluft zwischen Arm und Reich beispielsweise ist regelrecht absurd: Während Superreiche mit ihren Privatjets für ein Skiwochenende mit Champagner nach Davos fliegen, betteln in asiatischen Megalopolen Kinder, um an Trinkwasser und eine Mahlzeit zu kommen. Weltweit leben immer noch über 350 Millionen Kinder in Armut.26 Absurd ist auch die Ausbeutung von Menschen insbesondere im globalen Süden, die unser (westliches) wirtschaftliches System stützt. Wir alle haben von den Bränden in Textilfabriken in Bangladesch gehört, die unsere Turnschuhe und T-Shirts produzieren, oder von den Toten in den Kobalt-Minen im Kongo, aus denen Rohstoffe für unsere Handys und E-Autos stammen. Absurd ist die Ausbeutung der natürlichen Ressourcen, auf der unser westlicher Wohlstand aufbaut. Uns ist allen bewusst, dass wir mit fossilen Energien weiter zur Klimakrise beitragen – trotzdem unternehmen wir nichts dagegen. Man braucht sich nur auf Google Bilder von Braunkohle-Tagebaustätten wie Garzweiler, Hambach oder Jänschwalde anzuschauen, um zu verstehen, in was für einen desolaten Zustand wir unseren Planeten gebracht haben. Diese Entwicklung ist pervers, absurd und vor allem: tragisch.
Wir fahren mit dem jetzigen Wirtschaftssystem direkt gegen die Wand. Wir missachten unsere natürlichen Grenzen und setzen dabei jeden Tag die Demokratie und den sozialen Frieden ein bisschen mehr aufs Spiel. Die »morbiden Symptome« des Spätkapitalismus sind uns peinlich bewusst – und das schon seit Langem. Bereits Max Weber erklärte bei seinem USA-Besuch im Jahr 1904: »Alles, was der Kultur des Kapitalismus widerspricht, wird mit unwiderstehlicher Gewalt zerstört.«27 Im Jahr 1968, dem Höhepunkt der Studentenbewegung, erklärte der Philosoph Theodor Adorno bei der Tagung der Frankfurter Schule, dass die ökonomischen Prozesse »die Herrschaft über alle Menschen« einnehmen würden. Damit meinte er den Prozess der Vermarktlichung, in der die Logik des Marktes und des Wettbewerbs auf andere Bereiche angewendet wird. »Dinge, Dienste oder Ereignisse, die zuvor unentgeltlich zirkulierten, müssen nun vom Kunden käuflich erworben werden und den Regeln der Gewinnmaximierung und Kostenreduktion folgen.«28 Adorno sah die Kommodifizierung weiterer Lebensbereiche voraus, beispielsweise unserer Aufmerksamkeit und Privatsphäre durch die digitale Wirtschaft. Seit den 1970er-Jahren steht fest, dass grenzenloses Wachstum und die Ausbeutung von natürlichen Ressourcen nicht nachhaltig sind. Ein Jahr vor der Ölkrise 1973