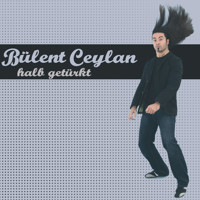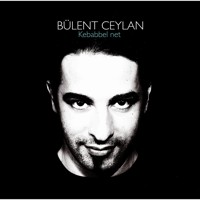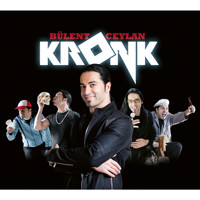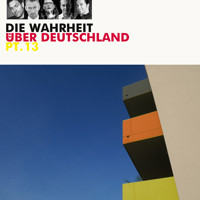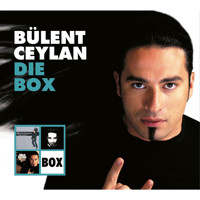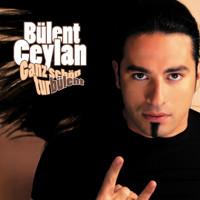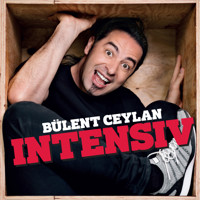12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2021
Ausverkaufte Stadien, große Talkshow-Auftritte, The Masked Singer und Duett mit Helene Fischer - Megastar Bülent Ceylan hat alles erreicht, dennoch ist er sich und seinen Wurzeln treu geblieben. Herzlich, ehrlich, persönlich: In seinem Buch spricht Bülent Ceylan erstmals über das, wofür auf der Comedy-Bühne kein Raum ist. Er heißt Tschäilan. Kann aber kein Türkisch. Monnemer Dialekt und Cordhosen. Das alles ist doch irgendwie eine Bankrotterklärung. »Nenn dich lieber Billy«, raten die Geschwister. Doch Bülent Ceylan entdeckt als Kind ein Talent. Er kann Stimmen imitieren und damit Leute zum Lachen bringen. Die Wirkung ist verblüffend: Witze lenken von den Geldsorgen seines Vaters ab, Witze zaubern seinen deutschen Mitschülern ebenso wie seiner bedrückten Mutter ein Lächeln ins Gesicht. Also erzählt der Junge mit dem rabenschwarzen Prinzessinnenhaar Gags, als ginge es um sein Leben. 2009 füllt Bülent Ceylan zum ersten Mal die SAP Arena. 10.000 Zuschauer, der Erfolg ist da. Zum ersten Mal erzählt der Comedian nun von seinem Aufwachsen, spricht über die Bedeutung von Vielfalt und Identität, Heimat und den Wert der Familie - entwaffnend ehrlich, mit Herz, Humor und Tiefgang. Wer behauptet, der Weg ist das Ziel, weiß nicht, wie wichtig Ankommen ist!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 249
Ähnliche
Bülent Ceylan
Ankommen
Aber wo war ich eigentlich?
Über dieses Buch
Wer behauptet, der Weg ist das Ziel, weiß nicht, wie wichtig ankommen ist!
Er heißt Tschäilan. Kann aber kein Wort Türkisch. Monnemer Dialekt und Cordhosen. Das alles ist doch eine Bankrotterklärung. »Nenn dich lieber Billy,« raten die Geschwister. Doch Bülent Ceylan entdeckt als Kind ein Talent. Er kann Stimmen parodieren und damit Leute zum Lachen bringen. Die Wirkung ist verblüffend: Witze lenken von den Geldsorgen seines Vaters ab, Witze zaubern seinen deutschen Mitschülern ebenso wie seiner bedrückten Mutter ein Lächeln ins Gesicht. Also erzählt der Junge mit dem rabenschwarzen Prinzessinnenhaar Gags, als ginge es um sein Leben. 2009 füllt Bülent Ceylan zum ersten Mal die SAP Arena. 10.000 Zuschauer, der Erfolg ist da. Und doch liegt vor ihm noch ein langer Weg … bis er fühlt, angekommen zu sein.
Zum ersten Mal erzählt der Comedian nun von seinem Aufwachsen, spricht über die Bedeutung von Vielfalt und Identität, Heimat und den Wert der Familie - entwaffnend ehrlich, mit Herz, Humor und Tiefgang.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Biografie
Über Bülent Ceylan und Astrid Herbold
Bülent Ceylan wurde 1976 als Sohn einer deutschen Mutter und eines türkischen Vaters in Mannheim geboren. Die Lebensverhältnisse waren einfach, aber Liebe, Geborgenheit und Unterstützung waren unerschöpflich. Bis heute ist Familie daher das Wichtigste in Bülent Ceylans Leben. Gemäß dem Motto “Ohne Kinder geht nix” engagiert er sich mit seiner Stiftung “Bülent Ceylan für Kinder” und als Botschafter diverser Hilfsorganisationen für Familien. Bülent Ceylan spricht kein Türkisch und der Mannheimer Dialekt ist für ihn nicht nur ein Markenzeichen, sondern ultimativer Integrationsbeweis. Mehr Toleranz und ein stärkeres gesellschaftliches Miteinander sind ihm zentrale Anliegen.
Astrid Herbold ist Autorin und freie Journalistin (u.a. Der Tagesspiegel und Die Zeit). Die Zusammenarbeit mit Bülent Ceylan weckte bei ihr viele Kindheitserinnerungen: Ihre Eltern und Großeltern kommen nämlich ebenfalls aus Mannheim. Sie selbst ist im Ruhrgebiet aufgewachsen und spricht leider kein Kurpfälzisch.
Meiner Familie
Vorbemerkung: Uffbasse! Alle hier geschilderten Ereignisse habe ich so erlebt, die Schilderung basiert aber auf meinen subjektiven Erinnerungen. Die Dialoge sind nicht wörtlich, sondern nach meiner Wahrnehmung sinngemäß wiedergegeben. Manche Personen aus meiner Kindheit und Jugend habe ich aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes anonymisiert.
1Patchwork auf 68 Quadratmetern
Meine Frau reißt zu Hause ständig die Fenster auf, sie mag frische Luft und kann es nicht leiden, wenn es »nach gestern riecht«, wie sie sagt. Ich mache Fenster lieber zu, mir zieht es schnell. Das habe ich von meinem Vater, Ahmet Turan Ceylan, von Beruf Betonmischer-Fahrer. Er konnte es im Wohnzimmer spüren, wenn im Bad das Fenster auch nur einen Spalt gekippt war. Wobei ich dazu sagen muss, dass unser Bad und unser Wohnzimmer nicht sehr weit auseinanderlagen. 68 Quadratmeter groß war die Etagenwohnung im Mannheimer Stadtteil Waldhof, in der ich mit meinen Eltern und meinen drei älteren Geschwistern lebte. Zu sechst wohnten wir dort allerdings nicht lange; meine zwei größeren Geschwister Angela und Fritz zogen schon bald nach meiner Geburt aus – der Altersunterschied zwischen mir und meiner ältesten Schwester beträgt 16 Jahre.
Jedenfalls konnte mein Vater feinste Luftzüge immer und überall spüren. »Ich merk’s am Nacken«, klagte er. Merkwürdig: Er war einerseits total empfindlich, andererseits hart im Nehmen. Er arbeitete viele Stunden täglich schwer, sorgte finanziell für unsere Großfamilie, wurde nie krank. Wenn ihn doch mal ein grippaler Infekt erwischte, legte er sich einen Tag lang ins Bett. »Frau, hol Decken!«, rief er meiner Mutter matt zu. Dann schwitzte er unter dem Deckenberg, bis ihm die Brühe runterlief. Am nächsten Morgen stand er wieder auf. »Ich geh’ jetzt arbeiten.«
Das war mein Vater.
Einmal im Jahr legte er in einem Topf Gemüse ein, das kannte er als Ritual aus dem türkischen Internat, das er in den 1950er Jahren besucht hatte. Vielleicht machte er irgendwas falsch, jedenfalls schwamm oben drauf bald eine dicke Schimmelschicht. Meine Mutter fand das so eklig, dass mein Vater seine undefinierbare Pampe nur im Keller aufbewahren durfte. Ab und zu ging er runter, schob den Schimmel zur Seite und holte sich eine Portion von dem labbrigen Gemüse.
»Ich esse das jetzt.«
»Nein, das wird nicht gegessen!«, protestierte meine Mutter.
»Doch, das härtet ab!«
Und dann schaufelte er das Zeug tapfer in sich hinein. Ansonsten pflegte er lustigerweise vor allem typisch deutsche Männerhobbys: In seiner Freizeit ging mein Vater kegeln oder spielte Skat, selbstverständlich als ordentliches Vereinsmitglied. Ich durfte als Kind oft mitkegeln, manchmal fuhr ich sogar mit auf Kegelclubreisen. Zwar machten mich die langen Männerabende als kleiner Junge ziemlich müde, aber ich mochte die besondere Atmosphäre. Das Fachsimpeln nach dem Spiel über gelungene und weniger gelungene Würfe, diese lauten, gutgelaunten Runden.
Alle anderen Männer im Verein waren Deutsche. Nur mein Vater war Türke. Er wurde von allen Turan genannt, vielleicht klang sein zweiter Vorname in den deutschen Ohren besser als Ahmet. Mein Zweitname ist ebenfalls Turan. Die dunklen Augen und die schwarzen Haare habe ich allerdings von meiner Mutter geerbt, mein Vater war hellhäutig und blauäugig. Das nur nebenbei, Stichwort Schubladendenken.
Mein Vater hat sich über solche Zuschreibungen Zeit seines Lebens wenig Gedanken gemacht. Er fühlte sich von seinen Freunden akzeptiert, hatte – so erinnere ich es jedenfalls – nie das Gefühl, dass es in seinem Umfeld ihm gegenüber rassistische Vorurteile gab. Turan sprach ganz gut Deutsch, wenn auch teilweise grammatisch fehlerhaft und mit Akzent. Auch die Artikel machten ihm gelegentlich zu schaffen. Trotzdem fiel es Fremden manchmal erst nach einigen Sätzen auf, dass er kein Muttersprachler war. Deutschland war wirklich seine Heimat geworden, und oft hat mein Vater gesagt, er könne sich nicht mehr vorstellen, in der Türkei zu leben. Von seinem Geburtsland hatte er sich über die Jahrzehnte innerlich immer weiter entfernt. Trotzdem liebte er die Traditionen, die Musik, das Essen. Meine Mutter kochte ihm zuliebe regelmäßig türkische Gerichte. Aber natürlich gab es in Hildes Küche auch weiterhin Nudeln und Sonntagsbraten.
Meine Geschwister Angela und Fritz waren schon Teenager, meine Schwester Anya war vier Jahre alt, als der neue türkische Mann zur Familie dazustieß. Meine Mutter war da bereits von ihrem ersten Mann geschieden und schon eine Weile alleinerziehend. Dass eine solche Konstellation anfangs nicht einfach ist, kann man sich denken. Ein neuer Partner ist für Kinder immer schwer. Manche Ansichten meines Vaters gefielen meinen Geschwistern nicht; vor allem meine große Schwester war häufig anderer Meinung als ihr neuer Stiefvater. Außerdem war mein Vater streng, oft zu streng. Er wollte meine Mutter im Alltag entlasten und ihr helfend zur Seite stehen. Dazu gehörte für ihn, den Kindern klare Ansagen zu machen. Aus heutiger Sicht verstehen meine Geschwister seine Motive, damals war der familiäre Krach vorprogrammiert.
Ich kenne diese erste Zeit nach dem Kennenlernen und der Heirat meiner Eltern nur aus Erzählungen, aber ich ahne, wie schwierig die Patchwork-Familiengründung war. Manchmal hat meine Mutter mit meinem Vater geschimpft: Ihr gefiel nicht, wie er mit den Kindern umging. Er wiederum kannte aus seinem Elternhaus nur einen Erziehungsstil – und der war autoritär. Trotzdem schlossen meine Geschwister meinen Vater bald in ihr Herz. Aber ohne Reibungen verlief unser Familienleben nicht.
Wie aus dem Bilderbuch war allerdings die Liebe meiner älteren Geschwister zu mir, dem Nachzügler. Das konnte ich von Anfang an spüren. Nie haben sie mich als einen Störenfried oder Fremdkörper in ihrer bisherigen Familie betrachtet – obwohl es von außen offensichtlich war, dass hier etwas zusammengewürfelt worden war. Meine Mutter hatte mit der Hochzeit den Namen meines Vaters, Ceylan, angenommen; meine älteren Geschwister behielten den Nachnamen ihres leiblichen Vaters. Ich hatte insofern einen anderen Vater, ich sah anders aus, und ich trug zwei türkische Vor- und einen türkischen Nachnamen. Das Wort »Halbbruder« wäre Angela, Fritz und Anya dennoch nie über die Lippen gekommen. Umgekehrt würde ich nie von meinen »Halbgeschwistern« sprechen, ich hasse dieses Wort regelrecht. Wir sind Geschwister, wir lieben uns – mehr gibt es für mich dazu nicht zu sagen. Das gilt übrigens auch für meinen Bruder Hasan, den Sohn meines Vaters aus einer früheren Beziehung. Zwar lebt er in der Türkei und unser Kontakt war leider nie sehr eng, aber für mich ist es selbstverständlich, dass er zur Familie gehört und ich immer für ihn da bin, wenn er meine Hilfe braucht.
Vor allem mit Anya, mit der ich noch lange zusammen bei meinen Eltern lebte, verband mich schon als Kind eine enge Bindung. Anya hat – wie auch Angela – oft auf mich aufgepasst, mit mir gespielt, mich umsorgt. Manchmal hat sie sogar ihr letztes Taschengeld für mich ausgegeben. Einmal wollte ich unbedingt einen Teddybär mit einem kleinen Elektromotor im Bauch haben, der sich so lustig bewegen konnte. Wie der Duracell-Hase, den ich aus der Werbung kannte. Sie plünderte wortlos ihre Spardose, nahm ihre letzten 20 Mark und kaufte mir diesen Bär. Ein anderes Mal nahm sie mich an der Hand, fuhr mit mir mit der Straßenbahn in die Mannheimer Innenstadt: erst ins Kino, dann zu McDonald’s! In dieser Kombination für mich als Kind der denkbar tollste Tagesausflug.
Selbst als Teenager hat sie sich oft Zeit genommen für ihren sechs Jahre jüngeren Bruder, auch wenn sie vielleicht lieber mit ihren Freundinnen weggegangen wäre. Als wir beide längst erwachsen waren, habe ich sie gefragt, warum sie damals so fürsorglich war. Ihre Antwort hat mich sehr berührt. Sie sagte, sie habe mir die Aufmerksamkeit geben wollen, die ihr selbst manchmal gefehlt hatte. Als Anya ein Kleinkind war, steckte meiner Mutter in einer anstrengenden und emotional aufreibenden Scheidung, danach musste sie sich erst einmal neu sortieren und war mit sich beschäftigt. Auch für meinen Bruder Fritz war das keine einfache Zeit, er bekam Probleme in der Schule, war beim Lernen innerlich wie blockiert. Meiner Mutter ging es in dieser Phase natürlich auch nicht gut. Sie hatte während der Trennungsphase mit ihrem schlechten Gewissen zu kämpfen, denn eigentlich wollte sie ihre Familie als gute Katholikin unbedingt zusammenhalten. Es fiel ihr nicht leicht, ihre erste Ehe zu beenden, auch als die Beziehung schon längst zerrüttet war.
Und nun der neue Mann – und noch ein Kind.
Als ich 1976 geboren wurde, war mein Vater unglaublich stolz, er platzte fast. Er hätte gern noch mehr Nachwuchs gehabt, aber meine Mutter schüttelte den Kopf. »Vier reiche’.« Zumal ich bei der Geburt kein Leichtgewicht war: 57 Zentimeter und viereinhalb Kilo, ein wahrer Wonneproppen. Anfangs schlief ich im Schlafzimmer meiner Eltern. Wo auch sonst? Im kleinen und vollgestellten Kinderzimmer standen schon das Doppelstockbett für die beiden Mädchen und das Einzelbett meines Bruders, mehr passte beim besten Willen nicht hinein. Ansonsten gab es noch das Wohnzimmer, einen Balkon, den mein Vater vor allem zum Rauchen nutzte, und eine kleine Küche. Platz zum Spielen war eigentlich nirgendwo.
Ich erinnere mich, dass ich später häufig auf meinem Bett saß (nachdem Angela und Fritz erwachsen waren, zog ich ins Kinderzimmer um) und auf meiner Bettdecke mit meinen Figuren oder Autos spielte. Ich blieb gern für mich alleine und konnte mich stundenlang selbst beschäftigen. Oft war ich in innere Monologe vertieft, in komplizierte Geschichten und Handlungen, die ich mir ausgedacht hatte. Wenn jemand die Zimmertür öffnete, fühlte ich mich gestört. Vor allem, wenn meine Mutter den Kopf reinstreckte: »Bülent, komm essen!«
»Nein, ich will weiterspielen!«
Schon damals war ich also ein ziemlich guter Alleinunterhalter, wenn man den Ausdruck mal wörtlich nimmt.
Bei Tisch und auch sonst im Familienalltag wurde nur Deutsch gesprochen. Das ist auch der Grund, warum ich, bis auf ein paar Brocken, nie richtig Türkisch gelernt habe. Bei meinen Autogrammstunden später gab es manchmal türkische Fans, die das gar nicht glauben konnten, die geradezu entsetzt und enttäuscht waren: »Was? Du kannst kein Türkisch?« Zwar unternahm mein Vater ein paar halbherzige Versuche, mir Wörter und Sätze in seiner Muttersprache beizubringen, aber das war von wenig Erfolg gekrönt. Wann hätten wir uns auch länger unterhalten sollen? Er stand auf, wenn ich noch schlief, und kam von der Arbeit, wenn ich schon wieder im Bett lag. Mit Hilde sprach Turan Deutsch, genauso wie mit allen anderen Menschen um ihn herum. Dem Klang der türkischen Sprache war ich selten ausgesetzt.
Zum Problem wurde meine fehlende Zweisprachigkeit allerdings, wenn die türkische Verwandtschaft, Tanten, Onkel, Cousinen und Cousins, aus Wuppertal zu Besuch kam. »Warum versteht der Junge denn immer noch nichts?« Bei jedem Besuch war das ein Reizthema. Mit mir schimpfte niemand, aber mein Vater musste sich von seiner Schwester viele Vorwürfe anhören. »Du bist schuld, dass der Junge unsere Sprache nicht lernt!« Nicht selten eskalierten diese Diskussionen, es wurde laut und ungemütlich.
Ich war noch ein Kindergartenkind, da schlug meine Tante meinen Eltern eines Tages vor, dass ich für einige Monate nach Wuppertal kommen und bei ihnen leben sollte, um endlich Türkisch zu lernen. Aber da hatte sie die Rechnung ohne meine Mutter gemacht. »Nix – ich geb’ kei’ Kind her!« Hilde war nicht gewillt, über solche pädagogischen Experimente auch nur nachzudenken. Dass sie damit Gefahr lief, Turans Familie vor den Kopf zu stoßen und den Konflikt weiter anzuheizen, nahm sie in Kauf. Denn sofort wurde mein Vater wieder mit Vorhaltungen überschüttet: »Siehst du, das hast du davon, dass du eine Deutsche geheiratet hast!« Woraufhin mein Vater, der nie etwas auf meine Mutter hätte kommen lassen, sofort zurückpolterte: »Ihr haltet jetzt alle die Gosch! Sonst könnt ihr sofort wieder nach Hause fahren!«
Diese Streits wurden natürlich auf Türkisch geführt, ich habe das jetzt mal frei übersetzt. Als Kind merkte ich nur, es ist wieder so weit, es wird geschrien, wild gestikuliert, und alle sind sauer aufeinander. Schrecklich, ich hasste das. Zumal wir uns in der kleinen Wohnung mit so vielen Menschen nicht gut aus dem Weg gehen konnten.
Dennoch, und das halte ich allen Beteiligten nachträglich zugute, gab es nie ernsthafte Zerwürfnisse. Man warf sich Sprüche an den Kopf, aber man vertrug sich auch schnell wieder. Letztlich akzeptierte die türkische Verwandtschaft, dass es in Turans Leben nun eine deutsche Frau gab. Und was alle verband und woran es überhaupt keinen Zweifel gab: dass ich, der kleine Bülent, das von allen heiß und innig geliebte Nesthäkchen war.
Für meine Mutter waren diese Besuche der Verwandtschaft auch noch aus einem anderen Grund anstrengend. Denn natürlich wurde erwartet, dass Hilde alle von morgens bis abends bekocht. Grundsätzlich machte das meiner gastfreundlichen Mutter nichts aus, nur manchmal wurde es ihr doch zu viel. Zum Beispiel weigerte sie sich, spät am Abend noch ein großes Mahl aufzutischen. »Nach 20 Uhr gibt’s bei uns nix Warmes mehr«, beharrte sie, ganz die Deutsche. Was, nichts Warmes, warum denn nicht? Die türkische Verwandtschaft schaute pikiert. Mein Vater versuchte, seine Frau zu überreden: »Geh, jetzt koch halt, auf!«
»Ich geb dir gleich: ›jetzt koch halt‹ – kannscht selber koche!«, gab meine Mutter grimmig zurück.
Mein Vater war an solchen Abenden sichtlich im Zwiespalt. Einerseits wollte er seine Frau nicht herumkommandieren, das hätte die sich auch gar nicht gefallen lassen, andererseits wollte er vor der türkischen Verwandtschaft als Hausherr gut dastehen. Normalerweise war es bei uns zu Hause eher so, dass Turan machte, was Hilde ihm auftrug – nicht umgekehrt. Aber vor Publikum wollte er lieber in die Rolle des Machos schlüpfen. Meine Mutter bemerkte das und schmierte es ihm regelmäßig aufs Brot: »Du denkst wohl, du musst hier den starken Mann raushängen lassen, wenn deine Familie da ist. Aber das kannst du dir gleich wieder abgewöhnen.« Und genauso war es: Am Ende hat Turan sogar die Weihnachtsbäume für Hilde gefällt und nach Hause getragen.
Immer wieder gab es Zusammenstöße, wenn die Wuppertaler uns besuchten oder wir bei ihnen waren. Manche Anekdoten habe ich später in meine Bühnenprogramme eingebaut. Auch diese hier: Meine Mutter schwärmte damals für kitschige Gemälde von spanischen Flamenco-Tänzerinnen mit wallendem Rock und schwarzem Haar. Mein Vater ging zum Flohmarkt und kam kurze Zeit später tatsächlich mit einem riesigen Ölgemälde wieder. Ein liegender weiblicher Akt. »Ich wollte doch eine Flamenco-Tänzerin«, beklagte sich meine Mutter. »Das ist eine Tänzerin, aber eben eine nackige«, meinte mein Vater. »Außerdem war das Bild teuer.« Meine Mutter zuckte mit den Schultern, sie wollte auch nicht undankbar wirken, und so wurde der Schinken übers Ehebett gehängt.
Das nächste Mal, als die älteste Schwester meines Vaters – eine strenggläubige Muslimin – mit ihrer Familie zu Besuch kam, boten meine Eltern den Gästen wie immer das beste Zimmer, das Schlafzimmer, an. An das Bild dachte niemand. Aber nachdem die Wuppertaler abgereist waren, entdeckten wir, dass die Nackte nun nicht mehr nackt war. Meine Tante hatte das Motiv kurzerhand mit mehreren Handtüchern verhüllt. »Jetzt trägt das Bild eine Burka«, kommentierte mein Vater lakonisch.
Gegenseitige Toleranz war immer wieder von allen Beteiligten gefordert. Einmal waren wir in Wuppertal zu Besuch. Schon zum Frühstück bog sich der Esstisch, es gab Wurst, Hähnchen, Eier, eingelegtes Gemüse und vieles mehr. Ratlos saß ich vor dieser überbordenden Fülle.
»Ich mag das alles nicht. Ich will ein Marmeladenbrot.«
Meine Cousins starrten mich ungläubig an. Meine Tante schimpfte sofort wieder auf meinen Vater ein: »Dein Sohn isst noch nicht mal türkisches Essen?!« Die Stimmung sank schon auf den Nullpunkt, bevor der Tag richtig angefangen hatte. Meine Tante, das muss man dazusagen, hatte den Ruf einer Diktatorin; mit ihr war nicht zu spaßen. Sie war ohne Zweifel das eigentliche Familienoberhaupt. (Ich hoffe, liebe Tante, du nimmst mir das nicht übel, falls du diese Zeilen liest.) Ende vom Lied: Meine Tante stand dann tatsächlich auf, ging in die Küche und schmierte für ihren Neffen genau so ein Marmeladenbrot, wie dieser es sich wünschte.
Mittlerweile ist sie über 90 Jahre alt und lebt wieder in der Türkei. Aber eine denkwürdige Begegnung mit meiner Tante hatte ich noch: Ich war bereits ein erwachsener Mann und hatte meine damalige Freundin zu einem Familientreffen mitgebracht. Vor den Augen aller berührte ich ihre Hand. Meine Tante fand die Geste unangemessen. Durch die Blume gab sie mir zu verstehen, dass ich das lassen sollte. Mein Vater bemerkte den aufkommenden Zwist und guckte mich ganz erschreckt an: Oje, wer flippt jetzt zuerst aus, Bülent oder sie? Ich erhob meine Stimme, so dass alle mich hören konnten, aber sprach – entgegen den familiären Gewohnheiten – diesmal ganz ruhig und sachlich:
»Hör mir zu, Tante: Wenn du sagst, bring mir einen Kaffee, dann bringe ich dir einen Kaffee. Wenn du sagst, wasch mir die Füße, dann wasche ich dir die Füße. Wenn du sagst, mach dieses oder jenes für mich, dann mache ich das. Ich gebe dir jederzeit den Respekt, den du verdienst. Aber – du hast mir nicht zu sagen, ob ich die Hand meiner Freundin halten darf. Wenn du darauf bestehst, dass ich sie in deiner Gegenwart nicht berühre, dann gehe ich jetzt sofort aus deinem Haus, und du wirst mich nicht mehr wiedersehen. Wir leben im 21. Jahrhundert, und auch du musst akzeptieren, dass die Zeiten sich geändert haben.«
Danach war absolute Ruhe im Raum.
Irgendwann machte meine Tante einen Laut. »Mmgrhhh.« Halb Knurren, halb Stöhnen. »Du bist genau wie dein Vater – also gut, mach doch, was du willst!« Damit war die Sache für sie erledigt. Später kamen meine Cousins zu mir und hauten mir anerkennend auf die Schulter: »Dass du dich das getraut hast! Du bist der Erste, der je so mit ihr geredet hat – dabei bist du einer der Jüngsten in der ganzen Familie.«
Danach gab es nie wieder Streit zwischen ihr und mir. Irgendwie hatte ich mir mit dieser Aktion Respekt verschafft.
2»Ihr solltet ihn Bülent nennen«
1938 wird mein Vater in einem Dorf in der Nähe der türkischen Stadt Sivas geboren. Er ist das jüngste von vier Kindern von Sıdıka und Hasan Ceylan, meinen Großeltern. 1958, 20 Jahre später, erreicht er Frankfurt am Main. Überstürzt ist Turan aus seiner Heimat geflohen. Nun muss er zuerst einmal die Sprache des fremden Landes lernen. Und zwar auf eigene Faust – staatlich organisierte Sprach- und Integrationskurse gibt es nicht.
»Ich war der erste Türke in Deutschland«, hat mein Vater später oft behauptet.
»Woher willst du das wissen?«, haben wir ihn gefragt.
»Ich habe jedenfalls keine anderen Türken an der Grenzkontrolle gesehen«, meinte er bloß und hat gelacht.
Ein Funke Wahrheit steckt in dem Witz, denn die Zeit der Gastarbeiteranwerbung der Bundesrepublik Deutschland in der Türkei begann erst 1960.
Mein Vater war ein kluger Kopf, er schrieb ein Buch und Gedichte und hatte einen höheren Schulabschluss. Aber wie viele Einwanderer konnte er sein Potenzial nie richtig ausschöpfen. »Einmal im Monat mussten wir Hundefleisch essen«, so arm seien sie gewesen, erzählte er oft. Ich buche das als väterliche Übertreibung ab, wahrscheinlich war es doch eher Ziege, aber er wollte mir vermitteln, wie schwer sein früheres Leben gewesen war. Dennoch verließ er sein Land nicht aus wirtschaftlichen, sondern aus politischen Gründen. Er kam, weil er als junger Mensch ein überzeugter Linker war. Er hatte mit 19 Jahren ein Buch geschrieben, auf dessen erster Seite in den Anfangsbuchstaben der Zeilen der Satz versteckt war: »Ich bin ein Kommunist.« Er sei aber kein Anhänger der Sowjetunion gewesen, schon gar kein Stalin-Fan, und auch kein Freund der DDR. Er interessierte sich nicht für den real existierenden Sozialismus, sondern für die philosophischen Ideen dahinter, erklärte er mir. In seinen Worten klang das so: »Ich glaube, dass jeder Mensch wichtig ist und dass alle Menschen gleich behandelt werden sollten.«
Als wir diese Unterhaltungen in den frühen 1990er Jahren führten, war ich ein Teenager und seine jugendliche Begeisterung für Karl Marx konnte ich nur schwer nachvollziehen. Mit Kommunismus oder Sozialismus assoziierte ich den zerfallenen Ostblock, die ehemalige Sowjetunion und andere kürzlich gestürzte Diktaturen. Er versuchte mir daraufhin darzulegen, welche Umstände ihn in seiner Jugend geprägt hatten: In der Türkei der 1950er Jahre regierte – mit zunehmend autoritärem Stil – die rechtsgerichtete »Demokratische Partei«, die immer härter gegen Kritiker und Andersdenkende vorging. Auch Turan war in ihren Fokus geraten. Doch einer seiner Freunde, ein junger Polizist, warnte ihn rechtzeitig: »Pass auf, es wäre gut, wenn du heute Nacht fliehst.« Der Ernst der Situation war meinem Vater damals sofort klar. Er wäre sonst vermutlich binnen Stunden verhaftet worden.
Mit großer Sorge hat Turan später den Aufstieg von Recep Tayyip Erdoğan und der AKP verfolgt. »Das ist der Untergang der Türkei«, sagte er immer. Damals nahm niemand von uns seine Worte ernst; Erdoğan galt in seinen ersten Jahren als türkischer Ministerpräsident als Hoffnung des Westens, sogar Beitrittsverhandlungen mit der Europäischen Union wurden eröffnet. Mein Vater blieb dennoch misstrauisch: »Ihr werdet schon sehen«, unkte er.
Bei der Flucht 1958 war mein damals zwanzigjähriger Vater noch von seinem Vater bis nach Deutschland begleitet worden. Eigentlich sollte Turan dann von Europa weiter nach Kanada fliegen, doch das teure interkontinentale Ticket konnte sich die Familie nicht leisten. In Frankfurt trennten sich daher die Wege; mein Großvater kehrte zurück in die Türkei, mein Vater blieb. Diesen Abschied stelle ich mir unglaublich schwer vor. Ob Vater und Sohn sich jemals wieder begegnen würden, war völlig unklar. (Sie sahen sich tatsächlich nie wieder.) Auch ahnten beide nicht, wie schwer der Neuanfang werden würde. Erst mal musste Turan einen Job finden und eine Unterkunft. Der Plan, Geld zu sparen und weiter nach Kanada auszuwandern, rückte in weite Ferne.
Denn schnell merkte mein Vater, dass im Wirtschaftswunderland Deutschland Arbeiter dringend gebraucht wurden – vor allem solche, die körperlich schuften konnten. Und das konnte er. Mit der Zeit habe er sich außerdem wohlgefühlt in der neuen Umgebung, erzählte er. In Mannheim wurde er heimisch. Trotzdem hegte er noch lange die Hoffnung, wenigstens für kurze Besuche zurück in die Türkei reisen und seine Eltern und Geschwister besuchen zu dürfen. Doch es blieb unmöglich; fast zwei Jahrzehnte lang waren die Verbindungen zu Familie und Heimat – bis auf seltene, kurze Telefonate – gekappt.
Erst als meine Eltern 1975 heirateten und meine Mutter kurze Zeit später mit mir schwanger war (genauer gesagt war sie am Tag der Trauung schon schwanger, ich bin ein typisches Siebenmonatskind), hatte sich die Lage unter dem sozialdemokratischen Ministerpräsidenten Bülent Ecevit leicht entspannt. Ecevit machte es möglich, dass ehemalige politische Flüchtlinge wie mein Vater wieder in die Türkei einreisen konnten. Für meinen Vater war das von großer Bedeutung. Ein Freund der Familie, wir nannten ihn alle Onkel Osman, sagte deshalb zu meinen Eltern: »Wenn es ein Junge wird, solltet ihr ihn zum Dank Bülent nennen.«
Das taten sie dann auch.
Doch zunächst ging es für meine Eltern auf Hochzeitsreise – nach Istanbul! Mein Vater betrat seit 17 Jahren zum ersten Mal wieder den Boden seiner Heimat; meine Mutter hatte überhaupt noch nie eine so weite Auslandsreise gemacht. »Ich war so glücklich in diesem Urlaub«, hat sie später oft zu mir gesagt. Ich kann mir das gut vorstellen: Sie hatte eine unglückliche Ehe und eine schlimme Scheidung hinter sich. Nun war da der neue Mann in ihrem Leben, der ihr buchstäblich seine Welt zu Füßen legte. Bald würde sie ihr viertes Kind bekommen. Und das alles gepaart mit einer aufregenden Reise in ein wunderschönes Land.
Einziger Wermutstropfen: Die frisch vermählte Braut konnte ihre neue türkische Familie nicht kennenlernen. Der Vater meines Vaters war ohnehin bereits gestorben, aber die Mutter lebte noch, war allerdings schon sehr alt und nicht mehr mobil. Meine Eltern wiederum scheuten den Weg ins Heimatdorf meines Vaters, das rund tausend Kilometer von Istanbul entfernt liegt. Lieber blieben sie in der touristischen Küstenregion, dort fühlten sie sich sicher. Wie wären sie im dörflichen Hinterland empfangen worden? Vielleicht hätten einige Nachbarn nicht so freudig auf die Rückkehr des Geflüchteten reagiert. Mein Vater wollte jedenfalls weder meine Mutter noch sich selbst unnötig in Gefahr bringen. Und so gab es keine Familienzusammenführung.
Ich bin sicher, dass ihm das einen Stich ins Herz versetzt hat. Denn er hatte nun, mit Ende 30, endlich die Liebe seines Lebens gefunden. Sicher hätte er sie gern seiner Mutter und seinen Geschwistern vorgestellt – diese wunderschöne deutsche Frau mit ihrem strahlenden Lächeln und ihrem großen Herzen.
Meine Mutter ist wirklich, ich übertreibe nicht, ein Engel. Jeder, der sie trifft, spürt das. Turan muss es schon vor ihrem Kennenlernen aus der Ferne geahnt haben. So fängt sie nämlich an, die Liebesgeschichte meiner Eltern:
Es ist ein Sonntagnachmittag, als es auf dem Waldhof an Hildes Wohnungstür klingelt. Komisch, sie erwartet doch niemanden. Sie öffnet – und wundert sich noch mehr. Da steht Turan, ein Freund ihres Exschwagers. Er arbeitet wie der Schwager als Fahrer für eine Brauerei, beide fahren dort die Bierfässer aus. Hilde kennt ihn nur flüchtig. Was will er? Mit leicht verlegenem Blick schaut er sie an und dreht die Blumen in seinen Händen.
»Für Sie«, sagt er und streckt Hilde den Strauß entgegen. Eine Flasche Wein hat er auch unterm Arm.
»Ja, ähm, dann kommen Sie doch herein«, sagt Hilde, ihre Verblüffung überspielend.
»Sind Sie allein?«, fragt Turan.
»Nein.«
Wie so oft am Wochenende hat Hilde ihre Mutter zu Besuch. Die drei Kinder sind heute ausnahmsweise beim Vater, Hildes geschiedenem Mann.
Nun sitzen sie zu dritt in der kleinen Küche zusammen, haben erst einen Kaffee getrunken und dann den Wein aufgemacht. Meine Mutter sagt, sie hätte gleich gespürt, dass da was ist. Sie erzählt ihm von ihren Kindern, ihrer Scheidung. Er hört ihr zu.
Ab jetzt wird Turan Hilde regelmäßig besuchen, sie werden sich auch Briefe schreiben. Sie ist anfangs zurückhaltend. Noch zwei Jahre lang leben sie in getrennten Wohnungen. »Ich wollte ihn erst besser kennenlernen, schauen, ob ich mit ihm auskomme«, erinnert sich meine Mutter. Doch Turan lässt nicht locker – denn sein Herz steht längst in Flammen. Für ihn heißt es: Hilde oder keine. (Ohne zu viel zu spoilern: Mit meiner großen Liebe, meiner Frau Radine, wird es mir ganz ähnlich ergehen. Aber davon später mehr.)
Hilde hat übrigens keinerlei Vorbehalte gegen Turans Nationalität oder seine Religion, sie will sich einfach sicher sein, dass es diesmal der Richtige ist. »Dass er Türke ist und ich Deutsche, darüber habe ich gar nicht nachgedacht, solche Kategorien haben mich nicht interessiert.« Dass die Leute tuscheln, weil Turan Moslem ist, bemerkt sie natürlich trotzdem. Sie ignoriert es.
Umgekehrt spielt es für Turan keine Rolle, dass Hilde eine geschiedene Frau mit drei Kindern ist. »Deine Mutter hätte schon tausend Kinder haben können, ich hätte sie trotzdem heiraten wollen.« Für diesen Satz, den ich oft aus seinem Mund gehört habe, liebe ich meinen Vater sehr. So altmodisch er in vielen Dingen war, so modern konnte er auch sein. »Deine Mutter war eine so tolle Frau und so hübsch – alles andere war mir egal.« Und Angela, Fritz und Anya? Die seien für ihn bald wie seine eigenen Kinder gewesen, sagte er.
Über Religion hätten sie früh und offen gesprochen, erzählt meine Mutter. Und kamen schnell zu einer gemeinsamen Haltung: »Du sagst nichts über meinen Glauben, ich nichts über deinen.« Niemals hätte Turan verlangt, dass Hilde nun Kopftuch trägt oder sich anders kleidet. Warum auch? Er liebt sie genauso, wie sie ist.
Nach der Heirat will Hilde nicht umziehen, sie ist in der Gegend rund um ihre Wohnsiedlung schon viele Jahre lang fest verwurzelt. Außerdem gehen die Kinder in Waldhof in die Schule. Einen Ortswechsel will sie ihnen nicht zumuten. Deshalb zieht Turan bei ihr ein. Ab jetzt leben die beiden das klassische Modell, er bringt das Geld nach Hause, sie führt den Haushalt. »Die Mama muss nicht arbeiten«, sagt er, nicht ohne Stolz in der Stimme. Auch meine Mutter empfindet das Hausfrauendasein als Privileg. Es ist ihr ganzes Glück, sich um die Kinder kümmern zu können – und nicht wie früher zehn Stunden am Tag in einer Fabrik zu schuften.
Das ist sie, die Ehe meiner Eltern, in die ich 1976 hineingeboren werde.
Als Kleinkind und Grundschüler verbringe ich viele Stunden täglich mit meiner Mutter, unsere Bindung ist extrem eng. Manchmal verabreden wir uns sogar heimlich nachts im Wohnzimmer, wenn mein Vater schon schläft. Dann sitzen wir zusammen auf der Couch, essen Chips und führen leise Gespräche. Manchmal werde ich in diesen Nächten vor lauter Glück furchtbar traurig und sage zu ihr: »Mama, wenn ich dich verlieren würde, das wär’ ganz schlimm für mich.« »Das wird nicht passieren«, antwortet meine Mutter und streichelt mir über den Kopf. Schon fließen bei uns beiden die Tränen.