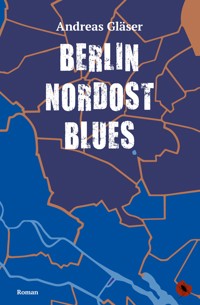
12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Periplaneta
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Edition Periplaneta
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2024
Ein vermeintlich gewöhnlicher Sonnabend in Berlin Nordost.
Schulle trotzt dem Sturm Zeynep, den Unwägbarkeiten des Glücksspiels und seinen schnippigen Kolleginnen im Zeitungs-Lotto-Tabak-Kram-Laden. Kraut, der neue Kumpel, kommt auch nicht schüchtern rüber. Ihre Dialoge sind Gefechte, ein ewiges Friendly Fire.
„Immer höflich zu de Kundschaft, och wenn se bekloppt is!“
Schulle kennt so einige Turbulenzen, ob als Betreuer für Demenzkranke, als Zusteller an der Post-Front oder als Scherge beim Wachschutz.
Hoch lebe der heitere Klassismus!
„Wo früher in den Häusern nur Freunde und Bekannte lebten, bejegnen dir heute inne Hausflure einije Helden und Jespenster aus Funk und Fernsehen.“
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 307
Ähnliche
periplaneta
ANDREAS GLÄSER: „Berlin Nordost Blues“ – Roman1. Auflage, Mai 2024, Periplaneta Berlin, Edition Periplaneta
© 2024 Periplaneta - Verlag und Medien Inh. Marion Alexa Müller, Bornholmer Str. 81a, 10439 Berlinperiplaneta.com
Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck, Übersetzung, Vortrag und Übertragung, Vertonung, Verfilmung, Vervielfältigung, Digitalisierung, kommerzielle Verwertung des Inhaltes, gleich welcher Art, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung des Verlags.
Die Handlung und alle handelnden Personen sind erfunden. Jegliche Ähnlichkeit mit realen Personen oder Ereignissen wäre rein zufällig.
Lektorat & Cover: Marion A. MüllerAutorenfoto: Marco Bertram Satz & Layout: Thomas Manegold
Buch ISBN: 978-3-95996-284-1eBook ISBN: 978-3-95996-285-8
Andreas Gläser
Berlin
Nordost
Blues
Roman
periplaneta
1
19. Februar 2022. Ich träume schlimm, erwache gerädert, sehe aber gut aus. Zeynep pflückt keine Äpfel von der Decke. Niemand knallt mir das Radio an den Kopf.
Es gehört zu meinem Berufsrisiko als Postmitarbeiter, dass plötzlich ein Kollege durch meine Träume jagt und blöd grinsend an meinem Kaffeetisch sitzt, oder dass sich mein geliebtes Schallplattenschatzregal in die Sortierablage eines Depots verwandelt.
Heute jedoch wandele ich in meinem Traum nicht nur außer Haus, sondern sogar weit vor meiner Zeit. Ich finde mich in einer blassgrauen Winterlandschaft wieder, wie in Wasserfarben gemalt, jedoch mit zu viel Wasser und zu wenig Farben. Das unheilvolle Land liegt flach und weit vor mir, Schüsse peitschen durch die Luft, Flakfeuer lässt den schlohweißen Himmel immer wieder aufblitzen. Im Schneegestöber tauchen einige schemenhafte Wesen auf und rennen wildgestikulierend vom linken zum rechten Bildrand meiner Traumglotze. Soldaten. Ich erkenne meinen Großvater, den besten Tänzer der verlorenen Ostgebiete; er stakst im tiefen Schnee umher und stürzt fast über sein herunterhängendes Gepäck. Doch Großvater trägt weder Panzerfaust noch Gewehr; er schleppt eine Posttasche mit sich herum, inmitten dieses lärmenden Infernos. Ich rufe ihm zu, er solle mir folgen, in die Kornkammer Deutschlands; die Ernte einfahren, wie es sich gehöre. Und zum Feierabend gäbe es Wein, Weib und Gesang. Familiäre Freuden. Großvater hält inne, er scheint sich zu fragen, wie es möglich sein kann, dass er als Vater eines zweijährigen Kindes, also meines Vaters, plötzlich seinem Enkelsohn begegnet, der schon doppelt so alt ist wie er selbst. Ich fordere ihn auf, die Tasche wegzuwerfen und nach Hause zu kommen! Opa verschwindet im Schneegestöber, ich erwache.
Verdammt, weshalb träume ich so schlecht? Und Großvater, ein Postillion? Das bin doch ich, immer mal wieder.
Großvater gehörte vor vielen Jahrzehnten zu den Wehrmachtssoldaten, die sich bei zweistelligen Minusgraden alles abfroren, irgendwo in Russland, vor einem Kaff, dessen Name nur in Krakelschrift auf dem Beileidsschreiben steht; dem Kaff, das nicht einmal Google kennt.
Ich dagegen gehöre zu einer Generation, die ohne Risiko am gemütlichen Privileg des gelebten Pazifismus teilhaben darf.
Nur ein Teil meines damaligen Postjobs fiel in die vermeintlichen Wintermonate, bei annehmbaren Außentemperaturen um den Gefrierpunkt. Es war nasskaltes Wetter, ich jonglierte im linken Arm einen Packen Sendungen, während meine rechte Hand an einem riesigen Schlüsselbund herumfingerte. Ich habe diese Monate überlebt, auch dank dem Job-Wechsel. Mein Opa väterlicherseits wäre froh gewesen, wenn er bei solchen Bedingungen nur die Post hätte austragen müssen. Stattdessen verreckte er fern der Heimat jämmerlich. Nicht jeder Schuss traf einen Russ’.
Tack-tack-tack-tack-tack!
Schlaf’ ich oder wach’ ich? Das ist doch … Ziemlich gerädert im Bett liegend erkenne ich das Geratter: Das ist der Typ mit dem Wochenblatt, der seinen Wagen über den Bürgersteig mit den Katzenköpfen schiebt. Guten Morgen, alter Hahn, der du nicht mehr krähst, sondern nur noch ein ewiges Tack-tack von dir gibst.
Voll der Rollkoffer-Blues, in aller Herrgottsfrühe, während der orkanartige Sturm Zeynep unentwegt über Deutschland fegt.
Das lautstarke Dauerrauschen von Wind und Regen ließ mich gegen 4 Uhr wachwerden. Der Sturm pustete mir den Dreck in die Bude und ich schloss das Fenster, obwohl ich bei offenem Fenster viel besser schlafe. Als ich mein Schlafzimmer dichtmachte, fühlte ich mich wie Kai in der Kiste. Lebendig begraben irgendwie. Habe es wieder geöffnet, kaum geschlafen. Dauernd diese Autos mit ihren Sirenen. Rettungsfahrzeuge im Prenzlauer Berg. Immer was los hier.
Der Typ mit dem Wochenblattwagen tackert leiserwerdend davon, dafür lässt der alte Radiowecker sein Programm schnarrend ertönen. Nun heißt es: Ohren auf, Schädeldecke hoch! Hirndusche, Hirndusche!
7 Uhr 30. Ich muss mein Meeting auf der Matratze beenden, flott aufstehen und mich strecken, nach den von der Zimmerdecke imaginär herunterhängenden Äpfeln greifen; mich aufraffen kurz nach den vielen Vögeln, lange vor den meisten Menschen. Sonnabend, halb 8, ihr habt sie doch nicht mehr alle! Radiowecker aus, Küchenradio an. Das Geplärre gehört zum Wachwerden, genauso wie das Duschen und das Frühstück.
Schlaftrunken geht es vom Zimmer über die Küche ins Bad. Ich überwinde mich zum Blick in den Spiegel und schlussfolgere: Ja, doch. Ich sehe gut aus, habe keine Herpesbläschen, kein blaues Auge. Ein Wunder? Immerhin war ich weg. Das kann an einem Freitagabend vorkommen.
Ich bin in Kreuzberg auf ein Konzert gegangen und traf unter vielen Fremden einige Bekannte. Wir hatten uns nicht viel zu erzählen, konnten aber prima nebeneinander rumstehen. Normale Leute, Senioren-Punks, denen die Frisur abhandengekommen war. Niemand ging nur für sich allein ein Bier holen, stattdessen kämpfte sich ein jeder abwechselnd zur Theke und zurück. Irgendwann fühlte ich mich dafür verantwortlich und reichte meine Becher über die Theke, wo man umstandslos den Inhalt der Flaschen in meine Becher füllte. Doch welcher Becher gehörte zu welchem Kumpel? Das war um diese Zeit nicht mehr so wichtig. Prost! Auf den Weltfrieden, oder wie meine Mutti zu sagen pflegte: „Schön, dass wir auf der Erde sind und nicht runterfallen.“
Die Band auf der Bühne zeigte sich gut drauf, der Mob davor ebenso. Meine Kumpels und ich, wir begnügten uns mit den Stehplätzen im hinteren Bereich, irgendwo zwischen dem Nicki-Basar und der Bierquelle. Dass hier dauernd Leute an uns vorbei drängten, machte nichts.
Dann plötzlich dieser tanzende Lichtkegel einer Taschenlampe. Zwei Sicherheitstypen vom Laden baten einen unserer Herren zum Eingang. Verdammt, das war auch der Ausgang. Gab es ein Problem? Wir sind mitgetrottet, denn so was soll in der Enge manchmal vorkommen: ein Problem!
Vor Monaten habe ich in dem Laden inmitten des Pogo-Mobs einen wiederholt in die Knie Gehenden mehrfach von hinten unter die Arme gegriffen und aufgeholfen, bis er mich entgeistert ansah und meinte, er würde seine Brille suchen.
Jedenfalls wurde es gestern am Ausgang unübersichtlicher und lauter, wobei ein Kumpel einen nahezu vollen Bierbecher gegen die Wand schleuderte. Ich gab ihm in der nächsten Kneipe ein gepflegtes Gezapftes aus. Bin sogar gut mit dem Taxi nach Hause gekommen und komatös ins Bett gefallen; für die zu kurze sechste Nacht in dieser stürmischen Woche, während der man nach Möglichkeit nicht aus dem Haus gehen solle.
Ich muss halbwegs kultiviert in die Schicht des Sonnabends kommen, heiß und kalt duschen, ohne in der Badewanne auszurutschen. Ich brauche keine Blessuren, will gut aussehen, im Oktober meines Lebens; in einem Alter, in dem sich einige Kumpels schon im Dezember wähnen dürfen. Und überhaupt: Einige arme Seelen aus dem engen Freundeskreis mussten sich vor Jahren schon verabschieden. Träumen sie nun von der Wiedergeburt? Ich bin zwar alt und grau, aber rüstig und schau. Vor allem ist es höchste Zeit für mein schnelles Autistenfrühstück: Kaffee, Stulle, Apfel. Ich habe zu früher Stunde keine Nerven für irgendwelche Experimente und auch nichts im Kühlschrank. Mann, diese Arbeit! Und das an diesem Superfußballsonnabend, wo ich den ganzen Tag nur zocken will.
Meine Frage aller Fragen lautet: Wie komme ich in naher Zukunft zu meinem derzeitigen Monatsgehalt, ohne dafür so viel Zeit wie jetzt auf Arbeit zu vergeuden? Ich will mit einer Fußballwette aus einem Euro zwei machen. Das alte Spiel: aus zwei mach vier, mach acht, mach 16, mach 32 … mach irgendwann 524.288 Euro. Das kann schon bei 131.072 Euro schief gehen. Was soll’s? Die übertriebene Angst ist der Tod des Träumers. Ich bin Arbeiter, will nicht ewig einer sein. Dann lieber ein zackiger Zocker, ein ausgeschlafener Bohème – doch genug geträumt.
Noch vom Kaffee einen Schluck, vom Brot einen Bissen, und auch der Apfel will bis zum Griebsch verputzt werden. Gelernt ist gelernt und so gut wie aufgegessen. Ah, der gute Nescafé Gold, der schmeckt nicht nach scheiß DDR. Dafür gebe ich gerne mein Geld. Und wenn in mir zu viel Ostalgie aufkommt, trinke ich einen Rondo und fühle mich sofort geheilt, denn der schmeckt nach ’80er-Jahre-Marzahn.
Aus dem Radio tönt lebensfrohes Gequatsche, es laufen nervende Jingles und Musik aus der Rotationsmaschine. Das blanke Elend. Fehlt nur noch ein bekloppter Hörerwunsch, ein scheinbar vergessener Song, den man im Radio ohnehin manchmal hören muss und im Internet immer abrufen kann. Angloamerikanisches The-Lord-and-Love-Gedöns. Hören die Menschen in Großbritannien und den USA jetzt deutschsprachige Musik? Eines Tages schicke ich an den Sender eine Elektropost und wünsche mir drei Minuten Stille, ohne lustige An- und Abmoderation. Irgendwann – vermutlich nie. Diese Moderatoren haben gute Laune, weil sie kurz nach ihrem Vorabendprogramm nüchtern ins Bett gehen, wenige Stunden später mit aufgeladener Batterie aufstehen und mit ihrem Schlitten innerhalb weniger Minuten über leere Straßen zum Sender durchheizen. Letzte Woche habe ich es um diese Zeit mit Klassikradio versucht und voll aufgedreht, damit ich nicht gleich wieder einschlafe. Sofort kam der U35-Vollbart von unter mir hoch und klingelte. Ob diese Lautstärke wirklich nötig wäre? Nein, natürlich nicht. Er soll mir später mal „die Kohlen hoch schleppen.“
Ich schlurfe mit der Kaffeetasse durch die Wohnung, ziehe mich nebenbei an. Frische Unterwäsche, soviel Kultur muss sein; alles aus dem Schrank, nichts vom Stuhl. Das hätte meiner Ex gefallen, dass ich während des Frühstücks rotiere. Manchmal zeigte sie sich über meine Ausgeglichenheit erbost oder beschwerte sich schon, wenn ich mich immer auf denselben Küchenstuhl setzte – was mir bis zu jener Zeit neu war, dass das ein Problem sein könnte. Einmal habe ich fast das Küchenradio an den Kopf bekommen. Danach schenkten wir uns noch einige Nummern in aller Freundschaft und legten zum ersten und letzten Mal den Schlager auf: „Frei, das heißt allein.“ Und ich hatte mir eingebildet, bis zum verflixten 7. Jahr noch viele Monate gewährt zu bekommen. Nun muss es bis auf Weiteres reichen, von der Arbeit, dem Alkohol und dem Tagtraumgezappel müde zu werden. Immerhin habe ich wieder eine im Auge, und eine hat mich im Auge; aber zu dritt wird das erstmal nichts. Abwarten.
Zähne putzen, Ohrenhonig entfernen. Ich habe kein Bock auf das Rasieren, auf dieses Geschabe im Gesicht. Das ist im soundsovielten Maskenmonat auch nicht notwendig. So, genug getrödelt. Radio aus. Schuhe, Jacke, Mütze an. Werden 7 Grad heute. Bleibt stürmisch, könnte regnen. Ein guter Tag, um meiner alten Leidenschaft und brotlosen Kunst nachzugehen – der Malerei. Daraus wird nichts. Doch ich bin immerhin schick genug für die Schicht an diesem 19. Februar 2022.
Noch etwa 30 Mal schlafen, dann ist Frühling, und ich werde wieder ein Vierteljahr überlebt haben. Oh, Mann! Wie meine Schuhe aussehen, zwar nicht zertanzt, aber dreckig. Ich sehe untenrum so aus, wie ich mich oben fühle. Kann ich jetzt nicht ändern.
Schnell wird der Frühstückskram in den Kühlschrank verfrachtet, an dessen Tür ein Zitat von Udo Jürgens per Aufkleber etwas Optimismus verspricht: „Denn immer wieder geht die Sonne auf / und wieder bringt ein Tag für uns ein Licht / ja, immer wieder geht die Sonne auf / denn Dunkelheit für immer gibt es nicht.“
2
Über die Kniprode-Brücke fahrend werde ich zwar nicht in den Dampf einer Lokomotive gehüllt, doch schaffe ich es jemals auf die Sonnenseite des Lebens?
Mein heimatliches Viertel im Osten vom Prenzlauer Berg umfasst ein in etwa so großes Gebiet wie der angrenzende Volkspark im Nachbarstadtbezirk Friedrichshain. Dort ragt ein Berg empor, der mit dem Schutt eines Wohnblocks aufgefüllt wurde, der bis zur Bombardierung an der hiesigen Straßenecke stand, ein Gründerzeitbau mit mehreren Hinterhöfen.
Heute steht dort mein schönes Heimathaus aus den ’50er Jahren. Es gibt vier Etagen, keinen Fahrstuhl und nur wenige Wohnungen haben, nach welchem Auswahlprinzip auch immer, einen Balkon bekommen. Schräg gegenüber ein trauriger Kinderspielplatz.
Bewohnbare Stuben und Küchen sind knapp, immer schon. Dennoch darf die Wohnungssuche der Nachwendejahre gegenüber der der Gegenwart und Zukunft als der reinste DDR-Schmus gelten. Damals wurde das Bötzowviertel unter den Ureinwohnern Groß-Pankows noch als Geheimtipp gehandelt, bevor es kurz nach dem Millennium von einem Teil der nach unten tretenden Zehntausend okkupiert wurde. So viel ist gewiss: Falls ich aus meinen Kiez nahe der Halli-Galli-Kneipe ziehen muss, wird es mich aus der Innenstadt katapultieren. Die besser betuchte Nachbarschaft bezahlt für eine urige Altbauwohnung mindestens das Doppelte, da kann und will ich nicht mithalten.
Und wo die Einkünfte stimmen, liegt man auch mit der Geburtenrate gut im Rennen. Zwei Kindings – ganz normal, selbst wenn manch Spötter den einst so grauen Prenzlauer Berg pauschal als grünen Lebensborn aburteilt. Na und? Zwei, drei Kindings, diese Anzahl an Mäulern hatten unsere Eltern zu DDR-Tagen auch zu stopfen, und unsere Großeltern während der Kaiser- und Führer-Jahre sowieso. Damals, als an der Stelle meines duften Wohnblocks aus der Anfangszeit der DDR noch ein altehrwürdiger Gründerzeitbau mit Seitenflügeln und Hinterhäusern stand; als auf den Höfen einige Ställe vom lieben Vieh bewohnt wurden, eine vielköpfige Kinderschar einen Heidenlärm verursachte und der dem Milieu verbundene Schutzmann genau wusste, wem der nächste Ordnungsgong gebührte.
Heute scheint alles befriedet. Es ist schön ruhig hier, wenn auch nicht so gut bewacht, wie das Regierungsviertel, welches sich in der Reichweite eines Kanonenschlages befindet und so einigen hier als Arbeitsstelle zu dienen scheint. Aber noch liegen sie in ihren Betten, die Doktoren mit den Doppelnamen, oder sie sitzen gemütlich am Frühstückstisch, wie im Schöbel-Märchen „Weihnachten in Familie.“ Wer auf dem Schulhof für seinen Namen verkloppt wird, bekommt für selbigen später einen roten Teppich ausgerollt und kann ausschlafen.
Ich dagegen eile die Treppen runter, um rechtzeitig in den Zeitungs-Lotto-Tabak-Kram-Laden zu kommen, wo ich fünf Stunden am DHL-Schalter verbringen werde. Voll der Familienbetrieb. Das ist seit einigen Wochen mein Los, meine Niete: Februar in Familie.
Vor dem Haus habe ich ein Erfolgserlebnis, denn kein einziger Idiot versuchte sich brachial am Öffnen des Fahrradschlosses. Niemand fingerte unbeholfen am Schloss herum und klaute in Anbetracht seines Misserfolgs nur den Sattel. Auch Einzelteile bringen Klimpergeld, dem Internet sei Dank. Ja, wir haben es hier nämlich alle dicke. Während der letzten 15 Jahre büßte ich drei Räder ein, doch nun scheint mein schwarzer Blitz mit drei Schlössern ausreichend gesichert. Und für den Fall, dass ich des Nachts durch mein geöffnetes Fenster ein verräterisches Geklapper vernehme, lagern auf dem Brett drei große Schrauben und eine Kernseife. Hart, aber fair. Na und? Ich habe nicht ständig schimmlige Zitronen im Haus. Diese Diebe raubten mir schon so manche Nacht, indem sie unsere Straße leise auf und ab latschten, auf dem knirschenden Schotter aber immer noch verräterisch laut, und sich sogar an den rostigsten Rädern vergriffen.
Doch am heutigen Morgen steht mein Rad noch da wie am gestrigen Abend, auch wenn der Sturm einige Räder und Mopeds umgeworfen hat. Bloß nicht zu viel klagen und jammern. Immerhin muss ich nicht zur Arbeit laufen, auch nicht mit den Bussen und Bahnen fahren; eine BVG-Tortour in ein fernes Plattenparadies am Stadtrand bleibt mir erspart. Halleluja!
Es geht nur in den benachbarten Bruderbezirk. Schindern in Lichtenberg, das läuft fast unter Heimarbeit. Halleluja! Auf dem Fahrrad ist es nur ein halbes Stündchen von meinem Kiez aus, auf der Betonpiste durch die Millionenmetropole; raus aus dem Bötzowviertel, die Durchfahrt zur zweispurigen Kniprode genommen, auf jener rüber und links hoch; die Werneuchener Wiesen rechts liegengelassen und so weiter und so fort. Sport frei! Heißt es zumindest für mich, denn die Solisten, die sonst um diese Zeit schon voll einen absportlern, indem sie durch den Park laufen und laufen und laufen, die liegen bei diesem Wetter lieber noch auf der Matratze.
Ich rolle an der Tanke vorbei, neben der für einige Wochen ein Zirkus residiert. Und wenn jener verschwunden sein wird, bauen sie dort viele Hüpfburgen auf, auf denen hundert Kinder am Dauerkreischen sein werden. Deren Eltern müssen einen Kaffee nach dem anderen trinken, denn sie dürfen nicht hüpfen, obwohl sie Eintritt bezahlt haben. So eine Hüpfburg hält zwar zwei Dutzend Kinder aus, aber keine zwei Erwachsenen – das meinte zumindest eine gelangweilte Aufsichtskraft. Vorschrift sei Vorschrift! Ende der Diskussion. Mir schwant: Hüpfen für Erwachsene, das ist eine Marktlücke. Immerhin fahren die auch Roller.
Ich nehme die große Kreuzung im Dreiländereck Lichtenberg-Friedrichshain-Prenzlauer Berg bei Rot, denn noch herrscht hier kaum Verkehr, zumindest wohl weniger als in den Häusern ringsum. Es geht die Kniprode hoch, den leichten Anstieg nehme ich locker. Welch prima Piste zwischen den Trümmerbergen der beiden Volksparks in Friedrichshain und Prenzlauer Berg, auf deren rechter Seite sich der Lidl und die zehnstöckige Dauerbaustelle befinden. Links liegt der Anton-Saefkow-Platz mit den angrenzenden Häusern aus dem sozialen Wohnungsbauprogramm der ’30er und ’40er Jahre. Nur wenige vorbeifahrende Autos übertönen kurzzeitig das Gezwitscher der Vögel. Kein Wunder, dass jetzt noch ein Fuchs seiner Fährte im Wohngebiet zwischen den großzügigen Parkanlagen folgt, von Mülleimer zu Mülleimer.
Unter der Kniprode-Brücke rollt auf einem der vier Gleise eine S-Bahn hindurch. Ziemlich clean und gar nicht mal so laut ratternd. Nur eine S-Bahn, keine rasende Lokomotive mit faszinierend vielen Güterwagen hintendran, wie sie zu meinen Kindertagen täglich entlanglärmte; wo wir auf der Brücke stehend dem Lokführer zuwinkten und uns in die Dampfwolken einhüllen ließen. In Windeseile stanken wir und mussten uns orientieren, wo hinten und vorne war. Die S-Bahn gibt heute wenig Lärm und Gestank von sich. Letzterer rührt hauptsächlich von den vielen alkoholisierten Nachtmenschen, welche sich jetzt durch die Gegend kutschieren lassen. Wie heißt es in MC Fittis’ Song? „Eigentlich wollt’ ich nur zwei Stationen fahr’n / Eigentlich wollt’ ich nur zwei Stationen fahr’n / Yolo! / Licht an, Club zu, mega geraved / Ab auf den Heimweg, Licht aus im Brain …“
In jedem Abteil ein halbes Dutzend Schläfer, in jedem sechsten Wagen eine Lache stinkender Kotzbrühe; zum traditionellen Schrecken der nüchternen Frühaufsteher, die auf ihre Bahn angewiesen sind. Wenn ich mit der BVG unterwegs bin, wird mir mitunter auch schlecht, weil nahezu alle Leute an ihren Handys herumfingern und ich mir einige Halbgespräche reinziehen muss.
Doch ich habe es halbwegs gut und fahre mit dem Rad zum Job, über die Brücke, auf der ein alter Mindestlohnsklave, der schon genug mit seinem Übergewicht zu tun hat, eine Karre vor sich her schiebt. Er muss ein kostenloses Wochenblatt verteilen und befindet sich in der Hierarchie der Zusteller ganz unten. Ich spüre etwas Mitleid für den armen Tropf, denn er leistet mit der Leibeskraft eines abgehalfterten Professors den Job eines sportlichen Studenten ab. Möge er rechtzeitig den Job erledigt haben und sich in seine Wohnung retten können, um während einer Vormittagssendung im TV über die Sorgen und Nöte seiner Peiniger etwas Entspannung zu finden.
Als ich noch als Briefzusteller unterwegs war, hasste ich es, wenn Typen wie er vor mir die Briefkästen mit ihrer Werbung verstopften und ich mich zu entscheiden hatte, ob ich das Papier hereindrücken oder herausfummeln müsse. Meine Kollegen und ich, wir beschimpften diese Wochenblatt-Typen, weil wir wegen denen in jedem Hausaufgang doppelt so viel Zeit verbringen mussten. Diese Leute wiederum verstanden unsere Beleidigungen nicht, denn entweder handelte es sich bei ihnen um Fremdsprachler oder um Schwerhörige; auf jeden Fall um demütige Typen, die um ihr schweres Los wussten und den Schwanz einzogen. Als Briefzusteller spielten wir eine Liga drüber, wir waren Scheißeschipper mit Diplom und verdienten anderthalb Riesen auf die Hand. Doch wenn die Miete abgezogen wurde, war das Guthaben nur noch ein Dreistelliges, von dem am Ende des Monats hoffentlich noch ein Zweistelliges übrig bleiben würde. Vier Wochen geschindert, nichts revolutioniert, damals wie heute. Mein aktueller Job als Mann hinter dem DHL-Schalter bringt über kurz oder lang auch nichts. Ich bin müde, doch anstatt einfach im Bett liegengeblieben zu sein, versaue ich mir den Sonnabend mit der Schicht.
Ich tagträume, dass, – was so oft funktioniert, nämlich aus einem Euro zwei zu zaubern –, dass das mit dem dauernden Verdoppeln 20 Mal hintereinander zu realisieren ist. Wie in der alten Sage mit den Reiskörnern und dem Schachbrett. Ich habe während der letzten Jahrzehnte etwa 2.000 Mal einen richtigen Tipp abgegeben, oft sogar als brauchbare Kombi-Wette; aber kaum, dass ich ein halbes Dutzend Mal hintereinander richtig lag, brannte mein Luftschloss nieder. Typisch, denn ich bin zwar ein Sonntagskind, aber ein im Winter geborenes. Das Schicksal sieht mich nur so weit auf der Sonnenseite des Lebens, dass es mich schuldenfrei durch die Jahrzehnte schlurfen lässt.
So bescheiden will ich nicht sein. Scheiß auf dieses redliche Nähren und demütige Quälen. Sportlich in die Altersarmut, nein danke. Dabei geht es mir nicht um Reichtum, sondern um die Zeit, mein Leben. Einen Dreck gebe ich auf Autos, Klamotten und Reisen. Ich bin ein alter Sack, ich muss nicht mehr die Welt sehen. Mein Universum nennt sich Umland, mein Barcelona heißt Rostock. Eine deutsche Stadt am Meer, was will ich mehr? Am Alten Strom eine frische Schrippe, danach zu den Fußballern vom SV Warnemünde City. In der Halbzeitpause renne ich kurz über die Parkstraße zum schmalen Sandweg, der durch die Düne führt, nehme die letzten hundert Meter zum großen Wasser und stürze mich kurz in die baltischen Fluten. An der Ostsee spricht man Deutsch, ziemlich schnuckeliges. Warum in Fernistan auf dicken Max machen, der ich hier nicht bin? Zuhause ist es am schönsten. Täglich ausschlafen. Dafür gilt es, mit den heutigen Tipps richtig zu liegen, auch mit den morgigen und übermorgigen.
An der Kreuzung zur Storkower Straße möchte ich einfach weiter geradeaus fahren, denn am Fuße vom Volkspark Prenzlauer Berg liegen einige Kleingartenkolonien. Ich kenne Leute, die in ihren Lauben nahezu überwintern. Dort könnte ich über den Zaun steigen und an die Tür ihrer Hütte klopfen, oder sogar etwas Zurückhaltung üben und mich vor der nahegelegenen Gaststätte auf eine Bank setzen und meine Leute anrufen, um mich zum Frühstück einzuladen. Alles schon vorgekommen. Damals, während der lockeren ’90er, als ich manchmal auf dem Weg zur Baustelle eine Richtungsänderung vornahm und mir die Schönheit der Stadt zur frühen Stunde gönnte. Frei nach Bob Teldens Song, seinem wohl einzigen, aber immer noch ergreifenden Hit, in dem es heißt: „Die ersten Leute gehen, die Zeitung unterm Arm, zu ihrer Bahn / Adio ’Berlin by night’, nun wird es Zeit, ein neuer Tag fängt an / Es ist 5 Uhr / Berlin erwacht / Berlin erwacht.“
An der Kreuzung schwenke ich entgegen meiner Gesinnung scharf rechts ein. Vorbei an der Polizei-Direktion 1, Abschnitt 16. Jetzt bloß keinen Zivilen umfahren, dem die Nachtschicht noch in den Knochen steckt; der vielleicht sogar aus der beruflichen Notwendigkeit heraus im benachbarten Mensch Meier oder im KDW durchmachen musste. Zwei Lokalitäten, deren Dreadlock-Heidis und Struwwelpeter plötzlich zum anrollenden Bus stürzen, immer lustig drauf und in Überzahl.
Ich dagegen rumpele auf meinem schwarzen Blitz über den maroden Radweg, fühle mich etwas müde und hier und da ziemlich steif. Ich bin ein verkaterter Ü50. Aber vermutlich wird sich mein Rad eher als ich aus dieser Welt verabschieden, es ist ziemlich hinüber. Ich muss Rücksicht nehmen, wenn ich ihm diesen holprigen Radweg zumute, der mitunter endet und neu beginnt; wie eine Gedenkmeile der sporadischen Zusammenarbeit zwischen Ost und West, ohne jegliche Geld-war-alle-Warnschilder.
Vorsicht vor dem Wurzelwerk! Auch die Straßenmarkierungen lassen das Erleben eines blau-grünen Wunders erahnen. Wer regiert, markiert – oder auch nicht. Ich heize die Storkower Straße hinunter, immer an der Stadtbezirksgrenze entlang, ab nach Lichtenberg, wo mir die Namen der Straßen nicht so geläufig sind, und es in diesem Leben auch nie sein werden.
Doch jetzt will ich in ein mir bis vor wenigen Wochen unbekanntes Einkaufsland, um in einem Laden für fünf Stunden an der Postfront zu kämpfen. Also immer geradeaus, nur zwei-, dreimal ein kleiner Schwenk; hinein ins Lohnsklavenglück, gleich hinter den sieben Späties. Ab ins Arbeitsquartier nach Lichtenberg, wo mich eine Tour der in Vergessenheit geratenen Dichter Wilhelm Weitling und Georg Weerth lockt; eine Tour, aus der nichts wird. Kein Wandeln und Forschen am Morgen. Pech gehabt, einsamer Strampler. Ab zur Absolvierung des notwendigen Leids.
3
Ganz früher war hier Wiese. Meine Sippe kam aus dem Umland. Doch fern blieb meist’ der Spaß aus Übersee. Viele glückliche Kindheiten fielen in die bunten ’70er.
Im ungefähr 785 Jahre alten Berlin ist mein Heimatbezirk Prenzlauer Berg mit seinen Pi mal Daumen 111 Jahren ein junger Stadtteil. Einst wurde diese dem alten Stadtkern vorgelagerte Gegend als Prenzlauer Tor bezeichnet. Hier standen inmitten von Kornfeldern viele Windmühlen. Es sollte ewig und drei Tage dauern, bis im Nordosten die umliegenden Dörfer von der Reichshauptstadt eingemeindet wurden. Das war zu den Zeiten von Claire Waldoff und Heinrich Zille, als man in Rekordzeit die Felder-und-Fluren-Landschaft bebaute und die ersten Häuser in den Seitenstraßen nur durchnummeriert wurden.
Damals zogen meine Ahnen mütterlicherseits aus dem nahen Umland an den Windmühlenberg, wie man den Bezirk auch nannte. Ob sie freiwillig und gerne kamen? Bismarcks Zeiten und die industrielle Revolution – das waren nicht die Themen, die zwischen den Eltern und Großeltern in Gegenwart der Kinder besprochen wurden. Irgendwann waren Oma und Opa nicht mehr. Am Kaffeetisch wurde meistens über die Lebenden gesprochen, nicht über die Verstorbenen.
Unsere Ahnen waren als Schmiede, Tischler und Landarbeiter gekommen. „Ehrlicher Adel“, wie Opa zu sagen pflegte. „Frank und frei bei Wind und Wetter.“ Immerhin galten sie nicht als Leibeigene, auch die Einführung der Gewerbefreiheit soll einen Hauch von freier Berufswahl mit sich gebracht haben. Auf den uralten Familienfotos sitzen sie in Sonntagstracht mit Kind und Kegel im Garten vor dem Haus. Doch für die Menschen vom Lande, die mit der Sonne aufstanden, brachte der Umzug in die Stadt die Anpassung an die Moderne mit sich.
Die Verheißungen dürften sich kaum erfüllt haben, davon sprachen auf den Fotos schon die neuen Wohnverhältnisse. Auch in der Stadt blühte ihnen ewige Arbeit ohne angemessene Entlohnung. Als nunmehr Angehörige des Proletariats galten sie als Vertreter der 6. Klasse, als Besitzlose und Unbewaffnete. Im Grunde zählten sie noch zu denjenigen, die mit dem Vieh lebten und sich genauso vermehrten; die nur nach Köpfen zählten und austauschbar schienen.
Sie war vorbei, die Zeit auf dem Lande, wo Familie und Gesinde an einer Tafel saßen; wo es notfalls eine Ansage von Angesicht zu Angesicht per Einsatzwort gab, auf dass man ohne Ärger ins Bett ginge. Und dass die Dampfmaschinen der Städte so nebenbei die Kultur der Dörfer einstampfte, davon werden sie gehört haben. Es hatte alles seine Vor- und Nachteile.
Auf dem Land bedrohten die Unwägbarkeiten der Natur die sicheren Ernten, in der Stadt war der Arbeiter dem Diktat der Uhren und Maschinen ausgeliefert. Die Verhältnisse blieben prekär, der Kampf um den Erhalt des Arbeitsplatzes offenbarte sich als ein ewiger freiwilliger Zwang. Die Schichten der Sechstagewoche degradierten den Menschen zum Fachidioten. Man hatte weder Zeit noch Mittel für Veränderungen. Auch in der großen Stadt blieb die Freiheit, sich mit verschiedenen Künsten und Arbeiten beschäftigen zu können, den anderen Menschen vorbehalten. Sich ausprobieren, ohne sich sofort entscheiden zu müssen? Die Neugier stillen und etwas Stolz und Anerkennung tanken? Das war Hokuspokus aus dem Märchenbuch.
Der Prenzlauer Berg, bis eben noch die unscheinbare Vorstadt-Kornkammer, wuchs zum Häusermeer heran. Heil dir im Siegerkranz! Die Vorderhäuser beherbergten das wohlhabende Bürgertum, deren Wohnungen man frühzeitig mit Balkonen, Innentoiletten und Badewannen ausstattete. Die Seitenflügel und Hinterhäuser blieben ohne Komfort und deshalb dem Proletariat vorbehalten. Prima, wenn man eine trockene Bleibe bewohnte und über den engen Hof ab und an die Sonne in die Zimmer strahlte. Hier lebten große Familien auf engstem Raum. Drei Generationen in zwei Stuben. Im Beisein der späteren Großeltern wurden deren Enkelkinder gezeugt.
Man lebte extrem und wählte oft entsprechend. Der rote Wedding war nicht weit, der Prenzlauer Berg gehörte zum selben Milieu. Bald wussten die Braunen ihr Potenzial abzurufen, Berlin fiel in Schutt und Asche. Flogen im November ’43 noch 400 Bomber der Alliierten über die Stadt, waren es im Januar ’44 schon 500. Unablässig warfen sie auf die alte Reichshauptstadt ihre Last ab, um aus den letzten bewohnbaren Häusern die notdürftigen Pappen aus den Fensterkreuzen bersten zu lassen. Im Februar ’45 folgte der schwerste Angriff, als über 900 Flugzeuge der US-Amerikaner über 150.000 Bomben niederfallen ließen. Nun hatte die Nachbarschaft dank der fehlenden Wände vollen Einblick in die bescheidene Behausung.
Während der letzten Kriegstage stapelten sich in den vermeintlich kühleren Räumen der Hinterhäuser die Leichen. Für die Überlebenden hieß es, raus an die Luft, aufs Land; sich auf die Nahrungssuche machen, Stoppeln gehen, Ähren nachlesen oder klauen. Und wenn der Bauer mit der Mistforke kam, galt es, bloß nicht die schweren Klotzen an den wunden Füßen zu verlieren.
Opa erzählte manchmal, wie er als junger Mann seine ersten Berliner Jahre verlebte. Auf jedem Hof krakelte ein Arsch voll ärmlicher Gören. Sie spielten Einkriegezeck, Fange, Greife. Es gab Gelächter, Geheule, Dresche. Während die Russen für den Weg von der östlichen Stadtgrenze bis ins Zentrum einige Tage benötigten, fabrizierte Opa im Haus ein halbes Dutzend wilder Wanddurchbrüche, worauf es hinter manchem Schrank eine Fluchtmöglichkeit in die jeweils nächste Wohnung gab. Seine vorsorglich gelernten Brocken Russisch ließen ihn die unausweichliche Begegnung menschlicher gestalten. Wohin hätte er mit seiner Familie auch flüchten sollen? Im nahen Umland lief der Russenfilm, in dem sein Bruder samt Anhang nur eine grausige Statistenrolle spielten.
Nach dem 2. Weltkrieg vierteilten die Alliierten die Ruinenstadt, der Prenzlauer Berg gehörte zum sowjetischen Sektor und entwickelte sich mehr denn je zum Arbeiterbezirk. Die neuen Verhaltensregeln wurden vom russischen Kommandanten angeordnet, der erwartete, dass man sich einen, im fernen Moskau hergestellten Dokumentarfilm über den soeben überstandenen Krieg ansah.
Einige Konzentrationslager der Nationalsozialisten wurden von den Kommunisten weiter genutzt. Schon wieder saßen Menschen aus dem humanistischen Spektrum ein, die nun wiederum nicht laut genug „Rot Front!“ gerufen hatten. Verdammt! Vielleicht sollte man der ins Rheinland geflüchteten Verwandtschaft folgen. Dort lief es besser mit der Verdrängung ab.
In Berlin fanden die Überlebenden lange keinen häuslichen Frieden, vor lauter Hals-, Rachen- und Lungenkrankheiten. Die Kinder spielten mit ausgedienten Kriegsgeräten. Deutscher gegen Russe, Panzer gegen Faust.
Immerhin war an die Mauer noch nicht zu denken, die Sektoren der Westalliierten konnten schnell erreicht werden. Wo bis vor einigen Monaten die Deutsche Wochenschau lief, wurde nun ein amerikanischer Knaller gezeigt. Spaß aus Übersee.
In den Schulen vermittelten alte Lehrer den neuen Stoff. Zeugnisse wurden auf Stullenpapier verewigt. Wenn die Schuhe zu klein geworden waren, schnitt man sie vorne auf, damit die müffelnden Zehen der frischen Luft entgegenstrebten. Der Winter 1946 war einer der kältesten seit Menschengedenken. Minus 25 Grad, die Zahl der Erfrorenen schoss in die Höhe. Der Unterricht fiel aus, die Wasserleitungen froren ein, worauf es noch weniger funktionierende Toiletten gab. Nachttöpfe wurden auf der Straße entleert, die Menschen bekamen die Krätze. Auf den Tellern fand sich Graupensuppe mit Baumwurzeln.
Irgendwann durften die Bäume wieder gedeihen. Wachsender Wohlstand bedeutete Kriegsspielzeug für alle. Langsam aber stetig, mit jedem Jahrzehnt der 1949 gegründeten jungen, ostdeutschen Republik. Vorbei auch die Zeit, während der man die Kinder mit dünnem Bier versorgte, weil das sauberer als das Leitungswasser war.
Blöderweise zerfielen zu DDR-Zeiten von Plauen über Berlin bis Rostock so viele herrliche Gründerzeitbauten, weil deren Erhalt zu kostspielig gewesen wäre. Außerdem erschienen einigen SED-Bossen jene Häuser zu gestrig und dekadent, alles Bürgerliche und Privatwirtschaftliche war verdächtig. „Von der Sowjetunion lernen, heißt, siegen lernen.“ Da konnte der Proll in seiner Kneipe meckern, wie er wollte, sein „Ras-twa-trie – Russen werden wir nie!“ hatte keine Chance, zur offiziellen Losung erhoben zu werden. Der Arbeiter musste froh sein, wenn er nicht aus seinem Ludenstall heraus in ein Lager von Stalins Schergen verfrachtet wurde. Der neue Staat war mit einem Geburtsfehler zur Welt gekommen, denn der Stalinismus offenbarte sich als perfide Form des Kommunismus, von dem sich die DDR nie wirklich erholen sollte. Doch auch das Krüppelkind beanspruchte sein Recht auf ein eigenes Leben und die maximale Unterstützung seiner Bevölkerung sowie die internationale Anerkennung.
Im Prenzlauer Berg setzten die Führer unserer Klasse einiges daran, das bauliche Niveau der Vorderhäuser auf das der Hinterhäuser und Seitenflügel zu senken. Wenn der Balkon nicht abfiel, sollte man froh sein, dass das Innen-WC nicht herausgerissen wurde. Zwar arbeiteten viele Leute auf dem Bau, doch sie wurden von den Planwirtschaftlern zunehmend in die zukünftigen Plattenparadiese an die Stadtränder delegiert. Man strebte zwar die behutsame Erneuerung an und brachte alten Stadtkernen vielleicht mehr Wertschätzung entgegen, als es in vielen zerbombten Städten des Westens der Fall war, doch spätestens 1980 wurde kapituliert. Zu viele Häuser gehörten zur Bauzustandsgruppe III und IV, womit sie als schlecht oder als unbewohnbar galten. Man setzte ganze Häuserzeilen auf die Abrisslisten.
Oft half auch alle Kritik aus Kirchenkreisen nicht. Selbst eine Gruppierung wie die Gesellschaft für Natur und Umwelt, die aus dem Staatlichen Kulturbund hervorgegangen war, hatte wenig zu melden. Die geringen Mieten erwirtschafteten nicht die nötigen Mittel.
In der Hauptstadt der DDR galt immerhin das Instandbesetzen als staatlich geduldet, es wurde sogar gefördert, mit FDJ-Initiativen wie „Dächer dicht in der zweiten Schicht“. Dennoch zeugten bis in die ’90er Tausende Einschusslöcher in Hunderten Fassaden von den ’40ern. Für wichtiger wurde in der Hauptstadt der DDR die Umsetzung des Programms im fernen Osten der Stadt erachtet; in Marzahn, Hellersdorf, Hohenschönhausen und Kaulsdorf – dort mussten die Erfolgszahlen möglichst realistisch umgesetzt werden, mit und ohne Hilfe der Jugendbrigaden aus den exotischsten Winkeln der Republik. In Berlin ging es aufwärts, wenn auch langsam; jedoch relativ schnell, gemessen an den Reparationszahlungen, die zum großen Bruder nach Moskau flossen. Im Osten Berlins herrschte immerhin sozialer Frieden.
Meine Kindheit fiel in die bunten ’70er. Die Eltern schufteten von Montag bis Freitag, und am Sonnabend, gerne auch am Sonntag, mimten wir die sozialistische Kleinbürgerfamilie. Wir zogen uns so unbequem wie möglich an und spazierten durch den Volkspark Friedrichshain. Parteigehorsam, ohne Parteibuch. Über dem reichgedeckten Tisch mit dampfendem Kaffee und Kakao, sowie frischem Pflaumenkuchen, baumelte von der Wohnzimmerlampe der eklige Fliegenfänger mit einigen daran klebenden Insekten, die eher weniger als mehr lebten.
Wir hatten doch alles, zumindest alles, was man im Fernsehen in Schwarz-Weiß gesehen hat, mitunter auch farbig im Kino, und später in den ’80ern sogar bunt im eigenen Fernseher. Bescheidenheit galt als Zier. Eine schöne Wohnung war oft auch spartanisch. Deutsch bleibt deutsch. Und sonntags ging es auf den Dachboden zur Badewannenpartie.
Die Erwachsenen hatten den Krieg miterlebt, und so sahen einige von ihnen auch aus; sie gingen mit einem Bein weniger an Krücken. Andere gestikulierten wild mit einem Arm, wie zum Ausgleich, weil auf der anderen Seite der leere Ärmel vom Jackett in die Tasche gesteckt worden war. Und dann erst dieses Zittern einzelner Gesichtsmuskel! Dennoch schienen diese Menschen meistens lustig drauf zu sein. Sie hatten den Krieg überstanden, dem Inferno getrotzt – wie die Samen der Eukalyptuspflanze im Stande sind, das Feuer zu überleben.
Unseren Prenzlauer Berg sahen viele Besucher und Spione zwar als armen Bezirk, doch wir Kinder wähnten uns reicher und unbeschwerter, als es unsere Eltern und Großeltern während ihrer Schulzeit gewesen sein dürften. Die Krüppel in den dreirädrigen Rollstühlen verschwanden bald aus dem Stadtbild, neue Kriegsinvaliden brachte die DDR nicht hervor. Allenfalls mal eine mittelalte Frau mit einer schwarzen Hand, hinter deren Rücken wir uns tuschelnd fragten, warum sie im Sommer einen Handschuh trug? War sie auch im Zorro-Film gewesen? Oder sollte das etwa eine …? Krass! Sie kam lächelnd auf uns zu. Ja, das sei eine echte Prothese, es hätte einen blöden Unfall in der Stadt des Friedens gegeben, aber das Leben ginge weiter, müsse ja. Für uns war sie von nun an „die Fabrikarbeiterin“. Eine Ikone der Diktatur des Proletariats.
Als Jungpioniere wollten wir fröhlich sein und singen, stolz das blaue Halstuch tragen, andern Freude bringen. Später wurden wir Thälmann-Pioniere, bekamen rote Halstücher, die wir, bevor wir zum Pionier-Nachmittag gingen, immer häufiger links liegenließen. Ach, vergessen, zu spießig. Und als wir in die Pubertät hineinwuchsen, wurden wir in die Freie Deutsche Jugend aufgenommen. Als Halbstarke wehrten wir uns gegen das Tragen eines Blauhemdes. FDJler erschienen uns als zu glatt und angepasst. Doch was wir zuallerletzt darstellen wollten, das waren diese Kirchen-Kindings; die sahen uns zu krass nach Hinterhofbauern aus. In meinem Kulturkreis verspürte niemand Bock auf das Bibelstundenkoma, auf das gestelzte Ausleben der Meinungsfreiheit, wo alles fünfmal durchgekaut wurde, was auch mit einem Dreiwortsatz gesagt werden konnte.
Der vermeintliche Feind aus Berlin-West funkte tief ins Land: RIAS, SFB, BBC. Wir ließen uns freiwillig von Rock, Pop, Blues, Metal und Punk sozialisieren.
„Wenn die Heizer kommen und total aufdrehen / als ob sie nicht von dieser Welt wären / Und es den Müttern wieder nicht gelungen ist / ihre Süßen einzusperren“.
Uuuhhh, Lindenberg! Rhythm and Blues, Rock’n’Roll. Endlich hatte sich uns der Zauber des vermeintlich strukturlosen Gebrummes erschlossen. Bei den Rolling Stones ging es drunter und drüber. Alles aus England und seinen Kolonien war sehr gut. Unser Wolf Biermann hieß Bon Scott. Wir interessierten uns für Andy Warhol, den blassen Karpaten-Andrew, schon weil er in den USA gelandet war – anders als unsere ebenso weltweit gefeierte Rinnstein-Künstlerin Käthe Kollwitz. Schöne Schlager waren nur noch was für Jugendliche, die ihre Halstücher nicht abzulegen wussten – und für Kirchen-Kindings.
Mit dem Stimmbruch entschwanden die lieblichen Töne aus dem Munde. Man hatte den Sitzenbleiber-Blues und wurde hässlich. Haare sprossen hervor, nicht nur an den Beinen. Helge Schneider schlussfolgerte Jahre später für so viele von uns: „Ich hatte keine Jugend, ich hatte Pickel.“





























