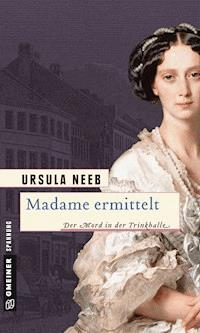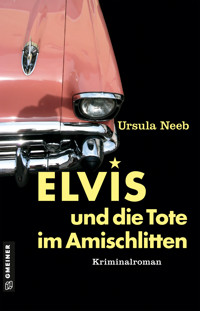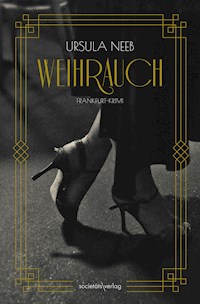8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ullstein Ebooks in Ullstein Buchverlage
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2011
In der Nacht von Allerseelen beobachtet der Totengräber ein dunkles Ritual. Am Morgen findet er im Beinhaus die Leiche einer jungen Frau. Der Verdacht fällt auf ihn, er soll gehenkt werden. Nur seine Tochter Katharina ist von seiner Unschuld überzeugt. Sie sucht den wahren Mörder und gerät dabei immer tiefer in den Sog einer Bruderschaft, die Meister Tod verehrt ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
Das Buch
Frankfurt am Main im Jahre 1509: In der Nacht von Allerseelen beobachtet der Totengräber Heinrich Sahl eine Gruppe vermummter Gestalten, die auf dem Friedhof seltsame Rituale vollziehen. Am nächsten Morgen entdeckt er im Beinhaus die Leiche einer jungen Frau. Die Obrigkeit geht davon aus, dass es sich um das Werk von Teufelsanbetern handelt, und beauftragt einen Inquisitor mit der Aufklärung des Falles. Bald wird der Totengräber der schrecklichen Tat verdächtigt und der Folter unterzogen. Lediglich die Totenwäscherin Katharina Bacher ist von der Unschuld ihres Vaters überzeugt. In Anna, der Schwester der Ermordeten, findet sie eine Verbündete. Über alle Standesgrenzen hinweg freunden sich die Patrizierin und die Geächtete an. Im Zuge ihrer Ermittlungen geraten die beiden immer tiefer in den Sog einer ominösen Todesbruderschaft und müssen um ihr Leben bangen …
Die Autorin
Schon während ihres Studiums der Geschichte, Kulturwissenschaften und Soziologie begeisterte sich Ursula Neeb für das späte Mittelalter, insbesondere für die geächteten Bevölkerungsgruppen. Aus der eigentlich geplanten Doktorarbeit entstand später ihr erster Roman »Die Siechenmagd«. Sie arbeitete als Archivarin und Bilddokumentarin beim Deutschen Filmmuseum und bei der FAZ. Heute lebt sie als Autorin mit ihren beiden Hunden in Seelenberg im Taunus.
Ursula Neeb
Das Geheimnis der Totenmagd
Historischer Roman
Besuchen Sie uns im Internet:www.ullstein-taschenbuch.de
Alle Rechte vorbehalten. Unbefugte Nutzungen, wie
etwa Vervielfältigung, Verbreitung, Speicherung oder
Übertragung können zivil- oder strafrechtlich
verfolgt werden.
Originalausgabe im Ullstein Taschenbuch
1. Auflage Juli 2011
© Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin2011
Umschlagkonzept: HildenDesign, München
Umschlaggestaltung: Zero Werbeagentur, München/Artwork HildenDesign, München, unter Verwendung von Motiven von © John Foley/Trevillion images und agk images
Satz und eBook: LVD GmbH
I. TEIL KÖNIG TOD
»So ist doch der Tod zu allen Zeiten bereit für Junge wie für Alte, und niemand ist begabt für ihn.«
Prolog
Die Fackeln waren fast schon heruntergebrannt, als er endlich von ihr abließ. Auch er schien allmählich am Ende seiner Kräfte zu sein.
»Wer bist du?«, fragte er sie ein letztes Mal, während er sich ächzend erhob und mit blutigen Fingern seinen Hosenlatz zuknöpfte.
»Ein Nichts und ein Niemand … ich bin ein Nichts und ein Niemand«, stammelte die Frau mit schwerer Zunge und wimmerte leise. Ihr Mund war von den vielen Schlägen wund und geschwollen, alles tat ihr weh. Das Gesicht, der Kopf, jeder Knochen im Leibe. Am höllischsten aber waren die Schmerzen an ihrem Geschlecht. Unzählige Male war er mit roher Gewalt in sie eingedrungen, hatte auf sie eingeprügelt und sie gewürgt und ihr immer wieder die gleiche Frage gestellt. Sie hatte ihm schließlich die Antwort gegeben, die er hören wollte. Damit er endlich aufhörte.
Ich bin ein Nichts und ein Niemand …
»So ist es. Jetzt scheinst du es kapiert zu haben. Hat ja auch lange genug gedauert«, blaffte er sie an und zog ein Glasfläschchen aus seiner Hosentasche. »So, das säufst du jetzt, damit du einen leeren Kopf bekommst«, befahl er und träufelte ihr etwas davon in den Mund. »Nicht, dass in dem allzu viel drin wär. Aber das wenige, was drin ist, ist lauter dummes Zeug.«
Er grinste höhnisch auf sie herunter, ergriff eine der Fackeln, löschte die übrigen und stapfte breitbeinig aus dem Verlies.
Sobald sie seine Schritte nicht mehr hörte, steckte sie sich einen Finger in den Rachen und erbrach sich mit heftigem Würgen neben den Strohsack. Es kostete sie zwar einige Überwindung, denn sie hätte die betäubende, einschläfernde Wirkung der Droge weiß Gott gut gebrauchen können. Doch sie wusste genau, dass es kein Entrinnen mehr gab, wenn sie sich dem Rausch überlassen und wieder in die alte Lethargie fallen würde. Dann wäre sie rettungslos verloren. Entrückt wie all die anderen in eine dunkle Schattenwelt, die unaufhaltsam in den Tod mündete. Und sie wollte nicht sterben.
Nein, alles in ihr schrie nach Leben!
1
Frankfurt am Main, den 28. Oktober 1509
Hildegard Dey zog die Tür des Frauenhauses »Zum Rosengarten« hinter sich zu und rümpfte die Nase. An diesem Oktoberabend roch es hier an der Frauenpforte keineswegs nach Rosen. Das brackige Wasser des nahen Stadtgrabens, die Fäkalien, die in den Main geleitet wurden, und die Fleischabfälle der nahen Gerbereien verströmten einen penetranten Kloakengeruch. Mit beiden Händen hielt die junge Hübscherin ihren langen dunklen Umhang zusammen, den der Wind immer wieder aufbauschte. Niemand sollte das schwefelgelbe Untergewand sehen, das sie als wohlfeile Frau kenntlich machte. Hildegard seufzte. Ein einziges Wort ihres Geliebten, und nur zu gern würde sie ihren schändlichen Erwerb aufgeben. Ihm jedoch schien vor allem daran gelegen, dass das Verhältnis, das sie seit nahezu drei Monaten miteinander hatten, nicht ruchbar wurde. Was sie, auch wenn es schmerzte, verstehen konnte, denn wer eine feste Liaison zu einer Hübscherin aus dem Frauenhaus unterhielt, wurde aus jeder Zunft ausgeschlossen und von der Allgemeinheit verachtet. Jemand wie er musste als angesehene Standesperson auf seinen guten Ruf bedacht sein.
Die neunzehnjährige Hildegard gehörte zu den begehrtesten Huren der Stadt. Sie war es gewöhnt, dass die Männer ihr zu Füßen lagen und sie entsprechend hofierten und bezahlten. Lange genug im Gewerbe, war ihr Herz dabei immer unberührt geblieben. Auch wenn sie es trefflich verstand, ihren Verehrern glühende Leidenschaft vorzuspiegeln, war das Verhältnis zu ihren Galanen doch stets ein rein geschäftliches gewesen. Nie hätte sie sich träumen lassen, dass es einmal anders sein könnte. Ganz anders. Und nun hatte sie unverhofft die Liebe erfahren – mit allem, was dazugehörte.
Als sie endlich in die Sandgasse einbog, wo ihr Geliebter in einem der imposanten Steinhäuser wohnte, zitterten ihr vor Aufregung und sehnsüchtiger Erwartung die Knie. In seinen Armen war sie unsagbar glücklich, sie hatte nur den Wunsch, dass dieser Zustand niemals enden möge. Geld nahm sie schon lange keines mehr von ihm, und wenn ihm daran gelegen gewesen wäre, hätte sie sich keinem anderen Mann mehr hingegeben. Doch das schien ihm egal zu sein. Ihm lag an Distanz, außer wenn er mit ihr schlief. Dann war er voller Leidenschaft und unersättlich. Er war der erste Mann, bei dem sie Lust empfand, und inzwischen konnte sie einfach nicht genug von ihm bekommen. Auch wenn er zuweilen recht grob werden konnte. Er nahm sie oft so heftig, dass es weh tat, hatte sie vor Erregung schon geschlagen, und das letzte Mal hatte er sie sogar gewürgt, als er sich in sie verströmte.
Dezent klopfte sie an das Portal seines Wohnhauses. Heute öffnete er ihr anstelle seines alten Leibdieners persönlich die Tür und bereitete ihr, kaum dass sie eingetreten war, einen schier atemberaubenden Empfang. Er trug nichts weiter als einen knöchellangen Umhang aus blutroter Seide, unter dem sie seinen nackten sehnigen Körper sehen konnte. Er war schon sehr erregt, riss ihr förmlich die Kleider vom Leib und nahm sie noch in der Halle. Trunken vor Glückseligkeit ergab sie sich ihm und hätte vor Wollust vergehen mögen.
In den frühen Morgenstunden des nächsten Tages entdeckten die Torwächter der Galgenpforte eine Frauenleiche im Stadtgraben. Die Tote, die anhand ihrer gelben Kleidung unschwer als Hübscherin zu erkennen war, trieb mit dem Gesicht nach unten im trüben Morast der Uferböschung.
Die Wächter riefen den Stadtphysikus und die Bürgerpolizei. Der Medicus machte sich nicht die Mühe, den schlammverkrusteten Leichnam mit dem langen honigfarbenen Haar genauer in Augenschein zu nehmen. Er befühlte nur kurz die Halsschlagader und bemerkte lapidar: »Die ist mausetot. Ist wahrscheinlich ertrunken.«
Der Polizeibüttel streifte die Tote mit abschätzigem Blick und brummelte: »Wahrscheinlich hat sich das Weibsbild die Nacht über im Galgenviertel herumgetrieben und ist dann besoffen in den Graben gefallen. Oder es wurde von zwielichtigem Gesindel, von dem es ja im Galgenviertel nur so wimmelt, ins Wasser gestoßen. Am besten wird es sein, den Züchtiger herzubestellen. Der soll sie sich mal angucken, ist doch eine von seinen Menschern.«
Nachdem der Henker, dem die städtischen Frauenhäuser unterstanden, die schlanke Tote als die Hure Hildegard Dey identifiziert hatte, wurde der Leichnam auf einen Leiterwagen geworfen und zur Totenkapelle auf dem Peterskirchhof gekarrt.
*
Als Katharina Bacher die polternden Schritte ihres Mannes draußen auf der Treppe vernahm, sprang sie von ihrem Strohsack auf, breitete sich ein Wolltuch über die Schultern und eilte zum Kachelofen, um Feuer zu machen. Schlaftrunken schichtete sie die Holzscheite aufeinander und gähnte dabei herzhaft. Gerne wäre sie an diesem trüben, regnerischen Oktobermorgen noch in ihrem warmen Bett geblieben und hätte weiter vor sich hin gedöst. Doch es grauste sie vor Ruprechts Branntweingeruch und seiner Zudringlichkeit, und so hatte sie lieber darauf verzichtet.
Der Nachtwächter Ruprecht Bacher, der gerade seinen Dienst beendet hatte, trat in die Stube, ging auf seine Frau zu und drückte ihr einen Kuss auf den Mund. Katharina wandte unwillkürlich den Kopf zur Seite.
»Guten Morgen, mein Mädchen«, sagte er gut gelaunt. »Was ist das für ein Wetter draußen! Jetzt freu ich mich aber auf mein warmes Bettchen.« Er entledigte sich seines regennassen Umhangs und dann seiner übrigen Kleidung. Als er nur noch die wollene Unterkleidung trug, die über seinem kugelförmigen, vorgewölbten Bauch spannte, rieb er sich behaglich die Hände und gurrte zärtlich wie ein verliebter Täuberich: »Willst du dich nicht noch ein bisschen zu mir legen?«
Katharina verzog missmutig das Gesicht. Es war doch immer wieder dasselbe mit ihm.
»Nein, das will ich nicht«, erwiderte sie gereizt. »Ich hab genug Arbeit. Schlaf du nur.« Ein wenig milder setzte sie hinzu: »Wenn du Hunger hast, kann ich dir gleich noch die Brühe warm machen.«
»Verschon mich bloß mit deiner Suppe!«, knurrte der Nachtwächter ärgerlich. »Mir ist nach was anderem. Man ist ja schließlich ein gesund empfindendes Mannsbild und kein Klosterbruder …«
»Dann musst du halt ins Hurenhaus gehen!«, unterbrach ihn Katharina barsch und blies aufgebracht in die Glut.
»Und so was muss man sich von der eigenen Frau anhören«, murmelte Ruprecht bitter. Er nahm den Weinkrug vom Wandbord, goss sich einen Becher voll und stürzte ihn in einem Zug herunter. »Kein Wunder, dass man säuft«, bemerkte er mit finsterem Gesichtsausdruck.
»Onkel Rupp, jetzt hör aber auf!« Katharina hatte sich vor ihrem Mann aufgebaut und funkelte ihn wütend an. »Das war schon bei unserer Heirat klar, ich habe dir diesbezüglich nie etwas vorgemacht. Fang also nicht wieder damit an. Für mich warst du immer wie ein Onkel, den ich sehr gern hatte, aber mehr auch nicht. Daran hat sich bis heute nichts geändert. Ich sorg für dich, mach dir den Haushalt und stehe treu zu dir. Aber was anderes darfst du nicht von mir erwarten, das weißt du genau. Also hör endlich auf, dich und mich damit zu quälen.« Sie beugte sich zu ihrem Mann hinunter, der mit trübsinniger Miene am Tisch saß, und strich ihm begütigend über das kahle Haupt.
»Du bist mir lieb und wert, und ich halte zu dir, in guten wie in schlechten Zeiten. Darauf kannst du dich verlassen, Onkel Rupp. Nur das eine verlange bitte nicht von mir.«
»Ich weiß doch, mein Mädchen. Ist schon recht«, presste Ruprecht hervor und goss sich noch Wein nach. »Den trink ich jetzt noch, und dann geh ich schlafen«, erläuterte er gähnend. In wenigen Schlucken hatte er den Trinkbecher geleert und wankte zum Strohsack, während ihm Katharina einen guten Schlaf wünschte.Und hoffentlich einen tiefen,dachte sie bei sich, räumte den Tisch ab und bereitete sich einen Haferbrei zu. Als sie gleich darauf Bachers Schnarchen hörte, atmete sie erleichtert auf, setzte sich auf die inzwischen warme Ofenbank und löffelte verschlafen ihren Frühstücksbrei.
Als Tochter des städtischen Totengräbers war Katharina Bacher von klein auf von Tod und Vergänglichkeit umgeben, was aber ihr Wesen keineswegs zu trüben schien. Im Gegenteil: Ihre bernsteinfarbenen Augen strahlten vor Energie und Lebenslust, und wenn sie lächle, so sagten die Menschen, die ihr zugetan waren, gehe regelrecht die Sonne auf. Früh hatte Katharina erfahren müssen, dass der Tod zum Leben dazugehörte, untrennbar mit ihm verbunden war. In seinem Schatten hatte sie gelernt, ihm die Lebensfreude gleichsam abzutrotzen. Bereits als Mädchen hatte sie der Mutter bei der Totenwäsche geholfen und war dadurch in ihre Tätigkeit hineingewachsen. Auch wenn ihr der Respekt für die Toten längst in Fleisch und Blut übergegangen war, so hatte sie doch durch ihren Beruf eine eher nüchterne Beziehung zum Tod entwickelt. Sie fand, dass der Tod weniger Rätsel barg, als die Menschen immer zu glauben schienen.
Für die jetzt22-Jährige war das Leben ungleich faszinierender als der Tod, und sie sehnte sich unsagbar nach dem Glück einer erfüllten Liebe, das sie an der Seite ihres zwanzig Jahre älteren, ungeliebten Ehemannes bislang so schmerzhaft vermisste. Wie so häufig fragte sie sich, ob ihr das jemals beschieden sein würde, und schaute wehmütig in den trüben, wolkenverhangenen Himmel, der sich hinter den regennassen Butzenscheiben des kleinen Turmfensters abzeichnete. Während sie noch ihren Gedanken nachhing, ertönte von unten das laute, durchdringende Geräusch des Türklopfers, und sie schreckte zusammen. Rasch erhob sie sich von der Ofenbank, eilte die Wendeltreppe herunter und entriegelte die schwere Eichentür. Gleich darauf blickte sie in das grellgeschminkte Gesicht einer jungen Hübscherin.
»Gott zum Gruße«, murmelte sie erstaunt und fragte die Hure nach ihrem Begehr.
»Gott zum Gruße«, erwiderte die gelbgewandete Frau und musterte Katharina scheinbar gleichermaßen verwundert. »Ihr seid doch die Bacherin, die, wo die Toten waschen tut?«
»Ja, die bin ich«, erwiderte Katharina und musste unversehens grinsen. Schon häufig hatte sie es erlebt, dass die Leute über ihre äußere Erscheinung verblüfft waren, weil sie sich unter einer Totenmagd ein hutzliges altes Weib vorstellten.
»Ursel Zimmer, die Vorsteherin der städtischen Hurengilde, schickt mich. Ich soll Euch mit der Totenwäsche unserer Gildeschwester Hildegard beauftragen, die heut’ in der Früh tot im Stadtgraben aufgefunden worden ist.« Der jungen Hure traten die Tränen in die Augen, und sie hatte Mühe weiterzusprechen.
»Mein Beileid«, erwiderte Katharina schlicht. »So tretet doch bitte ein, Ihr werdet ja ganz nass.«
Zögernd trat die junge Frau über die Schwelle. »Ich danke Euch«, murmelte sie. »Das hätte längst nicht jede gemacht. Ich meine, dass Ihr eine von uns hereinkommen lasst. – Jedenfalls möchte ich Euch bitten, hernach auf den Peterskirchhof zu gehen und unsere Schwester herzurichten. Für morgen ist die Beerdigung angesetzt, und wir möchten uns vorher noch … von Hildegard verabschieden.« Sie schniefte und wischte sich die Tränen von den Wangen.
»Keine Sorge, ich mach mich nachher gleich auf zum Friedhof«, versprach die Totenfrau und verabschiedete sich freundlich von der Hübscherin.
Ehe die Frau im gelben Gewand aus der Tür trat, drehte sie sich noch einmal zu Katharina um. »Wenn die Arbeit getan ist, bittet Euch die Zimmerin, ins Frauenhaus zu kommen und Euch den Lohn abzuholen.«
*
Um die zwölfte Stunde verließ Katharina ihre Behausung im Stadtturm links der Galgenpforte und machte sich um einiges zu früh auf den Weg zum Peterskirchhof, um die Leiche der Hübscherin zu waschen. Sie hatte es eilig, ihrem Zuhause zu entkommen, wo der verliebte alte Tor bald aufwachen würde. Gemächlich schlenderte sie an den Verkaufsständen am Rande des Rossmarkts entlang, nahm die verlockenden Spezereien in Augenschein, die für sie immer unerschwinglich bleiben würden, und ignorierte die herablassenden und feindseligen Blicke der behäbigen Bürgersfrauen. Hier und da hielt sie einen Schwatz mit fremden Marktfrauen, die sie nicht kannten und von ihrem verfemten Berufsstand nichts ahnten.
Als sie an einem Stand vorbeikam, an dem geröstete Maronen feilgeboten wurden, obsiegte ihr Heißhunger gegenüber der auferlegten Sparsamkeit. Sie erstand eine Handvoll der köstlichen Esskastanien, die sie im Weitergehen genüsslich verzehrte. Immerhin würde sie ja heute noch ein paar Groschen verdienen, wenn sie nachher die tote Hure herrichtete. Wenn sie am Nachmittag damit fertig war, würde sie heimgehen und ihrem Mann die Abendmahlzeit zubereiten. Dann musste er auch bald seinen Dienst als Nachtwächter antreten, und sie hatte ihre Ruhe vor ihm.
Als sie wenig später den Friedhof betrat und auf das Bahrhaus zustrebte, in dem ihr Vater eine Kammer bewohnte, war sie noch so in Gedanken versunken, dass sie den Pfarrer gar nicht bemerkte, der ihr entgegengeeilt kam. Beinahe wäre sie mit ihm zusammengestoßen.
»Gelobt sei Jesus Christus«, murmelte sie erschrocken und verbeugte sich artig in seine Richtung.
»Dank sei Gott dem Herrn«, entgegnete Pfarrer Juch unwirsch und schüttelte ungehalten sein kahles Haupt. »Wo steckt denn nur wieder dein Vater? In ein paar Tagen begehen wir das Fest der Toten, und drüben im Beinhaus sieht es wieder mal aus wie Kraut und Rüben! Man muss sich ja schämen …«
Wenn er nicht zu Hause oder auf dem Kirchhof ist, sitzt er womöglich in irgendeiner Schenke und lässt sich volllaufen,dachte Katharina besorgt, doch sie erklärte nur betreten, dass sie nicht wisse, wo sich ihr Vater aufhalte. Als der Geistliche ihre Befangenheit bemerkte, mäßigte er seinen Tonfall und äußerte milder:
»Na, du kannst ja nichts dafür, Kind«, und wandte sich mit einem knappen »Gott zum Gruße« zum Pfarrhaus.
Wenn der den Vater auf seine alten Tage nur nicht noch wegen seiner Sauferei vor die Tür setzt.Bekümmert setzte Katharina ihren Weg fort.
Nachdem sie in der Kammer ihres Vaters einen großen Bottich mit heißem Wasser bereitet und ihre Arbeitsutensilien zusammengetragen hatte, ging sie in die an der westlichen Friedhofsmauer gelegene Totenkapelle, wo die Toten gewaschen und aufgebahrt wurden. Dort lag auch der schlammverkrustete Leichnam der jungen Hübscherin.
Ehe Katharina mit der Säuberung begann, bekreuzigte sie sich vor der Toten und hielt ihr eine brennende Kerze an Mund und Nase, um sicherzugehen, dass die Frau tatsächlich nicht mehr lebte. Auch wenn sie es selbst noch nicht miterlebt hatte, ereignete es sich doch zuweilen, dass angeblich Verstorbene als Scheintote zu Grabe getragen wurden, weil eine genauere Prüfung versäumt worden war.
Im Falle der jungen Hübscherin aber brachte kein Hauch die Flamme zum Flackern.Noch nicht einmal die Augen haben sie ihr geschlossen,stellte Katharina unmutig fest und senkte behutsam die Lider der Toten über die deutlich hervorgetretenen Augäpfel. Dann befreite sie den Körper von dem schmutzstarrenden gelben Gewand und wusch zunächst die Haare und das Gesicht der jungen Frau. Auf einmal hielt sie erschrocken inne. Am Hals der Toten waren dunkle Flecken zu sehen. Würgemale!Die ist erwürgt worden. Genau wie die Bademagd, die ich im Frühjahr gewaschen habe.Angespannt überlegte die Totenwäscherin, was sie tun sollte.
Damals hatte sie, gleich nachdem sie bei der Totenwäsche die bläulichen Blessuren am Hals der Toten festgestellt hatte, die Bürgerpolizei verständigt. Doch der diensthabende Polizeibüttel hatte ihr erklärt, für derlei habe man jetzt, wo in wenigen Tagen die Frühjahrsmesse eröffnet werde, fürwahr keine Zeit. Streitereien unter dem Badestubengesindel gebe es immer wieder, das brauche keinen zu verwundern. Sie solle gefälligst ihre Arbeit machen und sich nicht in Dinge einmischen, die sie nichts angingen, beschied er sie und schob sie aus der Wachstube.
Katharina hatte sich sehr darüber geärgert. Natürlich wusste sie, dass eine Reiberin aus der Badestube gewöhnlich nicht viel taugte und ein liederliches Frauenzimmer war, aber hatte sie nicht wie alle Leute, die meuchlings ermordet worden waren, ein Recht darauf, dass der Täter gefasst und bestraft wurde? Sie hatte mit ihrem Vater gesprochen, und der hatte ihr dringend geraten, den Mund zu halten und nichts weiter zu unternehmen. Widerstrebend folgte sie seinem Rat.
Bei den stumpfsinnigen Stangenknechten würde Katharina sich jedenfalls nicht noch einmal das Maul verbrennen. Der Gedanke, die Sache einfach auf sich beruhen zu lassen, behagte ihr allerdings auch nicht.
»Armes Ding, wer hat dir das nur angetan?«, flüsterte sie mitleidig und streichelte der Toten liebevoll über die kalte Wange. »Wo du doch so eine Schöne bist!«
Sie kämmte der Toten sorgfältig das lang wallende Haar und fuhr mit der Totenwäsche fort. Als sie behutsam die zur Faust verkrampfte linke Hand der Hübscherin öffnete, um sie auch innen vom Schmutz zu reinigen, fand sie darin einen Stofffetzen. Erstaunt begutachtete Katharina das Stück Stoff genauer. Es war ein zerknittertes Dreieck aus scharlachroter Seide.
»Seltsam«, murmelte die Totenwäscherin nachdenklich, während sie das durchweichte Stoffstück ins Licht der Kerze hielt.Am Ende stammt es gar von ihrem Mörder. Sie hat es ihm womöglich beim Todeskampf aus der Kleidung gerissen.Rote Seide – dann muss es aber ein feiner Pinkel gewesen sein.Denn Rot war von alters her eine Herrenfarbe, die armen Leuten gar nicht zu tragen erlaubt war. Und seidene Gewänder konnten sich gleichfalls nur Wohlhabende leisten. Schlagartig wurde ihr klar, dass sie ihre Entdeckungen unbedingt der Hurenkönigin melden musste.
Als Katharina die Tote fertiggewaschen hatte, streifte sie ihr ein einfaches leinenes Totenhemd über. Dann klemmte sie ihr eine Pomeranze unters Kinn, um den Leichengeruch abzumildern und den Unterkiefer zu fixieren, rückte ihr den Kopf zurecht, damit das Gesicht zum Himmel gerichtet war, und faltete die Hände der Verstorbenen über der Brust. Die Kerze ließ sie brennen und stellte, wie es Brauch war, kleine Tiegel mit Milch und Honig für die Totengeister unter die Bahre.
*
Um die dritte Nachmittagsstunde bog Katharina auf dem Weg zum Frauenhaus eilig in die Mainzergasse ein. Sie war aufgeregt und fröstelte, was nicht alleine an den rauen Witterungsverhältnissen lag. Der Himmel war voll dunkelgrauer Wolken, und durch die langgezogene enge Gasse fegte ein eisiger Wind. Aber zu wissen, dass irgendwo in der Stadt ein Mörder, der junge Frauen erwürgte, unbehelligt seiner Wege ging, erfüllte sie mit größerem Unbehagen.
Endlich hatte sie die westliche Stadtmauer erreicht, wo das Frauengässchen entlangführte, und gleich darauf stand sie vor dem Frauenhaus »Zum Rosengarten«. Katharina war ängstlich, denn sie war noch nie zuvor in einem Frauenhaus gewesen und wusste nicht so recht, was sie dort erwartete. Aber sie fasste sich ein Herz und erklomm mit flinken Schritten die Stufen zur Eingangstür.
Im nächsten Augenblick ging die Tür auf, und ein Mann kam so schnell heraus, dass Katharina ihm nicht mehr ausweichen konnte. Sie geriet ins Straucheln und konnte sich gerade noch am Geländer festhalten. Dabei fiel ihr das Stückchen Seidenstoff, das sie die ganze Zeit über sorgsam in der Hand gehalten hatte, auf die Stufen.
»Könnt Ihr denn nicht besser achtgeben«, entfuhr es ihr gereizt, während sie sich nach dem roten Stofffetzen bückte. Auch der Mann hatte sich sofort vorgebeugt, und so prallten sie erneut zusammen, dieses Mal sogar mit den Köpfen, was die Totenwäscherin mit einem ärgerlichen »Auweh!« quittierte.
»Bitte entschuldigt meine Ungeschicklichkeit«, murmelte der hochaufgeschossene junge Mann in der abgetragenen Schaube und verbeugte sich ritterlich, während er Katharina den Flicken reichte. Immer noch konsterniert, betrachtete sie ihn genauer.Was für ein hübscher Kerl,fuhr es ihr durch den Sinn. Sein Gesicht war feingeschnitten und wurde von schulterlangen rotblonden Haaren umrahmt. Helle, meergrüne Augen musterten sie unverblümt, so dass sie verschämt den Blick senkte.
Der junge Mann hingegen sah sie mit unverhohlener Bewunderung an. »Ihr seid sehr liebreizend«, entfuhr es ihm.
»Was erlaubt Ihr Euch! Habt Ihr Euch im Hurenhaus nicht schon genug verlustiert, dass Ihr nun auch noch ehrbare Frauen belästigen müsst?«, fauchte ihn Katharina an. Dann trat sie energisch ins Haus und ließ ihn einfach stehen.
»Nein, es ist nicht so, wie Ihr denkt«, konnte ihr der Fremde gerade noch hinterherrufen, ehe die Tür hinter ihr zufiel.
Er blieb noch eine geraume Weile draußen auf der Treppe stehen, vollkommen in seine Impressionen versunken – ganz so, als wäre für ihn die Zeit stehengeblieben.
Als eine junge Hure die Totenwäscherin ins Zimmer der Hurenkönigin führte, blickte ihr die ältere Frau mit verweinten Augen entgegen. Sie saß am Fenster und flickte offenbar gerade Wäsche. Katharina hatte ihre imposante Gestalt bislang nur aus der Ferne gesehen, nun konnte sie zum ersten Mal ihr Antlitz betrachten. Die Vorsteherin der städtischen Hurenzunft hatte ein Gesicht, dem man ansah, dass sie gelebt hatte. Unter einer dicken Schicht Schminke zeichnete sich eine Vielzahl an Falten und Fältchen ab, auch kleinere Narben waren auf der großporigen Haut zu sehen. Dennoch war ihr Gesicht alles andere als unattraktiv. Der große, wohlgeformte Mund mit den purpurrot geschminkten Lippen kündete von Stolz und Lebensfreude, und den ausdrucksvollen, fast schwarzen Augen schien nichts Menschliches fremd zu sein. Katharina war beeindruckt. Trotz ihres verachteten Standes ging von der Hurenkönigin etwas Würdevolles aus. Die Totenmagd grüßte etwas verschüchtert.
»Jungfer Zimmerin, ich muss mit Euch reden«, erklärte sie ernst.
»So nehmt doch Platz, Bacherin, und sagt mir, was Ihr auf dem Herzen habt.« Die Hurenkönigin rückte einen weiteren Stuhl ans Fenster und legte fürsorglich noch ein Kissen darauf. »Habt Ihr unsere tote Schwester schon hergerichtet, oder seid Ihr noch nicht dazu gekommen? – Es ist Euch doch sicher ausgerichtet worden?«, erkundigte sich die Gildemeisterin.
»Doch, doch, und ich habe sie auch schon gewaschen. Deshalb bin ich ja hier«, entgegnete Katharina angespannt.
»Ach so, Ihr wollt sicher Euren Lohn haben. Wie töricht von mir! Seht es mir nach, Kind, in meinem Alter ist man manchmal etwas schwerfällig. Wartet, ich gebe es Euch gleich.« Die Hurenkönigin nestelte aus dem Ausschnitt ihres Kleides einen kleinen Lederbeutel hervor und entnahm ihm ein paar Münzen.
»Nein, deswegen bin ich nicht gekommen, das hat noch Zeit«, unterbrach sie Katharina. »Es gibt etwas, das ich Euch unbedingt sagen muss. Mir ist vorhin bei der Totenwäsche etwas aufgefallen am Leichnam Eurer Schwester.«
»Was denn?« Die Hurenkönigin blickte alarmiert, sie schien das Unheil bereits zu wittern.
Als Katharina die Würgemale beschrieb, schrie die Zimmerin entsetzt auf. »Heilige Muttergottes! Welcher Drecksack hat dem armen Kind nur sowas angetan?«
»Und das hier habe ich in ihrer zusammengeballten Hand gefunden.« Die Totenmagd präsentierte der Hurenkönigin den roten Seidenflicken.
Diese nahm ihn mit bebenden Fingern entgegen, besah ihn von allen Seiten und überlegte angestrengt. »Rote Seide. – Wer, zum Teufel, kann das nur sein? Von unseren Galanen hier im Frauenhaus wüsst’ ich keinen, der ein Wams oder einen Mantel aus roter Seide trägt.« Unverwandt starrte sie auf den Stoff, als könnte er ihr den Träger preisgeben.
»Ich habe die Obrigkeit noch nicht davon in Kenntnis gesetzt«, fuhr Katharina fort, »sondern wollte es erst Euch persönlich sagen. In einem ähnlichen Fall im letzten Frühjahr bin ich nämlich zur Bürgerpolizei gegangen, aber man hat mir nur ein freches Maul angehängt und mich wieder fortgeschickt. Deswegen bin ich diesmal gar nicht erst hin. Aber ich finde das nicht rechtens, wenn eine erwürgt wird und das dann still und heimlich untern Teppich gekehrt wird, nur weil es ein liederliches Frauenzimmer war. Und so habe ich mir gedacht, ich sage es Euch, und Ihr könnt dann überlegen, was Ihr unternehmen wollt.«
»Ich danke Euch sehr, Jungfer Bacherin. Eure Mitteilung macht mich tief betroffen. Dass unsere Schwester so jäh von uns gegangen ist, ist beileibe schon schlimm genug für mich und meine Schwestern von der städtischen Hurenschaft.« Die Hurenkönigin rang sichtlich um Fassung. »Aber dass sie nun auch noch so schändlich gemeuchelt wurde, ist einfach unerträglich!« Ihre Stimme bebte, und ihre schwarzen Augen funkelten vor Zorn.
Eine echte Löwenmutter,dachte Katharina bewundernd.
»Ihr seid eine ehrliche Haut, Totenwäscherin, und ich bin sehr froh, dass Ihr damit zu mir gekommen seid. Aber ich könnte förmlich die Wände hochgehen, wenn ich an diese dumpfen Polizeibüttel denke, die wieder einmal auf beiden Augen blind waren, nur weil es um eine von uns ging. Die hätten doch selber sehen müssen, dass das Mädel abgemurkst worden ist! Aber bloß nicht genauer hingucken, wenn eine Hure im Graben liegt. Die ist ersoffen, und damit fertig.«
Sie schüttelte empört den Kopf. »Wisst Ihr, wäre unsere Schwester im Frauenhaus ermordet worden, dann hätte der Schuft, der sie auf dem Gewissen hat, nichts zu lachen. Die Frauenhäuser des Rates gelten seit alters her als befriedete Orte, und wer darin mit Worten oder Taten frevelt, der verfällt sogar der doppelten Strafe. So schützt der Rat seine freien Töchter, die nicht unerheblich dazu beitragen, die städtische Schatulle zu füllen.«
Mit erhobener Stimme ereiferte sich die kräftige Frau: »Man braucht uns zwar, aber man verachtet uns auch! Wir haben keine Bürgerrechte, und in der Kirche müssen wir ganz hinten auf der Hurenbank sitzen. Dabei kommen zu uns die hohen Herren und die reichen Pfeffersäcke, Ehrengäste der Stadt vergnügen sich mit ihrer ganzen Gefolgschaft oft tagelang im Frauenhaus. Für ihre Lust sind wir gut genug, ansonsten sind wir für sie der letzte Dreck!«, wetterte die Hurenkönigin grimmig. »Nichts da, meine Herren, so haben wir nicht gewettet! Immerhin ist eine freie Tochter des Rates ermordet worden, und da hat der Magistrat sich gefälligst darum zu kümmern. Ich renn denen im Rathaus jetzt die Tür ein und pack sie bei den Eiern, die feinen Herren. Und wenn’s der Herr Schultheiß persönlich ist, umso besser. Der hat lange genug bei mir gelegen.« Sie erhob sich von ihrem Stuhl und wandte sich an Katharina.
»Hier, Bacherin, das ist für Eure Mühe«, sagte sie und steckte ihr eine Silbermünze zu.
»Aber, das ist ja viel zu viel, das kann ich doch nicht annehmen!«, protestierte die Totenfrau.
»Doch, nehmt das nur. Ihr seid ja schließlich auch nicht auf Rosen gebettet und könnt es bestimmt gut gebrauchen. Kauft Euch was Schönes dafür, mein Kind.«
»Aber das war doch selbstverständlich … dafür braucht Ihr mich doch nicht zu bezahlen.«
»Nix da, Ihr nehmt das jetzt und damit Schluss!«, entschied Ursel Zimmer streng. »Ich bezahl Euch ja nicht für Euren Anstand. Der ist sowieso mit Geld nicht aufzuwiegen. – Komm, mein Mädchen, ist schon in Ordnung so«, fügte sie mit gutmütigem Lächeln hinzu, während sie Katharina umarmte und an ihren mächtigen Busen drückte. Katharina, die ihre verstorbene Mutter zuweilen bitter vermisste, genoss die mütterliche Zärtlichkeit und bedankte sich noch einmal höflich für die großzügige Spende.
Als sie zur Tür ging, gewahrte sie in der Zimmerecke eine Staffelei mit einem Gemälde. Obgleich das Porträt noch unfertig war, konnte sie darauf eindeutig die Züge der Hurenkönigin erkennen, die mit meisterlichen Pinselstrichen skizziert waren.
»Ach, wie schön! Das seid ja Ihr!«, äußerte sie bewundernd.
»Ja, das hat ein junger, sehr begabter Maler aus der Nachbarschaft gefertigt«, erwiderte die Hurenkönigin stolz. »Die Mädchen haben es bei ihm in Auftrag gegeben. Es soll mein Geburtstagsgeschenk werden.«
*
Kaum war die Totenwäscherin fort, eilte Ursel Zimmer zum Römerrathaus und bestand darauf, sogleich zum Bürgermeister geführt zu werden.
Die Hurenkönigin, die das fünfzigste Lebensjahr bereits überschritten hatte und sich seit nunmehr zwei Jahrzehnten als Gildemeisterin um die Belange der städtischen Hurenschaft kümmerte, konnte sehr aufbrausend und ungnädig sein, wenn es darum ging, die Angelegenheiten der Hübscherinnen vor den Stadtoberen zu vertreten. Daher fürchteten die hohen Herren des Rates, die nahezu ausnahmslos zu ihren ehemaligen Kunden zählten, die Zimmerin. So war es auch Bürgermeister Reichmann recht unbehaglich zumute, als ihm von einem Rathausdiener gemeldet wurde, die Hurenkönigin wünsche ihn zu sprechen.
Gleich darauf trat Ursel Zimmer in seine Amtsstube. Höflich bat er sie, auf einem Lehnstuhl vor seinem Schreibtisch Platz zu nehmen, und erkundigte sich, was er für sie tun könne. Die Zimmerin streifte den Würdenträger mit einem kurzen durchdringenden Blick, bei dem Reichmann das Gefühl hatte, sie könnte auf dem Grund seiner Seele den einen oder anderen schwarzen Fleck genau erkennen. Dann kam sie, ganz, wie es ihre Art war, gleich zur Sache:
»Eine Eurer freien Töchter ist ermordet worden. Ich erwarte daher vom Magistrat, dass er in der Angelegenheit umgehend tätig wird.«
»Ach, Ihr meint bestimmt die Hure, die am Morgen ertrunken im Stadtgraben gefunden wurde«, erkundigte sich der Bürgermeister vorsichtig. Seine lange, spitze Nase hatte sich seit dem Auftauchen der Hurenkönigin leicht gerötet.
»Genau die meine ich. Es handelt sich im Übrigen um die Hübscherin Hildegard Dey, die dem Herrn Bürgermeister ja gut bekannt sein dürfte«, fügte sie spitz hinzu, während Reichmann verlegen den Blick senkte. »Mitnichten aber ist Hildegard ertrunken, sondern sie wurde, wie die Würgemale an ihrem Hals bekunden, eindeutig erdrosselt. Nur der Totenmagd Katharina Bacher, die die Tote im Auftrag der Hurengilde gewaschen und hergerichtet hat, ist es zu verdanken, dass dies überhaupt ruchbar geworden ist. Die Büttel, die sie heute Morgen gefunden haben, haben wohl noch geschlafen, dass sie das nicht bemerkt haben. Und auch dem herbeigerufenen Stadtarzt war unsere Schwester wohl keines genaueren Blickes wert.« Die Zimmerin schnaubte aufgebracht und schlug mit der flachen Hand auf die polierte Mahagoniplatte des Schreibtisches. Augenblicklich zuckte der Bürgermeister zusammen wie ein Scholar, den der Rohrstock des Magisters ereilt hatte. Doch die Hurenkönigin ließ ihm nicht mal die Zeit, Atem zu holen.
»Ich möchte den Herrn Bürgermeister nur noch einmal daran erinnern, dass nicht nur das Frauenhaus und sein gesamtes Inventar Eigentum des Rates sind, sondern dass er seinen freien Töchtern gegenüber auch eine Verantwortung und Sorgfaltspflicht hat. Schließlich tragen sie durch ihr Gewerbe nicht unerheblich dazu bei, die städtischen Schatullen zu füllen. Ich muss den Rat mit allem Nachdruck dazu auffordern, einen Untersuchungsrichter mit der Aufklärung des Falles zu betrauen, damit der schändliche Mensch, der Hildegard auf dem Gewissen hat, alsbald gefasst wird.«
Der Bürgermeister, dessen spitze Nase inzwischen einen satten Rotton angenommen hatte, nickte nur anheischig und versicherte der Hurenkönigin mit dem gebührenden Ernst, er werde noch heute alles Nötige in die Wege leiten.
*
Am nächsten Morgen betrat der Untersuchungsrichter Melchior Lederer das Sterbehaus auf dem Peterskirchhof. Er trug eine ausgeprägte Leichenbittermiene zur Schau, denn er war wenig erfreut darüber, sich sein ohnehin nicht gerade glänzendes Renommee durch Ermittlungen im Hurenmilieu noch mehr zu beschädigen. Als er die aufgebahrte Leiche in der Ecke der Totenkapelle gewahrte, überlegte er kurz, ob er sie sich vorab schon einmal anschauen sollte, entschied sich aber, auf den Stadtphysikus zu warten, der jeden Moment eintreffen musste.
Während Richter Lederer steifbeinig und mit gesenktem Kopf durch die Leichenhalle trippelte, gemahnte er in seinem fadenscheinigen schwarzen Amtstalar, den kleinen, eng zusammenstehenden Augen und der langen Nase an eine übergroße Saatkrähe. Wenig später betrat der Stadtarzt Stefenelli die Totenkapelle. Er war gleichfalls nicht besonders erbaut, ein zweites Mal wegen einer ersoffenen Hure konsultiert zu werden. Nachdem der Arzt, der in seiner edlen pelzverbrämten Schaube und der modischen Kappe aus Biberhaaren weltmännische Vornehmheit ausstrahlte, den Untersuchungsrichter begrüßt hatte, machten sie sich auch sogleich ans Werk.
Während der Leichenschau, die kaum zehn Minuten dauerte und sich vor allem auf die dunklen Hautverfärbungen am Hals der Toten konzentrierte, bemerkte der Arzt nur mit einigem Zynismus: »Na, da hat wohl einer im Eifer des Gefechts zu fest zugedrückt, und weg war sie.«
Der Untersuchungsrichter stimmte nicht minder hämisch zu: »Soll ja bei derlei Frauenzimmern häufiger vorkommen, dass ein eifersüchtiger Galan mal grob wird und über die Stränge schlägt. – Ob sich ein solcher indessen ausfindig machen lässt, da hege ich so meine Zweifel«, grummelte er kopfschüttelnd.
»Bei der ist doch halb Frankfurt ein und aus gegangen«, bemerkte Doktor Stefenelli abschätzig und verzog angewidert sein markantes Raubvogelgesicht. »Ihr seid um Eure Aufgabe fürwahr nicht zu beneiden, mein Guter. Meine Arbeit indessen ist beendet: Es handelt sich eindeutig um Tod durch Erwürgen. Eine weitergehende Visitation erübrigt sich demnach, und die Leiche kann unbedenklich unter die Erde geschafft werden.«
»Gut, dann lasse ich den Totengräber und den Pfarrer verständigen, dass das Hurenbegräbnis begangen werden kann«, entgegnete Lederer knapp und verließ hinter dem Arzt die Leichenhalle.
Als sich die beiden Herren der Friedhofspforte näherten, kam ihnen die Hurenkönigin entgegen und stellte sich ihnen resolut in den Weg.
»Nun, was ist jetzt? Ich erbitte umgehend einen ausführlichen Rapport«, forderte sie, während sie ihre Arme in die ausladenden Hüften stemmte und die beiden Männer abwechselnd mit unbeugsamen Blicken fixierte.
Doktor Stefenelli fühlte sich augenscheinlich nicht bemüßigt, daraufhin etwas zu erwidern. Er setzte eine unbeteiligte Miene auf und überließ die Beantwortung seinem Begleiter, der sich vor Unbehagen wand. Dann setzte er zu einer knappen amtlichen Erklärung an:
»Die soeben erfolgte Leichenschau der städtischen Hübscherin Hildegard Dey hat ergeben, dass dieselbe eines gewaltsamen Todes gestorben ist. Anhand der blauen Male im Kehlkopfbereich muss davon ausgegangen werden, dass sie erwürgt wurde. Wir werden der Sache nachgehen und versuchen, den Täter ausfindig zu machen, was indessen nicht einfach sein wird. Bei den zahlreichen Männerbekanntschaften, die die Ermordete ja aufgrund ihres … Gewerbes hatte, wird man bei der Tätersuche wohl, wie soll ich sagen: vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr sehen.« Den letzten Satz hatte der Untersuchungsrichter mit einem Grinsen von sich gegeben, was die Hurenkönigin mit tiefem Ingrimm erfüllte.
»Wenn man den Wald nicht sehen will,mag das vielleicht zutreffen, Herr Richter«, erwiderte die Zimmerin in schneidendem Tonfall. »Ich hingegen kenne einen jeden, der bei uns im Frauenhaus ein und aus geht, Anwesende nicht ausgenommen. Ich erinnere mich an nahezu jedes Gesicht, das ich in des Rates freien Häusern jemals gesehen habe. Wenn es Euch weiterhilft, komme ich gerne zu Euch in die Amtsstube und nenne Euch die Namen aller, die zu Hildegards Galanen gehörten. Es sind in der Tat nicht wenige. Und dem einen oder anderen wird es auch nicht sonderlich gefallen, wenn er dabei genannt wird.« Sie warf dem Stadtarzt einen bezeichnenden Blick zu. »Es ist eigentlich auch nicht meine Art, die Namen unserer Kundschaft preiszugeben. Aber in diesem Fall, da es um die heimtückische Ermordung einer Gildeschwester geht, werde ich es tun.«
»Von mir aus, kommt vorbei, wenn Ihr Euch davon einen Nutzen versprecht«, presste Lederer hervor. Er wollte sich schon zum Gehen wenden, als ihn die Hurenkönigin erneut ansprach:
»Und was ist mit dem roten Stofffetzen, den ich Euch übergeben habe? Habt Ihr Euch dazu schon ein paar Gedanken gemacht? Oder meint Ihr am Ende gar, es lohnt der Mühe nicht, weil man ja ohnehin vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr sieht?«
»Nein, nein, dem werden wir schon noch nachgehen«, murmelte Lederer.
»Das will ich auch schwer hoffen. Und seid Euch gewiss: Ich werde Euch dabei über die Schulter blicken! Morgen bin ich bei Euch und nenne Euch ein paar Namen«, zischte die Hurenkönigin Lederer zu, der unwillkürlich vor ihr zurückwich wie ein verängstigtes Kaninchen vor der Schlange.
Mit belegter Stimme stieß er hervor: »Morgen ist Sonntag, am Montag ist Allerheiligen und am Dienstag Allerseelen. Kommt meinethalben am Mittwoch, da bin ich wieder im Dienst.« Dann drehte er sich um und strebte endgültig dem Ausgang zu.
»Was ist denn das für eine Arbeitsmoral? Immerhin geht es darum, einen Mord aufzuklären. Um einen Mörder zu suchen, sollte man auch am Feiertag arbeiten!«, rief ihm die Zimmerin empört hinterher.
*
Wie im Leben, so waren auch die Menschen im Tode nicht gleich. Wurden wohlhabende Tote in ein feines Totengewand gekleidet, so reichte es bei anderen noch nicht einmal für ein letztes Hemd. Nackt, wie Gott sie geschaffen hatte, wurden die Armen von der Totenwäscherin oder einer Spitalmagd in ein Leichentuch eingenäht.
Die sterblichen Hüllen von Begüterten hingegen bestattete man in kunstvollen Holzsärgen, Vornehme sogar in Sarkophagen. Die Besitzlosen trug man auf dem wiederverwendbaren Totenbrett zu Grabe, das der Stadt gehörte.
Selbst auf dem Friedhof war die Gemeinschaft der Toten ähnlich gegliedert wie die der Lebenden: Arme und Reiche hatten jeweils separate Begräbnisplätze, und das galt erst recht für die Schandbaren und Verachteten. War ihnen im Leben schon ein Platz am Rande der Gesellschaft und meist auch am Rande der Stadt zugewiesen, so setzte sich dies im Tode noch fort. Des Rates freie Töchter und andere in niederen Diensten Stehende hatten ihre vorgeschriebenen Plätze im abgelegenen nördlichen Bereich, dort, wo der Peterskirchhof mit seinen vielen Obstbäumen und dem grasbewachsenen Boden einem verwilderten Garten glich.
In Frankfurt konnten es sich nur die Wohlhabenden leisten, in Einzelgräbern beigesetzt zu werden. Dort sollten die Toten so tief in der Erde zu liegen kommen, wie sie groß waren, was dem Totengräber einiges an Arbeit abverlangte. Bei armen Leuten dagegen musste er sich weniger Mühe machen. Ihre Leichen wurden in einen großen Graben gepackt und mit etwas Erde bedeckt. Die Friedhofsvorschrift bei einem Armenbegräbnis bestimmte, dass das Erdreich den Leichnam gerade mal eine Elle hoch bedecken musste.
Auch die Kuhle, die der Totengräber für die sterblichen Überreste der ermordeten Hübscherin ausgehoben hatte, war nicht sehr tief. Im Erdreich waren noch die Knochen und Leichenteile anderer Verstorbener zu erkennen. Der Totengräber und ein Gehilfe, die das Totenbrett in Ermangelung anderer Leichenträger von der Totenkapelle an der Westmauer bis zum Armenbezirk getragen hatten, kippten den in ein Leinentuch eingenähten Leichnam ohne großes Zeremoniell in die Grube. Der Pfarrer der Peterskirche, der zu diesem Anlass auf Weihrauch und andere kostspielige Devotionalien verzichtet hatte, besprengte die Tote mit Weihwasser, verlas, wie bei Hurenbegräbnissen üblich, das Gleichnis »Jesu Salbung durch die Sünderin« aus dem Lukas-Evangelium, sprach noch ein paar knappe, vorwurfsvolle Worte über Buße und Vergebung und warf die erste Schaufel Erde auf die Tote.
Als Katharina den Friedhof betrat, war die kurze kirchliche Zeremonie bereits vorüber und die städtischen Hübscherinnen und ihre Vorsteherin Ursel Zimmer drängten sich um das Grab ihrer ermordeten Gildeschwester.
Als die Huren die Anwesenheit der Totenwäscherin bemerkten, begrüßten sie Katharina mit großem Respekt. Vor allem die Hurenkönigin schien es ihr hoch anzurechnen, dass sie zu der Beisetzung gekommen war, und dankte ihr im Namen der Hurengilde für ihr Erscheinen.
Katharina stellte sich etwas abseits, um den Trauernden nicht im Wege zu stehen, und ließ ihre Blicke verstohlen über die anwesenden Hübscherinnen gleiten. In ihrer Nähe stand eine junge Frau, die von auffallender Schönheit und Grazie war, sie konnte aber auch ältere Frauen ausmachen, die eher gewöhnlich und verlebt wirkten. Alle waren wie stets in ihre grelle Hurentracht gekleidet, denn den Hübscherinnen war es selbst zu diesem Anlass verboten, Trauerkleidung anzulegen. Die Huren hielten Zitronen oder Pomeranzen in den Händen, um sie der Verstorbenen nach der Aussegnung ins Grab zu werfen. Mit den kostspieligen Früchten wollten sie ihre Wertschätzung gegenüber der toten Gildeschwester zum Ausdruck bringen. Der Reihe nach traten sie an das offene Grab. Die Frauen waren tief ergriffen und weinten, auch der Hurenkönigin rannen die Tränen über die Wangen.
Obgleich Katharina die Verstorbene nicht gekannt hatte, war sie selbst den Tränen nahe. Es tat ihr einfach leid, dass die junge Frau so früh hatte sterben müssen. Schon wollte sie sich unauffällig zurückziehen und die Trauergemeinde verlassen, als jemand sie von hinten sachte am Mantel fasste. Sie drehte sich um und gewahrte die Hurenkönigin.
»Jungfer Bacherin, wollt Ihr uns nicht die Ehre erweisen und dem Leichenschmaus beiwohnen? Wir wollen im Frauenhaus unserer Schwester gedenken«, erkundigte sie sich mit bittendem Unterton. Katharina willigte dankend ein und hielt sich wartend im Hintergrund.
Plötzlich stieß eine der Huren einen gellenden Schrei aus und deutete entsetzt auf etwas, das offenbar auf der Erde lag. Andere stimmten in schriller Panik ein, Rufe wie »Wiedergänger« und »Untote« waren zu vernehmen, und selbst die Hurenkönigin war vor Entsetzen kreidebleich geworden.
Katharina trat näher, um die Ursache des Schreckens genauer in Augenschein zu nehmen, und gewahrte eine halbverweste Hand, die neben der ausgehobenen Grube aus dem Erdreich ragte. Fürwahr ein schrecklicher Anblick, der selbst furchtlose Gemüter das Grauen lehren konnte!
»Es bewegt sich!«, schrie eine der Huren panisch. Tatsächlich war die Hand wieder zur Hälfte in der Erde verschwunden, so, als wäre sie von dem Toten selbst zurückgezogen worden.
Katharina, der als Totengräbertochter solche schaurigen Phänomene bekannt waren, versuchte, die Hübscherinnen zu beschwichtigen: »Ruhig Blut, das ist nichts Schlimmes. So etwas kommt immer wieder mal vor, wenn eine frische Kuhle ausgehoben wird. Dadurch verändern die anderen Toten, die in der Nähe verscharrt wurden, ihre Lage und fallen in sich zusammen. Das sieht schrecklich aus, ist aber ganz normal. Das sind keine Wiedergänger, glaubt mir, die sind alle schon lange tot.«
Nach und nach gelang es ihr, die verschreckten Frauen zu besänftigen. Doch nun hatten es alle recht eilig, den Friedhof zu verlassen.
Als Katharina wenig später gemeinsam mit den Huren dem Frauengässchen zustrebte, konnte sie es bei aller Beherztheit nicht verhindern, dass ihr eine schwelende Furcht im Nacken saß, die sie wie eine böse Ahnung noch den Abend und einen Großteil der Nacht umklammert hielt.
2
Am Abend von Allerheiligen fegten bereits die ersten Vorboten der Novemberstürme, begleitet von heftigen Regenschauern, durch die Gassen der Frankfurter Neustadt. Ein Wetter so recht zum Verkriechen; wer nicht unbedingt musste, blieb in der Stube und machte es sich auf der warmen Ofenbank gemütlich. Man trank heißen Würzwein und lauschte den schaurigen Geschichten, die sich seit alters her um das Fest der Toten rankten. In jener Nacht, so erzählte man sich, zögen die Jenseitigen durch die Gassen, pochten an die Haustüren der Lebenden, kehrten in die Häuser von Menschen ein, die ihnen einst zugetan waren, und hielten dort Nachtmahl. Dann machten sie sich davon, ohne Spuren oder Schaden zu hinterlassen, es fehle auch nichts von den Speisen. Wen auch immer die Wiedergänger unterwegs anträfen, der müsse sie auf ihrer Nachtfahrt begleiten. Die Heimgesuchten kehrten zwar zurück, seien fortan jedoch wunderlich und seltsam entrückt. Sie lebten nicht mehr länger im Hier und Jetzt und könnten weder Freud noch Leid empfinden.
Wer immer an diesem Abend kurz vor der achten Stunde die lange, hagere Gestalt erblickt hätte, welche im schwarzen kuttenartigen Mantel mit spitz zulaufender Kapuze durch die einsame Vilbeler Gasse hastete, der hätte mit Sicherheit einen Entsetzensschrei ausgestoßen und behauptet, er habe einen solchen Wiedergänger gesehen.
Heinrich Sahl, den städtischen Totengräber, hätte das nicht verwundert, er war es gewohnt, dass sich die Leute vor ihm fürchteten. Sein ausgemergelter Körper, die bleiche Gesichtsfarbe und die tiefen Ringe um die wässrigen Augen riefen selbst am helllichten Tage ein Raunen unter den Stadtbürgern hervor.
»Da geht Freund Hein!«, hieß es, wenn er vorüberhuschte, und man erzählte sich, er stehe mit dem Jenseits in Kontakt und sei hellsichtig genug, das nahe Ende eines Menschen zu erspüren. Wenn er über den Markt schritt oder eine Schenke betrat, wichen alle seinem Blick aus, denn es wurde gemunkelt, wen er anlächle, der werde sein nächster Kunde.
Als Sohn eines Totengräbers war Heinrich Sahl mit der Verachtung und Feindseligkeit seiner Umwelt aufgewachsen. Aus dem stillen Jungen war ein in sich gekehrter, scheuer Mensch geworden, der seit seiner Kindheit unter tiefer Schwermut litt. Seit vielen Jahren war er dem Alkohol ergeben, und nach dem Tod seiner Frau, die er vor zwei Jahren an die Pest verloren hatte, war seine Trunksucht noch stärker geworden.
Das war auch der Grund, warum er bei diesem Unwetter noch um die Häuser strich. Sein Weinvorrat war zur Neige gegangen, und er hatte sich bei einem Weinhändler an der alten Bornheimer Pforte einen schweren Krug säuerlichen Frankfurter Weißweins geholt, den er nun sorgsam unter seiner regennassen Kutte verbarg. Die heftigen Sturmböen peitschten ihm eisige Regengüsse ins Gesicht, und die Kapuze hing ihm vor den Augen, so dass er kaum noch etwas erkennen konnte. Endlich war er vor der Peterskirche angelangt und trat durch die hinter der Kirche gelegene Friedhofspforte auf den Gottesacker. Er ging ein ganzes Stück an der hohen Friedhofsmauer entlang, die verhindern sollte, dass herumstreunende Tiere die eben verscharrten Leichen ausgruben und auffraßen, bis er vor dem Bahrhaus am Südende des Peterskirchhofs angelangt war. Dies war sein Reich, hier bewahrte Sahl Totenbretter und Arbeitsutensilien auf und bewohnte eine kleine Kammer. Unter dem Vordach des Bahrhauses flackerte das Licht der Totenleuchte, eine Öllampe in einem steinernen Pfeiler, der dem hageren Totengräber bis zur Brust reichte. Das ewige Licht als Zeichen der Fürbitte für die armen Seelen.
»Sapperlot, was für eine Nacht!« Keuchend und völlig durchnässt betrat Heinrich Sahl seine dunkle Behausung und stellte den Weinkrug behutsam auf dem Boden ab. Er tastete in dem Holzstapel neben dem erkalteten Ofen nach einem Kienspan und trat erneut nach draußen zur Totenleuchte. Die Hände schützend darübergebreitet, hielt er das Holzstück in die Flamme, bis es Feuer gefangen hatte, trug es in der hohlen Hand zurück in seine Kammer und entzündete damit eine Talgkerze auf dem Wandbord. Mit zitternden Händen goss er sich Wein in einen Trinkbecher und leerte ihn in einem Zug.
Nachdem er den Becher abgesetzt hatte, zog er den Mantel wieder eng um den mageren Körper und begab sich erneut hinaus, um zum nahe gelegenen Friedhofsportal an der Schäfergasse zu laufen. Knirschend drehte sich der große Bartschlüssel im Schloss, als der Totengräber das Tor für seinen bald erwarteten Besuch aufschloss.
Nachdem er in die stickige, feuchtkalte Stube zurückgekehrt war, entledigte er sich schlotternd seiner nassen Kleidung, rückte einen Schemel an den Tisch und genehmigte sich noch einen Schoppen.
Wenig später klopfte es an der Tür, und ein beleibter Mann betrat die Stube, dicht gefolgt von einem schwarzweißen Hund, der ebenso vor Nässe troff wie sein Herr.
»Gott zum Gruße, Ruprecht«, sagte Sahl mit heiserer Stimme.
»Grüß dich, Heinrich«, erwiderte der Besucher und nickte dem Totengräber zu. »Was für eine unwirtliche Nacht.« Während der Hund den Totengräber freundlich anwedelte, entledigte sich der Mann seiner Lanze und einer Pechfackel, die der Regen zum Erlöschen gebracht hatte, legte den durchnässten Umhang ab, stellte eine Steingutflasche auf den Tisch und setzte sich.
Der städtische Nachtwächter Ruprecht Bacher war Heinrich Sahls einziger Freund. Seit über zwanzig Jahren verband die beiden fast gleichaltrigen Männer, die innerhalb der städtischen Ordnung ganz unten standen, eine alte Kameradschaft. Bachers Eheschließung mit Sahls jüngster Tochter Katharina vor fünf Jahren hatte dazu beigetragen, dass sich die so zurückhaltenden Männer noch näher gekommen waren.
Heinrich Sahl blickte in das bekümmerte Gesicht seines Schwiegersohns und dachte sich sein Teil. Er wusste gut genug, dass der Nachtwächter in der Ehe mit Katharina häufig unglücklich war.
»Und, wie geht’s bei euch daheim?«, fragte er vorsichtig.
»Wie soll’s schon gehen?«, brummte Ruprecht. »Ehrlich gesagt: beschissen!«
»Du kannst einem leidtun, Rupp. Komm, lass uns einen trinken.« Sahl klopfte dem Freund ermutigend auf die Schulter und füllte zwei Trinkbecher mit einem ordentlichen Quantum Branntwein, den die Männer schweigend hinunterkippten. Der Totengräber wusste, dass es einiges brauchte, um die Zunge des schweigsamen, in sich gekehrten Ruprecht ein wenig zu lockern. Auch wenn es dann eher gestammelte Andeutungen waren, die er von sich gab, als ausführliche Schilderungen. Einmal hatte Ruprecht sogar geweint.
»Ich kann ihr ja nichts vorwerfen«, stieß der Nachtwächter nach einer Weile des Schweigens hervor. »Sie versorgt den Haushalt tadellos und ist mir gegenüber immer anständig. Hat mir auch noch niemals Hörner aufgesetzt, obwohl sie an jedem Finger zehn Galane haben könnte, so liebreizend wie sie ist. Sie liebt mich halt nicht. Was kann man da machen?« In Ruprechts vom Alkohol geröteten Augen glitzerten Tränen.
Heinrich Sahl, dem nicht viel einfiel, was er hätte erwidern können, grummelte nur: »Arme Haut!«
Wie so häufig plagten ihn dabei nagende Schuldgefühle. Die Ehe der beiden war seine Idee gewesen. Er hatte damals nur das Beste gewollt für seinen Freund und für seine Tochter, und als ihm Katharina offen gesagt hatte, dass sie für den Mann, der ihr Vater hätte sein können, nichts empfinde, hatte er entgegnet, dass die meisten Ehen weniger auf Liebe gründeten als auf gegenseitigen Respekt. Damit war das Thema für ihn erledigt gewesen. Wie hätte er denn ahnen können, dass seine pragmatische Entscheidung zwei Menschen, die ihm am Herzen lagen, ins Unglück stürzen würde?
Ruprecht, der dazu neigte, seinen Kummer in sich hineinzufressen, war in den letzten Jahren ebenfalls zum Trinker geworden. Zwar hatte er auch früher schon bei seinen nächtlichen Wachgängen immer eine Branntweinflasche dabeigehabt, um die Einsamkeit und Ödnis der endlos langen Nächte besser ertragen zu können, aber inzwischen betrank er sich jede Nacht, und oft tat er dies mit Heinrich Sahl gemeinsam. Und Katharina, die schon immer der Augenstern ihres Vaters war, hatte nie einen Hehl daraus gemacht, dass sie an der Seite des korpulenten, kahlköpfigen Nachtwächters nicht glücklich war. Immer wieder musste Sahl sich eingestehen, dass sein Sonnenschein eigentlich etwas Besseres verdient hatte. Doch er hütete sich, dies auszusprechen.
Der Totengräber schenkte dem Schwiegersohn von dem säuerlichen Wein ein und legte ein paar Wecken und Würste auf den Tisch.
»Iss nur, Rupp, das ist von dem Leichenschmaus geblieben, den die Huren am Freitag abgehalten haben«, forderte er seinen Gast auf, ohne sich selber etwas von den Speisen zu nehmen.
Es war ein alter Brauch, die Überbleibsel des Leichenschmauses, der zu Ehren des Verstorbenen nach dessen Beisetzung begangen wurde, dem Totengräber zu bringen, und die Hurenkönigin hatte sich nicht lumpen lassen. Sie hatte dem alten Friedhofswärter ein paar fette Leber- und Blutwürste überlassen, bei deren Anblick dem Nachtwächter, erst recht aber seinem Hund förmlich das Wasser im Munde zusammenlief. Der Totengräber, dem die großen flehenden Augen des Tieres und sein erregtes Schnüffeln nicht entgangen waren, ergriff schließlich das Ende einer Wurst und warf es mit gutmütigem Lächeln dem Hund vor, der es mit einem Biss gierig hinunterschlang und kräftig mit dem Schwanz wedelte.
»Das ist vielleicht ein Sauwetter heute«, brummte der Nachtwächter zwischen zwei Bissen.
»Und, haste wenigstens nen Geist gesehen?«, fragte Sahl und verzog den Mund zu einem schiefen Lächeln.
»Dafür bist du doch zuständig«, gab Bacher zurück. »Ich hab nur ein paar arme Gesellen getroffen, die Kutten trugen. Bettelmönche oder dergleichen. Hab sie ins Pilgerhospiz geschickt.«
Nachdem die Männer schweigend noch ein paar Becher geleert hatten, erhob sich der Nachtwächter ächzend, um sich wieder an die Arbeit zu machen. Pünktlich zur neunten Stunde musste er von der Balustrade des Rathauses auf dem Römerberg die Zeit verkünden. Dazu brauchte er jedoch nicht nüchtern zu sein, denn die Verse, die er aussang, kannte er in- und auswendig.
Ruprecht Bacher stellte erleichtert fest, dass der Regen nachgelassen hatte, entzündete seine Pechfackel an der Totenleuchte und schlurfte leicht wankend zur Friedhofspforte. Plötzlich hörte er in der Nähe ein Geräusch. Im flackernden Licht der Fackel kam es ihm vor, als huschten dunkle Schatten über den Kirchhof. Auch der Hund schien etwas wahrgenommen zu haben, er knurrte drohend. Ein Schauder überlief den Nachtwächter. So schnell er konnte, eilte er zur Friedhofspforte und stürzte hinaus auf die Schäfergasse.
Sein Atem ging schnell, doch einige Schritte später schon hatte er sich gefasst. Ein Hirngespinst, weiter nichts. Nicht ungewöhnlich in so einer unheimlichen Nacht. Ruprecht besann sich auf seine Pflicht, zog seinen Mantel enger und beschloss, dass die Gestalten auf dem Kirchhof nur ein Trugbild durch Schnaps und Wein gewesen waren.
Zielstrebig eilte er zum Römerrathaus und erklomm die Stufen zur Balustrade, um von dort die neunte Stunde anzusingen. Seit nunmehr fünfundzwanzig Jahren wiederholte er Nacht für Nacht seine Verse, Stunde für Stunde, von Sonnenuntergang, wenn die Stadttore geschlossen wurden, bis Sonnenaufgang, wenn die Torwächter sie wieder öffneten. Für jede Uhrzeit gab es einen eigenen Stundenruf. Je weiter die Nacht voranschritt, desto länger wurden die Verse und umso eindringlicher die Bitte um Schutz vor den Mächten der Finsternis. Von allen Versen war ihm das Tagansingen der liebste: »Der Tag vertreibt die finstre Nacht, auf, auf, ihr braven Leut’, erwacht!« Während die Menschen der Stadt aufstanden und sich an ihr Tagwerk machten, konnte er endlich seinen Dienst beenden und sich zu Bett begeben.
Nach dem Verkünden der neunten Stunde verließ der Nachtwächter den Rathausbalkon und drehte seine vorgeschriebenen Runden durch die schlafende Stadt. Eigentlich fürchtete sich Ruprecht schon lange nicht mehr vor der Dunkelheit. Als er allerdings in dieser Nacht durch die menschenleeren Gassen schritt, an der Stadtmauer entlang, während die Herbststürme an den Türmen rüttelten und irgendwo in der Ferne ein Käuzchen anschlug, musste er an die armen Seelen denken. Er vermeinte, ihr Wehklagen zu hören, spürte die Furcht vor bösen Geistern und Nachtdämonen wie ein törichter alter Mann und sehnte sich unsagbar danach, in den Armen seiner Frau zu liegen.
*
Müde und betrunken, wollte sich Heinrich Sahl um die zehnte Stunde herum allmählich schlafen legen, als er auf einmal einen sonderbaren Gesang vernahm. Es war ein sich stets wiederholender Chor von düsteren Stimmen, eine eintönige, aber beschwörende Melodie, die aus einem abgelegenen Winkel des Friedhofs zu kommen schien. Er wankte nach draußen, um nach dem Rechten zu sehen, und hörte den Gesang nun deutlicher. Er drang eindeutig vom nördlichen Teil des Friedhofs zu ihm herüber.
»Verdammtes Gesindel«, fluchte er erbost vor sich hin, »müssen die einen jetzt auch noch in der kalten Jahreszeit behelligen!«
Nicht nur während der Pest waren Friedhöfe beliebte Treffpunkte und Versammlungsstätten gewesen, von gewissen Leuten wurden sie auch in ruhigen Zeiten aufgesucht. Da sich die meisten Menschen davor grauten, nach Einbruch der Dunkelheit auf den Friedhof zu gehen, blieben Ganoven und andere zwielichtige Gestalten dort ungestört. In warmen Sommernächten wurde ausgiebig dem verbotenen Glücksspiel gefrönt und Diebesgut verschachert, Huren, die nicht in einem der städtischen Frauenhäuser kaserniert waren, gingen auf dem verwilderten Gelände ihrem Gewerbe nach. Der Bereich an der Nordmauer des Peterskirchhofs war besonders beliebt, denn die angrenzende Gegend war nahezu unbewohnt. In den letzten Jahren hatte das Treiben so sehr überhandgenommen, dass Pfarrer Juch seinen Totengräber verschärft dazu angehalten hatte, das lichtscheue Gesindel zu verjagen. Schon mehrfach hatte er ihn des Nachts durch seine Wirtschafterin unsanft wecken lassen, weil Lärm und Gejohle vom Kirchhof bis zum Pfarrhaus tönten und Heinrich Sahl, seinen Rausch ausschlafend, nichts davon bemerkt hatte.
»Ich kann es keinesfalls dulden, dass unser heiliger Kirchhof durch diese sündigen Metzen entweiht wird!«, hatte Hochwürden gewettert. Als Sahl ihn nur mit betretener Miene ansah, herrschte er ihn erbost an: »Er, Sahl, hat mir persönlich dafür Sorge zu tragen, dass unser Peterskirchhof nicht durch deneffusio seminisaufs Schmählichste geschändet wird!«
»Was ist denn das, ein … Fusio herminis?«, erkundigte sich der Totengräber begriffsstutzig.
»Mensch, Kerl, Er kann einem aber auch noch den letzten Nerv rauben!«, schimpfte Pfarrer Juch unwirsch und wand sich regelrecht vor Unbehagen. »Das ist der Erguss männlichen Samens«, murmelte er errötend. »Die Heilige Kurie in Rom hat festgelegt, dass im Falle eines vollzogeneneffusio seminisder Kirchhof umgehend entsühnt werden muss. Und diese Schande, mein lieber Sahl, soll meiner Pfarrei erspart bleiben. Also, halte Er sich ran, Bursche, und sorge Er dafür, dass mein Kirchhof nicht zu einem Freudenhaus verkommt!«
Jetzt packte Heinrich den Spaten verärgert mit festerem Griff, um den Störenfrieden nötigenfalls drohen zu können, und eilte unsicheren Schrittes zur Nordmauer hin. Ein eisiger Novemberwind blies ihm gehörig um die Ohren und trug dazu bei, dass sein Kopf nach dem Trinkgelage ein wenig klarer wurde. Als er den schmalen Durchgang der Mauer erreichte, die den kleineren nördlichen Bezirk von dem weitaus größeren des neuen Gräberfeldes abteilte, tastete er vorsichtig die Maueröffnung ab. Schon einmal war es ihm während eines nächtlichen Kontrollgangs widerfahren, dass er in angetrunkenem Zustand gegen die Mauer gestoßen war und sich an einer der prunkvollen Grabinschriften, welche wohlhabende Frankfurter Bürger in den Schwibbögen hatten anbringen lassen, eine blutige Nase geholt hatte. Dann schob er sich durch den Durchlass.
Er holte noch einmal tief Luft, um sich in eine gewisse Kampfesstimmung zu versetzen, was dem friedliebenden Mann jedoch kaum gelang. Weitaus lieber wäre es ihm gewesen, sich der weinseligen Müdigkeit zu ergeben und ausgestreckt auf seinem Strohsack in bleiernen Schlaf zu versinken. Eher missmutig als aufgebracht lief er an den kahlen Obstbäumen vorbei in Richtung der nordöstlichen Mauerecke, wo sich, den gedämpften Stimmen nach zu urteilen, die Schlawiner aufhielten. Bald konnte er die Eindringlinge schon als Schemen wahrnehmen. Er nahm seinen ganzen Mut zusammen, strebte, den Spaten fest umklammert, geradewegs auf sie zu und wollte sie gerade in strengem amtlichen Tonfall zurechtweisen. Doch was er dann sah, raubte ihm den Atem. Hastig verbarg er sich hinter dem wuchtigen Stamm einer alten Eiche. Hoffentlich hatten ihn die Unholde nicht bemerkt!
Er sah vor sich eine Geisterschar in langen schwarzen Gewändern, die Gesichter wie von Blut überzogen. Im nächsten Moment erkannte er, dass es sich um dunkelrote Masken handelte, wie sie die Pestknechte zum Schutz gegen die Ausdünstungen zu tragen pflegten. Die schauerliche Schar vollführte einen gespenstischen Reigentanz um die Gräber. In der Mitte des Kreises stand eine Gestalt, die mit dem blanken Totenschädel und der weiten blutroten Kutte aussah wie der leibhaftige Tod. In den Händen hielt der Knochenmann einen brennenden Kienspan, den er nun einem der Geister übergab. Die unheimlichen Reigentänzer reichten das glimmende Holzstück im Kreis herum, bis es schließlich in den Händen eines der Vermummten erlosch. Dieser stieß einen gellenden Schrei aus und warf sich vor dem Gevatter auf den Boden.
»Gütiger Gott, steh mir bei«, flüsterte der Totengräber entsetzt.Hat jetzt etwa mein letztes Stündlein geschlagen?Ihm war es, als täte sich die Erde unter ihm auf und wollte ihn verschlingen. Ein grässlicher Gedanke erfasste ihn: Vielleicht hatten sich die Geister all jener Toten, die er jemals in der Friedhofserde vergraben hatte, gegen ihn verschworen und trachteten danach, ihn in ihr Totenreich hinabzuziehen?