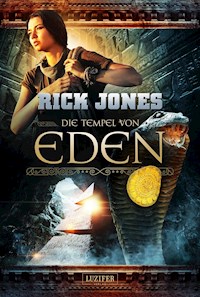Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Luzifer-Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2024
Joey Cavello, der an einer tödlichen Krankheit leitet, soll seine letzten Tage auf Erden in einem Hospiz verbringen. Doch dort wird er Zeuge seltsamer Vorkommnisse. Der gesamte Ort ist von einem seltsamen und undurchdringlichen Nebel umgeben, der die Bewohner gefangen hält, und im zweiten Stockwerk scheint eine mysteriöses, unheimliches Wesen zu hausen. Und was hat es mit dem verurteilenden, blinden Hospizleiter auf sich, der allwissend und allgegenwärtig zu sein scheint? Cavello verbündet sich mit den anderen Heimbewohnern, um das dunkle und übernatürliche Geheimnis des Hospizes zu lüften. Aber wird es ihnen rechtzeitig gelingen, bevor sie die ewige Verdammnis ereilt? Denn die Uhr tickt …
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 260
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Das Hospiz
Rick Jones
Impressum
Deutsche Erstausgabe Originaltitel: HOSPICE Copyright Gesamtausgabe © 2024 LUZIFER Verlag Cyprus Ltd. Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Cover: Michael Schubert Übersetzung: Peter Mehler
Dieses Buch wurde nach Dudenempfehlung (Stand 2024) lektoriert.
ISBN E-Book: 978-3-95835-889-8
Folgen Sie dem LUZIFER Verlag auf Facebook
Sollte es trotz sorgfältiger Erstellung bei diesem E-Book ein technisches Problem auf Ihrem Lesegerät geben, so freuen wir uns, wenn Sie uns dies per Mail an [email protected] melden und das Problem kurz schildern. Wir kümmern uns selbstverständlich umgehend um Ihr Anliegen.
Der LUZIFER Verlag verzichtet auf hartes DRM. Wir arbeiten mit einer modernen Wasserzeichen-Markierung in unseren digitalen Produkten, welche Ihnen keine technischen Hürden aufbürdet und ein bestmögliches Leseerlebnis erlaubt. Das illegale Kopieren dieses E-Books ist nicht erlaubt. Zuwiderhandlungen werden mithilfe der digitalen Signatur strafrechtlich verfolgt.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Inhaltsverzeichnis
Prolog
Joey Cavello, von der Last des Daseins gezeichnet, saß in seiner ungepflegten Wohnung, die die Unordnung seines eigenen Lebens widerspiegelte. Der Raum, vollgestopft mit Möbeln aus dem Secondhandladen, zeugte von seinem Mangel an Ehrgeiz. Leere Bierflaschen lagen auf dem Couchtisch, und Reste zerbröselter Kartoffelchips waren auf dem abgenutzten Teppich verstreut. In der Ecke flimmerte der Fernseher, dessen Ton aus abgenutzten Lautsprechern, die kurz vor der Kapitulation standen, immer wieder ausfiel. Alles in diesem Raum schien aus Überresten eines Lebens zu bestehen, das eher dem reinen Überleben als einem echten Zweck diente.
Joey, ein Mann mit sehnigen Muskeln und einem gestählten Körperbau, bewegte sich mit einer gewissen Trägheit, als er nach einem Bier aus dem Kühlschrank griff. Doch als er zu der Couch zurückkehren wollte, durchfuhr ein plötzlicher Schmerz seinen Unterleib und strahlte auf seinen Rücken aus. Die Flasche entglitt seinem Griff und verschüttete ihren Inhalt in Form von Schaum auf den bereits befleckten Teppich. Ein Schmerzensschrei drang über seine Lippen, als er auf die Knie sank und eine Hand fest gegen seine schmerzende Seite presste.
Mit zusammengebissenen Zähnen und schmerzverzerrtem Gesicht sank Joey zu Boden und blieb auf dem Rücken liegen. Er starrte nach oben, den Blick auf die Decke gerichtet, und Wellen von Schwindel überkamen ihn. Seine Sicht flackerte und schwankte zwischen Momenten der Klarheit und verschwommener Unschärfe und ahmte dabei den erratischen Rhythmus eines stockenden Herzschlags nach.
Kapitel 1
Das Hospiz
Der schwach beleuchtete Korridor warf das Knarren der Räder zurück, während der Rollstuhl langsam vorwärts rollte. Gretchen, eine ältere Frau von zweiundsiebzig Jahren, saß in dem Stuhl. Ihr gebrechlicher Körper zitterte vor Unbehagen. Neben ihr stand Milo, eine imposante Gestalt von gewaltiger Statur, deren bedrohliche Gegenwart im Kontrast zu Gretchens Verletzlichkeit stand. Milos Gesicht war eine Maske emotionaler Distanziertheit, seine Augen bar jeder Wärme und jedes Mitgefühls.
»Bitte, Milo«, flehte Gretchen mit bebender Stimme. »Ich bin noch nicht so weit. Bitte bringen Sie mich zurück in mein Zimmer. Ich flehe Sie an.«
Milo schien davon völlig ungerührt. Mit der kalten Entschlossenheit einer Maschine und unter mechanischen und steifen Bewegungen schob er Gretchen weiter den Flur entlang, dessen karierter Boden schon bessere Tage gesehen hatte. Weiche, bauschige Vorhänge schwebten verträumt vor den offenen Fenstern und bildeten in der makabren Beleuchtung unheimliche Formen. Die Wand auf der gegenüberliegenden Seite war mit Porträts ehemaliger Verwaltungsangestellter geschmückt, die eine beunruhigende Präsenz ausstrahlten, da ihre Augen geweißt worden waren, sodass sie wie seelenlose, grausige Gespenster wirkten.
Sie näherten sich Raum 200, dessen Tür von einem Schloss so groß wie die Hand eines Mannes gesichert wurde. Über der Tür befand sich ein poliertes Messingkruzifix, dessen Glanz in dem schwachen Licht jedoch nicht besonders gut zur Geltung kam.
Etwas weiter zurück machte Gretchens Herz einen Satz in der Brust, während ihre kraftlos wirkenden Finger die Armlehne ihres Rollstuhls umklammerten. »Milo, bitte, Sie müssen das nicht tun … meine Zeit ist noch nicht gekommen.«
Milo ging weiter, unbeeindruckt von den bedrohlichen Porträts, die den Korridor säumten. Schließlich erreichten sie das Ende des Korridors, wo Zimmer 201 sie erwartete. Ein Gefühl des drohenden Unheils hing in der Luft wie ein schwerer Schleier. Mit einer fast automatischen Bewegung zog Milo den Riegel zurück, zögerte, schob den Rollstuhl in den Raum und zog die Tür hinter sich zu.
Gretchens ohrenbetäubende Schreie, obwohl durch die Tür gedämpft, durchbrachen die Stille der Kammer. Die Frau flehte um Gnade und eine Möglichkeit der Flucht. Verzweiflung schwang in ihrer Stimme mit, als etwas Unsichtbares in den verhüllten Tiefen des Raumes waberte. Dichter Nebel, wie ein ätherischer Schleier, hüllte die Dunkelheit ein und verbarg das Grauen, das dort lauerte. Gretchens Wimmern wurde lauter, als sie spürte, dass die bedrohliche Präsenz näher kam.
Dann tauchte etwas mit eisiger Gewalt aus dem Nebel auf und verdeckte sie mit seiner schrecklichen Gestalt. Das Flehen der älteren Frau wurde zu einem qualvollen Heulen, als sie sich dem Bösen stellen musste, das in diesem Raum hauste. Es war ein Wesen jenseits aller Vorstellungskraft, eine alptraumhafte Manifestation der Angst.
Milo, der vor der geschlossenen Tür stand, hörte Gretchens gequälte Schreie, doch sein Gesicht blieb emotionslos. Er hörte regungslos zu, wie sich die Qualen jenseits der Grenzen des Raumes weiter entfalteten. Die Geräusche von Chaos und Leid erfüllten die Luft und erreichten ein Crescendo des Schreckens.
Drinnen wurde der Rollstuhl mit überirdischer Kraft quer durch den Raum geschleudert und wurde zu etwas, das kaum mehr als verbogenes Metall war. Ein umgedrehtes Rad drehte sich auf einer verbogenen Achse, bis es abrupt zum Stillstand kam und nur noch eine unheimliche Stille hinterließ.
Milo, der sich von den Schreien nicht beeindrucken ließ, schob den Riegel wieder zurück, verriegelte die Tür jedoch nicht ganz. Ohne einen zweiten Blick wandte er sich ab und ließ Gretchen in ihrem unvorstellbaren Leid zurück. Doch während er sich entfernte, beschlich ihn ein Gefühl des Grauens, ein Urinstinkt, der vor dem lauernden Übel warnte.
Die scheinbar verschlossene Tür strafte ihre scheinbare Gefangenschaft Lügen, als sich der Riegel von selbst zurückzog und sich die Tür mit einem leisen Knarren öffnete, wenn auch nur einen Spalt. Aus der schmalen Öffnung, die die Tür vom Türrahmen trennte, flüsterte die Dunkelheit ihre Geheimnisse und lockte ungeahnte Schrecken an, als wolle sie ihr nächstes Opfer willkommen heißen.
In diesem Moment zerriss der Schleier der Normalität, und die Bewohner der Einrichtung waren nur noch zerbrechliche Spielfiguren in einem gespenstischen Reich der Dunkelheit und Verzweiflung, als Gretchens Schreie verstummten und von dem Ding im Nebel absorbiert wurden.
Kapitel 2
Der düstere Warteraum vermittelte eine melancholische Atmosphäre auf Joey, der mit seinen dreiunddreißig Jahren keine Familie und nur wenige Freunde besaß. Da er sich entschieden hatte, die Gesellschaft den Rücken zu kehren, saß er hier nun allein zwischen einem Meer aus leeren Stühlen und wartete darauf, dass er an der Reihe war, die Ergebnisse seiner jüngsten Untersuchungen zu erfahren.
Während er so da saß und seine Gedanken abschweiften, hörte er kaum die Krankenschwester, als sie seinen Namen rief. Dann erhob sich Joey. Seine Beine fühlten schwer und gummiartig an, und seine Schritte waren langsamer als gewöhnlich.
Als Joey sich der Tür näherte, lächelte er und grüßte die Krankenschwester: »Wie geht es Ihnen?«
Das stoische Gesicht der Krankenschwester spendete ihm keinen Trost, sondern antwortete nur mit einem festen Nicken, das ihm signalisierte, ihr zu folgen. Mit jedem Schritt den Korridor hinunter schien das Echo ihn zu verhöhnen und ihm Geheimnisse zuzuflüstern, die er noch nicht zu hören bereit war.
… Das ist es …
… Dein Leben geht zu Ende …
… Und schlimmer noch, du hast nichts vorzuweisen …
Das letzte Flüstern in seinem Kopf hatte recht. Und daran, so dachte er, bin ich selbst schuld.
Schließlich erreichten sie das Büro von Dr. Simon, einen Raum mit gedämpftem Licht und dem überwältigend stechenden Geruch von Antiseptika. Die Ärztin war eine selbstsichere und intelligente Erscheinung, und ihr Haar war sorgfältig zu einem festen Dutt zusammengebunden, der ein Gesicht umrahmte, dem die Last der Überbringung schlechter Nachrichten abzulesen war. Sie forderte Joey auf, Platz zu nehmen. Ihre Stimme war sanft und gleichmäßig.
Als die Krankenschwester die Tür hinter ihnen schloss, fühlte sich der Raum kleiner an und schien Joey zwischen seinen Wänden erdrücken zu wollen. Dr. Simons Augen, die sowohl von Einfühlungsvermögen als auch von Professionalität erfüllt waren, begegneten seinem Blick. Mit einer Stimme, die das Gewicht der Trauer in sich trug, sprach sie die Worte aus, die seine zerbrechliche Hoffnung zerstörten.
»Mr. Cavello, es ist nie leicht, so etwas zu sagen, aber es gibt keine Möglichkeit, die Dinge zu beschönigen. Also werde ich einfach ganz offen sein.« Nach einer Pause fuhr sie fort. »Ich fürchte, Sie leiden an Bauchspeicheldrüsenkrebs im vierten Stadium.«
Ihre Worte trafen ihn wie ein bleierner Schlag in die Brust, während ein eisiger Griff sein Herz umklammerte, als ihm die Realität seiner Sterblichkeit bewusst wurde. Das Ende des Lebens war etwas, das jeden mit dem unvermeidlichen Lauf der Zeit ereilte; etwas, das er tief in seinem Inneren wusste, aber nicht wahrhaben wollte. Vor einem Jahr hatte er noch geglaubt, er würde ewig leben. Niemand dachte über seine Vergänglichkeit nach, bis man wie alt war? Sechzig, siebzig Jahre?
»Es tut mir so leid.«
Joeys Gesicht kämpfte mit seinen Emotionen, während er versuchte, den Stoizismus aufrechtzuerhalten, den er über die Jahre aufgebaut hatte. Erste Risse kamen zum Vorschein und offenbarten den Schmerz, den er so verzweifelt zu verbergen versuchte. Tränen stiegen ihm in die Augen, aber er kämpfte dagegen an und war entschlossen, seine Fassung zu bewahren.
Dr. Simon, die sich des emotionalen Sturms bewusst war, der in ihm tobte, reichte ihm mitfühlend die Hand. »Ich weiß, dass diese Nachricht niederschmetternd ist, Joey. Ich bin hier, um Ihnen zu helfen, Ihre Optionen zu verstehen und diese schwierige Reise zu bewältigen.«
Ihr Gespräch bewegte sich auf einem schmalen Grat zwischen Verzweiflung und Akzeptanz. Dr. Simon erklärte ihm die wenigen Möglichkeiten, die ihm noch blieben, und zeichnete ein düsteres Bild seiner Zukunft. Die Hospizpflege, das Tor zum Jenseits, schien unausweichlich. Die Zeit war ein unbarmherziger Herrscher, der ihm diktierte, dass sein Aufenthalt in dieser Welt sich dem Ende zuneigte, und zwar zu schnell und zu heftig. Bald klang alles, was sie sagte, in Joeys Ohren nur noch wie ein unsinniges Dröhnen, und sein Verstand blendete die Wahrheit aus.
»Mr. Cavello, hören Sie mir zu?«
Er wurde aus seinen Gedanken gerissen. »Es tut mir leid.«
»Das Hospiz. Ich glaube, das wäre wirklich der beste Weg, den Sie einschlagen könnten. Ich weiß, das ist schwer zu verkraften, und es ist alles andere als eine Freude in meiner Tätigkeit als Onkologin. Mein Wunsch ist es, den Menschen einen positiven Ausblick zu geben, wenn sie zu mir kommen, dass es Hoffnung am Ende dieses dunklen Tunnels gibt, in den sie plötzlich hineingeworfen werden.«
»Irgendwann müssen wir alle sterben«, antwortete er. »Ich hatte auf mehr Zeit gehofft, etwa dreißig oder vierzig Jahre mehr. Ich bin erst dreiunddreißig.«
»Ich weiß, es erscheint einem ungerecht, Mr. Cavello. Und ich wünschte wirklich, ich hätte bessere Nachrichten. Aber …« Sie unterbrach sich selbst.
»Hospizbetreuung … wann kann ich mich dafür anmelden?«
»Haben Sie noch irgendwelche Angelegenheiten zu regeln?«
»Nein. Nichts. Ich habe … nichts.«
»Ich kann Sie für morgen anmelden, wenn Sie wollen. Oder nächste Woche …«
»Morgen ist in Ordnung.«
»Sind Sie sicher?«
»Ich war noch nie in meinem Leben so sicher. Morgen.«
Dr. Simon lächelte milde, wenn auch nicht ganz aufrichtig, und sagte: »In Ordnung. Ich werde meine Mitarbeiter veranlassen, sofort die zuständige Verwaltung zu kontaktieren. Wir werden uns um alles kümmern. In der Zwischenzeit … ich weiß, das ist leichter gesagt als getan, aber versuchen Sie, einen gewissen Frieden in sich zu finden. Wenn nicht, steht Ihnen im Hospiz ein Seelsorger zur Seite, der Ihnen helfen wird, den Übergang zu bewältigen.«
»Danke, Doktor. Ich weiß das zu schätzen. Das tue ich wirklich.«
Als sich das Gespräch dem Ende näherte, stellte Joey die Frage nach dem Sinn des Lebens und der Zerbrechlichkeit des Menschseins, insbesondere seines Zustands. Die Unsterblichkeit, einst ein abstraktes Konzept, schien nun wie ein ferner Traum, der für immer unerreichbar war.
Seine Gedanken verschlangen ihn, umwirbelten ihn wie ein ätherischer Nebel. In den Tiefen seiner Kontemplation entdeckte Joey eine neue Wertschätzung für die flüchtige Schönheit des Lebens, für die Momente, die die Grenzen der Zeit überschritten. Die nackte Erkenntnis seiner Sterblichkeit wurde zu einem Katalysator für die Selbstbetrachtung und den Drang, jede verbleibende Sekunde zu nutzen.
Als die Sitzung beendet war, erhob sich Joey von seinem Platz, mit einem Gesichtsausdruck, der eine Mischung aus Resignation und Entschlossenheit war. Dr. Simons Worte hallten noch immer in seinen Ohren nach, deutliche Worte, die ihn aufforderten, die begrenzte Zeit, die ihm noch blieb, zu nutzen, um sich mit dem Unvermeidlichen abzufinden. Das Gespräch als Ganzes aber war sein Todesurteil gewesen, und die Glocken läuteten noch immer.
Er verließ die Arztpraxis und trat in eine Welt hinaus, die ihm plötzlich vertraut und zugleich fremd erschien. Das Gewicht der Diagnose lastete auf seinen Schultern, doch in seinem Inneren flackerte ein Funke der Unverwüstlichkeit auf. Joey würde sich den Schatten der Sterblichkeit stellen und die Fragmente des Lebens, die ihm noch blieben, bis zu seinem letzten Atemzug auskosten.
Das Leben, auch wenn es nur kurz war, setzte seinen Weg zum Tor der Ewigkeit fort.
Kapitel 3
Joey kehrte mit hängenden Schultern in seine Wohnung zurück. Das Gewicht der Enttäuschung lastete schwer auf ihm. Die Welt außerhalb gab sich den Zitrusfarben der Dämmerung hin und warf lange Schatten in den schwach beleuchteten Flur seines Wohnhauses.
Er schob den Schlüssel ins Schloss, das sich mit einem hohlen, mechanischen Klicken öffnete. Nachdem er die Tür geöffnet hatte, schlug ihm der Geruch von Moder und schmutziger Wäsche entgegen; etwas, das er vorher nie wahrgenommen hatte. Wie sich die Sinne plötzlich schärfen, wenn man weiß, dass man kurz vor dem Tod steht, dachte er.
Seine winzige, spartanisch eingerichtete Wohnung, die er seit fast einem Jahrzehnt sein Zuhause nannte, empfing ihn mit einer unheimlichen Stille. Die Wohnung selbst war kaum das, was man einen Zufluchtsort nennen könnte; sie war ein Ort der Einsamkeit, doch fühlte sie sich eher wie ein Gefängnis an, eine Zelle des uninspirierten Daseins. Joey musterte sein Wohnzimmer für eine Bestandsaufnahme, die ihm einen Einblick in die Unordnung gab, die seinen inneren Kampf widerspiegelte. Er besaß kaum Küchenutensilien, nur ein paar halbleere Gläser und eine Dose zum Mitnehmen hier und da. Er aß hauptsächlich von Papptellern und mit Plastikbesteck, von denen der Mülleimer überquoll. Und auf der Arbeitsplatte lag pfefferkörnergroß der Kot von Kakerlaken.
Joey entschied sich für eine Flasche Bier und holte sie aus dem spärlich gefüllten Kühlschrank. Das mattierte Glas fühlte sich kühl an, als er die Flasche aufdrehte. Mit ihr in der Hand lief er in die Mitte des Raums, der mit gebrauchten Möbeln und einem Fernsehständer aus Schlackensteinen und verwitterten Holzbrettern gefüllt war.
Er stieß einen schweren Seufzer aus und ließ sich auf seiner abgenutzten Couch nieder. Das rissige Leder ächzte protestierend unter ihm. Er starrte auf den leblosen Fernsehbildschirm, dessen spiegelnde Oberfläche seine Untätigkeit verhöhnte, während er in einem Raum saß, der keinerlei Dekoration, Erinnerungsstücke oder Errungenschaften enthielt, die an sein Leben hätten erinnern können. Es gab keine Bilder an den Wänden und keine Souvenirs in den Regalen; alles in dieser Wohnung war ein deutliches Zeugnis seiner Apathie gegenüber einem erinnerungswürdigen Leben. Joey Cavello, sagte er sich, hatte der Menschheit oder der Welt nichts gegeben. Er existierte lediglich.
Die Bierflasche, die nun halb leer war, stand vor ihm auf dem abgeplatzten Couchtisch. Joeys Blick starrte auf sie, als wäre sie eine Kristallkugel, die ihm den Sinn seiner Existenz offenbaren könnte. Er fühlte eine tiefe Leere in sich, eine Leere, die jeden Sinn zu verschlucken schien. Seine Gedanken wanderten durch die Jahre und sezierten seine Vergangenheit wie ein Gerichtsmediziner. Die grausame Ironie war jedoch, dass er sich selbst für schuldig befand, ein Leben ohne Sinn geführt zu haben.
Schuldig!
Tränen stiegen in Joeys Augen auf, und seine Sicht verschwamm, während er mit der Verzweiflung in seinem Herzen rang. Mit zitternden Händen beugte er sich nach vorne, das Gesicht in die Handflächen gestützt. Ein tiefes, klagendes Schluchzen entrang sich seiner Kehle, ein quälendes Wehklagen, das durch seine Wohnung hallte. Die Tränen flossen nun in Strömen und bahnten sich ihren Weg über seine Wangen und über seine Hände.
Joeys Stimme war ein Flüstern inmitten der Kakophonie seiner eigenen Verzweiflung. »Es tut mir so leid«, murmelte er, die Worte durch sein Schluchzen kaum hörbar. »Es tut mir so leid, dass ich mein Leben vergeudet habe, dass ich dieser Welt nichts bieten kann … wenn ich noch eine Chance bekäme …« Die Worte waren ein Geständnis der Sünde, die er gegen sein eigenes Potenzial begangen hatte. Er fühlte sich, als hätte er das Geschenk des Lebens erhalten, es zu etwas Sinnvollem zu formen und zu gestalten, nur um es zu vergeuden wie ein Kind, das ein kostbares Spielzeug wegwirft, nachdem es das Interesse daran verloren hat.
Vor seinem geistigen Auge flackerten Erinnerungen auf, Momente, in denen er die Möglichkeiten von Größe erahnt hatte. Doch das waren nur flüchtige Funken, die durch seine eigene Selbstzufriedenheit ausgelöscht wurden. Seine Jobs, wenn er welche hatte, hatten wenig mehr als einen Mindestlohn eingebracht. Keiner davon hatte ihn erfüllt; keiner hatte es ihm ermöglicht, der Welt oder gar seiner eigenen Seele einen Stempel aufzudrücken.
Das Gewicht seiner vergeudeten Jahre lastete auf ihm, eine fast physische Kraft, die seine Seele erdrückte. Es war, als ob all die Zeit, die er vergeudet hatte, sich zu einem bleiernen Leichentuch verdichtet hatte, das ihn nun erstickte und panisch nach einem Sinn suchen ließ. Er erinnerte sich an die Träume, die er aufgegeben hatte, an die Leidenschaften, denen er nie nachgegangen war, und an die Beziehungen, die durch Vernachlässigung verdorrt waren.
Während Joey weinte, gingen ihm die vielen Gelegenheiten durch den Kopf, in denen er im Leben anderer etwas hätte bewirken können, ob groß oder klein. Er hätte seine Talente weitergeben, Freundlichkeit zeigen und ein Zeichen setzen können, das seine eigene flüchtige Existenz überdauert hätte. Stattdessen hatte er sich entschieden, nur zu existieren, ziellos in den Strömungen des Lebens zu treiben, ohne einen Kurs zu setzen.
Die Nacht brach an, und die Schluchzer verebbten schließlich in einer schweren Stille. Joeys Tränen waren vergossen, der Schmerz in seiner Brust aber blieb. Er wusste, dass er die Vergangenheit nicht ändern konnte, aber die Erkenntnis über sein vergeudetes Leben nagte an ihm wie ein hartnäckiges Gespenst. Das Bedauern war ein bitterer Nachgeschmack, eine ständige Erinnerung daran, dass die Stunden und Tage, die er hatte verstreichen lassen, nun für immer verloren waren.
In der Stille seiner Wohnung, während die Stunden weiter verstrichen, legte Joey einen stillen Schwur ab. Er konnte die Jahre der Untätigkeit nicht ungeschehen machen, aber er konnte in Zukunft einen anderen Weg einschlagen. Er konnte sich bemühen, ein Leben zu führen, an das man sich erinnern würde, einen positiven Einfluss zu haben, egal, wie unbedeutend er war. Sein Herz war zwar schwer von der Last des Bedauerns über die Vergangenheit, aber es gab auch einen Hoffnungsschimmer und einen Funken der Entschlossenheit, sein restliches Leben mit Sinn zu führen.
Joey nahm sich vor, in der wenigen Zeit, die ihm noch blieb, wie ein Mann aufzutreten, der sein Leben noch vor sich hatte, auch wenn ihm nur noch Tage oder Wochen blieben. Er würde sich bemühen, etwas zu bewirken, sagte er sich.
Er würde einen Unterschied machen.
Kapitel 4
Der dichte Nebel hing wie ein Leichentuch der Melancholie in der Luft, als die schnittige schwarze Limousine durch den Schleier raste. In ihrem Schlepptau drehte und wirbelte sich der Nebel, bis er sich widerwillig auflöste und eine gewundene Auffahrt freigab, die zu einem bedrohlichen wirkenden Haus im viktorianischen Stil führte, das auf einer trostlosen Hügelkuppe thronte. Dort stand es wie ein düsterer Wächter, dessen verwitterte Fassade einen Hauch von verblasster Erhabenheit verströmte.
Auf dem Rücksitz der Limousine schlief Joey. Seine Träume tanzten an den Rändern seines Bewusstseins, Fragmente entfernter Erinnerungen und drohender Ungewissheiten. Als das Auto den Hügel hinauffuhr, griff der leichenhaft aussehende Chauffeur mit knochigen Fingern, die so lang und dünn wie die Zinken einer Mistgabel zu sein schienen, nach hinten, um Joeys Knie zu berühren.
»Sir, wir sind angekommen.« Die Stimme des Chauffeurs klang rau und kehlig, eine gespenstische Melodie, die in Joeys Ohren scharrte. Er war dünn wie ein Besenstiel und hatte strähniges Haar, das unter seiner Mütze hervorlugte und an zarte Ranken der Verwesung erinnerte. Wenn er sprach, schürzten sich seine Lippen und enthüllten Zähne, die so klein und gelb wie Maiskörner waren.
Joey blinzelte, und der Nebel des Schlafes löste sich so weit auf, dass er das Hospiz in Sichtweite kommen sah.
Ein verblasstes, abblätterndes Schild wies auf den Namen der Einrichtung hin: ÜBERGÄNGE.
Als der Chauffeur fragte, ob Joey Hilfe mit seinem Gepäck benötige, lehnte Joey ab. Bei seinem Blick auf die einsame Tasche wurde Joey leider klar, dass dies alles war, was er im Laufe seines Lebens angesammelt hatte, die einzigen Erinnerungen an seine Existenz.
Zum Abschied lüftete der Chauffeur seinen Hut, was eine fleckige Kopfhaut in den Farben des Verfalls unter seinem schütteren Haar offenbarte. Es war ein beunruhigendes Bild, das Joey noch lange in Erinnerung bleiben würde, als unmissverständliches Zeichen, dass Vater Zeit unbesiegt blieb.
Der Chauffeur kehrte zu seinem Fahrzeug zurück, und dann fuhr die Limousine den Abhang hinunter, verschwand im Nebel und ließ Joey mit seiner Tasche an der Seite allein zurück. Ein Gefühl der Melancholie überkam ihn, als er die umlaufende Veranda des Hospizes betrachtete. Dann fiel sein Blick auf eine Gestalt, die im Schatten der Veranda stand, eine alles überragende Erscheinung inmitten der verblassten Eleganz.
Milo, ein stämmiger, wortkarger Mann, näherte sich Joey mit stoischer und unnachgiebiger Miene. »Brauchen Sie Hilfe mit Ihrer Tasche, Mr. Cavello?«, erkundigte er sich so monoton und distanziert wie immer.
Joey schüttelte den Kopf. »Nein, kein Problem. Noch bin ich nicht tot.« Er sammelte seine Kräfte, um das Gepäckstück anzuheben, umklammerte den Griff und machte sich dann mit einem knappen Seufzer auf den Weg in das Hospiz.
Die Schwere schien ihn zu umarmen, was sich beklemmend anfühlte, während die Atmosphäre um ihn herum beladen mit unausgesprochenen Geheimnissen und geflüstertem Bedauern schien. Als Joey die Schwelle überschritt, durchlief ein Schauer seinen Körper – vielleicht eine instinktive Reaktion auf die unheilvolle Atmosphäre des Hospizes. Es war ein kalter, feuchter Ort.
Joey wusste, dass er in diesen Mauern nicht nur mit seiner eigenen Sterblichkeit, sondern auch mit den Geistern jener, die den gleichen Weg vor ihm gegangen waren, konfrontiert werden würde. Es war ein Ort, an dem Leben und Tod aufeinandertrafen, an dem Hoffnung und Verzweiflung einen ewigen Kampf austrugen.
Als Joey das Foyer des Hospizes betrat, suchten seine Augen die Umgebung ab. Die Düsternis schien in jede Ecke zu dringen und sich wie ein schwerer Schleier über alles zu legen. Von der Decke hing ein kleiner Kronleuchter, dessen schwaches Licht kaum die Dunkelheit durchdringen konnte, die den Raum einhüllte. Einige wenige verschnörkelte Tische und ein paar dekorative Stühle standen in dem Raum, deren Eleganz durch das Gewicht der Zeit in Mitleidenschaft gezogen worden war.
Milo, sein schweigsamer Begleiter, führte Joey durch das Foyer. Seine Schritte hallten leise nach, und es lag ein Gefühl stiller Resignation in der Luft, als würden die Wände das Gewicht unzähliger, noch nicht erzählter Geschichten in sich aufnahmen.
An Joeys Zimmer angekommen, öffnete sich knarzend die Tür und gab den Blick auf einen gemütlichen wie bescheidenen Raum frei. Ein ordentlich gemachtes Bett stand an einer Wand, die Bettwäsche verblasst und abgenutzt vom jahrelangen Gebrauch. Auf einer Kommode, der man ihr Alter ansah, standen die Überbleibsel aus dem Leben der früheren Bewohner. Eine Nachttischuhr, die mit einem unaufhörlichen Geräusch lauter tickte, als es eine LED-Uhr tun sollte, unterstrich die Stille mit jeder Sekunde, die verstrich. Die Ziffern auf dem Display zeigten 88:88 an.
Aber es war das Buntglasfenster, das Joeys Aufmerksamkeit erregte. Es befand sich gegenüber dem Bett und zeigte ein eindrucksvolles, aber auch beängstigendes Bild. Ein Engel mit majestätischen Flügeln stand triumphierend über einem besiegten Dämon, das Schwert hoch über den Kopf erhoben. Der Dämon, der seinen Arm zur Verteidigung ausstreckte, schien vor der Anwesenheit des Engels zurückzuschrecken, und sein Gesichtsausdruck war von Unbehagen und Angst geprägt.
Die Szene beunruhigte Joey. Der Kontrast zwischen Licht und Dunkelheit war in lebhaften Farben auf dem Buntglasfenster festgehalten. Es zeugte von einem Kampf zwischen Gut und Böse, einem Kampf, der in den Grenzen des Hospizes selbst widerhallte. Er kam nicht umhin, sich zu fragen, ob diese Darstellung eine tiefere Bedeutung hatte, ein Spiegelbild der Prüfungen, denen er in diesen Mauern begegnen würde.
Milo, so stoisch wie immer, verfolgte Joeys Reaktion mit einem unergründlichen Blick. »Dr. Kezmet, der Verwalter der Einrichtung, wird Sie in den nächsten Stunden aufsuchen. Eine Einführung ist für alle neuen Patienten verpflichtend. Wenn Sie möchten, können Sie sich in den Gemeinschaftsraum begeben, um die anderen kennenzulernen.«
»Und wo ist das? Dieser Gemeinschaftsraum?«
»Folgen Sie den Zeichen an den Wänden. Sie werden Ihnen den Weg weisen.« Ohne ein weiteres Wort wandte sich Milo zum Gehen. Das unangenehme Gefühl seiner Anwesenheit verblasste langsam.
Joey fand sich schnell allein in dem Raum wieder, dessen Buntglasfenster ätherische Farben in den Raum warf.
In der Stille spürte er eine Welle der Entschlossenheit in sich aufsteigen. Trotz der düsteren Atmosphäre und der beunruhigenden Bilder schwor er sich, sich der Dunkelheit zu stellen, sie herauszufordern und sie wissen zu lassen, dass er bis zu seinem letzten Atemzug nicht bereitwillig untergehen würde. Mit einem entschlossenen Seufzer richtete sich Joey in seiner neuen Wohnung ein und verstaute seine Sachen.
Das verglaste Fenster hinter ihm war zwar in der Zeit eingefroren, aber das würde es nicht mehr lange bleiben.
Kapitel 5
Nachdem er seine Sachen in der abgenutzten Holzkommode in seinem Zimmer verstaut hatte, beschloss Joey, sich in den Gemeinschaftsraum des Hospizes zu begeben. Dessen spartanische Einrichtung ließ viel zu wünschen übrig. Nur eine Couch, ein paar Stühle und ein Tisch nahmen den schwach beleuchteten Raum ein. Sein Blick fiel auf eine Gruppe von fünf Personen, die sich um den Tisch versammelt hatten und ein Kartenspiel spielten.
Angie Wakefield, deren graues Haar ihr wettergegerbtes Gesicht umspielte, paffte an einer Zigarette, während sie aufmerksam ihr Blatt studierte. Jackson Hyman, der eine Brille auf dem Nasenrücken trug, prüfte akribisch seine Karten. Taylor Higbee stand in der Nähe, die Arme vor der Brust verschränkt, und stellte seinen stets verärgerten Gesichtsausdruck zur Schau. Susan Smith, stark geschminkt, starrte auf ihre Hand, und ihre übertriebenen Gesichtszüge hoben sich von ihrem blassen Teint ab. Und Conrad Simmons, eine grüblerische Gestalt mit kahlem Kopf, verströmte eine Aura schwelenden Zorns.
Als Joey den Raum betrat, blickte Angie auf und schenkte ihm ein warmes Lächeln. Auch Susan versuchte sich an einem Lächeln, obwohl es keine echte Wärme ausstrahlte. Susan brach das Schweigen, und in ihrer Stimme schwang ein Hauch von Schalk mit. »So, so, so, ein Neuling in unseren Hallen. Willkommen in Gottes Warteraum. Du bist jung. Und süß.«
Sofort unterbrach sie Conrad mit kritischer Stimme. »Er ist ein wenig zu jung für dich, oder nicht?«
Susan tat Conrads Bemerkung spielerisch ab. »Es ist nichts falsch daran, sich ab und zu nach jungem Gemüse umzusehen, Conrad. Wie oft hast du das schon selbst gesagt? Dürfen Männer so etwas sagen, Frauen aber nicht? Das klingt für mich ein wenig nach Doppelmoral.« Sie klopfte auf den leeren Stuhl neben sich. »Komm, setz dich neben mich.«
Joey machte sich auf den Weg zu dem Tisch und bemerkte die weggeworfenen Karten darauf. Er nahm Platz, bereit, sich mit seinen Mitbewohnern zu unterhalten. Susan beugte sich zu ihm; ihre Neugierde war geweckt. »Wie heißt du?«
»Cavello«, antwortete Joey. »Joey Cavello.«
Conrad warf mit einem abschätzigen Brummen eine Karte auf den Tisch. »Cavello. Ist das italienisch?«
Joey nickte zustimmend. Conrads missbilligende Miene ließ auf ein verstecktes Vorurteil schließen.
Jackson streckte seine Hand zur Begrüßung aus, die Joey mit einem festen Schütteln annahm. »Mein Name ist Jackson«, stellte er sich vor. Er deutete auf Susan. »Und diese hübsche Frau ist Susan.« Dann deutete er auf Angie und Taylor und stellte auch sie kurz vor.
Sie nickten einander zu und tauschten Grüße aus. Der Raum war erfüllt von einem beginnenden Gefühl der Kameradschaftlichkeit.
Susan, die ihrer Neugierde nicht widerstehen konnte, fragte weiter. »Du bist noch jung. Das scheint mir nicht fair, oder? Darf ich fragen, aus welchem Grund du hier bist, Joey?«
Jackson widersprach und erinnerte Susan an die unausgesprochene Etikette. »Susan, du kennst unsere Regeln.« Und an Joey gewandt, fügte er hinzu: »Wir fragen nie nach der Krankheit einer Person. Das wird zu deprimierend. Es ist schon schlimm genug, hier herumzusitzen und auf den Tod zu warten. Aber wir kommen damit klar.«
Dennoch beschloss Joey, seine Wahrheit zu sagen und damit gegen die ungeschriebene Regel zu verstoßen. »Es macht mir nichts aus«, sagte er. »Ich habe Bauchspeicheldrüsenkrebs.«
Jacksons Augen verengten sich angesichts von Joeys Offenheit.
Taylor meldete sich zu Wort und versuchte sich an einer Begrüßungsrede. »Nun, willkommen im Club, Joey. Manchmal, wenn es nicht anders geht, verfallen wir so sehr in unser eigenes Selbstmitleid, dass wir nicht mehr aus dem Bett kommen. Aber zusammen spornen wir uns gegenseitig an. Wir machen uns gegenseitig klar, dass wir noch nicht tot sind. Also leben wir jeden Tag so, als wäre es unser Letzter. Eines Tages wird es aber der Letzte sein. Aber dann werden wir bereit sein.«
Nachdem Jackson eine weitere Karte auf den Tisch geworfen hatte, sagte er: »Es hat nicht lange gedauert, Gretchen zu ersetzen, oder? Eben noch hier, am nächsten Tag weg, die Laken wechseln und wieder auf Anfang. Nur der Tod und Steuern sind einem sicher, wie man so sagt.« Er sah Joey direkt an und ließ seinen Blick auf ihm verweilen. »Gretchen ist letzte Nacht gestorben. Schon komisch …« Jacksons Worte blieben in der Luft hängen. Ihre Schwere sank tief in die Herzen der in dem Raum Versammelten. Gretchens plötzliches Ableben erinnerte die Anwesenden eindringlich daran, wie unberechenbar das Leben in den Mauern des Hospizes war. Gestern hatte sie noch genau dort gesessen, wo Joey sich jetzt befand, und sich mit einem Kartenspiel beschäftigt. Es war schwer zu begreifen, dass jemand, der so lebendig gewirkt hatte, so plötzlich verschwinden konnte.