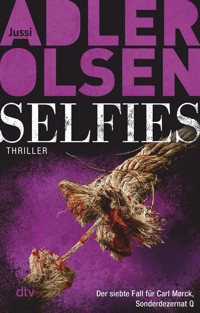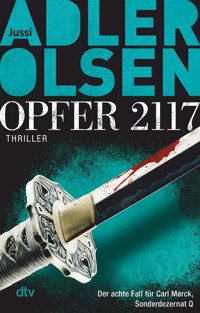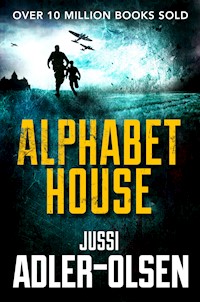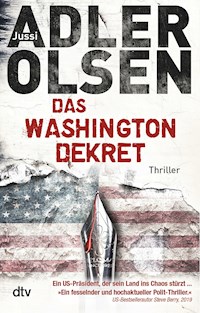
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dtv Verlagsgesellschaft
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2013
Die atemberaubende Vision vom Zerfall einer Gesellschaft Ein Politthriller, ein psychologischer Roman, eine Parabel über Machtmissbrauch und die Manipulierbarkeit der Massen von Bestsellerautor Jussi Adler-Olsen. Ein durchgeknallter Präsident, der mit einem einzigen Dekret ein Land an den Abgrund führt - Jussi Adler-Olsens frappierende Vision von einer Demokratie, die in die Hände eines Despoten fällt Durch den kaltblütigen Mord an seiner Ehefrau und dem ungeborenen Kind gerät der neu gewählte amerikanische Präsident Bruce Jansen völlig aus dem Gleichgewicht. Er erlässt das ›Washington Dekret‹ – eine politische Entscheidung, die schwerwiegende Folgen nach sich zieht für die gesamte amerikanische Bevölkerung. Amerika im Ausnahmezustand … Doggie Rogers, Mitarbeiterin im Stab des Präsidenten, steht nach dem Attentat unter Schock – nicht zuletzt, weil ihr eigener Vater nun des Mordes angeklagt wird. Auf der Suche nach der Wahrheit wird Doggie zur meistgesuchten Frau der USA. Mit Hilfe von Freunden versucht sie, das Komplott aufzudecken. Alles ruht nun auf ihren Schultern … »Ein fesselnder und hochaktueller Polit-Thriller.« US-Bestsellerautor Steve Berry »Adler-Olsen schreibt, als hätte er sein ganzes Leben in den Vereinigten Staaten verbracht. Die Geschichte liest sich, als wäre sie erst vor Kurzem geschreiben worden. Dieser provozierende, hellsichtige und hochgradig zeitlose politische Thriller zeigt, dass dieser Autor nicht nur umwerfende Krimi-Szenarien entwerfen kann.« Associated Press »Adler-Olsen entwirft eine provozierende Dystopie. Ein quälender, total aktueller Politthriller.« Booklist Neben der Carl-Mørck-Reihe sind bei dtv außerdem folgende Titel von Jussi Adler-Olsen erschienen: - ›Das Alphabethaus‹ - ›Takeover‹ - ›Miese kleine Morde‹
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 836
Ähnliche
Jussi Adler-Olsen
Das Washington-Dekret
Thriller
Aus dem Dänischen von Hannes Thiess und Marieke Heimburger
dtv Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG, München
Elisabeth und Lennart Sane gewidmet für ihren unermüdlichen Einsatz und ihr immenses Vertrauen
»Auf der ganzen Welt und besonders in den neueren Staaten kommen junge Männer an die Macht – Männer, die nicht an die Traditionen der Vergangenheit gebunden sind –, Männer, die nicht aus alter Furcht und Hass und Rivalität verblendet sind –, junge Männer, die sich von alten Parolen, von Illusionen und Misstrauen befreien können.«
John F. Kennedy in seiner Dankesrede auf dem
Nominierungsparteitag der Demokraten in Los Angeles am
15. Juli 1960
VORWORT
Wenn es in der Weltgeschichte etwas gibt, dessen man sicher sein kann, dann, dass es nichts gibt, dessen man sicher sein kann. Nichts ist ewig gültig, und nichts ist unvergänglich. Wer gestern ein Held war, ist morgen der Schurke. Große Reiche kommen und gehen: das Phönizische Reich, das Römische Reich, das Fränkische Reich, das Byzantinische Reich und das Osmanische, Hellas, die Wiege der Demokratie: Weltmächte, die allesamt untergingen.
Mal dauerte es Hunderte von Jahren, mal geschah es ganz plötzlich.
Wer hätte geglaubt, dass ein Ereignis am 11. September 2001 die Welt so nachhaltig erschüttern würde? Wer hätte geahnt, dass ein einzelner Schuss in Sarajewo einen Weltkrieg auslösen könnte, in dem Millionen Menschen ihr Leben lassen würden? Dass eine Supermacht wie die Sowjetunion und der gesamte Ostblock in kurzer Zeit kollabieren könnten? Dass ein Mensch wie Adolf Hitler tun könnte, was er getan hat. Und mit dem Hundertjährigen Krieg und den Kreuzzügen und der Inquisition im Hinterkopf, wer hätte da vorhersagen können, dass noch im einundzwanzigsten Jahrhundert vor allem religiöse Überzeugungen weltweit für Krieg und Unruhen sorgen würden? Dass zwölf Karikaturen die islamische Welt in Zorn vereinen könnten?
1975 holten Pol Pots Rote Khmer Woche für Woche die Menschen aus allen Großstädten Kambodschas, und ein Schreckensregime ohnegleichen hatte begonnen. Ähnlich radikale Umwälzungen sind seither immer wieder und überall zu beobachten: in Indonesien, in Khomeinis Iran, in Miloševićs und Karadžićs Jugoslawien, in Ruanda und in Idi Amins Uganda. Menschen wurden verfolgt, deportiert und vernichtet, Gesetze und Gerichte ausgeschaltet. Gegen solche Zustände versuchen die sogenannten zivilisierten Staaten, sich mit allen einer Demokratie zur Verfügung stehenden Mitteln abzusichern: Gesetzgebung, Rechtspraxis, Vorschriften und Verordnungen.
In Europa bemüht man sich, durch die EU den Frieden zu bewahren, und mit Bedacht werden deshalb neue Staaten in diese Gemeinschaft eingeladen. Das sei der sicherste Weg zur Stabilität in unserem Teil der Welt, meinen unsere Politiker. Aber vergisst man dabei vielleicht, dass wir so gleichzeitig eine Supermacht aufbauen, die im Kielwasser dieser friedlichen Absichten für andere Großmächte eine kulturelle, militärische und wirtschaftliche Herausforderung sein kann? Russland, China und eine mögliche zukünftige Konföderation arabischer oder islamischer Staaten scheinen jedenfalls keinen unmittelbaren Vorteil aus dieser expansiven EU-Politik ziehen zu können.
George Washington, der erste Präsident der USA, erklärte einmal, dass man einem Land immer nur genau so weit vertrauen könne, wie dessen Interessen es zuließen, und dass kein vorsichtiger Staatsmann oder Politiker je aus dem Blick verlieren werde, dass nationale Interessen stärker sind als jede Ideologie. Trotz dieser Worte und obwohl uns die Weltgeschichte lehrt, dass Stabilität nie von Dauer ist, haben Washingtons Nachfolger im Präsidentenamt immer aufs Neue dafür gekämpft, dass sich die USA in hohem Maß daran beteiligten, die sogenannte Stabilität in der Welt zu sichern. Viele unterdrückte Völker und Menschen stehen tief in der Schuld der amerikanischen Nation. Gleichzeitig hat ebendiese Nation in den letzten Jahren eine Reihe verfassungsmäßiger Anpassungen vorgenommen, die vom Weißen Haus selbst als »the biggest restructuring of the federal government since 1947« bezeichnet wurden. Damit gemeint ist eine Umstrukturierung des Verfassungsapparates, die in den falschen Händen und unter falschen Vorzeichen zu unvorhersehbaren Konsequenzen führen könnte. Konsequenzen, bei denen man sich an einige der Staaten erinnert fühlen kann, denen amerikanische Truppen einst zu Hilfe kamen.
Mit der Einrichtung des Ministeriums für Innere Sicherheit, The Department of Homeland Security, hat Präsident George W. Bush dafür gesorgt, dass alle Sicherheitsorgane der USA unter einer Verwaltung versammelt und koordiniert werden. Es wurde nach dem 11. September 2001 mit dem Ziel eingerichtet, das Land in erster Linie gegen Terroristen von außen zu sichern. Gleichzeitig ermöglicht es aber auch, die eigene Bevölkerung zu überwachen und zu kontrollieren.
Im vorliegenden Roman, ›Das Washington-Dekret‹, verliert ein amerikanischer Präsident durch ausgesprochen unglückliche Umstände seine gesunde Urteilskraft. Trotz bester Absichten manövriert er damit das Land in Windeseile in einen Zustand, in dem das Sicherheitsministerium, die Katastrophenschutzbehörde FEMA und die Streitkräfte missbraucht und alle verfassungsmäßigen Sicherheitsventile außer Kraft gesetzt werden können.
Das passiert nicht zum ersten und sicher auch nicht zum letzten Mal. Und manchmal passiert es sehr schnell.
Jussi Adler-Olsen, im Mai 2005
»Lassen Sie die Arbeit in der öffentlichen Verwaltung zu einer stolzen und interessanten Karriere werden. Und lassen Sie jeden Mann und jede Frau, die im Dienst der Regierung arbeiten, egal, wo und auf welcher Ebene, in Zukunft voll Stolz und Ehre sagen: Ich diente der Regierung der Vereinigten Staaten, als die Nation es brauchte.«
John F. Kennedy,
Ansprache zur Lage der Nation am 30. Januar 1961
PROLOG
1992
Seit mindestens einer Stunde stand Pete Bukowski unter dem Schild an der Route 460 mitten in Wakefield und starrte in Richtung Jarratt. Das Röhren und Klappern des Buick konnte man immer schon von fern hören. Aber außer dem monotonen Quietschen des Ladenschilds von Plantation Peanuts im trockenen Wind blieb es still. Sein Vater würde heute also nicht kommen.
Enttäuscht scharrte der Junge mit dem Turnschuh im Sand. Er hatte schon oft hier auf seinen Vater gewartet, seit der im Greensville Correctional Center den Job übernommen hatte, die Beine der zum Tode Verurteilten am elektrischen Stuhl festzuzurren. Wenn das erledigt und der Dienst vorbei war, trafen sie sich immer vor dem Erdnussladen, und Pete durfte sich eine von den großen blauen Dosen mit der Nussmischung nehmen. Denn für den neuen Job bekam sein Vater einen Bonus, und so waren diese Tage in der Familie des Gefängnisbeamten Bukowski ganz besondere Tage, fast schon Feiertage. Und deshalb wussten die Kinder auch immer ganz genau, wer wann hingerichtet werden sollte.
In der Stadt kursierten seit Langem Witze, Gouverneur Jansen sei zu weich. Einige nannten ihn zu liberal, aber die Canasta-Gang aus Ivor sagte, er sei ein lächerliches, feiges Kommunistenschwein. Petes Vater konnte ihn auch nicht leiden, denn wenn Gouverneur Jansen die Hinrichtungen aufschob, bedeutete das für die Bukowskis Einkommenseinbußen. Und auch wenn der Gefangene nicht zum ursprünglich vorgesehenen Zeitpunkt hingerichtet wurde, war Petes Vater tagelang kreidebleich vor Anspannung. Er verfluchte dann den Gouverneur, trank ein Budweiser nach dem anderen und brüllte alle an. Pete hasste diese Tage, und entsprechend hasste er auch Gouverneur Jansen. Dem würden sein Vater und die Canasta-Gang bei der nächsten Wahl bestimmt nicht ihre Stimme geben, und Petes bekam er auch nicht, falls sich jemals die Gelegenheit ergäbe.
Pete zählte die schweren Lastwagen aus Petersburg und versuchte, an etwas anderes zu denken. Heute Abend gab es im Fernsehen ein Quiz, sein Vater liebte diese Sendungen. Da war ein Mädchen dabei, Doggie, das wusste alles. Pete lachte sich jedes Mal über ihren Namen kaputt. Aber Hauptsache, Doggie machte heute Abend ihre Sache gut, dann trank sein Vater vielleicht nicht so viel.
Er sah noch einmal in Richtung Norden und ging weg von dem Laden mit den leckeren Nussmischungen.
Die nächste Hinrichtung fand in einer Woche statt, und diesmal traf es einen, der es verdiente, das sagten alle. Einen von diesen Schwarzen, die nichts bereuen.
So lange konnte er auf die Dose mit der Nussmischung noch warten.
1
Im Herbst 1992
Doggie war zwar erst vierzehn, aber sie wusste, dass Märchen nicht immer einen schönen Anfang haben und manchmal auch ein böses Ende nehmen. Ihr Märchen hätte kaum schlimmer ausgehen können.
Begonnen hatte es so: Das Büro von Gouverneur Jansen schlug dem größten Lokalsender Virginias eine neue Quizsendung vor. Dafür stellte man auch gleich etwas Startkapital zur Verfügung. Es sollte ein Länderquiz werden, bei dem man zunächst erraten musste, welche chinesische Stadt die meisten Einwohner hatte. Der Lokalsender stieg ein.
Unter den achtundvierzig Teilnehmern der ersten Runde war ein vierzehnjähriges Mädchen. Eine kleine Sensation! Nun galt es, vier Wochen lang die Spannung aufrechtzuerhalten, denn für das Wahlkampfbüro von Gouverneur Jansen sollten sich die finanzielle und die moralische Unterstützung der Show schließlich lohnen.
Die beiden ersten Sendungen wurden nachmittags ausgestrahlt, aber dann bekam die Show einen Sendeplatz zur Primetime. Die Presse schoss sich schnell auf das Schulmädchen mit dem reizenden Lächeln ein, das als mögliche Gewinnerin gehandelt wurde – und drei Viertel der Zuschauer in Virginia wanderten von den übrigen Fernsehsendern ab. Das war ein neuer Rekord. »Rund um die Welt« hatte sich zum reinsten Straßenfeger entwickelt. An Sendetagen stieg der Verkauf von Snacks und Sixpacks in beachtliche Höhen. Die Fernsehleute jubelten über die Einschaltquoten.
Überall in Virginia wurden Wetten abgeschlossen. Alle hatten ihre Favoriten. Viele setzten auf den Sheriff aus einem der kleinsten Countys von Virginia, andere auf eine üppige Blondine mit Silikonbusen und passenden Hüften, aber die weitaus meisten wetteten auf die Jüngste aus der Runde, das Mädchen mit den Grübchen, Dorothy Curtis: Doggie.
Sie war schnell, sie wusste mehr als die meisten erwachsenen Teilnehmer, und sie lachte sich scheckig über die angestrengten Witze des Moderators. Die Herzen der Zuschauer flogen ihr zu, und alle wollten sehen, ob sie es bis in die Endrunde schaffte.
Drei Wochen und drei Sendungen später standen die drei Sieger fest. Und was für welche! Gouverneur Jansen strahlte, das Honorar des Moderators wurde verdoppelt, und die Zeitungen waren schier außer sich.
Den ersten Preis gewann Rosalie Lee aus New York, eine dicke schwarze Frau, die zufällig und zum ersten Mal überhaupt ihre Schwester Josephine in Virginia besucht hatte. Rosalie war ein Prachtexemplar von einer Frau, mit Zähnen wie Perlen und einem ansteckenden Lachen, und sie verstand es, das Publikum zu unterhalten. Nur einen Punkt Rückstand hatte T. Perkins, der farblose, aber ausgesprochen freundliche Sheriff aus dem Nordwesten Virginias. Er war früher einmal der beste Dartspieler des Landes gewesen. Dritte wurde tatsächlich Doggie Curtis, das Mädchen mit den Lachgrübchen. Was für ein Triumph! Beliebter und unterschiedlicher hätten die Sieger nicht sein können – alle Beteiligten waren zufrieden. Bei diesem Ergebnis konnte sich keine Bevölkerungsgruppe übergangen fühlen.
Rosalie Lee, T. Perkins und Doggie Curtis bekamen die üppigen Prämien vor laufender Kamera überreicht. Außer einer erklecklichen Summe Geldes hatten sie eine Reise nach China gewonnen.
Doggie konnte ihr Glück kaum fassen. Sie, zusammen mit Gouverneur Bruce Jansen und seinem Stab in China! Sie würde in dieses fremde, ferne Land reisen und gemeinsam mit einer chinesischen Delegation eine zwanzigtägige Rundreise unternehmen. Ein Märchen!
Ja, Gouverneur Jansen hatte ein Gespür für die Wünsche der Menschen, das hatte er einmal mehr unter Beweis gestellt – und die Medien überboten sich in der Berichterstattung.
Doggies Vater war zwar stolz auf seine kluge Tochter, aber er schäumte vor Wut, als er von der Prämie hörte. Als äußerst konservativer Republikaner lehnte er den Demokraten Bruce Jansen vehement ab. »Bei diesem PR-Gag eines Demokraten machst du nicht mit!«, schrie er. In einer erbitterten Auseinandersetzung mit ihrem Mann sorgte Doggies Mutter schließlich dafür, dass ihre Tochter die Reise antreten durfte.
Es war die letzte Auseinandersetzung der Eltern – fünf Monate später wurden sie geschieden. Von da an lebte Doggie bei ihrer Mutter, deren Mädchennamen sie annahm.
In gewisser Weise hatte ihr Vater ja recht gehabt. Das Ganze war eine Publicity-Nummer. Aber warum denn auch nicht! Gouverneur Jansen war ein fähiger Mann. Er hatte drei ganz normale Menschen zu Publikumslieblingen gemacht, und alle sieben Millionen Einwohner Virginias fühlten sich über diese drei eingeladen, an der Reise in das rätselhafte Land teilzunehmen. Doggie wurde zu einer Art Lokalprominenz, ihre Fotos und Interviews fanden sich in allen Medien. Und die Strategie von Gouverneur Jansen ging auf: Mit diesem Manöver hatte er die Herzen seiner potentiellen Wähler erobert. Wem entstand dadurch schon ein Schaden? Seinem politischen Gegner, ja. Jansen kannte die Menschen gut, er wollte an die Macht – und er war klug.
Als Doggie im Sonnenschein zur Gangway hinaufschaute und zum Abschied winkte, hatte sie Herzklopfen. Sie war in Mexiko gewesen und in Puerto Rico und in mindestens zwanzig der amerikanischen Staaten. Aber noch nie war sie mit einer so großen Maschine geflogen.
Als sie zu ihrem Platz in der Mitte kam, saß Sheriff T. Perkins bereits am Fenster und machte sich mit einem vergoldeten Dartpfeil die Fingernägel sauber. Wenige Sekunden später kam Gouverneur Jansens Frau Caroll zu Doggie und tätschelte ihr die Wange. »Doggie, du bist ein tolles Mädchen«, sagte sie. »Ich gratuliere dir zum dritten Platz. Wir zwei werden es uns unterwegs schön machen.« Sie nickte nach links und rechts und nahm dann zwei Reihen weiter vorn Platz zwischen ihrem Mann und Thomas Sunderland, der rechten Hand des Gouverneurs.
Rosalie Lee begrüßte Doggie herzlich, pflanzte ihren gewaltigen Körper neben sie und beanspruchte dabei auch noch die Hälfte von ihrem Sitz. Aus einer riesigen Tüte holte sie Cola, Kekse und Süßigkeiten und verteilte alles großzügig. In Rosalie Lees Gesellschaft sollte es niemandem an etwas mangeln.
Sie unterhielt Doggie mit Geschichten von New York, von ihrer kleinen Wohnung in der Bronx und ihren drei hübschen Söhnen. Schließlich gab sie laut lachend zum Besten, wie sie ihren ungehobelten Kerl von einem Ehemann mit einem Tritt aus der Wohnung befördert hatte.
Ihre Lachsalve weckte Sheriff T. Perkins. Verwirrt blickte er um sich. Er wirkte geduldig, sprach wenig und döste immer wieder ein. Beim Quiz hatte er mit einem enormen Wissen geglänzt. Aber auch Rosalie war nicht zu unterschätzen. Ihr Gehirn konnte blitzschnell umschalten, und dann rauschte sie allen davon.
»Wow!« Rosalie starrte auf den Pazifik unter ihnen. »Da müsste man mal Urlaub machen: Molokai! Muss herrlich sein!«
Unwillig öffnete Sheriff T. Perkins wieder die Augen. Er hatte drei Tage und Nächte durchgearbeitet, um seinen Schreibtisch für die Zeit seiner Abwesenheit geordnet zu hinterlassen, und jetzt war er hundemüde.
Ein junger Mann in der Reihe vor ihnen, der seit dem Abflug fest geschlafen hatte, schaute zwei Stunden später über den Stuhlrücken. »Wesley Barefoot!«, stellte er sich mit strahlendem Zahnpastareklamelächeln vor. »Wir werden die nächsten Wochen also zusammen verbringen. Vielleicht kennt ihr meine Mutter? Sie ist Gouverneur Jansens Sekretärin.«
Sie schüttelten den Kopf.
»Glückwunsch auch«, schaltete er dann um. »Ich hab mir sämtliche Sendungen angesehen. Ihr wart einfach irre gut!«
Sie lächelten ihn an, und der junge Mann fühlte sich ermuntert, ihnen mehr über sich zu erzählen. Er studierte Jura, liebte Politik und englische Rockbands.
Doggie fand, dass er fantastisch aussah und gut roch.
Auf dem Flughafen von Peking war es kalt, staubig und grau. Angesichts der Abordnung von Fotografen, Kameramännern und Journalisten legte Gouverneur Bruce Jansen Rosalie und Doggie die Arme um die Schultern. Nach den obligatorischen Fragen der chinesischen Medien ließ er die beiden gehen und wandte sich den Vertretern der internationalen Presse zu, die hinter einer Reihe blau gekleideter chinesischer Soldaten warteten.
Einer der Journalisten fiel Doggie sofort auf: ein ausgesprochen kleiner Mann mit zurückweichendem Haaransatz und sehr dunklen Augen, dessen Fragen stets zuerst beantwortet wurden.
Nachdem das alles überstanden war, fuhr der Gouverneur mit seiner Frau und zwei chinesischen Beamten in einer schwarzen Limousine davon. Seine Mitarbeiter folgten ihnen in der nächsten, und die Schar der Journalisten zerstreute sich. Nur der kleine mit den dunklen Augen interessierte sich offenbar für Jansens Mitreisende. Er winkte seinem Fotografen und steuerte auf die kleine Gruppe zu.
»Hallo! Ich heiße John Bugatti.« Er räusperte sich. »Ich arbeite für die NBC und begleite Sie und Jansens Stab auf der Reise.«
Von Nahem fiel Doggie auf, dass sie noch nie jemanden mit so vielen Sommersprossen gesehen hatte. Sie war hin und weg. Alles war großartig, sie genoss die Reise schon jetzt in vollen Zügen. Ihr Vater hatte sich umsonst Sorgen gemacht. Sie war in guten Händen.
So wie alle Tage zuvor hatte auch der letzte Tag in Peking für Doggie wie im Märchen begonnen. Umgeben von einer Heerschar lächelnder chinesischer Kellner hatten sie im Hotel ein üppiges Frühstück zu sich genommen. Bis auf Caroll Jansen und Rosalie Lee hatten alle gelernt, die Essstäbchen zu benutzen.
Doggie sah sich um. Das Licht, das durch die großen Fenster fiel, intensivierte die kräftigen Farben an den Wänden und schien die vielen geschnitzten Holzornamente zu vertiefen.
»Heute liegt wieder ein ganz besonderer und gesegneter Tag vor uns«, sagte Caroll Jansen wie an jedem Morgen.
Doggie legte die Stäbchen beiseite und richtete zum letzten Mal den Blick auf die Silhouette der Stadt. Die glitzernden Ziegeldächer der Hutongs wirkten wie Fischschuppen. In den letzten Tagen hatten sie die langen Korridore des Sommerpalasts durchwandert, im Beihai-Park den Wind über den Seen gespürt und andächtig die »Halle des Gebetes für eine gute Ernte« betrachtet. Die Tage waren wie im Fluge vergangen. Jetzt sollten sie mit dem Bus zum Seidenmarkt gebracht werden, und anschließend erwartete man sie zu einem offiziellen Besuch im Konsulat, das dort ganz in der Nähe in einer der engen Gassen lag. Für den Abend war ein Zirkusbesuch geplant, und in den kommenden Tagen sollten sie über Land fahren. Auf dem Programm standen Xi’an, der Gelbe Fluss, Hangzhou, Shanghai, und danach würden sie die Heimreise antreten.
Das Gewimmel des Seidenmarkts war geradezu überwältigend. Mindestens hundert winzige hölzerne Verkaufsstände waren mit fast vollkommen gleich gekleideten Händlern besetzt, die der Reisegruppe neugierig hinterherstarrten.
Dabei war es auf dem Markt erstaunlich still. Auch die wenigen Einheimischen, die der Gesellschaft wie Hunde folgten, schwiegen. Niemand rief ihnen etwas zu, niemand bedrängte sie.
»Wahnsinn, wie diszipliniert die hier sind. Ihr solltet mal sehen, wie man in Hongkong oder Taipeh hin und her geschoben wird«, flüsterte John Bugatti an Doggies Seite. »Aber das wird sich in ein paar Jahren ändern. Auch hier.«
Sie nickte und ließ den Blick über die vollen Tische mit Stoffen schweifen. Da fiel ihr ein Seidentuch auf, das ihrer Mutter gut gefallen würde.
»Was das wohl kostet? Was steht da?«, fragte sie Bugatti und deutete auf ein Schild mit chinesischen Schriftzeichen.
Caroll Jansen war hinter sie getreten und hatte Doggie die Hände auf die Schultern gelegt. »Ja, das würde dir toll stehen!« Lächelnd nahm sie ihre Geldbörse und reichte dem Verkäufer zwei Scheine. Dass er nicht zurücklächelte, als er das Tuch einpackte und ihr über die Theke reichte, schien sie nicht zu bemerken.
»Schau mal, Doggie!«, rief Gouverneur Jansen, der vor einem Heer großer und kleiner chinesischer Figuren stand. »Die bedeuten Glück! Ich möchte dir zu gern eine schenken.«
Wenige Minuten später gingen sie weiter, Doggie mit einem neuen Schultertuch und einer kleinen, schweren Buddhafigur in den Händen. Sie war stolz und glücklich. Gouverneur Jansen hatte ihr feierlich versichert, diese kleine Figur symbolisiere ein Band ewiger Freundschaft zwischen ihnen. Unglaublich!
Doggie zog die Schultern hoch und atmete die kühle Luft tief ein. Rings um sie war alles so wundervoll. Die Reisegesellschaft, die kahlen exotischen Bäume und die Menschen. Sie lächelte die Arbeiter an, die an der Bordsteinkante saßen und mit Essstäbchen dampfende Nudeln und Gemüse aus kleinen Schalen verzehrten.
Unmittelbar vor ihr ging Wesley Barefoot mit einem so breiten Lächeln, dass man es beinahe von hinten sehen konnte. Er drehte den Kopf in alle Richtungen, eine billige, gerade gekaufte Kamera im Anschlag. Neben ihm schritt T. Perkins, hellwach seine Umgebung beobachtend, beladen mit zwei Tüten voller Spielzeug für Nichten und Neffen. Ganz vorn ging Gouverneur Jansen, der alle anderen überragte, in bester Laune, seine Frau hatte sich bei ihm untergehakt. Als einer der Funktionäre ihnen aus dem geöffneten Tor des Konsulats entgegenkam, winkte er ihm zu.
Doggie sah an dem Gebäude hinauf. Wie erwartet, war es kleiner als die eigentliche Botschaft an der Xiushui Bei jie, wo sie vor ein paar Tagen zu einem großartigen Willkommensdinner eingeladen gewesen waren. Trotzdem wirkte das Konsulat im Sonnenschein mit der im Wind flatternden amerikanischen Fahne und der uniformierten chinesischen Schildwache auf der Plattform vor dem Gittertor bombastisch.
Doggie sah kurz über die Schulter zurück in die enge Marktgasse. Was für ein Unterschied zwischen diesem westlich geschmückten Gebäude und den zusammengeschusterten Verkaufsständen dort auf dem Seidenmarkt.
Vor ihnen warf ein Verkäufer eines seiner vielen papiernen Fabeltiere in die Luft, und alle verfolgten gebannt die anmutigen, züngelnden Bewegungen des Drachen.
Plötzlich schrie Caroll Jansen auf, riss die Arme zur Seite und klammerte sich an ihre Tasche. Im nächsten Augenblick verstummte sie und sank in sich zusammen. Blut spritzte ihr aus dem Hals und traf ihren Mann, und gleichzeitig spurtete Thomas Sunderland los, um den jungen Chinesen zu ergreifen, der mit dem Messer zugestochen hatte. Sheriff T. Perkins ließ die Tüten mit den Einkäufen fallen, Gummibälle und Plastikfigürchen rollten über den Asphalt. Mit einem Satz, den man ihm nicht zugetraut hätte, schnitt er dem Attentäter den Weg ab. Doggie sah das blutige Messer noch einmal aufblitzen. Noch viele Jahre später würde sie diese entsetzlichen Bilder jederzeit abrufen können.
Gouverneur Jansen war auf die Knie gesunken, in seinem Arm der leblose Körper seiner Frau.
Doggie sah, wie Menschen von allen Seiten herbeieilten und versuchten, ihnen zu helfen.
Sie sah, wie Rosalie Lee ihre schöne Bluse zerriss, um mit den Stoffstreifen die Blutung zu stoppen. Sah die Soldaten, die zu T. Perkins rannten, der den wie verrückt heulenden Chinesen mit dem Knie auf den Boden presste. Sah, wie das Blut vom Arm des Sheriffs lief und wie Wesley Barefoot mit kreidebleichem Gesicht ganz still auf dem kleinen Platz vor dem Konsulat stand. Ja, Doggie sah Wesley Barefoot in dem Augenblick, als er erwachsen wurde und sein ungetrübtes Lächeln für immer verschwand.
Es herrschte ein heilloses Durcheinander. Menschen eilten hinzu, hielten sich entsetzt die Hand vor den Mund, während der Täter etwa zwanzig Meter vom Tatort entfernt wimmerte. Unterdessen halfen John Bugatti und Thomas Sunderland, Caroll Jansen ins Konsulatsgebäude zu tragen.
Doggie setzte sich auf die niedrige Plattform der Schildwache und lehnte sich mit dem Rücken an den Pfeiler.
»Komm, mein Mädchen, komm, Doggie!« Der Sheriff sprach sie an. Wie viel Zeit war seit dem Attentat vergangen? Sie wusste es nicht.
T. Perkins breitete die Arme aus und zog sie an sich. »Hast du gesehen, wie es geschehen ist?«
Sie nickte.
»Sie ist tot, Doggie.« Für einen Moment war er ganz still, als wollte er ihre Reaktion abwarten. Aber Doggie sagte nichts. Sie hatte es sofort gewusst.
Er brachte sie im Konsulat in einen großen, weißen Raum, wo sich zwei der Verwaltungsangestellten um sie kümmerten. Die meisten Mitarbeiter saßen mit versteinerten Mienen vor den Computern oder telefonierten. Hektik und Sorge bestimmten das Bild, der Name des amerikanischen Außenministers James Baker fiel immer wieder.
Durch das Fenster waren Schritte zu hören, Menschen liefen hin und her. Der junge Chinese, der Caroll Jansen erstochen hatte, wurde von Uniformierten gegen eine Wand gepresst, er zitterte und sah aus, als könne er nicht fassen, was mit ihm geschah.
»Doggie, ich glaube, er ist nicht normal«, sagte Rosalie Lee und drückte Doggies Arm.
Schließlich kam ein Lieferwagen mit noch mehr Uniformierten, um den Täter abzuholen. Die Augen des jungen Mannes weiteten sich vor Entsetzen.
»Das dauert keine zwei Tage, dann wird dem Schwein eine Kugel durch den Kopf gejagt«, schnaubte einer der Funktionäre.
Doggie setzte sich auf einen Stuhl und starrte vor sich hin, bis John Bugatti zu ihr trat und ihr eine Tasse heißen Tee reichte.
»Was da geschehen ist, Doggie, ist entsetzlich«, sagte er und bemühte sich zu lächeln. »Es tut uns allen sehr leid, dass du das mit ansehen musstest. Aber das darf deine Seele nicht zerreißen, hörst du?«
Sie nickte. Er hatte sich sonderbar ausgedrückt, aber sie verstand ihn.
»Du bist rein zufällig hier gewesen, das ist alles. Ich könnte nur zu gut verstehen, wenn du dich jetzt fürchtest und schrecklich traurig bist. Aber es ist vorbei! In ein paar Tagen sind wir wieder zu Hause.«
Doggie atmete tief ein. »Ja, aber wir hatten doch noch so viel vor!« Ihr war gerade erst bewusst geworden, dass das Märchen zu Ende war.
Bugatti legte ihr den Arm um die Schulter. »Doggie, hör mir zu. Was da geschehen ist, schweißt uns für immer zusammen.« Im Hintergrund nickte Rosalie.
»Was wir heute erlebt haben, wird uns ein Leben lang verbinden. Uns alle, dich und mich und T. Perkins und Rosalie Lee und Wesley. Ist dir das klar?«
Doggie sah sie alle an. Jeder zeigte auf seine Weise Zustimmung, nur Wesley gelang kein Nicken. Er war wie erstarrt.
Dann nahm Bugatti die Buddhafigur, die ihr Bruce Jansen vor nicht einmal einer Stunde geschenkt hatte, und legte sie sich auf den Schoß. »Darf ich den mal kurz ausleihen?«, fragte er und zog den goldenen Dartpfeil aus T. Perkins’ Brusttasche. Damit kratzte er ein wenig Farbe von den Lippen der Figur und schuf eine kleine Öffnung zu dem hohlen Innern. Er riss ein Blatt aus dem Notizbuch, das stets in seiner Brusttasche steckte. »Ich schreibe dir die Telefonnummer von meinem lieben Onkel Danny auf. Den kannst du jederzeit anrufen. Wenn einer immer weiß, wo ich bin, dann er.« Er rollte das Papier auf und steckte es der Figur in den Mund. »Jetzt liegt Onkel Dannys Telefonnummer hier drin. Und du kannst mich jederzeit erreichen.«
In dem Moment betrat Gouverneur Jansen den Raum. Thomas Sunderland folgte ihm. Beide sahen grau aus.
Jansen stand einen Moment ganz still und starrte leer vor sich hin. Als er sich dann aufrichtete, senkten alle den Blick und hörten ihn sagen, was Doggie niemals vergessen würde: »Liebe Freunde. Ihr habt getan, was ihr konntet. Gott segne euch!«
Dann versagte ihm die Stimme.
2
Sechzehn Jahre später
Doggie empfing schon den dritten Schwung Journalisten im Wahlkampfbus. Obwohl sie müde und gereizt war, bemühte sie sich zu lächeln. Die Hälfte ihrer Wahlkampfreise durch die USA hatten sie jetzt hinter sich, und alles war bestens gelaufen. Zwanzig Bundesstaaten lagen dem Spitzenkandidaten der Demokraten, Senator Bruce Jansen, und seiner schönen Frau Mimi Todd Jansen bereits zu Füßen, und alle konnten eigentlich bester Laune sein. Nur hatte Doggie in den letzten achtundvierzig Stunden nicht besonders viel Schlaf bekommen und war entsprechend erschöpft.
Cary Simmon, ein befreundeter Journalist von der ›Washington Post‹, bemerkte das und zog sie kurz zur Seite. »Lass das doch andere machen, Doggie! Leg dich hin und schlaf etwas, du wirkst echt gereizt. Ach ja, und herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag.«
Doggie lächelte und nickte. Er hatte recht.
Sie rief einen der Letztangekommenen des Wahlkampfteams zu sich, einen Mann namens Donald Beglaubter, und bat ihn, zu übernehmen. Dann zog sie sich ins hintere Ende des Busses zurück und ruhte sich ein wenig aus.
Gleich morgens hatte ihr Vater angerufen, um ihr zum dreißigsten Geburtstag zu gratulieren. Der dreißigste! Genau das Alter, in dem sich herausstellte, ob die Entscheidungen, die man bisher getroffen hatte, in Sackgassen geführt hatten. Der Punkt im Leben, an dem sich die Frage aufdrängte, ob man da stand, wo man stehen wollte. Mit ihren Freundinnen konnte sie kaum darüber sprechen – die Hälfte von ihnen war längst dabei, das dritte Kinderzimmer einzurichten. Vielleicht würde es Doggie besser gehen, wenn die anderen sie ein klein wenig beneideten, aber niemand beneidete Doggie. Warum sich für nichts und wieder nichts abrackern, wenn man mit einem goldenen Löffel im Mund auf die Welt gekommen war? Warum das, wofür Frauen nun mal auf der Welt waren, weiter aufschieben? Ja, Doggie wusste, was sie dachten, und darum hatte sie auch kein Bedürfnis, ihre Freundinnen zu sehen.
Und dann das Telefonat mit ihrem Vater. Einen Moment lang war er richtig nett zu ihr gewesen, doch dann fing er wieder mit seinen Sticheleien an. Warum musste ausgerechnet sein einziges Kind für einen demokratischen Präsidentschaftskandidaten arbeiten? Als sie ihn bat, damit aufzuhören, wurde er richtig ausfällig.
»Du tust ja gerade so, als ob Jansen ein Engel wäre!«, lachte er sie aus. »Wieso unterstützt du diesen Idioten, Doggie? Hast du womöglich ein Auge auf ihn geworfen? Und wartest nur auf eine Gelegenheit, die Kommunistenschlampe Mimi Todd auszustechen?«
Doggie hatte gekocht vor Wut. Hatte ihren Vater noch lange, nachdem sie aufgelegt hatten, beschimpft. Die anderen im Bus konnten sich ihr Teil denken, auch Thomas Sunderland und Wesley Barefoot. Bud Curtis’ Temperament und seine politische Einstellung waren bekannt. Die seiner Tochter auch.
Von dem Stab, der Bruce Jansen auf der schicksalhaften Reise nach Peking sechzehn Jahre zuvor begleitet hatte, waren nur noch zwei Mitarbeiter übrig. Gute Leute – sie hatten Jansen in seinen erfolgreichen Jahren als Gouverneur, später als Sprecher bei strittigen Kernproblemen im Repräsentantenhaus, dann als Senator und nun auch im Präsidentschaftswahlkampf unterstützt, einem der aufsehenerregendsten, die das Land je gesehen hatte.
Die Leute liebten Jansen, und das machte dem republikanischen Kandidaten, dem Bruder des scheidenden Präsidenten, das Leben schwer. Die alte Regierung schnitt in sämtlichen Meinungsumfragen mehr als dürftig ab. Vertraute des Präsidenten berichteten, er sei erschüttert, und dazu hatte er allen Grund.
Jeden Tag hatte der charismatische Jansen den Wahlkampfmitarbeitern des Gegenkandidaten mehr graue Haare beschert, und ebenso seinen Rivalen in der eigenen Partei. Inoffiziellen Analysen zufolge wollten bereits vor dem Nominierungsparteitag einundsechzig Prozent der Delegierten Bruce Jansens leicht verständlicher und logischer Argumentation folgen. Es war eine Erfolgsstory sondergleichen.
Doch Jansens Mitarbeitern war dieser Erfolg nicht in den Schoß gefallen. Monatelang hatten alle unter der Führung des knallharten Wahlkampfleiters Thomas Sunderland geschuftet, der so seine Position am besten hatte festigen können. Sunderland, ein hagerer, ernster Mann und ehemaliger Offizier, hatte Bruce Jansen immer zur Seite gestanden, war aber stets in dessen Schatten geblieben. Als Belohnung winkte nun eines der höchsten und wichtigsten Ämter des Landes. Es gab mehrere Möglichkeiten, aber am wahrscheinlichsten war der Posten des Stabschefs im Weißen Haus.
Doggie hatte sich gleich nach ihrem Juraexamen dem Team um Jansen angeschlossen, und bereits nach zwei Monaten hatte man ihr für den Fall des Wahlsiegs einen Job im Weißen Haus in Aussicht gestellt.
Wesley Barefoot, seit jener folgenschweren Pekingreise ein Anhänger Jansens, hatte sein Jurastudium schon vier Jahre vor Doggie abgeschlossen, er würde höchstwahrscheinlich ihr direkter Vorgesetzter im Westflügel werden. Mit messerscharfem Verstand begabt, war er das reinste Kommunikationsgenie, was er bereits in Harvard, wo sie beide studiert hatten, mehrfach unter Beweis hatte stellen können. Er war brillant, beliebt und charmant, und seine Kommilitoninnen waren fasziniert von seiner Eloquenz und seinem guten Aussehen. Doch ausgerechnet Doggie zeigte sich seinen Avancen gegenüber unempfänglich.
Als sie ihn damals in Harvard wiedersah, hatte sie für sich beschlossen, dass zwischen ihnen irgendwann einmal eine ernsthafte Beziehung entstehen würde, und dieser Überzeugung war sie bis heute. Wenn sie Lust auf Sex hatte, boten sich ihr mehr als genug Möglichkeiten, das hatte mit Wesley nichts zu tun. Eine attraktive junge Frau wie sie mit einem Hintergrund wie dem ihren konnte es sich erlauben, wählerisch zu sein. Und das war sie. Wesley hob sie sich für später auf.
Sie rieb sich die Augen und sah auf die Uhr. Zwanzig Minuten hatte sie geschlafen, aber es kam ihr vor, als wäre es eine Ewigkeit gewesen. Sie hob den Kopf und beobachtete zufrieden, wie Wesley am anderen Ende des Busses damit beschäftigt war, die seit Wochen mehr oder weniger gleichen fünf Fragen der Journalisten zu beantworten.
Sie sah, wie sich seine Lippen bewegten. Ja, bestätigte er seinen Zuhörern, Bruce Jansen sei sehr zufrieden mit den sinkenden Beliebtheitswerten des Gegenkandidaten und des amtierenden Präsidenten, und ja, seine Nominierung als Präsidentschaftskandidat der Demokraten sei so gut wie sicher. Und ja, er könne auch bestätigen, dass Mimi Todd Jansen schwanger sei.
Doggie schnellte hoch. Was hatte Wesley da gerade gesagt? Mimi Jansen war schwanger? Die Nachricht des Jahres, das war ihnen allen sofort klar. Der Gouverneur, der seine erste Frau auf so tragische Weise verloren hatte, der jahrelang getrauert und keine Frau an sich herangelassen hatte. Der Mann, der endlich zur Ruhe gekommen war und das Glück gehabt hatte, noch einmal die große Liebe zu finden – sollte er jetzt auch Vater werden? Die Journalisten johlten und übertönten sich gegenseitig: War das ganz sicher? Wie lange wusste man das schon? Was sagte Senator Jansen dazu? War es nicht beängstigend, mit fünfundfünfzig zum ersten Mal Vater zu werden? Wann war der Geburtstermin? Wusste man schon, ob es ein Mädchen oder ein Junge …
Sämtliche Fragen zu Lobbyismus und staatlichen Subventionen in der Landwirtschaft sowie zu den Bundesstaaten im Südwesten, in denen Jansens Wahlkampf noch nicht den gewünschten Erfolg gezeitigt hatte, waren auf einen Schlag uninteressant geworden. Wenn Jansen die Wahl gewann – und diese Nachricht war ein Riesenschritt in genau diese Richtung –, dann würde es im Weißen Haus wieder kleine Kinder geben. Das wäre das erste Mal seit Präsident Kennedy.
John Bugatti stürzte breit grinsend durch den Bus auf Doggie zu. Sie lächelte verschlafen zurück.
»Doggie! Verdammt, warum hast du mir das nicht erzählt?«
Sie schüttelte den Kopf. Er verstand. Sie hatte es ja auch nicht gewusst.
Die Neuigkeit beherrschte am nächsten Tag sämtliche Schlagzeilen. ›USA Today‹ brachte ein retuschiertes Foto von Mimi Todd Jansen mit einem Baby auf dem Arm, die ›Washington Post‹ eine gründliche Analyse darüber, was das für die Sozial- und Familienpolitik der neuen Regierung bedeuten werde. Ein Sieg Bruce Jansens wurde immer wahrscheinlicher, und die neuesten Meinungsumfragen zeigten, dass Jansen selbst in den konservativsten Staaten stark an Zustimmung gewann. Sogar Texas, der Heimatstaat des amtierenden Präsidenten, begann zu wanken.
Kurz gesagt: Mimi Todd Jansens Schwangerschaft war ein Coup, sowohl für Bruce Jansens Wahlkampf als auch für die Medien. Mimi war der Inbegriff der perfekten First Lady. Sie hatte den Platz der ermordeten Caroll Jansen nicht nur mit Bescheidenheit und Demut eingenommen, sondern auch mit einer Professionalität, wie man sie sonst nur von gestandenen Politikern kannte.
Noch am selben Tag, an dem die beiden ihre Beziehung publik gemacht hatten, war klar gewesen, dass Mimi Todd etwas ganz Besonderes war. Sie sah den Menschen in die Augen, sie beantwortete alle Fragen und wich nie aus – auch nicht, wenn man sie zu ihrer Vergangenheit als Friedensaktivistin während des ersten Golfkriegs befragte. Im Gegenteil: Sie ließ jedem Journalisten ausreichend Zeit, zur Sache gehende Fragen zu stellen, und die Presse liebte sie dafür.
Mimi Todd war eine Bilderbuchamerikanerin, eine wahre Pionierin, die sich vor nichts fürchtete. Das konnte man überall lesen. Wie sie während ihrer Kindheit den Ermahnungen ihres Vaters zum Trotz auch im Dunkeln durch Richmonds finsterste Straßen geradelt war, wie sie sich bei der Eröffnung des neuen Stadions der Seattle Seahawks heiser geschrien hatte und wie sie in den nahen Bergen Snowboard gefahren war. Zwei Tage tobte ein regelrechter Mediensturm rund um Mimi Todd, dann wussten alle, dass sie ihr BWL-Studium in New York mit Auszeichnung abgeschlossen und bei einem Hospizbesuch in Salem geweint hatte.
Alle erinnerten sich noch gut an ihr spektakuläres Debüt bei einem der bundesweiten Fernsehsender, der die streitbare und steinreiche neue Frau des Senators zu sozialpolitischen Themen befragen wollte. Auf ihren Wunsch hin fand das Interview vor einem Obdachlosenheim in Washingtons prekärstem Stadtteil Anacostia statt, was sich aber vom ersten Moment an als Fehlentscheidung erwies. Mimi Todd wirkte in ihrem teuren Kostüm vollkommen fehl am Platz, und binnen kürzester Zeit hatte sich eine Bande rüpelhafter Jugendlicher vor ihr aufgebaut und sie ausgebuht und verhöhnt. Sie wolle in diesem Armenviertel bloß auf Stimmenfang gehen.
Man sah Mimi Todd deutlich an, dass diese Vorwürfe sie nicht kaltließen, doch anstatt das Interview abzubrechen und zu einem anderen Zeitpunkt an einem anderen Ort zu führen, war sie den Warnungen der Fernsehleute zum Trotz auf die Menschen zugegangen. Sie nahm sich die Zeit, mit ihnen zu reden, bis sich der Mob beruhigte. Sie ging von einem zum anderen, bis die Buhrufe aufhörten. Schließlich stellte sie sich wieder auf die Treppe vor dem Obdachlosenheim und hielt spontan eine Rede. Sie sprach davon, wie Menschen zusammenleben sollten, indem sie einander ehren und respektieren sollten – so überzeugend und direkt, dass man davon eine Gänsehaut bekam. Anschließend war es ganz still. Nicht einmal die Journalisten wagten, etwas zu sagen. Die Kameras aber liefen und verbreiteten die Botschaft im ganzen Land: Mimi Todd war eine ganz besondere Frau.
Und jetzt war sie auch noch schwanger. Ohne Leichen im Keller, mit anständigem familiärem Hintergrund. Ganz klar, dass die Medien durchdrehten.
Am nächsten Morgen rief Doggies Vater an und entschuldigte sich zerknirscht für das letzte Telefonat. Er sei bereit, alles zu tun, um das wieder auszubügeln.
Doggie bezweifelte die Lauterkeit seiner Absichten. Bruce Jansen hatte in Pennsylvania gerade haushoch gegen seinen Rivalen in der eigenen Partei gewonnen. Jetzt waren sie auf dem Weg nach Virginia, wo Doggie den größten Teil ihres Lebens verbracht und ihr Vater seine Kette eleganter Hotels gegründet und etabliert hatte. Rechnete er sich möglicherweise irgendeinen Vorteil aus?
Nach einigem Zögern nahm Doggie seine Entschuldigung an. Sie verabredete sich mit ihm für den nächsten Tag im Splendor Resort Hotel & Conference Center, dem größten seiner Hotels an der Ostküste und dem mit Abstand am schönsten renovierten Haus in Virginia Beach. Doggie passte das hervorragend, da sie sich an ihrem freien Tag dringend ein bisschen erholen wollte. Monatelang hatte sie nun jede Nacht in einem anderen Hotel verbracht und unzählige missglückte Versuche unternommen, im Bus zu schlafen. Das hatte an ihren Kräften gezehrt. Ein Besuch bei ihrem Vater würde sie ganz sicher wieder aufrichten. Denn als Tochter von Bud Curtis wohnte sie selbstverständlich in einer Luxussuite des Fünf-Sterne-Hotels mit stilvollen Möbeln in skandinavischem Design.
Meine Güte, dann hatte ihr Vater eben Hintergedanken und seinen Profit im Sinn. Das hatte er doch immer. Aber er war ihr Vater, und sie liebte ihn.
Er selbst war gar nicht im Hotel, als sie ankam. Stattdessen erwartete der devot-verschrobene Toby O’Neill sie auf dem Gehweg der Atlantic Avenue. Wieso ihr Vater dieses kauzige Faktotum auf seiner Gehaltsliste haben wollte, war ihr ein Rätsel. Wie ein Penner sah er aus, er passte so gar nicht in die exklusive Umgebung. Und er wirkte immer etwas falsch.
»Was für eine Freude, Sie wieder zu Hause zu haben, Miss Curtis!«, sagte er.
»Rogers, Toby! Seit der Scheidung meiner Eltern heiße ich Rogers.«
»Entschuldigung, Miss Rogers. Wie schön, dass Sie wieder da sind!«
Er schleppte ihren Koffer die Marmortreppe hinauf und schob den Portier zur Seite, damit er selbst Doggie die Tür aufhalten konnte. Sie fand das nicht rührend, eher nervte es sie.
Sie löste den Blick von dem schwitzenden Toby O’Neill und sah sich um. Seit ihrem letzten Besuch hatte sich viel verändert. Die Lobby war komplett renoviert worden und strahlte nun fast schon Perfektion aus, irgendetwas zwischen Hyatt Regency in Washington und Radisson Lexington in New York. Einladende Sitzgruppen, gedämpftes Licht, Edelhölzer, Marmor, Messing und frische Blumen, alles geschmackvoll aufeinander abgestimmt. Überall Hinweisschilder zu Konferenzräumen, Besprechungszimmern, Restaurants und dem hauseigenen Fitnesscenter. Allenthalben traf man auf freundlich lächelndes Personal in makellos gebügelten Uniformen, stets bereit, auf den geringsten Wink hin zu reagieren.
Stolz auf ihren Vater erfüllte sie – bis ihr Blick auf eine vier Meter hohe Kopie der Freiheitsstatue fiel, gleich daneben eine riesige vergoldete Vase mit baumgroßen, blühenden Kirschzweigen. Diese beiden Monstren wirkten auf Doggie, als seien sie nur dort platziert, um die Visionen des Innenarchitekten zu verhöhnen.
An der Vase lehnte ein Schild, auf dem stand: »Möge der Bessere gewinnen!« Gott, wie geschmacklos.
In ihrem Zimmer angekommen, schlief sie erst einmal zwei Stunden. Dann ging sie auf den Balkon und genoss den Blick über das Wasser. Sie war ausgeruht und guter Dinge – genau die richtige Verfassung, um sich mit ihrem impulsiven Vater zu treffen.
Zum ersten Mal seit Wochen zog sie ein Kleid an, ein blassgrünes Designerstück, das sie letzten Monat im Rahmen der Vorwahl in Colorado in Denver gekauft hatte.
Ihr Vater hatte schon immer gerne im Mittelpunkt gestanden, und das sah man ihm auch jetzt an, als er auf sie zukam. Er war noch zehn Meter vom Tisch entfernt, da posaunte er: »Meine Lieblingstochter!« Er nahm sie in den Arm, und Doggie gab nach. Sie liebte diese Augenblicke. Die Geborgenheit, seine Wärme und seine echten Gefühle für sie. Was das anging, war er immer wunderbar gewesen.
Sie redeten über den Umbau des Hotels und darüber, wie viel das alles gekostet hatte. Ihr Vater war ganz offenkundig stolz, und das zu Recht. Fünfzehn Hoteleröffnungen in zwölf Jahren, und alle Häuser erwirtschafteten satte Gewinne. Jetzt wolle er mit der Splendor-Kette auch an die Westküste expandieren, erzählte er und nickte, zufrieden mit sich und seinen Plänen. Potentielle Investoren würden schon noch auf ihn aufmerksam werden, brummte er lächelnd.
An dieser Stelle wurde Doggie hellhörig. Ihr Vater suchte Investoren.
»Okay!«, sagte sie. »Darum bin ich also hier, ja?«
Ihr Vater ignorierte ihren Einwurf und nickte Gästen zu, die gerade herübersahen.
»Du willst, dass Bruce Jansen während der Vorwahl übermorgen hier wohnt, stimmt’s?«
»Nein.«
»Nein? Was denn dann?«
»Nichts.«
»Ach, komm! Jetzt sag schon!«
»Nein, er soll nicht hier wohnen, jedenfalls noch nicht. Aber ich möchte dich bitten, Einfluss darauf zu nehmen, dass er seinen Wahlsieg im November bei mir feiert. Hier im Splendor Resort Hotel & Conference Center. Wär das nicht schick, Doggie?« Er neigte den Kopf und strahlte sie an, aber damit wickelte er sie nicht ein. Nicht mehr.
»Du spinnst ja wohl! Und wie kommst du dazu, von seinem Sieg zu sprechen? Erst mal müssten wir ja noch beim Nominierungsparteitag gewinnen. Und dann müssen wir gegen den Bruder eines trotz allem ziemlich beliebten Präsidenten antreten, schon vergessen? Und überhaupt: Du bist der reaktionärste, stockkonservativste Republikaner in ganz Amerika, Dad. Wie kommst du dazu, so etwas vorzuschlagen? Du würdest dir doch bereitwillig einen Arm brechen lassen, wenn das verhindern könnte, dass Jansen Präsident wird.«
Ihr Vater lächelte. »Ist dir noch gar nicht aufgefallen, dass dein großes Vorbild gerade über das Land fegt wie ein Buschfeuer? Er und seine schöne Frau und jetzt auch noch der kleine Teufelsbraten in ihrem Bauch?« Er grinste. »Nein, mein Schatz, Demokrat hin oder her, ab sofort ist Jansen mein Mann!«
Sie schob ihren Stuhl zurück. »Mir wird schlecht von deinem Opportunismus.«
»Halt, Dorothy, einen Moment bitte. Hör mir zu.«
Jetzt zog er wirklich alle Register. Wann hatte er sie zuletzt Dorothy genannt?
Er lehnte sich über den Tisch und nahm ihre Hand. »Jansen ist in Ordnung, Doggie. Ja, mir passen weder seine Ansichten noch seine Politik noch seine Visage noch seine hirnrissigen Argumente. Und ich sehe jede Menge Lug und Betrug in seinem Blick. Meiner Meinung nach ist auf den Mann kein Verlass. Er ist wie ein aktiver Vulkan. Aber seine Frau ist einfach bezaubernd, und er wird die Wahl mit ihrer Hilfe und der des Kindes gewinnen, aber auch mit Hilfe seiner großartigen Mitarbeiter, und du bist eine von ihnen, mein Kind.« Er tätschelte ihre Hand. »Darum ist er in Ordnung. Wenn du sagst, dass er dein Mann ist, dann ist er auch mein Mann. Basta.«
Eine derartige Kehrtwende hatte Doggie noch nie erlebt. Sie konnte es nicht begreifen. »Das ist doch Wahnsinn, Dad. Hast du die Publicity wirklich nötig? Warum kannst du dich nicht mit den fünfzehn Hotels zufriedengeben, die du bereits hast? Das viele Geld, das du angehäuft hast, kannst du doch nie im Leben ausgeben, selbst wenn du hundert Jahre alt wirst!«
Er lachte. »Es soll ja auch noch was für dich und deine Mutter übrig bleiben, oder?«
»Jetzt mach aber mal ’nen Punkt. Du führst doch irgendetwas im Schilde, und das gefällt mir gar nicht. Und lass gefälligst Mum aus dem Spiel, das würde sie sich auch verbitten.« Sie schüttelte seine Hand ab.
»Sieh dich doch mal um! Ist das nicht ein schönes Hotel?« Mit einer ausladenden Geste deutete er zu den pompösen, glitzernden Kronleuchtern und dem exklusiven Publikum. Schon wieder redete er um den heißen Brei. Wie sie das hasste.
»Hier in Senator Jansens eigenem kleinen Bundesstaat am Meer – könnte es einen besseren Ort geben, an dem ihr das Wahlergebnis erfahren und damit die Früchte eurer jahrelangen harten Arbeit ernten könntet? Ich biete Jansen und seinem Stab an, kostenlos eine ganze Woche hier zu wohnen. Alles ist gratis, und der Secret Service, oder wer auch immer auf den Mann aufpasst, kann machen, was er will. Von mir aus können die morgen schon kommen. Siehst du es denn nicht auch schon vor dir, Dorothy? Der zukünftige Präsident der USA wird in seinem Heimatstaat in dieser Lobby stehen, die Freiheitsstatue im Hintergrund, und seine Rede wird in die ganze Welt übertragen werden. Gibt es einen passenderen Rahmen?«
»Du bist echt schräg, Dad.« Sie sah sein schiefes Lächeln, schüttelte den Kopf und musste unwillkürlich zurücklächeln. Geschäft und Politik gewinnbringend vereinen: Darin war ihr Vater wirklich unschlagbar.
Dann wechselte er das Thema. »So, meine Süße, und jetzt erzähl mal: Was macht die Liebe?«
Sie zuckte die Achseln. Die Liebe machte natürlich immer ein bisschen was, aber nichts, wovon sie ihrem Vater erzählen wollte.
»Was ist mit diesem Wesley, von dem du früher immer so viel geredet hast? Wird das jetzt bald mal was mit euch beiden?«
Sie gab ihm einen Klaps auf die Hand. Seine Geschäftsmann-Gene mochten ein bisschen dominant und seine politischen Ansichten grundverschieden von ihren sein, aber abgesehen davon war ihr Vater wirklich in Ordnung.
»Das musst du ihn schon selbst fragen, Dad. Er hat ziemlich viel um die Ohren.«
Nach dem Essen mit ihrem Vater war sie ein paar Bahnen im Pool geschwommen, dann hatte sie sich auf ihren Balkon gesetzt, die Haare in der leichten Brise trocknen lassen und den funkelnden Sternenhimmel genossen. Als das Telefon klingelte, war Doggie ganz weit weg. Träge nahm sie ab. Wenn ihr Vater die Abmachung mit einem Drink besiegeln wollte, würde sie ablehnen. Sie hatte keine Lust, sich mit ihm an die Bar zu setzen. Sie hatte ihm versprochen, seine Einladung an Thomas Sunderland weiterzuleiten, das musste reichen. Jetzt wollte sie einfach nur ihre Ruhe haben und schlafen.
Doch die vertraute Stimme am anderen Ende war nicht die ihres Vaters, sondern die von Wesley Barefoot. Seit wann rief Wesley sie außerhalb der Arbeitszeit an? Man hätte meinen können, er hätte die Frage ihres Vaters gehört.
»Hallo, Doggie. Störe ich?«
Leicht verärgert bemerkte sie, dass sie die Luft anhielt.
»Hast du schon von den Meinungsumfragen heute gehört?«, sprach er weiter.
Ganz schön lahme Eröffnung. Natürlich war sie konstant im Bilde über sämtliche Meinungsumfragen, und das wusste er genau. »Nein, ich fahre nicht noch heute Abend nach Richmond, falls es das ist, wozu du mich bewegen willst«, sagte sie. »Ich habe frei, Wesley. Ich muss dringend mal ausschlafen. Das kann doch wohl bis morgen warten, oder? Ich möchte wenigstens dieses eine Mal …«
»Psch!«, machte er.
Sie hielt inne.
»Ich bin heute in der Sankt-Lukas-Kirche in Smithfield gewesen. Ist die süße kleine Dorothy da nicht getauft worden?«
Sie runzelte die Stirn. Worauf wollte er hinaus?
»Ganz schön beeindruckend. Die älteste erhaltene Kirche Amerikas. Neugotik, oder?«
Sie schüttelte den Kopf. »Wesley, du warst in der Kirche, weil Bruce und Mimi Jansen da geheiratet haben. Es gab extra einen Abendgottesdienst außer der Reihe, habe ich gehört. Tu nicht so, als würdest du dich für Neugotik interessieren oder dafür, wo ich getauft wurde. Also ehrlich.«
»Ich habe an dich gedacht.«
»O-kay …« Sie betonte die letzte Silbe und fixierte einen der hellsten Sterne. In einem schwachen Moment mochte das etwas Romantisches haben.
»Das war alles, was ich sagen wollte.«
»Ach?« Sie wartete einen Moment. »Und?«
Noch weiter konnte sie ihn nicht aus der Reserve locken, aber Doggie reichte das. Jetzt würden sie erst mal ganz normal weitermachen. Ein halbes Jahr lang würden sie gemeinsam sämtliche Kräfte in den Vorwahlkampf, die Nominierung und den Präsidentschaftswahlkampf stecken, und dann würden sie sich etwas näherkommen. Immerhin wusste sie jetzt, dass er sich noch immer für sie interessierte.
Am nächsten Morgen schlief Doggie aus. Es war ziemlich kalt, aber Doggie blieb bei ihrer Absicht, ihre Mutter in Chesapeake zu besuchen und den restlichen Vormittag mit ihr auf der Veranda zu verbringen. In hässliche Decken gehüllt, würden sie ein, zwei Stunden ihren Vater durch den Kakao ziehen. Doch bevor sie überhaupt richtig aufgestanden war, rief Wesley wieder an. Bruce Jansen und sein Gefolge würden noch vor Mittag in Richmond sein, und wenn sie sich um dreizehn Uhr alle im Büro des dortigen Gouverneurs versammelten, sollte Doggie dabei sein. Offenbar hatte es Drohungen gegen Jansen gegeben, und Sunderland wollte sein Team beisammen haben.
»Was für Drohungen?« Aber Wesley wusste auch nicht mehr. Sie verstand. Jansen und Sunderland hatten beschlossen, alle gleichzeitig zu informieren.
Sie packte ihren Koffer und fuhr mit dem Lastenaufzug hinunter in die Tiefgarage, um ihren schönen alten MG zu holen. Eisern hatte sie von ihrem nicht gerade üppigen Gehalt dafür gespart.
Als sich die Aufzugtüren öffneten, stand Toby O’Neill direkt vor ihr und grinste einfältig. Wie meistens war er unrasiert und trug einen grauen Kittel. Vermutlich wollte er gerade Papier in die Abfallpresse stopfen.
»Hallo, hallo, Miss Curtis, na, soll wohl weitergehen, was?«
Zuerst wollte sie ihn wieder wegen des Namens korrigieren, aber dann nickte sie nur. Brachte ja doch nichts. Er wollte es einfach nicht lernen.
»Zurück zum Riesenarschloch, was?«
Sie ging an ihm vorbei.
»Zurück zu Arschloch Jansen und seinem Hurenweib, die ganz Amerika und die ganze Welt verarschen. Große Arschlöcher, die uns verarschen, was?«
Sie blieb stehen. »Was sagst du da, Toby?«
»Er ist ein Arschloch, und sein dreckiges Weib ist genau wie alle anderen Huren!«
Sie hätte dem Kerl eins in seine ungepflegte Visage hauen können. »Jetzt hör mir mal zu, Toby, ja? Ich möchte nicht, dass du in meiner Gegenwart solche Sachen sagst. Woher hast du das bloß?«
Toby O’Neill rieb sich das Auge. Schwer zu sagen, ob er wirklich geistig zurückgeblieben war. Mal wirkte er ganz normal, mal wie ein sechsjähriges Kind. Und er war unberechenbar. Konnte in diesem Moment erschrocken zusammenzucken und im nächsten wütend aufbrausen. Sie bereute ihre Frage bereits und bewegte sich weiter auf ihr Auto zu.
»Das Arschloch hat Augen wie eine Eidechse und eine widerliche, gespaltene Zunge!«, hörte sie von hinten. »Wir hier unten trauen ihm nicht über den Weg, nein, wir Leute von hier trauen ihm nicht. Ihm nicht und seinem Hurenweib nicht und auch nicht seinem Teufelsbraten, dass Sie’s nur wissen!«
Sie drehte sich zu ihm um. Er hatte Jansens ungeborenes Kind Teufelsbraten genannt. Genau wie ihr Vater am Tag zuvor. »Wer sind ›wir‹, Toby?«
Er lachte. »Na, Sie jedenfalls nicht! Ganz bestimmt nicht!«
»Hat mein Vater das alles gesagt, Toby?«
»Ihr Vater?« Er wirkte plötzlich wie eingefroren. »Ihr Vater sagt niemals irgendwas in der Richtung, nein.« Sein Blick richtete sich auf etwas hinter ihr, und sie drehte sich blitzschnell um. Zwei Meter von ihnen entfernt stand mit unheilvoller Miene ihr Vater. Was in aller Welt hatte er hier verloren? War er gerade mit dem Wagen gekommen? Sie hatte nichts gehört. Dann wandte sie sich wieder Toby zu. Er sah aus, als habe er Angst.
»Du redest zu viel, Toby«, sagte Doggies Vater und sah den kleinen, dünnen Mann wütend an. »Hör auf, solches Zeug über Doggies Arbeitgeber zu faseln, das wollen wir nicht hören, kapiert?«
Während sie auf der Interstate Richtung Norden fuhr, schwirrte Doggie der Kopf. Eine Minute nach eins betrat sie das Sekretariat des Gouverneurs im zweiten Stock.
Um einen riesigen Konferenztisch saß bereits der gesamte Stab. Sie ließ sich auf den freien Stuhl neben Wesley fallen, der die Mitarbeiter als Erstes darüber informierte, was er der Presse bezüglich der Wahl am heutigen Tag mitgeteilt hatte. Dann lehnte er sich zu ihr herüber und fragte leise: »Na, ausgeschlafen?«
Sie brummte zustimmend.
»Du hast gesagt, Jansen hätte Drohungen erhalten. Weißt du, welcher Art?«
Wesley zeigte auf Thomas Sunderland, der im selben Moment den Raum betrat. Sunderland nickte ihnen allen kurz zu, dann setzte er sich.
»Um 10.05 Uhr hat die Polizei uns einen Hinweis gegeben, dass Drohungen gegen Senator Jansen geäußert wurden«, sagte er und sah die Anwesenden einzeln so durchdringend und ernst an, als hätten sie etwas zu verbergen.
Er sagte, die Polizei habe ihnen einen Hinweis gegeben, aber was genau bedeutete das? Doggie war gar nicht wohl. Nur mühsam gelang es ihr, die Bilder aus China zu unterdrücken.
Wesley bemerkte nicht, dass sie ihn ansah. Ob er ihr Gespräch von gestern schon vergessen hatte? Am liebsten hätte sie ihn jetzt berührt. Sie sah schräg nach hinten, wo Donald Beglaubter saß und ihr zuzwinkerte. Dann wandte sie sich wieder Thomas Sunderland zu. Er sah nicht gut aus.
»Wir wissen noch nicht genau, was das alles bedeutet«, fuhr er fort, »genau aus diesem Grund aber sah ich mich gezwungen, Senator Jansen über die Verschärfung der Sicherheitsbestimmungen zu informieren. So, wie es aussieht, befinden wir uns nunmehr in Phase zwei des Wahlkampfs und damit in der Phase, in der wir alle uns als potentielle Repräsentanten einer zukünftigen Regierung betrachten müssen – und damit als potentielle Zielscheiben von bösartigen und hasserfüllten Menschen und von Verrückten. So leid mir das tut, aber so ist es nun mal.«
Sunderland nickte in Richtung der Tür, die einer der Sicherheitsbeamten des Gouverneurs soeben geöffnet hatte. Sechs ernst dreinblickende Männer in schwarzen Anzügen betraten einer nach dem anderen den Raum.
»Ab sofort wird Jansen an keinem öffentlichen Ort mehr auftreten können, der vorher nicht gründlich gecheckt worden ist. Sie haben jetzt die Gelegenheit, unsere neuen Security-Mitarbeiter kennenzulernen. Herzlich willkommen!« Er applaudierte. »Diese Truppe steht unter dem Kommando von Spezialagent Ben Kane, der in diesem Moment seinem Arbeitgeber vorgestellt wird. Diese Männer sind ab sofort für Senator Jansens persönliche Sicherheit zuständig sowie für die Koordination mit dem Secret Service. Ab sofort haben Sie alle sich an die Anweisungen dieser Männer zu halten. Prägen Sie sich ihre Gesichter gut ein – diese Männer können unter Umständen eine Schlüsselrolle für uns alle spielen.«
Die Männer sahen sich zum Verwechseln ähnlich. Alle hatten den gleichen Körperbau und den gleichen toten Blick. Wie Klone. Nur ihre Mütter würden sie unterscheiden können. Gerade wollte Doggie Wesley eine entsprechende Bemerkung zuraunen, als sich die Tür hinter Sunderland öffnete und Jansen hereinkam. Er war in Begleitung eines Unbekannten in schwarzem Anzug. Vermutlich der Chef der anderen schwarz gekleideten Männer, Ben Kane.
»Einen wunderschönen guten Tag!«, schmetterte Jansen. Ihn schienen die Drohungen überhaupt nicht zu beunruhigen. »Sind wir alle bereit, uns zujubeln zu lassen? Ich habe nämlich bereits ein Umfrageergebnis bekommen – möchten Sie es hören?« Alle riefen durcheinander, und Jansen lächelte. »Wir werden in Virginia mit fast achtzig Prozent gewinnen!«
»Yes!«, schrie Wesley neben ihr, und alle sprangen von ihren Stühlen auf und rissen die Arme in die Höhe. Doggie war plötzlich ganz erleichtert. Allmählich glaubte sie es auch: Die nächste Station hieß Weißes Haus.
Als der Jubel verebbte, hob Thomas Sunderland die Hand. »Einen Moment noch, meine Damen und Herren! Das hier ist einfach wunderbar, so wunderbar, dass wir alle unserem zukünftigen Präsidenten und uns selbst einen Applaus schulden.« Er ging mit gutem Beispiel voran, und alle anderen fielen in das Klatschen ein. Dann hob Sunderland abermals die Hand. »Alles deutet darauf hin, dass wir bis zum Wahltag im November weiter mit von der Partie sein werden, und darum ist es mir ein dringendes Bedürfnis, unser Sicherheitsgespräch fortzusetzen und ordentlich abzuschließen.« Er wandte sich Bruce Jansen zu. »Senator Jansen, ich weiß, dass es uns zur Gewohnheit geworden ist, uns unter freiem Himmel zujubeln zu lassen, und ich weiß auch, wie sehr Sie darauf brennen, die Pressekonferenz auf dem Rasen vor Ihrem alten Domizil abzuhalten, aber ich muss Ihnen sagen, dass das heute leider nicht möglich ist.«
Die Nachricht änderte nichts an Jansens Lächeln. Er klopfte Sunderland auf den Rücken, sodass dessen dünnes Haar ganz durcheinandergeriet. Doggie sah, wie Sunderlands Hand sofort hochschoss, um es wieder in Ordnung zu bringen.
»Ich bin ein durch und durch glücklicher Mann, Thomas.« Einige klatschten, andere riefen ihm Glückwünsche zum Kind zu.
»Danke. Vielen Dank. Heute sollen alle an meinem Glück teilhaben und es mit eigenen Augen sehen dürfen. Und mein Sohn soll eines Tages wissen, dass sein Vater sich nicht von Drohungen beeindrucken ließ. Dass sein Vater die Presse mit Stolz ganz genau da empfing, wo es ihm passte.«
»Wer sagt, dass es ein Junge wird?«, rief einer.
Jansen breitete die Arme aus. »Ob Junge oder Mädchen, mir ist es ganz gleich. Wir sind schließlich in Amerika. Unsere Aufgabe ist es, für Frieden und Gleichberechtigung für alle zu sorgen, oder?«
Doggie bemerkte, dass Wesley lächelnd den Kopf schüttelte. Natürlich hätte man das eleganter ausdrücken können, aber der Applaus kam ja trotzdem.
»Ganz ruhig, Thomas«, sagte Jansen dann, zu Sunderland gewandt. »Wir wissen noch nicht, von wem die Drohung überhaupt stammt, und wir wissen auch nicht genau, worin sie überhaupt besteht. Wahrscheinlich ist das Ganze falscher Alarm, und als solchen sollten wir es auch behandeln. Heute wollen wir feiern, das soll uns nichts und niemand verderben.« Er streckte beide Arme in die Luft und rief: »Heute, Freunde, ist unser Tag!«
Die meisten sprangen auf und klatschten begeistert. Doggie und Wesley blieben sitzen. Wenn Sunderland der Ansicht war, dass sie gerade heute besonders vorsichtig sein sollten, wieso sollten sie seinem Rat dann nicht folgen?
Sunderland war ebenfalls sitzen geblieben. »Ich glaube nicht, dass das besonders klug ist. Wir werden die Wahl aufgrund klarer Aussagen gewinnen, aber mit klaren Aussagen schafft man sich auch Feinde, Senator Jansen. Wie Sie sagten, wir sind hier in Amerika. Hier sind Präsidenten nicht unantastbar, und Präsidentschaftskandidaten schon gar nicht! Die Welt ist gefährlich, und das wissen Sie besser als manch anderer.«
Doggie sah, wie sich ein Schatten auf Jansens Gesicht legte. Der Mord an seiner ersten Frau war ein Thema, über das man nicht sprach, das wusste Sunderland ganz genau.
Jansen trat ans Fenster und sah gedankenverloren hinaus. Dann drehte er sich wieder um und lächelte etwas bemüht. »Ich gehe jetzt trotzdem in den Park! Und stelle mich verdammt noch mal direkt vor den Springbrunnen. Das wird ein Anblick!«
Wütend sah Sunderland ihn an. »Nicht, solange ich hier etwas zu sagen habe!«
Jansen klopfte ihm noch einmal auf den Rücken. »Aber, aber, lieber Thomas, Misstrauen ist ein schlechtes Fundament. Wir treffen die üblichen Sicherheitsvorkehrungen, und dann gehen wir runter in den Park, ja?« Er machte auf dem Absatz kehrt und verschwand ins Nebenzimmer, wo der amtierende Gouverneur des Staates Virginia ihn erwartete. Sämtliche Blicke richteten sich auf Sunderland, der regungslos am Tisch saß und so abwesend dreinblickte, als wollte er gleich alles hinschmeißen. »Okay!«, sagte er nach einigen langen Sekunden und klatschte in die Hände. »Ihr wisst alle, was ihr zu tun habt, also los geht’s!« Dann ging er zu der Gruppe dunkel gekleideter Mitarbeiter und sprach leise mit ihnen.
Der Konferenzraum leerte sich, doch Doggie und Wesley blieben sitzen. Sie hatten noch mindestens eine Stunde bis zum Termin. Die Zeit hätte Doggie gerne noch in ihrem Hotelbett verbracht.
Wesley sah, wie sie gähnte. »Bist du sicher, dass du ausgeschlafen hast?«
Sie nickte. Spielte er mit seiner Frage auf einen möglichen Rivalen an?
Dann frag mich doch einfach, dachte sie. Aber Wesley ließ sich nichts anmerken, lehnte sich zurück und fragte, ob der freie Tag schön gewesen sei, was sie gegessen und wie sie den Abend verbracht habe. Genau darum war er großartig darin, aufdringliche Journalistenfragen abzuschmettern: Einerseits war er von kühler Rationalität, andererseits verbindlich, geistesgegenwärtig und interessiert. Eine Mischung, die Doggie ausgesprochen gut gefiel.
Er zeigte zum Fenster. »Heimspiel für dich, Doggie. Genieß es.« Während des anschließenden Gesprächs schaffte er es, dass sie ein wenig auftaute. Sie erzählte ihm von ihrer Zeit in Richmond, von der Scheidung ihrer Eltern, ihrem nicht immer einfachen Vater und schließlich auch von dessen Wunsch, Jansen möge den Wahlabend im November im Splendor Resort Hotel in Virginia Beach verbringen. Sie sagte ihm auch, dass sie überlegte, ob sie die Idee ihres Vaters überhaupt weiterleiten sollte, und dass es ihr von jeher zu schaffen gemacht hatte, wie schlecht ihr Vater von Senator Jansen dachte. Wesley nickte immer nur, als könne man ihm nichts erzählen, was er nicht ohnehin schon wusste. Das war ein seltsames, aber eigentlich gutes, vertrautes Gefühl.