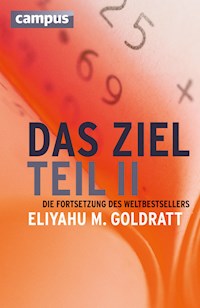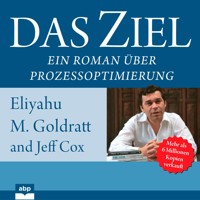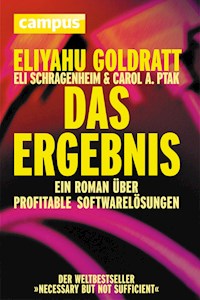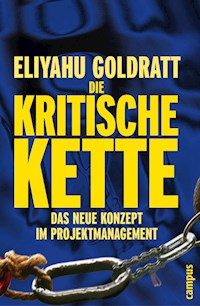Eliyahu M. Goldratt
Das Ziel – Teil II
Die Fortsetzung des Weltbestsellers
Aus dem Englischen von Petra Pyka
Campus Verlag Frankfurt/New York
Über das Buch
Sieben Jahre später: Alex Rogo, der Held von »Das Ziel«, leitet einige Firmen des Konzerns UniCo. Als die Firmen abgestoßen werden sollen, setzt Alex alle Hebel in Bewegung, um sie und sich nicht unter Wert zu verkaufen – in einem spannenden Wettlauf gegen die Zeit.
Mit dem Vorgänger »Das Ziel« hat Eliyahu Goldratt den Weltbestseller unter den Wirtschaftsromanen geschrieben. Nun setzt er die Erfolgsstory fort. Fachlicher Schwerpunkt ist diesmal das Marketing – mit der Theorie der aktiven Marktsegmentierung bietet Goldratt wieder eine fantastische Grundlage für betriebliche Revolutionen. Und nicht zuletzt erzählt er endlich, wie die Geschichte von Alex Rogo weitergeht ...
Über den Autor
Dr. Eliyahu M. Goldratt (1948–2011) war Autor und Managementberater. Das von ihm gegründete Unternehmen berät weltweit agierende Firmen wie Ford, General Motors oder Boeing. Seine THEORY OF CONSTRAINTS ist eine der innovativsten Managementmethoden der letzten Jahrzehnte, seine Wirtschaftsromane sind internationale Bestseller.
Im Campus Verlag erschienen DAS ZIEL, DAS ZIEL TEIL II, DAS ERGEBNIS und DIE KRITISCHE KETTE.
Kapitel 1
»Was nun die Konzernsparte von Alex Rogo betrifft …« Endlich kommt Granby zu meinem Bereich. Ich lehne mich zurück und lausche ergriffen. Ich genieße jedes Wort. Kein Wunder. Da ich geschäftsführender Vizepräsident des diversifizierten Konzernbereichs bin, stammt schließlich alles, was er nun sagt, aus meiner Feder. Nun, nicht alles, um genau zu sein. Granby hat ein paar Superlative ausgewechselt – was wohl sein gutes Recht ist als CEO.
Seine Worte sind Musik in meinen Ohren, und das liegt nicht etwa an seinem sonoren Bariton. Wer hat gesagt, dass man aus Zahlen keine Sinfonie komponieren kann? Und nun das Crescendo: »Insgesamt schließt dieser Bereich das Jahr mit einem Betriebsgewinn von 1,3 Millionen Dollar ab.«
Granby redet weiter, doch ich höre kaum noch hin. Gar nicht schlecht, denke ich bei mir. Überhaupt nicht schlecht, wenn man bedenkt, dass der Bereich noch tief in den roten Zahlen steckte, als ich vor einem Jahr die Führung übernahm. Jede einzelne der drei Konzerngesellschaften schrieb Verluste. Granby war am Ende. Aber diesmal sind es die externen Vorstandsmitglieder, die ihre Existenz rechtfertigen müssen. Die Konzernspitze setzt sich nämlich aus drei Gruppen zusammen. Da sind zunächst die Topmanager der Gesellschaft, die ihre Arbeit vor der Vorstandssitzung erledigen. Dann gibt es die dekorativen Direktoren, die in den Chefetagen anderer Unternehmen sitzen (oder früher einmal saßen) und ihre Arbeit woanders tun. Schließlich lauern da noch die professionellen Blutsauger, die »Vertreter« der Aktionäre – die überhaupt nicht arbeiten.
»Gut gemacht«, meint der aufgeblasene Ex-CEO einer Ölgesellschaft. »Sie haben UniCo genau zur richtigen Zeit wieder auf Kurs gebracht, um noch den bevorstehenden Konjunkturaufschwung zu nutzen.«
Selber gut gemacht, gebe ich in Gedanken zurück. Immerhin war das ein ganzer Satz ohne Anspielung auf seine eigenen vergangenen Erfolge. Der Kerl macht sich. Aber jetzt sind die Blutsauger an der Reihe. Wer wird sich als Erster auf Granbys Bericht stürzen, ihn in der Luft zerreißen und – wie gewöhnlich – noch mehr verlangen?
»Ich denke, der Etat fürs kommende Jahr ist zu wenig aggressiv«, meint einer der Blutsauger.
»Genau«, stimmt ein anderer zu. »Die prognostizierte Wertentwicklung stützt sich einzig und allein auf die erwartete Konjunkturerholung. Ein stärkeres Engagement von UniCo ist in der Planung gar nicht vorgesehen.«
Nun, das war ja nicht anders zu erwarten. Die hauptberuflichen Direktoren sind im Grund nichts anderes als moderne Sklaventreiber. Was man auch tut, es ist nie gut genug – und schon schwingen sie wieder die Peitsche. Granby würdigt die Einwürfe keiner Antwort. Da meldet sich James Doughty zu Wort.
»Ich glaube, wir dürfen nicht vergessen, dass wir es nicht mit dem gewöhnlichen Tagesgeschäft zu tun haben. Wir müssen uns schon ein bisschen anstrengen.« An Granbys Adresse setzt er hinzu: »Als Sie vor sieben Jahren als CEO antraten, wurden die Aktien zu sechzig Dollar zwanzig Cent gehandelt. Inzwischen pendeln sie bei zweiunddreißig Dollar.«
Besser als zwanzig Dollar wie vor zwei Jahren, denke ich bei mir.
»Außerdem«, fährt Doughty fort, »hat das Unternehmen so viele fragwürdige Investitionen getätigt, dass unsere Vermögenssituation mittlerweile recht prekär ist. In der Bonitätsbewertung wurde UniCo um zwei Kategorien heruntergestuft. Das ist keinesfalls akzeptabel. Meiner Ansicht nach sollte der Plan fürs kommende Jahr Managementinitiativen enthalten, die UniCo zu seiner einstigen Größe zurückführen.«
So eine lange Rede habe ich von Doughty noch nie gehört. Es muss ihm also wirklich ernst sein. So ganz Unrecht hat er gar nicht, wenn man einmal von dem gesamtwirtschaftlichen Umfeld absieht. Nie zuvor war der Wettbewerb so hart. Nie zuvor hat der Markt so hohe Anforderungen gestellt. Ich für meinen Teil – der ich weiß, wie schwierig diese Aufgabe ist – glaube, dass Granby seinen Job mehr als gut gemacht hat. Er hatte ein Blue Chip-Unternehmen übernommen, dessen Produktbasis jedoch ausgehöhlt war. Ein Unternehmen, das in die Verlustzone abglitt. Und er hat das Ruder herumgerissen.
Trumann hebt die Hand. Das Gemurmel verstummt. Die Lage ist tatsächlich ernst. Wenn Trumann Doughtys Partei ergreift, verfügen die beiden zusammen über so viel Einfluss, dass sie praktisch durchsetzen können, was sie wollen.
Es wird ruhig am Tisch. Trumann mustert uns Manager einen nach dem anderen und sagt dann sehr bedächtig: »Wenn das das Beste ist, was unser Management hergibt, dann … müssen wir uns wohl außerhalb nach einem Nachfolger umsehen.«
Wow. Das schlägt ein wie eine Bombe. Granby wird in einem Jahr ausscheiden. Bisher hatten alle stillschweigend angenommen, dass die Entscheidung über die Nachfolge zwischen Bill Peach und Hilton Smyth, den für die beiden Kernbereiche verantwortlichen geschäftsführenden Vizepräsidenten, ausgetragen werden würde. Ich persönlich bin für Bill Peach. Hilton ist nichts als ein schleimiger Intrigant. Doch hier beginnt ein ganz neues Spiel.
»Sie müssen doch über aggressivere Strategien nachgedacht haben«, meint Trumann zu Granby.
»Ja, das haben wir«, räumt Granby ein. »Bill?«
»Wir haben einen Plan«, setzt Bill an. »Einen Plan, der, wie ich betonen muss, noch nicht ausgereift und ausgesprochen sensibel ist. Wir sehen da eine Möglichkeit, das Unternehmen umzubauen und so noch einmal sieben Prozent an Kosten einzusparen. Doch es sind noch viele Details zu klären, bevor das spruchreif ist. Es ist nicht gerade ein leichtes Unterfangen.«
Nicht schon wieder. Ich dachte, das hätten wir hinter uns. Jedes Mal, wenn das Ergebnis nicht gut genug ausfällt, besteht die reflexhafte Reaktion darin, die Kosten zu senken – also Leute zu entlassen, denn darauf läuft es hinaus. Das ist lächerlich. Wir haben bereits Tausende von Stellen abgebaut. Und die waren bei weitem nicht alle überflüssig. Wir haben durchaus empfindliche Einschnitte vorgenommen. Als Werksleiter und noch mehr als Bereichsleiter lag ich permanent im Clinch mit Bill, um meine Leute zu schützen. Wenn wir die Energien, die wir in das ständige Umorganisieren investieren, stattdessen der Erschließung neuer Marktanteile widmen würden, ginge es uns sicher besser.
Aus unerwarteter Ecke kommt Widerspruch. Doughty meint: »Das allein genügt nicht.«
Und Trumann pflichtet prompt bei: »Das ist keine Lösung. Die Börse lässt sich von solchen Maßnahmen längst nicht mehr beeindrucken. Die neueste Statistik belegt, dass die Hälfte der Unternehmen, die Personal abgebaut haben, unter dem Strich nicht besser dasteht.«
Das kommt überraschend, und nicht nur für mich. Offensichtlich ziehen die Direktoren diesmal an einem Strang. Und sie haben etwas ganz Bestimmtes im Auge. Aber was?
»Wir müssen die richtigen Schwerpunkte setzen. Wir sollten uns mehr auf unser Kerngeschäft konzentrieren«, sagt Hilton Smyth entschieden.
Auf Hilton kann man sich verlassen, er hat immer eine abgedroschene Phrase zur Hand. Soll er sich doch auf das Kerngeschäft konzentrieren, genau das ist schließlich sein Job.
Trumann fragt sich das Gleiche: »Was brauchen Sie denn noch, um das Kerngeschäft zu stärken?«
»Ein weit höheres Investitionsvolumen«, entgegnet Hilton. Mit Granbys Einwilligung geht er zum Overhead-Projektor hinüber und legt ein paar Folien auf. Neues hat er nicht zu bieten. Es ist dieselbe Litanei, mit der er uns schon seit Monaten bombardiert. Mehr Investitionen in tolle Ausrüstung, mehr Investitionen in Forschung und Entwicklung, mehr Unternehmen, die wir zur »Vervollständigung unserer Linie« aufkaufen sollten. Woher zum Kuckuck nimmt er die Überzeugung, dass uns das weiterbringen wird? Das ist doch genau der Weg, auf dem wir in den vergangenen paar Jahren über eine Milliarde Dollar in den Wind geschossen haben.
»Das ist sicher der richtige Weg«, meint Doughty.
»Ganz bestimmt«, bekräftigt Trumann, »aber wir dürfen nicht außer Acht lassen, was Hilton eingangs sagte. Wir müssen uns auf das Kerngeschäft konzentrieren.«
Hilton Smyth, die Natter. Die drei klüngeln also. Eine schöne Show, die sie hier abziehen. Aber was soll denn nun konkret geschehen? Woher wollen sie die riesigen Summen nehmen, die sie benötigen, um solch fantastische Investitionen zu tätigen?
»Ich glaube, Diversifizierung war die falsche Strategie«, sagt Trumann. Zu Granby gewandt fährt er fort: »Ich verstehe schon, was Sie sich dabei gedacht haben. Sie wollten UniCo eine breitere Basis verschaffen, um Sicherheitsreserven zu bilden. Rückblickend werden Sie jedoch sicher einsehen, dass das ein Fehler war. Wir haben fast dreihundert Millionen Dollar in die Diversifizierung gesteckt. Für eine Rendite, die den Aufwand sicher nicht rechtfertigt. Ich glaube, wir sollten entgegengesetzt vorgehen. Wir sollten die betreffenden Firmen verkaufen, um unsere Finanzlage zu verbessern, und das Kapital stattdessen ins Kerngeschäft investieren.«
Ich erlebe zum ersten Mal, dass Granby derart attackiert wird. Doch das ist nicht das Schlimmste. Viel schlimmer ist, dass dieser Angriff auf Granby mein Ende bedeutet. Denn Trumann schlägt hier nichts anderes vor, als die Gesellschaften zu verkaufen, für die ich zuständig bin!
Was kann ich tun?
Granby wird das sicher nicht zulassen. Seine langfristige Strategie steht und fällt mit der Diversifizierung.
Aber plötzlich geht alles ganz schnell. Immer mehr Direktoren schlagen sich auf Trumanns Seite. Ein entsprechender Beschluss wird beantragt, unterstützt und angenommen – und das alles in nicht einmal fünf Minuten. Und Granby sagt kein Wort dazu. Er stimmt sogar dafür. Er muss noch ein Ass im Ärmel haben. Er muss einfach!
»Bevor wir uns nun dem nächsten Punkt auf der Tagesordnung zuwenden«, fährt Granby fort, »möchte ich zu bedenken geben, dass die Investitionen ins Kerngeschäft sorgfältig geplant werden müssen.«
»Einverstanden«, meint Trumann. »Die bisherige Investitionsplanung ist viel zu konventionell und birgt zu hohe Risiken.«
Ich schaue zu Hilton Smyth. Das Lächeln ist ihm vergangen. Ganz offensichtlich spielt hier jemand ein doppeltes Spiel. Er hat den CEO-Sessel also doch noch nicht in der Tasche. Es sieht ganz so aus, als würden wir mit einem CEO von außerhalb beglückt. Auch gut, jeder andere ist besser als Hilton.
Kapitel 2
Es klingt, als gäbe irgendeine zweitklassige Band ein Live-Konzert in unserem Haus. Ich gehe auf direktem Weg zu Daves Zimmer. Er sitzt am Schreibtisch und macht Schularbeiten. Ihn zu begrüßen, kann ich mir getrost schenken, denn er hört sowieso nichts. Ich mache seine Tür zu. Der Lärm wird um fünfzig Dezibel erträglicher. Es war wirklich ein weiser Entschluss von Julie gewesen, zusammen mit der Stereoanlage eine schallisolierte Tür anzuschaffen.
Sharon hängt am Telefon. Ich winke ihr zu und gehe in die Küche hinunter. Seit Julie ihr Büro aufgemacht hat, haben wir uns an späte Essenszeiten gewöhnt. Sie ist Eheberaterin und sagt immer, die beste Arbeitszeit sei zwischen sechzehn und einundzwanzig Uhr. Zumindest für ihre Kunden. Wir trösten uns mit den Tapas, die Julie vorbereitet hat. Auch wenn wir in Amerika leben, können wir schließlich trotzdem ein paar europäische Sitten pflegen.
»Am Samstag bin ich zu einer absolut hippen Party eingeladen.«
»Wie schön«, sage ich und nehme mir den Rest Hühnerleberpastete. »Was ist denn so hip daran?«
»Es ist eine Oberstufenparty. Es sind nur vier Leute eingeladen, die noch unterhalb der elften Klasse sind.«
»Meine umschwärmte Tochter«, sage ich und zwinkere ihr zu.
»Wieso auch nicht?«, meint sie und wirbelt im Kreis herum.
Die Kinder haben mir nur ein einziges von den Sandwiches mit Frischkäse und Oliven übrig gelassen. Ich verschlinge es in zwei Bissen.
»Du erlaubst es mir also?«, fragt sie.
»Ich wüsste nicht, was dagegen spricht.« Sie wirft mir eine Kusshand zu und schwebt aus der Küche.
»Warte mal«, rufe ich sie zurück. »Gibt es denn irgendeinen Grund, weshalb ich etwas dagegen haben könnte?«
»Eigentlich nicht«, sagt sie. »Schließlich bin ich fast vierzehn.«
»Eben, du großes Mädchen. Wenn man acht Monate als »fast« bezeichnen kann…« Da dämmert es mir allmählich. »Wie lange soll diese Party denn gehen?«
»Weiß nicht«, meint sie beiläufig – viel zu beiläufig für meinen Geschmack. »Länger, nehme ich an.«
»Wie lang, Sharon?«, frage ich und nehme mir ein Bier aus dem Kühlschrank.
»Jedenfalls«, erwidert sie und ihre Stimme wird quengelig, »kann ich auf keinen Fall nach Hause gehen, solange sie noch nicht zu Ende ist.«
Ich mache die Dose Bier auf und steuere das Wohnzimmer an.
»Wie lange, Sharon?«, wiederhole ich.
»Mensch, Daddy, das ist eine Oberstufenparty.« Sie gibt mir immer noch keine Antwort. »Begreifst du das denn nicht?«
»Ich begreife ganz gut«, sage ich und schalte den Fernseher ein. »Und ich möchte, dass du spätestens um zehn Uhr zu Hause bist.«
»Aber Debbie, Kim und Chris gehen auch hin!« Die ersten Tränen rollen. »Wieso muss ich dann zu Hause bleiben?«
»Du musst ja gar nicht zu Hause bleiben. Du sollst nur um zehn zurück sein.« Ich zappe ziellos durch die Programme. »Was sagt denn deine Mutter dazu?«
»Sie hat gesagt, ich soll dich fragen«, schnieft Sharon.
»Jetzt hast du gefragt und weißt Bescheid. Mehr gibt’s dazu nicht zu sagen, mein Schatz.«
»Ich hab ihr ja gleich gesagt, dass du das nicht verstehen wirst«, heult sie und rennt auf ihr Zimmer.
Ich schalte mich weiter durch die Kanäle. Es ist zehn vor sechs. Gleich wird Julie anrufen und mir Anweisungen fürs Essen erteilen. Was hat sie sich nur dabei gedacht, Sharon mit so etwas zu mir zu schicken.
Julie gibt sich alle Mühe, mich in den familiären Alltag einzubinden. Ich habe ja auch gar nichts dagegen, denn das Meiste lastet ohnehin auf ihren Schultern. Aber auf die Rolle des Spielverderbers kann ich gerne verzichten. Julie hätte doch wissen müssen, dass ich Sharon nicht erlauben würde, länger wegzubleiben.
»Also noch einmal, zur Sicherheit: Um sieben schalte ich den Ofen ein, bei dreihundertfünfzig Grad, und nach zehn Minuten schiebe ich dann die Lasagne hinein.«
»Genau, mein Schatz«, lobt Julie. »Alles in Ordnung bei dir?«
»Nun, eigentlich nicht. Ich fürchte, Sharon wird wohl nicht mit uns essen wollen heute Abend.«
»Mhm. Das heißt, du hast es ihr rundweg verboten.«
»Natürlich«, bestätige ich. »Was hast du denn erwartet?«
»Nun, ich dachte, du würdest die Verhandlungsmethode einsetzen, die Jonah uns beigebracht hat.«
»Mit meiner Tochter verhandle ich nicht«, entgegne ich gereizt.
»Wie du meinst«, meint Julie ruhig. »Es ist dein gutes Recht, ihr vorzuschreiben, was sie zu tun hat, aber du musst auch bereit sein, die Folgen zu tragen. Stell dich drauf ein, dass du zumindest bis Samstag bei deinem kleinen Liebling nicht allzu hoch im Kurs stehst.«
Als ich nicht antworte, setzt sie hinzu: »Lass es dir doch noch einmal durch den Kopf gehen, Alex. Es ist ein typisches Anwendungsbeispiel für unsere Verhandlungsmethode. Gehe einfach nach der üblichen Strategie vor. Konstruiere die ›Wolke‹.«
Jonah ist mein ehemaliger Physikprofessor, der mir mit seinen Anstößen zu einem unkonventionellen Denken schon Job und Ehe gerettet hat. Eine seiner Methoden zur Konfliktbewältigung ist die »Wolke«.
Ich gehe zum Fernseher zurück, um die Nachrichten zu sehen. Nichts Neues. Verhandlungen. Die Israelis und die Araber, wieder eine Entführung. Überall Verhandlungen.
Ich muss schon bei der Arbeit für meinen Geschmack viel zu oft mit sturen, unverträglichen, unlogischen Zeitgenossen verhandeln. Spaß macht mir das nicht. Kein Wunder also, dass ich Jonah nicht glauben wollte, als er behauptete, dass nicht die Menschen daran schuld seien, sondern die Umstände. Eben die Umstände, die sich ergeben, wenn das, was man selbst will, nicht vereinbar scheint mit dem, was der andere will. Wenn es keinen akzeptablen Kompromiss gibt.
Damals, im Gespräch mit Jonah, gab ich zu, dass solche Situationen schwer zu lösen seien, beharrte jedoch darauf, dass es sehr viel mit dem unsympathischen Wesen des Gegenübers zu tun habe. Da schlug Jonah vor, ich solle doch einmal nachfragen, ob es meinem Gesprächspartner nicht genauso erging, wenn ich den Eindruck hätte, er sei stur und unlogisch.
Genau das tat ich. Seither wende ich diese Methode immer an, wenn sich berufliche Verhandlungen nicht wunschgemäß entwickeln. Aber zu Hause? Mit Sharon?
Julie hat Recht. Sharon und ich hatten tatsächlich eine Verhandlung geführt, und wir hatten den Punkt erreicht, an dem jeder vom anderen glaubte, er sei uneinsichtig. Wenn ich mir vorwurfsvolle Blicke ersparen wollte, sollte ich mich wohl besser an Jonahs Anweisungen halten.
»Wenn Sie feststellen, dass eine Verhandlungssituation keinen akzeptablen Kompromiss zulässt, machen Sie den ersten Schritt: Brechen Sie den Dialog ab«, höre ich Jonah sagen.
Den Dialog hat Sharon bereits abgebrochen (soweit man zwei gleichzeitig stattfindende Monologe überhaupt als Dialog bezeichnen kann).
Nun befinde ich mich also bereits im zweiten Stadium, das dem Erreichen der richtigen Einstellung dient. Man muss erkennen, dass trotz aller Emotionalität nicht der andere für die Situation verantwortlich gemacht werden darf, sondern dass wir uns eben in einem Konflikt befinden, der einfach keine freundschaftliche Lösung zulässt.
Das ist nicht so einfach. Schließlich habe ich das Problem ja nicht in die Welt gesetzt. Andererseits wäre es ziemlich albern, Sharon zum Vorwurf zu machen, dass sie auf diese Party gehen will.
Vielleicht können wir ja doch einen Kompromiss schließen? Zehn Uhr ist schließlich kein unantastbares Gesetz. Vielleicht könnte ich ihr soweit entgegenkommen, dass sie bis halb elf bleiben darf. Aber das würde ihr sicher nicht reichen. Und Mitternacht kommt einfach nicht infrage.
Also gehe ich lieber ins nächste Stadium über und schreibe tatsächlich die Wolke. Ich gehe in mein Arbeitszimmer, um mir die genauen Anweisungen durchzulesen.
Ich kann sie nicht finden, doch das ist nicht so schlimm – ich kenne sie auswendig. Ich greife nach Papier und Stift und versuche, sie mir zu vergegenwärtigen. Die erste Frage ist: Was will ich erreichen? Ich schreibe in die rechte obere Ecke des Blattes: »Sharon soll um zehn Uhr zu Hause sein.« Darunter schreibe ich die Antwort auf die Frage: Was will sie erreichen? »Sharon will bis Mitternacht fortbleiben.« Das wäre ja noch schöner!
So weit, so gut, versuche ich mich zu beruhigen. Zurück zu meiner Methode. Aus welchem Bedürfnis heraus bestehe ich auf meinem Anliegen? »Um den Ruf meiner Tochter zu schützen.« Nun mach mal halblang, Alex, sage ich zu mir. Was ist schon dabei, wenn sie auf eine Party mit älteren Schülern geht? Aber die Nachbarn, was werden die sagen? Vermutlich gar nichts, und wenn, wen interessiert das schon?
»Was ich dem einen Kind verboten habe, kann ich doch jetzt nicht plötzlich dem anderen erlauben.« Ich wünschte, ich könnte mich hinter dieser Ausrede verstecken, doch bei Dave kam so etwas einfach nicht vor. Er zeigt erst seit kurzem Interesse an Partys, und selbst jetzt noch kommt er kaum je nach Mitternacht nach Hause. Mädchen! Mit Jungen ist das eben alles viel einfacher.
Warum bestehe ich also unbedingt auf zehn Uhr? Wieso weiß ich so genau, was ich will, und trotzdem fällt es mir so schwer, zu erklären, warum?
»Kinder brauchen Disziplin«, schießt es mir durch den Kopf. Kinder müssen lernen, dass es bestimmte Grenzen gibt. Dass sie nicht tun und lassen können, was ihnen passt. Regeln sind nun einmal da, um sie zu befolgen.
Moment mal – aber für Regeln muss es doch eine Begründung geben. Sie müssen einen Sinn haben. Ansonsten vermittelt man seinen Kindern nicht, was Disziplin ist, sondern man gebärdet sich höchstens als Haustyrann. Und das ist eine gefährliche Schiene. Damit erreicht man nur, dass die Kinder so bald wie möglich ausziehen.
Julie und ich achten geflissentlich darauf, keine unsinnigen Regeln aufzustellen. Worauf beruht also diese Zehn-Uhr-Regel? Nur darauf, dass ich in ihrem Alter höchstens bis neun wegbleiben durfte? Das ist kein Grund.
»Ihre Sicherheit.« Das ist es. Genau deshalb beharre ich so auf meinem Standpunkt. Ich fühle mich richtig erleichtert.
Ich schreibe mittig ganz oben auf die Seite: »Sharons Sicherheit gewährleisten.« Jetzt muss ich noch herausfinden, welches Bedürfnis sie zu ihrem Anliegen treibt. Aber woher soll ich das wissen? Wer kann schon nachvollziehen, was in einem dreizehnjährigen Mädchen vorgeht? Wobei – eigentlich weiß ich ja, worum es ihr geht. Sie hat es oft genug deutlich gemacht. Sie will beliebt sein. Also gut. Das schreibe ich auf. Jetzt kommt die allerschwierigste Frage: Was ist unser gemeinsames Ziel? Offen gestanden, in meiner augenblicklichen Stimmung glaube ich nicht, dass wir hier auch nur annähernd ähnliche Ziele verfolgen. Kinder. Wir lieben sie. Das tun wir ganz bestimmt. Wir sind genetisch so gepolt. Das heißt aber noch lange nicht, dass wir sie auch mögen müssen. Was für ein Dilemma.
[Bild vergrößern]
Aber ich will nicht abschweifen. Worin besteht denn nun unser gemeinsames Ziel? Wieso verhandeln wir überhaupt? Wieso liegt uns an einer Entscheidung, mit der wir beide leben können? Weil wir eine Familie sind, weil wir weiterhin unter einem Dach leben müssen. Links schreibe ich hin: »Ein harmonisches Familienleben führen.«
Ich lese noch einmal durch, was ich geschrieben habe. Um ein harmonisches Familienleben zu führen, muss ich dafür sorgen, dass Sharon nichts zustößt. Unbedingt. Andererseits muss Sharon beliebt sein, damit wir ein harmonisches Familienleben führen können. Ich weiß zwar nicht genau, warum, aber – wie ich schon sagte – schließlich habe ich keine Ahnung, was im Kopf eines weiblichen Teenagers vorgeht.
Nun zum Konflikt. Um Sharons Sicherheit zu gewährleisten, muss Sharon um zehn Uhr zu Hause sein. Doch damit Sharon bei ihren Freunden gut angeschrieben ist, muss sie bis Mitternacht wegbleiben. Ein eindeutiger Konflikt. Ebenso klar ist, dass es keine Kompromisslösung gibt. Ich mache mir Gedanken um ihre Sicherheit, und dabei ist mir ehrlich gesagt schnurzpiepegal, ob sie deshalb bei ihren unerzogenen Freunden weniger gut ankommt. Für sie ist es genau umgekehrt.
Seufzend klopfe ich an Sharons Zimmertür. Das wird bestimmt kein Spaß. Sie schaut mich mit verheulten Augen an.
»Sharon, lass uns noch einmal darüber reden.«
»Was gibt es da noch zu reden«, schluchzt sie los. »Du verstehst mich einfach nicht.«
»Dann hilf mir doch, dich zu verstehen«, sage ich und setze mich auf ihr Bett. »Immerhin haben wir im Grunde dasselbe im Sinn.«
»Haben wir das?«
»Das will ich schwer hoffen. Was hältst du zum Beispiel«, beginne ich von der Wolke auf meinem Zettel abzulesen, »von einem harmonischen Familienleben? Das willst du, und das will ich. Richtig?«
Sie antwortet nicht.
»Wie ich das sehe, musst du bei deinen Freunden gut ankommen, damit wir ein harmonisches Familienleben führen können.«
»Aber nein, darum geht es doch gar nicht. Das Problem ist doch nicht, ob ich gut ankomme. Verstehst du denn nicht, Daddy, ich habe Freunde. Ich kann mich nicht ausschließen. Dazuzugehören ist nun einmal wichtig.«
Ich kann nicht erkennen, inwiefern sich das von dem unterscheidet, was ich notiert habe, doch ich beherzige Jonahs Anweisungen und streite nicht. Ich streiche es einfach durch und schreibe stattdessen: »Sharon wird von ihren Freunden akzeptiert.«
»Trifft das zu?«
»Schon eher.«
Nun, mehr kann ich in diesem Stadium wohl kaum erwarten. Ich fahre fort. »Um von deinen Freunden akzeptiert zu werden, musst du also bis Mitternacht auf der Party bleiben, richtig?«
»Ich muss bleiben, bis die Party zu Ende ist. Ich kann nicht gehen, wenn sie noch in vollem Gange ist. Das ist, als würde ich da stehen und rufen: ›Ich bin noch ein Baby. Ihr hättet mich nicht einladen sollen. Lasst mich ruhig links liegen.‹ Verstehst du das denn nicht, Daddy?«
»Was soll ich also hinschreiben?«, frage ich.
»Was du geschrieben hast, ist schon in Ordnung, denke ich. Die Party wird nicht viel länger gehen als bis zwölf. Was hast du damit bloß für ein Problem? Du solltest langsam mal zur Kenntnis nehmen, dass ich erwachsen werde.«
»Das ist mir schon klar, Sharon. Aber damit ich ein harmonisches Familienleben führen kann, muss ich sichergehen, dass dir nichts zustößt.«
»Das verstehe ich ja, Daddy«, meint sie.
»Deshalb möchte ich, dass du bis zehn zu Hause bist.«
»Aber siehst du denn nicht …«
»Ich sehe schon, aber wir wollen nicht um die Uhrzeit streiten. Darum geht es im Grunde ja gar nicht. Es geht ausschließlich um deine Sicherheit und darum, dass du von deinen Freunden akzeptiert werden möchtest. Warum schauen wir uns nicht die Annahmen an, die uns zu der Schlussfolgerung geführt haben, dass zehn Uhr entscheidend ist für deine Sicherheit und zwölf Uhr entscheidend dafür, dass du von deinen Freunden akzeptiert wirst?«
»Ich weiß nicht, was es mit meiner Sicherheit zu tun hat, wenn ich später nach Hause komme«, lamentiert sie.
»Das weißt du nicht?«
»Nein. Sicher wird uns einer der Jungen nach Hause fahren.«
»Oh? Haben die denn alle einen Führerschein?«
Das nimmt ihr kurz den Wind aus den Segeln. »Daddy, könntest du uns nicht fahren?«, fragt sie zögernd.
»Was sind denn das überhaupt für Schüler?«, frage ich zurück. Als ich höre, dass es sich durchweg um Jungs von Daves alter Schule handelt, beruhigt mich das etwas. Es ist eine gute Schule, die Jungs sind sicher in Ordnung. Und das Transportproblem wird sich lösen lassen. Es besteht also kein Grund zur Besorgnis.
»Du lässt mich also? Danke, Daddy. Ich wusste, du würdest mich verstehen.« Sharon hüpft erst auf und nieder, dann auf meinen Schoß und schließlich zum Telefon. »Ich muss gleich Debbie anrufen. Jetzt wird ihr Vater bestimmt auch ja sagen.«
Lachend eile ich die Treppe hinunter zum Ofen.
Ich habe Julie gerade von der Vorstandssitzung berichtet.
»Das sieht ja nicht sehr gut aus«, meint sie.
»Gar nicht gut«, pflichte ich ihr bei. »Diesmal braut sich eine echte Wolke über mir zusammen. Mein Ziel ist, meinen Job zu behalten. Deshalb muss ich den Vorstandsbeschluss mittragen. Das heißt aber, ich muss helfen, meine Firmen zu verkaufen.«
»Andererseits«, spinnt Julie den Faden weiter, »kannst du deinen Job nur behalten, solange er noch da ist. Das wiederum bedeutet, dass du alles tun musst, um den Verkauf der Gesellschaften zu verhindern.«
»Genau.«
»Und was wirst du tun?«
»Ich weiß es noch nicht. Ich werde wohl zunächst den Weg des geringsten Widerstands gehen, zumindest bis klar wird, was Sache ist«, sage ich, aber es klingt nicht sehr überzeugend.
Julie setzt sich neben mich aufs Sofa. »Mein Schatz«, sagt sie und streicht mir über die Wange, »du weißt doch, was passiert, wenn man widrige Umstände einfach wuchern lässt.«
Natürlich weiß ich es. Wenn man nichts unternimmt, wird es höchstens noch schlimmer. Ich lege den Arm um sie. »Na ja, zur Not können wir ja immer noch von deinem Einkommen leben«, weiche ich aus.
»Meinetwegen. Aber ob dir das gefallen würde?«
Ich küsse sie. »Du hast ganz Recht. Ich kann mich nicht einfach auf Granby verlassen. Es hat keinen Sinn, untätig abzuwarten. Ich muss eine Möglichkeit finden, den Vorstand in meinem Sinne zu beeinflussen.«
Kapitel 3
»Das ist keine gute Idee«, versuche ich Don zuzurufen.
»Was?«, entgegnet er – zumindest dem nach, was ich von seinen Lippen ablesen kann.
Es hat keinen Sinn. Diese riesigen Druckmaschinen sind noch schlimmer als Daves Stereoanlage. Monströs, beinah furchterregend. Die Geschwindigkeit, mit der sich die Papierbahnen hindurchschlängeln, ist direkt unheimlich. Wenn man länger als ein, zwei Minuten zuschaut, wird man seekrank. Wenigstens geht es mir so. Außerdem – wenn man einmal eine Druckerpresse gesehen hat, dann genügt das. Sofern man nicht gerade ein Druckerpressenfan ist.
Ich packe meinen Assistenten Don mit der einen Hand und Pete, den Leiter dieser Druckerei, mit der anderen, und zerre sie zum nächsten Ausgang. Hier draußen, wo man wieder hört, was der andere schreit, erkläre ich Pete, dass ich nicht seine geliebten Maschinen gemeint habe, als ich sagte, ich wolle sehen, wie sein Betrieb funktioniert. Für mich ist ohnehin eine Maschine wie die andere.
»Was wollen Sie dann sehen?«, fragt Pete.
»Das Lager mit den fertigen Produkten zum Beispiel.«
»Aber da gibt’s nichts zu sehen«, meint er. »Haben Sie denn meine Berichte nicht gelesen?«
»Genau deshalb will ich mir die Geschichte ja mit eigenen Augen anschauen«, entgegne ich.
Das Lager ist dreimal so groß wie der Rest des Komplexes, und zweimal so hoch. Als ich das erste Mal hier war, eine Woche nach meiner Ernennung zum geschäftsführenden Vizepräsidenten des diversifizierten Konzernbereichs, quoll es förmlich über von allen möglichen Druckerzeugnissen. Meine erste Amtshandlung war prompt die Ablehnung des Antrags auf Bewilligung eines weiteren Lagers. Danach hatte ich das aufwändige, doch große Vergnügen, Pete und seinem Managementteam beizubringen, wie man ein Unternehmen leitet, ohne sich mit einer Riesenmenge an Lagerbeständen selbst die Luft abzudrücken.
»Was haben Sie mit dem Raum vor?«, frage ich Pete. »Partys feiern? Flugzeuge bauen?«
»Verkaufen, denke ich«, lacht er. Ich antworte nicht.
»Wie steht es mit der Pünktlichkeit bei der Auslieferung?«, fragt Don.
»Nun, unsere Werte liegen bei knapp einhundert«, entgegnet er stolz.
»Wie verhielt es sich damit, bevor Sie das Lager geräumt haben?«
»Fragen Sie lieber nicht. Wissen Sie, damals hat außer Alex hier keiner so richtig geglaubt, dass der Abbau des Bestands an fertigen Erzeugnissen zu einer Verbesserung der Lieferpünktlichkeit führen könnte. Daran hatten wir ganz schön zu schlucken. Aber ich will Ihnen zeigen, wo sich die wirklich wichtigen Veränderungen vollzogen haben – in der Arbeitsvorbereitung.«
Auf dem Weg löchert Don Pete weiter mit Detailfragen. Don ist ein guter Mann, und sein stetiger Lerneifer garantiert, dass er noch besser werden wird. Ich habe jemanden gebraucht, der sich um die Details kümmert. Jemanden, der nicht nur versteht, was ich tue, sondern auch, warum ich es tue. Es ist mittlerweile eineinhalb Jahre her, dass ich mich dazu entschlossen habe, den blitzgescheiten Jungingenieur anzuwerben, der in Bill Peachs Team Däumchen drehte. Es war eine gute Entscheidung. Eine meiner besten.
Wir betreten den Vorbereitungsraum.
In Wirklichkeit handelt es sich dabei nicht um einen Raum, sondern beinah um eine ganze Etage. Es ist ruhig. Hier wird gearbeitet. Hier werden Kundenwünsche in »Kunstwerke« verwandelt. Von hier gehen die Aufträge, sobald der Kunde zufrieden ist, an die Druckerei zur Produktion. Auf den ersten Blick ist alles beim Alten geblieben, doch dann fällt mir auf, dass die Nervosität fehlt, die Hektik, die gestressten Gesichter.
»Hier schein gar kein Druck zu herrschen«, sage ich zu Pete.
»Eben«, lächelt er. »Kein Druck. Aber trotzdem bearbeiten wir neue Entwürfe hier in weniger als einer Woche – gegenüber mehr als vier Wochen, was früher akzeptierter Standard war.«
»Das wirkt sich doch sicher auch auf die Qualität aus«, meint Don.
»Ohne Frage«, bestätigt Pete. »Qualität ist neben der Bearbeitungszeit unsere große Stärke.«
»Wirklich beeindruckend«, sage ich. »Kommen Sie mit ins Büro, und lassen Sie uns über die Zahlen sprechen.«
Petes Druckerei ist der kleinste der Betriebe meines Bereichs, doch er ist auf dem besten Wege zum Vorzeigeobjekt. Alles, was ich in dieses Unternehmen investiert habe – nicht an Geld, sondern an Zeit –, um Pete und seine Leute zu schulen, hat sich ohne jeden Zweifel bezahlt gemacht. In einem Jahr haben sie sich von einer mittelmäßigen zu einer hervorragenden Druckerei gemausert. In mancherlei Hinsicht sind sie sogar die Besten. Aber die Zahlen sind weniger erfreulich. Das Unternehmen wirft zwar Gewinn ab, doch nur mal so eben.
»Pete«, frage ich, obwohl ich die Antwort schon kenne, »wie kommt es, dass sich Ihre überlegenen Leistungen – bei der Einhaltung von Lieferterminen, der Reaktionszeit und der Qualität – nicht durch höhere Preise bemerkbar machen?«
»Ja, ist schon komisch, nicht wahr?«, sagt er emotionslos. »Jeder Kunde verlangt kürzere Lieferzeiten und bessere Leistungen. Doch wenn man das bietet, weigern sie sich, mehr dafür zu bezahlen. Sie betrachten das Leistungsplus als Prämie dafür, dass sie mit uns ins Geschäft kommen. Wer nicht mithalten kann, bekommt kaum noch Aufträge. Wer die geforderten Ansprüche erfüllt, kann trotzdem nicht mehr Geld verlangen.«
»Verspüren Sie Druck, die Preise zu senken?«, fragt Don.
Pete mustert ihn. »Aber sicher. Der Preisdruck ist enorm, und ich fürchte, der eine oder andere Konkurrent wird bald nachgeben. Dann müssen wir unsere Preise ebenfalls senken. Im Grunde dreht sich diese Spirale schon. Um den Vertrag für die kleinen Müslipackungen zu bekommen, mussten wir einen dreiprozentigen Preisnachlass gewähren. Ich habe Ihnen dazu ein Memo geschickt.«
»Ja, ich erinnere mich«, bestätige ich. »Wie wird sich das alles auf die diesjährige Prognose auswirken?«
»Es ist bereits eingerechnet«, entgegnet Pete. »Der prognostizierte Preisrückgang hat die Auswirkungen der Umsatzsteigerung fast komplett aufgefressen. Wir werden also dieses Jahr zwar unseren Marktanteil steigern, aber nicht unseren Gewinn.«
»Genau das ist unser Problem«, sage ich zu Pete. »Wie könnten Sie eine drastische Gewinnsteigerung erreichen?«
»So, wie ich das sehe, gibt es da nur eine Möglichkeit. Schauen Sie sich einmal die aufgeschlüsselten Zahlen an. Das Geschäft mit Verpackungsmaterial läuft ausgesprochen gut. Die Süßwarenverpackungen machen dagegen Probleme. Letztes Jahr entfielen zwanzig Millionen von den insgesamt sechzig Millionen Umsatz auf die Abteilung für Süßwarenverpackung. Doch diese zwanzig Millionen brachten unter dem Strich vier Millionen Dollar Verlust. Wir müssen dafür sorgen, dass uns dieser Bereich nicht weiter zur Ader lässt. Der Gesamtertrag sank dadurch auf neunhunderttausend Dollar.«
»Was wollen Sie unternehmen?«, frage ich.
»Wir müssen uns auf großvolumige Aufträge verlegen. Im Bereich Süßwarenverpackung haben wir fast nur Aufträge mit geringen Stückzahlen – für Süßwaren, die in kleinen Mengen verkauft werden. Die Aufträge für den trendigen Süßkram, der in Massen produziert wird, sind uns bisher durch die Lappen gegangen. Aber genau dort steckt das Geld.«
»Was fehlt Ihnen, um an solche Aufträge zu kommen?«
»Ganz einfach«, entgegnet er, »modernere Maschinen.« Er drückt mir einen dicken Bericht in die Hand. »Wir haben die Sache gründlich durchleuchtet. Hier ist unsere einschlägige Empfehlung.«
Ich blättere durch die Seiten bis zur Endzahl. Unter dem Strich stehen 7,4 Millionen Dollar. Er muss verrückt geworden sein. Ich versuche, ein gleichmütiges Gesicht zu machen, und sage: »Pete, bitten Sie mich bloß nicht um Investitionskapital.«
»Aber Alex, mit unseren alten Maschinen sind wir einfach nicht wettbewerbsfähig.«
»Alte Maschinen? Die haben Sie noch nicht einmal fünf Jahre!«
»Die Technik veraltet immer schneller. Vor fünf Jahren waren wir damit auf dem neuesten Stand. Heute stehen wir im Wettstreit mit Firmen, die über die nächste Maschinengeneration verfügen. Sie arbeiten nicht mehr mit Offsetdruck, sondern mit Rotationstiefdruck. Diese Maschinen haben eine bessere Auflösung bei dunklen Farben, sie können silber- und goldfarben drucken – und unsere können das nicht. Die können sogar auf Kunststoff drucken, wir nur auf Papier. Vor allem aber sind sie viel breiter. Allein durch ihre Breite verdreifacht sich der Output pro Stunde. Durch die höhere Produktionsgeschwindigkeit haben sie einen Riesenvorteil, wenn es um große Mengen geht.«
Ich schaue ihn an. Wo er Recht hat, hat er Recht. Aber angesichts der Vorstandsentscheidung spielt das alles keine Rolle. Ich beschließe, ihm reinen Wein einzuschenken. Ich kann es meinen Unternehmensleitern sowieso nicht verschweigen.
»Pete, auf der letzten Vorstandssitzung wurde die Strategie von UniCo um hundertachtzig Grad gedreht.«
»Was soll das heißen?«, fragt er.
»Nun, der Vorstand hat beschlossen«, sage ich langsam, »von der Diversifizierung abzugehen und sich stattdessen aufs Kerngeschäft zu konzentrieren.«
»Ja, und?«
Er kapiert nicht. Ich muss also deutlicher werden. »Das bedeutet, dass der Vorstand keinen einzigen Cent mehr in unseren Unternehmensbereich stecken will. Um ganz genau zu sein, er hat sogar beschlossen, die Gesellschaften dieser Sparte abzustoßen.«
»Und mich auch?«, fragt er.
»Ja, Sie auch.«
Die Farbe weicht aus seinem Gesicht. »Aber, Alex, das ist ja eine Katastrophe.«
»Immer mit der Ruhe. Es ist keine Katastrophe. Sie werden eben für einen anderen Konzern arbeiten. Was soll sich dadurch groß ändern?«
»Alex, was reden Sie da? Wissen Sie denn so wenig über das Druckgeschäft? Glauben Sie ernsthaft, irgendein anderes Unternehmen wird mir gestatten, den Betrieb so zu führen, wie Sie es mir beigebracht haben? Die Maschinen, die Nicht-Engpässe darstellen, einfach von Zeit zu Zeit stillstehen zu lassen? Keine fertigen Erzeugnisse auf Lager zu produzieren? In jedem anderen Druckbetrieb, den ich kenne, herrscht die Kostenmentalität. Wir werden gezwungen sein, alles rückgängig zu machen, was wir aufgebaut haben. Können Sie sich vorstellen, was dabei herauskommen wird?«
Das kann ich wohl. Allzu gut, denn ich habe es bereits in anderen Fällen erlebt. Es ist eine Sache, lediglich siebzig Prozent aller Lieferungen fristgerecht zu erledigen. Die Kunden gewöhnen sich daran und stellen sich darauf ein. Doch wenn man sie quasi hundertprozentig zuverlässig mit pünktlichen Lieferungen verwöhnt hat und die Leistung dann nachlässt, trifft das die Kunden unerwartet, weil sie sich nicht durch großzügige Lagerbestände an Rohmaterial abgesichert haben. Und das verzeihen sie nie. Ein Leistungsabfall geht fast immer unmittelbar einher mit verlorenen Kunden. Dann müssen Mitarbeiter entlassen werden, was die Leistung weiter verschlechtert, und mit dem Betrieb geht es rasend schnell abwärts.
Es geht hier nicht um meinen Job. Es geht um das Überleben meiner Betriebe. Um fast zweitausend Arbeitsplätze.
Wir sitzen eine Weile schweigend da. Dann raffe ich mich auf und sage: »Pete, wie könnten Sie in diesem Jahr eine Gewinnsteigerung erreichen? Eine maßgebliche Gewinnsteigerung?«
Pete antwortet nicht.
»Also?«, dränge ich.
»Ich weiß nicht«, sagt er. »Ich weiß es wirklich nicht.«
»Pete, lassen Sie uns den Tatsachen in die Augen sehen. Unsere Aussichten, die Vorstandsentscheidung zum Kippen zu bringen, ähneln denen einer Schneeflocke in der Hölle.«
»Und Granby?«, meint er.
»Ja, vielleicht wird Granby etwas dagegen unternehmen. Aber darauf können wir uns nicht verlassen, Pete. Die einzige Möglichkeit, die uns bleibt, ist, den Betriebsgewinn so zu erhöhen, dass das Unternehmen eine echte Goldgrube ist, wenn es auf den Markt kommt. Dann wird sich der neue Besitzer nicht in die Unternehmensführung einmischen.«
»Na, toll, wenn’s weiter nichts ist«, murmelt er, doch immerhin kehrt etwas Farbe in sein Gesicht zurück.
»Eins ist klar«, meint Don. »Pete muss die Verluste im Süßwarensegment eindämmen.«
»Ja«, stimmt Pete zu. »Aber wenn Sie mir kein Geld geben wollen, dann bleibt mir nur die Möglichkeit, die ganze Abteilung zu schließen.«
Überall das Gleiche. Nur die Größenordnung ist anders. Auf Konzernebene geht es um die Schließung von Fabriken und auf Betriebsebene um die Schließung von Abteilungen. Es muss doch einen besseren Weg geben.
»Aber das reicht sowieso nicht aus«, meint Pete. »Dadurch würde sich zwar das Ergebnis verbessern, doch das Unternehmen wäre damit noch lange keine Goldmine. Wir verringern so nur unsere Möglichkeiten. Ich sehe einfach keinen Ausweg.«
Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Ich sehe auch keinen Ausweg, sage aber zu Pete: »Wissen Sie noch, was ich Ihnen beigebracht habe? Es gibt stets eine Möglichkeit. Gerade Sie und Ihre Leute haben das im letzten Jahr immer wieder bewiesen.«
»Stimmt schon«, räumt Pete ein. »Aber damals ging es um technische, um logistische Fragen. Nicht um so ein Problem.«
»Pete, denken Sie darüber nach. Setzen Sie Jonahs Methoden ein. Ihnen wird schon etwas einfallen.« Ich wünschte, ich wäre so überzeugt, wie ich mich gebe.
»Bis gerade eben war mir gar nicht klar, wie verheerend sich die Vorstandsentscheidung auswirken wird«, gesteht Don, als wir wieder im Auto sitzen. »Das passiert also, wenn man vernünftig arbeitet, während überall in der Branche der Unverstand regiert. Dann gibt es irgendwo in den höheren Rängen eine Veränderung, und schon wird man zum Rückzug gezwungen.«
Ich antworte nicht. Ich konzentriere mich darauf, auf den Highway zurückzufinden. Als wir die Auffahrt erreicht haben, sage ich: »Don, Ihnen ist ja wohl klar, dass das nicht allein Petes Problem ist. Es ist genauso unser Problem. Wenn Petes Betrieb für Peanuts verkauft wird, haben wir den Schwarzen Peter. Und darum kommt es auf keinen Fall infrage, die Abteilung für Süßwarenverpackung zu schließen.«
Nach einer ganzen Weile meint Don: »Ich erkenne da keinen Zusammenhang.«
»In unseren Büchern werden diese riesigen Druckerpressen über einen Zeitraum von zehn Jahren abgeschrieben. Wenn wir die Abteilung dicht machen, fällt der Wert der Maschinen auf den Verkaufswert, der praktisch bei null liegt. Dadurch wird das Unternehmensvermögen weiter ausgehöhlt. Der zu erzielende Preis wäre womöglich noch geringer. Don, wir befinden uns hier in einem echten Konflikt.«
»Aha, jetzt verstehe ich. Und wie Sie mir beigebracht haben, sollte man nie auf Kompromisslösungen ausweichen, wenn man vor einem Konflikt steht.« Don öffnet seine Aktentasche und zieht eine Mappe heraus. »Der erste Schritt besteht in der präzisen Verbalisierung des Konflikts. Dann erst kann man herausfinden, wie er aus der Welt zu schaffen ist.« Er beginnt, eine Wolke zu schreiben. »Das Ziel lautet: ›Petes Firma soll gut verkauft werden.‹«
Das ist ganz sicher nicht mein Ziel. Ich verzichte jedoch auf einen Kommentar.
»Eine Anforderung ist ›Gewinnsteigerung‹. Das bedeutet die ›Schließung der Abteilung für Süßwarenverpackung‹. Eine weitere Anforderung ist der ›Schutz des Betriebsvermögens‹. Diese wiederum verlangt das ›Bestehenbleiben der Abteilung für Süßwarenverpackung‹. Ein Konflikt, wie er im Buche steht!« Ich überfliege seine Aufzeichnungen:
[Bild vergrößern]
Ein guter Ausgangspunkt. »Okay, Don. Arbeiten Sie die zugrunde liegenden Annahmen heraus, und stellen Sie sie infrage.«
»Um einen guten Preis zu erzielen, müssen wir den Gewinn steigern, weil …?«
»…weil der Gewinn, den ein Unternehmen erzielt, seinen Wert bestimmt«, greife ich die zugrunde liegende Annahme heraus.
»Genau«, bestätigt Don. »Ich weiß aber nicht, wie ich das infrage stellen soll, besonders nicht in Petes Fall. Er verfügt weder über vielversprechende neue Technologie, noch über ein bahnbrechendes Patent, das den aktuellen Gewinn nebensächlich erscheinen lassen würde.«
»Weiter«, sage ich.
»Um einen guten Preis zu erzielen, müssen wir das Betriebsvermögen erhalten, denn … es ist nun einmal der Wert der Vermögensgegenstände eines Unternehmens, der über den Verkaufspreis entscheidet. Ich weiß wirklich nicht, wie uns die linke Seite der Wolke hier weiterhelfen soll.«
Als ich nichts dazu sage, fährt er fort.
»Um den Gewinn zu steigern, müssen wir die Abteilung für Süßwarenverpackung schließen, weil … weil die Abteilung Verluste macht. Ich hab die Idee!«, ruft er da. »Wir müssen dafür sorgen, dass die Abteilung für Süßwarenverpackung zur Goldgrube wird!«
»Ha, ha.« Mir ist nicht nach dummen Witzen.
»Okay«, meint Don. »Um das Betriebsvermögen des Unternehmens zu schützen, müssen wir die Abteilung weiterbetreiben … denn der Buchwert der Maschinen ist größer ist ihr Verkaufswert.« Ich weiß selber nicht, wie man das infrage stellen soll. »Dann ist da noch der letzte Pfeil«, setzt er hinzu. »Die Schließung der Abteilung für Süßwarenverpackung und ihr weiterer Betrieb schließen sich aus, da … da wir diese Abteilung nicht separat verkaufen können. Moment mal, Alex, vielleicht können wir das ja doch?«
»Aber natürlich. Nur, dass Sie in diesem Leben keinen Käufer dafür finden werden.«
»Dann bin ich mit meinem Latein so ziemlich am Ende«, gesteht er.
»Schauen Sie sich die Pfeile noch einmal an. Normalerweise beruht jeder Pfeil auf mehr als einer Grundannahme. Konzentrieren Sie sich dabei auf den Pfeil, der Ihnen die größten Probleme bereitet.«
»Um den Gewinn zu steigern, müssen wir die Abteilung für Süßwarenverpackung schließen. Das ist definitiv die Annahme, die mir die größten Probleme macht. Wieso müssen wir sie schließen? Weil sie Verlust macht. Wieso macht sie Verlust? Weil wir nicht an die ganz großen Aufträge herankommen. Moment mal, Alex. Wenn Pete bei Großaufträgen nicht mit den schnellen Maschinen konkurrieren kann, wie kann er es dann bei kleineren Stückzahlen? Das ist doch unlogisch.«
»Es muss aber logisch sein«, entgegne ich. »Sicher übersehen wir dabei etwas. Rufen Sie Pete doch einfach an, und finden Sie es heraus.«
Don ruft an. Nach einigen »Mhms« und »Ahas« beendet er das Gespräch. »Das Rätsel ist gelöst«, meint er. »Petes Offset-Druckmaschinen haben einen großen Vorteil: Sie benötigen deutlich weniger Rüstzeit. Aus diesem Grund ist er bei kleineren Mengen wettbewerbsfähig, doch bei größeren Aufträgen verliert sich dieser Vorsprung durch die Schnelligkeit der Konkurrenz.«
Den Rest der Strecke legen wir schweigend zurück. Ich sehe keine Möglichkeit, Petes Wolke zu knacken. Stimmt nicht, ich sehe doch eine. Es gibt noch einen anderen Weg, den Gewinn von Petes Firma hochzutreiben. Wir könnten die Prognosen nach oben korrigieren, indem wir die Sorge vor sinkenden Preisen einfach unberücksichtigt lassen. Dadurch würde sich der Gewinn vermutlich auf einen Schlag verdoppeln. Aber nicht mit mir! Auf keinen Fall werde ich auf solche schmutzigen Tricks zurückgreifen.
Ich weiß also doch nicht, wie Petes Wolke aufzulösen ist. Ich weiß auch nicht, wie ich meine eigene Wolke auflösen soll. Nur eins, das weiß ich sicher: Aufgelöst müssen sie werden. Unbedingt. Aber wie?
Kapitel 4
»Könnten Sie bitte kurz heraufkommen?«, fragt Granby durchs Telefon.
»Aber natürlich«, entgegne ich und eile in sein Büro hinauf. Endlich werde ich erfahren, was er im Hinblick auf den Vorstandsbeschluss zu unternehmen gedenkt. Ich habe ja gleich gesagt, dass hier das letzte Wort noch nicht gesprochen ist. Ich habe gewusst, dass er nicht einfach klein beigeben und seine Wunden lecken würde.
»Hallo, Alex.« Er steht vom Schreibtisch auf und winkt mich ans andere Ende des Raumes. Das wird ja immer besser, denke ich. Es wird also kein förmliches Gespräch. Ich lasse mich in eines der weichen Sofas sinken.
»Kaffee, Tee?«, fragt er.
»Einen Kaffee nehme ich gern«, erwidere ich. Dann muss er sich wenigstens fünf Minuten Zeit nehmen.
»Nun, Alex, zunächst möchte ich Ihnen gratulieren zu dem, was Sie in Ihrer Sparte erreicht haben. Ich hätte nie für möglich gehalten, dass man Verluste dieser Größenordnung in nur einem Jahr in den Griff kriegen könnte. Wobei – an sich sollte mich das nicht überraschen. Sie haben ja schon als Werksleiter wahre Wunder vollbracht und noch mehr als Bereichsleiter.«
Ja, denke ich bei mir. Ich habe Wunder vollbracht. Doch Hilton Smyth, der keine Wunder vollbracht, sondern nur ein paar Fäden gezogen hat, ist zwei Jahre vor mir zum geschäftsführenden Vize befördert worden.
Zu Granby sage ich: »Nun, dafür sind wir ja da.«
»Sagen Sie mir, Alex, was haben Sie dieses Jahr für uns auf Lager? Mit welchen märchenhaften Verbesserungen werden Sie uns diesmal beglücken?«
»Ich habe da ein paar Pläne«, sage ich. »Bob arbeitet an einem äußerst interessanten Auslieferungssystem, das im Erfolgsfall drastische Veränderungen mit sich bringen dürfte.«
»Schön, schön«, sagt er. »Wie sehen Ihre konkreten Prognosen aus? Sagen Sie mir, womit rechnen Sie unter dem Strich?«
»Nun, da muss ich Sie enttäuschen. Tatsächlich bezweifle ich, ob wir in diesem Jahr überhaupt eine Prognose stellen werden.«
»Wie bitte?«, fragt er, wirkt aber nicht ernsthaft überrascht.
»Vom Markt geht ein immenser Preissenkungsdruck aus. So etwas habe ich noch nie erlebt. Natürlich haben wir das in unseren Prognosen berücksichtigt, doch sie werden der Realität offensichtlich nicht gerecht. Der Konkurrenzkampf tobt so heftig, dass wir auf Hochtouren arbeiten müssen, nur um unsere Position zu halten.«
Hätte Granbys Sekretärin nicht gerade den Kaffee gebracht, wäre das Gespräch an dieser Stelle zu Ende gewesen, da bin ich mir sicher. Ich warte, bis sie wieder weg ist, und sage dann: »Darf ich fragen, wie Ihre Pläne in Bezug auf den Vorstandsbeschluss aussehen?«
»Was meinen Sie?«
»Ja, wollen Sie denn tatenlos zusehen, wie die Unternehmen verkauft werden, deren Übernahme Sie selbst veranlasst haben?«
»Alex«, sagt er da, »ich habe noch ein Jahr bis zum Ruhestand. Wenn Sie mir heute die nötige Munition geliefert hätten, dann hätte ich vielleicht etwas unternehmen können. Doch wie die Dinge liegen, muss ich mich wohl oder übel damit abfinden.«
Obwohl ich diesen Gesprächsverlauf im Geist mehrfach durchgespielt habe, bin ich doch ehrlich überrascht. Das einzige Ass in Granbys Ärmel bin ich gewesen! Es soll nichts geben, was man gegen diese verheerende Entscheidung unternehmen kann?
Wie durch dichten Nebel höre ich Granby sagen: »Trumann und Doughty wollen sich persönlich um den Verkauf der Unternehmen kümmern.« Als er meinen Gesichtsausdruck wahrnimmt, fügt er hinzu: »Doch, Alex, ich habe noch immer genug Einfluss, um mich dagegen zu sperren. Ich könnte die Sache zumindest ein Jahr lang hinauszögern. Aber was bringt das? Dann tun sie es eben nächstes Jahr, und ich wäre als ausgeschiedener CEO die Zielscheibe für eine Schlammschlacht. Da schlucke ich die Kröte lieber jetzt. Und was für eine Kröte! Ich hoffe, ich ersticke nicht daran.«
»Was soll ich also tun?«, frage ich. »Zur Tagesordnung übergehen?«
»Das gilt zumindest für Ihre Firmen. Sie werden alle Hände voll zu tun haben. Trumann und Doughty haben für Ende dieses Monats bereits eine ganze Reihe von Terminen in Europa vereinbart. Sie werden die beiden begleiten.«
»Wieso in Europa?«
»Nun, die Hälfte des investierten Kapitals stammt von dort, und außerdem kann es nicht schaden, zu sehen, was der internationale Markt zu bieten hat, bevor man mit einheimischen Interessenten verhandelt.« Er erhebt sich. »Es ist wirklich schade, dass Sie diesmal kein Kunststück auf Lager haben. Aber ich verstehe das. Der Markt wird immer chaotischer. Ich bin froh, dass ich mich bald zur Ruhe setzen kann. Ich glaube nicht, dass ich noch genügend Energie habe, um mit einem solchen Umfeld zurechtzukommen.«
Während er mich zur Tür begleitet, sagt er noch: »Es gefällt mir ebenso wenig wie Ihnen, dass wir die diversifizierte Konzernsparte abstoßen müssen. Das ist ein gefundenes Fressen für alle, die mir in den Rücken fallen wollen. Ich hoffe, mein guter Ruf wird nicht komplett dahin sein, wenn der Verkauf unter Dach und Fach ist.«
Ich lasse ihn allein und steuere direkt Bill Peachs Büro an. Ich will wissen, was dahinter steckt. Die ganze Geschichte.
Bill lächelt mir entgegen. »Haben Sie gemerkt, was unser Freund Hilton im Schilde geführt hat, der falsche Hund? Aber diesmal ging der Schuss nach hinten los.«
Bill hat persönliche Gründe für seine Abneigung gegen Hilton Smyth. Bis vor kurzem war er Hiltons Vorgesetzter, jetzt befinden sie sich auf gleicher Höhe. Hilton ist geschäftsführender Vizepräsident eines Bereichs, der mindestens so groß ist wie der von Bill.
»Ja, das ist mir auch aufgefallen«, sage ich, »aber hatten Sie etwas anderes erwartet?«
»Er ist clever, verdammt clever. Granbys Tage sind gezählt. Also hat er flugs seine Taktik geändert und begehrlich die Finger nach dem Chefsessel ausgestreckt. Ein solches Manöver hätte ich eigentlich erwarten müssen«, meint er nicht ohne Bewunderung.
»Nun, diesmal hat er die Blutsauger von der Wall Street gegen sich«, füge ich hinzu. »Und die spielen in einer ganz anderen Liga.«
»Eine ganz andere Liga, wirklich«, lacht Bill. »Die haben ihn als Marionette benutzt, bis der Vorstand in ihrem Sinne entschieden hat. Dann haben sie eine Kehrtwendung vollzogen und ihm seine schönen Investitionspläne um die Ohren gehauen. Geschieht ihm ganz recht. Menschenskind, wie ich das genossen habe.«
»Mir war gar nicht klar gewesen, dass Hilton tatsächlich ein ernst zu nehmender Kandidat für den CEO-Posten war«, sage ich. »Sie sind doch schon länger dabei und können auch mehr Erfolge vorweisen.«
Er klopft mir auf die Schulter. »Erfolge, die ich zu einem nicht ganz unwesentlichen Teil Ihnen verdanke, Alex. Aber ich mache mir da keine Illusionen. Ich bin nicht der Typ für einen CEO. Und nach dieser Vorstandssitzung habe ich sowieso keine Chance mehr.«
»Wieso das denn?«, frage ich verständnislos.
»Na, ist doch klar: wegen des Beschlusses, Ihre Firmen abzustoßen. Ich war maßgeblich an ihrem Kauf beteiligt. Also wird man mir auch einen beträchtlichen Teil der Verantwortung dafür zuweisen. Das reicht auf jeden Fall, um mich von einer Nominierung auszuschließen.«
Jetzt bin ich von den Socken. »Wieso sind meine Firmen ein so brisanter unternehmenspolitischer Zündstoff? Sie sind doch längst keine Fässer ohne Boden mehr. Im letzten Jahr haben wir sogar Gewinn gemacht.«
»Alex«, lächelt Bill, »haben Sie mal nachgesehen, wie viel wir dafür bezahlt haben?«
»Nein«, räume ich ein. »Wie viel mag das gewesen sein?«
»Verdammt viel. Granby wollte auf Biegen und Brechen diversifizieren. Das war 1989, als alle mit einem Aufschwung rechneten. Aber Sie wissen ja, was dann passierte. Statt abzuheben, setzte der Markt zum Sturzflug an. Nach meiner Schätzung haben wir zumindest doppelt so viel für die Unternehmen hingeblättert, wie wir jetzt dafür bekommen – wenn alles gut geht. Alex, jeder, der beim Kauf die Finger im Spiel hatte, muss sich warm anziehen.«
»Moment mal, Bill«, sage ich. »Solange wir die Firmen nicht verkaufen, stehen sie doch zum Anschaffungspreis in unseren Büchern? Sobald wir sie aber verkaufen, müssen wir den Differenzbetrag komplett abschreiben. Vielleicht ist das Trumann und Doughty nicht klar?«
»Machen Sie sich doch nichts vor«, grinst er mich an. »Die kennen jede Zahl mit einem Dollarzeichen davor. Die wissen genau, was sie tun. Sie werden dieses Jahr die Prügel einstecken, unsere Liquiditätslage verbessern, und im nächsten Jahr schleppen sie dann irgendeine Koryphäe als CEO an, und der Aktienkurs springt in die Höhe.«
Das muss ich mir erstmal durch den Kopf gehen lassen. »Wieso in aller Welt freuen Sie sich so darüber?«, frage ich.
»Weil ich mich jetzt entspannt zurücklehnen kann.« Als er meinen erstaunten Blick bemerkt, setzt er hinzu: »Alex, mir war von Anfang an klar, dass ich nicht der nächste CEO werden würde. Meine Befürchtung war nur, dass es Hilton werden könnte. Wenn es jemanden gibt, für den ich nicht arbeiten möchte, dann ist es Hilton. Jeder andere ist mir lieber, auch wenn er nicht aus unserem Unternehmen stammt. Nun hat Hilton mit seinem letzten Manöver Granbys Unterstützung verspielt, und Trumann und Doughty hat er auch nicht auf seine Seite bringen können. Das kostet ihn Kopf und Kragen.«
Sobald ich wieder in meinem Büro bin, bitte ich Don, mir Informationen über die Übernahmen unserer Gesellschaften zu beschaffen. Wir analysieren sie gemeinsam. Das Ergebnis ist schlimmer, als Bill angedeutet hatte.
Unseren Schätzungen nach bringt Petes Firma maximal zwanzig Millionen Dollar. Gekauft haben wir sie für 51,4 Millionen. Stacey Kaufmanns Firma PressureSteam hat einen Marktwert von allerhöchstens dreißig Millionen Dollar. Gezahlt haben wir sage und schreibe einhundertvierundzwanzig Millionen.
Jetzt ist mir klar, wieso Granby möchte, dass der Verkauf über die Bühne geht, solange er noch am Ruder ist. Immerhin hatte er die Übernahmen persönlich veranlasst und autorisiert. Für knapp zweihundertfünfundfünfzig Millionen Dollar. Von den rund zwanzig Millionen Dollar, die zwischenzeitlich hineingepumpt wurden, ganz zu schweigen. Seit dem Kauf haben diese Investitionen außerdem insgesamt sechsundachtzig Millionen Dollar Verlust gebracht. Nun soll uns dieser ganze Aufwand lediglich rund achtzig Millionen einbringen. Wenn das keine Fehlentscheidung war!
»Sehen Sie, Don«, sage ich zu ihm, »das passiert, wenn man den Markttrend falsch deutet. Jetzt verstehe ich allmählich, wieso alle – J. Bartholomew Granby III eingeschlossen – so verzweifelt versuchen, ihre Finger da herauszuziehen. Der Karren steckt rettungslos im Dreck.«
»Aber was wird nun aus uns?«
»Da machen Sie sich mal keine Sorgen, Don. Wenn’s hart auf hart kommt, bringe ich Sie bestimmt gut unter. Da sehe ich überhaupt kein Problem. Aber schieben wir solche Gedanken erst mal beiseite. Im Moment haben wir Wichtigeres zu tun.«
»Und ich dachte, mit ganz großen Einsätzen würde nur in Las Vegas oder an der Wall Street gespielt«, sagt er mit großen Augen.
»Mag sein. Aber lassen Sie uns jetzt mal an andere Dinge denken.« Ich erzähle ihm von meiner bevorstehenden Europareise.
»Soll ich für Sie Info-Termine mit den Präsidenten aller Gesellschaften vereinbaren?«, fragt er.