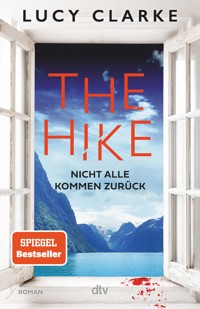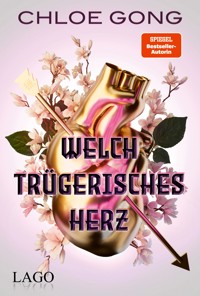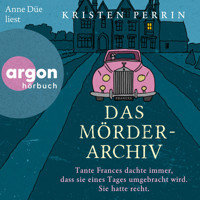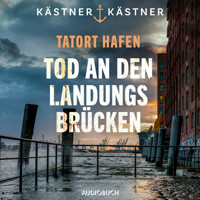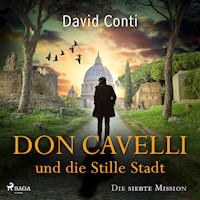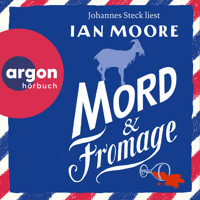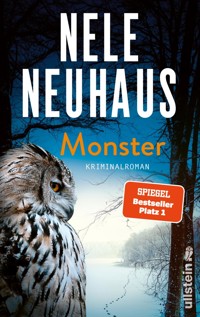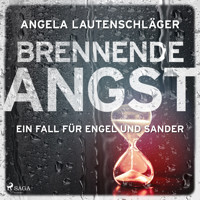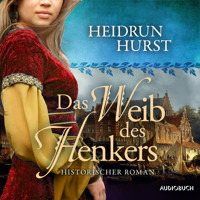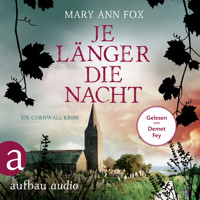Vorwort – Hotzel-Carl
Es gibt einige, äußerst seltene Momente der Selbsterkenntnis im Verlaufe eines Lebens, die einen Menschen entweder in tiefe Verzweiflung stürzen oder der Zukunft eine Vision, ein zu erstrebendes Ziel und neue Zuversicht geben können.
Ausgerechnet bei einem feierlichen Requiem für eine hochehrwürdige Adelswitwe anno 1678 wurde ihm bewusst, sein Leben werde einst so enden, wie es begonnen hatte: als ehrloser, krüppeliger Bastard, geächtet von Kirche und Gemeinde, vielleicht sogar auf dem Acker der Verstoßenen verscharrt, ohne christlichen Segen. Mit der unehelichen Geburt war sein Leben vorbestimmt. Knecht blieb Knecht, Adel und Klerus standen jedoch die Welt offen dank der ihnen – und nur ihnen – verliehenen Macht, sei es weltliche oder geistliche oder weltliche und zugleich geistliche. Verliehen von wem? Von Gottes Gnaden? Wen Gott liebt, so sagte man, dem schenkt er adliges Geblüt, Macht, Ehre, Weisheit und Wohlstand. Die weltlichen und kirchlichen Würdenträger schwelgten im Pomp und Überfluss, davon konnte er nur träumen. Der brave, gemeine Bürger hatte den Mächtigen zu dienen, vor ihnen untertänigst im Staub zu kriechen.
Der vierzehnjährige Carl war zu dieser Trauerfeier eigentlich nicht zugelassen, das Volk war ausgesperrt, hatte vor der Klosterkirche zu warten. Sein Ziehvater, Ratsherr der Stadt, hatte ihn eingeschleust: Carl müsse dieser für Lympurg einmaligen Ansammlung von höchsten Würdenträgern beiwohnen, dieses Ereignis dürfe er nicht versäumen. Seine rastlosen, aufgerissenen Augen schweiften immer wieder über die Hochwürden und Hochwohlgeborenen, als sie den breiten Gang zum Traueraltar hinunterschritten. Es schien, als blicke er durch eine unsichtbare Mauer auf Menschen, die der Schöpfer mit besonderen Privilegien ausgestattet hatte, die wahrlich Gottes Lieblinge sein mussten.
Immer wieder schaute er zum Gekreuzigten in der Klosterkirche Sankt Sebastian auf. Zunächst noch zögerlich fragend, dann mit einem deutlichen Ausdruck des Unmutes. Warum? Warum hatte der Allmächtige ihn nicht als Adligen in die Welt gesetzt? Warum hat er ihn mit körperlichem Makel gestraft? Warum musste sein Leben mit dem Tod seiner Mutter beginnen?
Seine Mutter Anna hatte sich einst als Küchenmagd beim Freiherrn von Walderdorff bedingt. Zwei Jahre bevor die Arbeiten für den Um- und Neubau des kompakten, feudalen Gebäudekomplexes mitten in der Stadt, hinter den Brotschirnen, begannen. Sie musste vor allem die Handwerker – vorwiegend italienische – bekochen. Anna war die jüngste von drei Schwestern, von denen zwei bereits unter der Haube waren. Ihre Eltern hatten sie bereits lange verloren. Die Töchter mussten zusehen, wo sie blieben. Lisbeth war mit dem Hofbeständer Johann Pauli von Blumroth verheiratet. Keine besonders erstrebenswerte Partie, aber sie war versorgt. Die andere, hübschere Schwester Maria hatte sich den reichen Lympurger Ratsherrn und Tuchhändler Hans Birkenbühl geangelt, sie wollte nicht wie ihre anderen Schwestern als Magd enden. Anna dagegen war stolz, am neuen, herrschaftlichen Hof der Freiherrn arbeiten zu dürfen, war es doch neben der Residenz des Churfürstlichen Oberamtmanns oben auf dem Felsen das zweitgrößte und bedeutendste profane Bauwerk der Stadt, das die Lympurger auch als „Stadtschloss“ bezeichneten. Zu ihrer größten Freude hatte sie eine eigene kleine Kammer am Hof beziehen dürfen. Die Küchenmägde hatten Anna ob ihrer freundlichen, lebensfrohen Art ins Herz geschlossen. Aber das Schicksal war ihr nicht hold. Nach einer kurzen, ungestümen Liebesaffäre wurde sie schwanger. Bald strengte sie die Küchenarbeit zu sehr an, und als sie zudem großes Unwohlsein plagte, bat sie ihre Schwester Lisbeth, auf dem abgelegenen Hof Blumroth niederzukommen. Sie verließ den Walderdorffer Hof nicht unbedingt freiwillig, denn der rigorose Küchenmeister drängte sie mit Nachdruck, in ihrem Zustand vom herrschaftlichen Anwesen zu verschwinden. Der gestrenge Baron dulde keine unverheiratete Magd in guter Hoffnung an seinem ehrwürdigen, honorigen Domizil. Sie sei ein gefallenes Mädchen, das nur noch im Freudenhaus oder bei den Nonnen Unterschlupf finden werde. Er vertrieb sie mit Schimpf und Schande von der herrschaftlichen Baustelle. Mit ihr verschwand auch ihr Liebhaber auf Nimmerwiedersehen.
Von heftigen Schmerzen gepeinigt, setzten die Wehen unverhofft und zu früh ein. Eine eilig aus der Nachbarschaft herbeigerufene Wehmutter sorgte sich bei der schwierigen Geburt um das Wohl der Mutter, aber auch des neugeborenen Knaben. Sie schwitzte Blut und Wasser, hatte sie doch nie an einer Ausbildung zur Hebamme teilgenommen, nie den Ammeneid abgelegt. Ihre Kenntnisse stammten allein von ihrer Mutter, die von den Bäuerinnen gerufen wurde, wenn eine Niederkunft bevorstand. Geburtshilfe war zwar per Gesetz nur den examinierten Ammen vorbehalten, doch die konnte sich auf dem Land niemand leisten, die gab es nur in der Stadt.
Die Geburt war schmerzvoll und langwierig, man musste um das Leben der Mutter fürchten. Zudem zeigte das Neugeborene deutliche Anzeichen einer körperlichen Missbildung. Wie sollte die Wehmutter damit umgehen? Bei derartigen Komplikationen könnte sie sehr schnell in den Verdacht einer ‚weisen Frau’ geraten, als Hexe denunziert werden und auf dem Scheiterhaufen landen. Tief besorgt wandte sie sich an die Bauersfrau, die ihr bei der Niederkunft helfend zur Hand ging.
„Die schwere Geburt hat Eure Schwester zu sehr geschwächt. Ich rate Euch dringend, einen studierten Arzt hinzuzuziehen. Der Junge ist aber wohlauf, obschon ich zu bedenken gebe …“
„Was ist mit dem Balg?“, mischte sich Bauer Johann ein, angelockt vom lauten Geschrei des Neugeborenen. Ungewöhnlich für den schweigsamen Mann. Beunruhigt sah er auf den kleinen Körper, den großen Kopf, die kurzen Beinchen. Der Volksmund beteuerte mit ernsthafter Miene, in einem verkrüppelten Körper wohne nicht nur der Teufel, sondern auch ein wirrer Geist. Besser sei es, den Teufelsbraten ohne Zaudern unter Anrufung aller Heiligen im Namen des Herrn sofort bei der Geburt zu töten. Doch Johann scherte sich nicht um solche, in seinen Augen unsinnige Hexensprüche.
„Was wollt ihr? Ist doch alles dran, alle Finger und Zehen und das Zippelche, was einen Jungen ausmacht. Wäre das Neugeborene ein Mädchen, dann hätten wir sicher ein Problem. Rettet seine Seele und tauft ihn auf der Stelle auf den Namen Carl, damit ich ihn im Kirchenbuch von Sankt Peter in Dietz eintragen lassen kann. Ich hole derweil einen Medicus vom Lympurger Hospital.“
Anna verstarb im Wochenbett. Der herbeigerufene Arzt fragte Johann ungehalten, welche Hebamme denn bei der Geburt behilflich war. Johann wies auf die Eilbedürftigkeit hin, er habe keine andere Wahl gehabt, als eine Wehmutter aus der Nachbarschaft zu rufen. Achselzuckend bohrte der Medicus nicht weiter nach und beruhigte die Schwester der Verstorbenen, als sie die Hände bestürzt vors Gesicht schlug. Nein, die Amme trage keine Schuld am Tod der Mutter. Wer denn der Vater des Kindes sei, fragte der Arzt, er bräuchte den Namen für den Geburtsschein, darauf bestünden Klerus und Stadtrat. Doch sowohl Lisbeth als auch Johann waren überfragt. Anna hatte das Geheimnis, wer sie geschwängert hatte, mit ins Grab genommen. Sie wurde ohne Aufsehen auf dem Armenteil des Friedhofs von Sankt Peter in Dietz verscharrt. Für einen Sarg hatte es nicht gereicht.
Als Kind war Carl eine armselige Kreatur. Der zu große Kopf saß auf einem zu schmächtigen Körper und dieser auf zu kurzen Beinen. Er hatte sich die pechschwarzen Haare vor die dunklen Augen gestriegelt, als wolle er die Welt nur durch ein dichtes Netz sehen oder sich verstecken oder vor dem Spott über seine Figur und die Hasenscharte schützen.
Seine ersten Lebensjahre hatte Carl in der einsamen Hofreite ‚Blumroth’ seines Oheims Johann Pauli verbracht, fern der Stadt, draußen vor der Stadtmauer Lympurgs, jenseits des Wehrgrabens Schiede. Der Hof hatte im Dreißigjährigen Krieg stark gelitten und bestand nur noch aus einem heruntergekommenen Gehöft samt Viehstall und einer kleinen, einsturzgefährdeten Kapelle. Aber immerhin verfügte er über ein eigenes Gotteshaus. Pauli hatte die Hofstatt vom edelmütigen Freiherrn von Hohenfeld gegen einen niedrigen Zins gepachtet mit der Auflage, sie soweit herzurichten, dass sie wieder ertragreich bewirtschaftet werden konnte. Ein Gewinn für beide, den Freiherrn ebenso wie den Hofbeständer.
Johann war ein schweigsamer, in sich gekehrter Mensch. Das hatte seine Gründe. Seine Kindheit verlebte er auf einem bescheidenen, aber durchaus einträglichen Bauernhof in Mühlen an der Lahn unweit von Lympurg. Die beschauliche Lage in Sichtweite zur Dietkirchener Sankt Lubentiuskirche tröstete nicht über die schweren Zeiten hinweg, die der große Krieg mit sich brachte. Ständig waren durchziehende, halb verhungerte und verlotterte Söldner mit ihrem Tross vor allem bei den Bauern nach ess- oder versilberbarer Beute aus, so auch in Mühlen. Sie nahmen sich mit unvorstellbar roher Gewalt Früchte, Vieh, Geschirr und selbst die Möbel zum Verfeuern – ohne Rücksicht auf die fünfköpfige Familie Pauli. Schließlich war nichts Essbares mehr am Hof zu holen, das Vieh war längst geraubt, die Ernte so mager, dass es selbst für die Bauernleute zum Leben nicht reichte. Dennoch forderten eines Tages schwedische, sturztrunkene Soldaten die Herausgabe von Früchten und Branntwein, die sie noch auf dem Hof wähnten. Brutal, gewaltsam, entmenscht. In ihrer furiosen Wut folterten sie erst den Vater mit dem barbarischen Schwedentrunk, dann schlugen sie auf die Mutter ein, ins Gesicht, in den Bauch. Aus Zorn, ohne Beute abziehen zu müssen, hängten sie den nur noch röchelnden Bauern im Türrahmen auf. Die verzweifelte Mutter winselte um Gnade. Doch Gnade war ein Fremdwort für die verrohten Schweden. Erbarmungslos zerrten sie die Frau in die Kate, vergewaltigten sie und schnitten ihr kurzerhand die Kehle durch. Das waren keine Menschen, das waren Bestien. Als sich ihnen anschließend zwei der laut um Hilfe schreienden Kinder in ihrer Verzweiflung in den Weg stellten, warfen sie die Gören kurzerhand in die Puddelgrube, wo sie erbärmlich ertranken.
Entsetzlich, sie hatten in ihrer teuflischen Raserei eine Familie ausgelöscht, einfach so, ohne Beute und Nutzen für sich. Nur der kleine Johann konnte sich in Sicherheit bringen. Er hatte sich gottlob in der Schweinesuhle hinter dem Trog eingegraben, aber das fürchterliche Gemetzel mit ansehen müssen. Es war die reinste Hölle. Johann überlebte. Angst, Schrecken und wütende Ohnmacht hatten ihn verstummen lassen. Nach zwei Tagen und Nächten – die Schweden waren weitergezogen – erschien der Verpächter, um nach seinem Hof zu sehen. Erst jetzt traute sich der vom Hunger geplagte, vor Angst zitternde Johann aus seinem Versteck. Freiherr von Hohenfeld war entsetzt ob dieser brutalen Bluttat. Er ließ die Leichen begraben und nahm den verwirrten Knaben mit auf seinen herrschaftlichen Hof. Dort arbeitete Johann als Knecht und lernte die Magd Lisbeth kennen. Später sollte der Freiherr die Hochzeit der beiden genehmigen – ohne auf sein Recht der ersten Nacht zu bestehen – und übergab ihnen die vom Krieg stark in Mitleidenschaft gezogene Domäne Blumroth.
So fühlte sich Pauli wie der eigene Herr am Hof und stürzte sich mit Fleiß in die Arbeit. Sechs eigene Kinder tobten inzwischen auf der einsamen Hofreite herum, nun kam noch Carl hinzu. Ein schweres Los für den Bauern, denn so viel warf der Hof noch nicht ab, was mit einem zusätzlichen Mitesser geteilt werden konnte. Kein Wunder, dass die kurz gehaltenen, oft hungernden Kinder den Carl nicht als Bruder angenommen hatten. Die Mutter hatte nie davon gesprochen, dass ein Geschwisterchen unterwegs sei, wie sie es sonst tat. Sie vermuteten mit voller Überzeugung, der Storch habe den Carl eigentlich nach Lympurg bringen sollen, aber zu früh im Fluge auf den Hof fallen gelassen. Wahrscheinlich hatte sich der Vogel erschrocken oder ein Blitz war in ihn hineingefahren. Vielleicht hatte Carl sogar etwas von dem Blitz abbekommen. Mitten im Gesicht. Die Wunde an seiner Oberlippe war noch deutlich zu erkennen. Gehässig nannten sie den unverhofft hereingeschneiten Mitbewohner „Hotzel-Carl“, um ihn von einem anderen Carl zu unterscheiden. Den Schmähnamen verdankte er seiner hutzeligen Statur, die an einen geschrumpften, alten Mann erinnerte. Kindermund konnte so gemein sein.
Carl hatte es wahrlich nicht leicht. Die größeren Jungen machten sich einen Spaß daraus, ihn zu verhöhnen, zu demütigen und gaben ihm auf grausame Art zu verstehen, dass er keiner von ihnen und zudem unerwünscht war. In solchen Momenten kam sein feuriges Temperament zum Durchbruch, kochte in Carl eine unbändige Wut hoch. Dann wehrte er sich kurz und heftig, auch wenn er nicht über ausreichende Körperkraft verfügte. Aber er war flinker als alle anderen. Überfallartig wusste er sich mit einem gezielten Faustschlag in die Magengrube oder ins Gesicht zu verteidigen. So verschaffte er sich Respekt bei seinen gehässigen ‚Geschwistern’. Echte Freunde konnte Carl in Blumroth nicht finden. Kein Wunder, dass er sich verschloss, die Einsamkeit suchte und mit sich und der Welt haderte. So verbrachte er sehr viel Zeit in der kleinen, recht baufälligen Kapelle, obwohl es ihm verboten war, auch nur einen Schritt hineinzugehen. Dennoch fühlte sich Carl dort geborgen. An der Wand hing ein vergilbtes Bild der Muttergottes, die er immer wieder ansah, in der er seine Mutter zu erkennen glaubte, mit der er sprach, von ihr Rat und Trost erbat, wenn er eine diffuse Wehmut verspürte, die er nicht deuten konnte und die ihn zu einem stillen Außenseiter machte. Doch selbst diese stille Einsamkeit gönnten ihm seine Neffen nicht. Eines Tages verkeilten sie die Tür zur Kapelle, Carl musste bis zum Abend ausharren, bis ihn sein Oheim befreite. Des Nachts verdrückte er nicht selten eine Träne auf dem Strohlager, sandte ein kurzes Stoßgebet gen Himmel und sehnte sich nach seiner Mama, an die er keine Erinnerung hatte, die er nur vom Hörensagen kannte, deren Grab er nicht ein einziges Mal besucht hatte. Ein heimliches Schluchzen, das niemand sehen oder hören sollte. Als memmenhafter Jammersack zu gelten, kam für ihn nicht infrage. Der einzige Mensch, dem er eine gewisse Zuneigung entgegenbrachte, war sein schweigsamer Oheim, wohl auch, weil ihn Johann akzeptierte und ihm wenigstens das Gefühl gab, ein vollwertiger Mensch zu sein, auch wenn sie nicht viel miteinander sprachen. An den Markttagen zog er nur ungern und allein aus Gehorsam mit seiner Muhme Lisbeth zum Lympurger Kornmarkt. Menschenmassen ängstigten ihn. Viel lieber ging er mit großem Eifer seinem Oheim bei der anstrengenden Feldarbeit zur Hand, hütete die wenigen Schafe und versorgte das Vieh im Stall, als wollte er sich für die Aufnahme am Hof bedanken, schließlich war er ein Waisenknabe.
Carl schreckte auf. Ein schwermütiger Chorgesang riss ihn aus seinen Gedanken. Mit einem Seufzer lauschte er andächtig dem düsteren Choral und starrte noch einmal auf die illustre Trauergemeinde. Wieder schaute er ehrfürchtig auf das Kreuz und schickte ein inbrünstiges Stoßgebet zum Allmächtigen: „Jesus Christus, du allein vermagst es, dass ich eines Tages dieser ehrwürdigen Gesellschaft angehöre! Erlöse mich von meinem Standesmakel und führe mich in die Welt der Hochwohlgeborenen, der Hochwürden, der Mächtigen, der Reichen, der Achtbaren. Ich bitte dich, erhöre mich! Amen.“
Erste Liebe – Lympurg
1
Kurz nach dem Dreißigjährigen Krieg war das Haus ‚Zum Stern’ in der Lympurger Salzgasse – wie viele andere Häuser in jener Zeit auch – aufgrund von Erbstreitigkeiten geteilt worden. Als später die kleinere, linke Hälfte zum Verkauf anstand, sicherte sich diese sofort der Ratsverwandte Hans Birkenbühl, natürlich dank seiner exzellenten Beziehungen und seines Geldes. Die Anwesen der Salzgasse und der Barfüßerstraße waren heiß begehrt. Die Lympurger meinten, Gott selbst habe die Prachtstraße nicht ohne Grund in Ost-West-Richtung ausgerichtet, denn wenn die Morgensonne über der Sankt Sebastian-Kirche aufging, leuchteten ihre hellen Strahlen die anliegenden Häuser vollständig aus, als sollten die Anwohner eine große Portion vom Licht des Himmels abbekommen. Am Abend tauchte dann die Abendsonne noch einmal die beiden Gassen in ein warmes Licht; die langen Schatten der ersten Gasthausbesucher zeigten den Weg zu den Tränken. Kein Wunder, dass hier die prunkvollsten Fachwerkhäuser standen, die besten Gasthäuser lagen, die reichen Patrizier wohnten, die angesehensten Kaufleute und die ehrenwerten Würdenträger.
Birkenbühl verdiente als Tuchhändler recht ordentlich, war im Rat der Stadt geachtet und wurde sogar zweimal zur Bürgermeisterwahl vorgeschlagen. Das schmeichelte ihm, obwohl er ein solches Amt nicht anstrebte, sondern sich vielmehr um sein einträgliches Geschäft kümmerte. Der Erfolg machte den jungen Mann begehrenswert für die Jungfern, auch für die bildhübsche Maria. Die ehrgeizige und ziemlich gerissene Schwester der Küchenmagd Anna hatte den reichsten Tuchhändler der Stadt unverhohlen betört, mit List und Tücke umworben und ihn sogar nach der Kirmes in Dietkirchen dazu gebracht, mit ihr eine Nacht im Heu zu verbringen. Der lebenslustige Birkenbühl nahm es als eines von zahlreichen amourösen Abenteuern hin, war jedoch nicht bereit, ihr ein Eheversprechen zu geben. Nun zog Maria ein fieses Register: Sie erklärte ihrem Auserwählten, sie glaube, in Umständen zu sein. Der gottesfürchtige Mann vereinbarte daraufhin gleich nach der Beichte bei einem Franziskanerpater einen eiligen Hochzeitstermin, bevor sich ein schwangerer Bauch abzeichnete. Eine gesellschaftliche Schmach konnte er sich nicht leisten. Zu spät zeigte sich, dass ihn Maria niederträchtig belogen hatte. Birkenbühl überlegte einen Moment, den Ehebund ob der perfiden List rückgängig zu machen, doch er wollte seinen guten Ruf nicht aufs Spiel setzen. Zudem war Maria von ansehnlicher Statur, mit ihr konnte er sich in der Gesellschaft sehen lassen. Dennoch, kein guter Start für die Ehe. Die Liebe erkaltete, Maria aber war am Ziel ihrer Wünsche. Von diesem Makel abgesehen, war Birkenbühl rundum zufrieden. Trotzdem fehlte etwas zu seinem vollständigen Glück. Bisher war ihm ein Kind versagt. Schon kursierten gemeine Gerüchte, er sei impotent, von Gott mit Kinderlosigkeit gestraft. Das zehrte an seinen Nerven.
Eines Nachmittags – das Marktfähnlein am Kornmarkt war bereits eingeholt – tauchte überraschend Lisbeth bei ihrer ungeliebten Schwester Maria auf. Sie hatte den inzwischen sechsjährigen Carl an der Hand. Beide trugen Kiepen auf dem Rücken, mit denen sie am frühen Morgen Mohrrüben zum Markt geschleppt hatten. Carl mochte seine Muhme in Lympurg nicht. Er war ihr zweimal auf dem Markt begegnet, jedes Mal verspürte er eine eisige Kälte, die von ihr ausging. Eigentlich mochte er keine seiner Muhmen, weder die hochnäsige Stadtmuhme noch die einfältige Landmuhme, die stets ihre Söhne vorzog und ihn wie einen zugelaufenen Köter behandelte. Keine von ihnen hatte jemals ein freundliches Wort für ihn übrig, er fühlte sich bei ihnen wie ein lästiges Furunkel, das man nicht loswird.
Während sich der Junge abwandte und wie gebannt aus dem Fester schaute, um die zahlreichen Fuhrwerke zu verfolgen, die sich mühsam einen Weg durch die enge Salzgasse bahnten, kam Lisbeth auf ein heikles Thema zu sprechen, das ihr offensichtlich auf der Seele brannte. Sie scheute sich nicht, es vor Carl offen anzusprechen.
„Maria, es wird Zeit, dass du dich jetzt um den Carl kümmerst. Der Junge sollte in der Stadt aufwachsen und zur Schule gehen. Ich bin wieder schwanger. Mit acht Kindern wird es mir zu viel am Hof. Ich kann den Carl fürderhin nicht durchfüttern, so viel gibt unsere Scholle nicht her.“
Lisbeth war gleich mit der Tür ins Haus gefallen. Sie wollte nicht eine Minute länger als nötig verweilen. Die Schwestern gingen sich seit der Hochzeit Marias aus dem Weg. Sie waren grundverschieden, schon rein äußerlich. Lisbeth trug nur einen schlichten, blauen Rock aus derbem Sackleinen, und eine ehemals weiße Bluse aus Tuch, die sie nur zu Stadtbesuchen anlegte. Maria dagegen kleidete sich allmoda nach der neuesten französischen Mode aus den Gazetten, die erst Monate nach deren Erscheinen in Paris Lympurg erreichten. Ihr Mann versorgte sie mit den neuesten Stoffen aus Frankreich und Italien, nicht ohne Eigennutz, da Weib als Werbeträger in der feinen Gesellschaft auftrat. Die Gemahlin eines wichtigen und reichen Amtsträgers stellte ihre besondere Stellung in der Lympurger Gesellschaft heraus, verkehrte nur in den Kreisen ihresgleichen. Mit dem niederen Bauernvolk wollte sie absolut nichts zu schaffen haben, selbst nicht mit ihrer Schwester, der schmuddeligen Bäuerin vom entfernten Hof Blumroth, und schon gar nicht mit dem Kind einer Krebse, dem Bastard ihrer verstorbenen Schwester Anna.
„Was stellst du dir vor? Mein Mann ist tagsüber im Geschäft und im Stadtrat beschäftigt. Wir haben viele gesellschaftliche Verpflichtungen. Ich kann mich wirklich nicht um deinen Carl kümmern.“
„Mein Carl? Der Junge ist der Sohn unserer verstorbenen Schwester. Du hast genauso eine familiäre Pflicht zu übernehmen wie ich auch. Ihr könnt dem Carl in der Stadt weitaus mehr bieten als wir auf dem Land. Und übrigens, wie steht es denn mit eurem Nachwuchs? Die Leute zerreißen sich schon die Mäuler. Hat dein Mann keinen Saft im Geschröt oder bist du eingetrocknet?“
Das war zu viel für Maria Birkenbühl. Sie holte tief Luft, so dass das eng geschnürte, steife Mieder aus Fischbein fast zu platzen drohte, und wies ihr mit einem Fingerzeig die Tür:
„Ich lasse mich von dir nicht beleidigen. Schnapp dir deinen verdammten Bengel und verschwinde! Raus!“
Der unverhoffte Besuch blieb nicht ohne Nachwirkung. Maria hatte ihrem Gatten von dem unverschämten Ansinnen ihrer hohlköpfigen Schwester berichtet. Ihre Empörung war nicht gespielt. Hans antwortete nicht darauf. Das war nichts Außergewöhnliches, denn zwischen den Ehepartnern war ein ausführliches Gespräch längst verstummt. Zu tief saß die Schmach, die ihm Maria zugefügt hatte. Der Hausherr teilte nur noch Entscheidungen mit, ohne diese vorher mit seiner Frau zu erörtern. Maria hatte sich auch darin eingefügt, wie man ihr zugetragen hatte, dass ihr Mann seine Liebschaften anderweitig suchte. Vielleicht wollte er testen, ob er wirklich impotent war, ob es an ihm liege, dass ihr Kinderwunsch unerfüllt blieb oder an seinem zu voreilig angetrauten Weib. Bis dato hatte Maria von keinem Bastard ihres Gatten gehört, stattdessen die zunehmend schlechten Launen ihres Mannes registriert.
„Der Junge ist ein Krüppel, ein Homunkulus, oder?“, fragte Hans nach einer Weile des Schweigens.
„Krüppel? Mitnichten. Die anfängliche Missbildung ist langsam herausgewachsen. Ich habe bis auf seine diabolische Hasenscharte nichts Ungestaltetes an dem Knaben bemerkt. Aber klein ist er schon.“
„Ein Wolfsrachen? Wir glauben nicht daran, dass er als Strafe Gottes anzusehen ist. Das ist Humbug. Wofür sollte ein Kind bestraft werden? Im Mannesalter wird die Missbildung sowieso vom Bart verdeckt. Ist er denn im Kopf klar?“
„Ja, schon … er scheint, ein aufgewecktes, normales Kind zu sein.“
„Also gut, richte eine Stube und schaffe ihn alsdann mit der Kutsche her.“
„Du meinst wohl nicht ernsthaft, wir sollen den Bankert aufnehmen, das kannst du mir nicht antun …“
„Keine Widerrede. Sollte mir der Junge gefallen, werde ich für die offizielle Namensregistrierung Carl Birkenbühl sorgen. Dann hat das unsägliche Gewäsch über die Kinderlosigkeit endlich ein Ende.“
Maria Birkenbühl schnaufte vor Wut.
2
Nach sanftem Druck und wortreicher Überredung mochte sich Carl letztlich damit abfinden, zu seinem Oheim Hans nach Lympurg zu wechseln. Bei seinen neuen Zieheltern vermisste er anfänglich die Geborgenheit, die ihm vor allem sein Oheim Josef entgegengebracht hatte. Die Stadtmuhme wies ihm im Erdgeschoss ein finsteres Kabuff zu, gleich neben der Kammer der alten Magd Luzie, so als wäre er ein gemeiner Knecht. Das Gesinde wurde nach hinten verbannt in Riechweite des stinkenden Abtritts, nicht ohne Grund, denn sie stellten das Bollwerk gegen Ratten, Mäuse und streunende Katzen dar. Eingesperrt wie ein Wachhund, der von seinem Herrchen in einen heruntergekommenen Verschlag gesteckt worden war. Nur mit Mühe konnte er seine Wut unterdrücken. In den ersten Tagen verkroch er sich bockig auf sein karges Bettlager und quittierte jeden strafenden Blick seiner Muhme mit unverhohlener Nichtbeachtung und beißendem Trotz. Sie ließ ihn deutlich spüren, dass er nur ein vorübergehend geduldeter Fremdkörper im Hause sei, wobei die Betonung auf ‚vorübergehend‘ lag. Kein Wunder, dass er mit dem Gedanken spielte, sofort wieder in seine gewohnte Umgebung zurückzugehen – lieber dort als hier. Die meiste Zeit sprach er kein Wort und aß nur das Notwendigste, das ihm die alte Magd mit liebevollem Zureden in seine Kammer brachte. Als ihn Maria auf Befehl ihres Mannes zur Stiftsschule brachte, erkannte er die Chance, etwas zu lernen, auch wenn der Lateinunterricht mühsam und ungewohnt war. Anfangs fehlte ihm die bäuerliche Arbeit, doch dann konzentrierte er sich auf das Lesen, Schreiben, Rechnen und die lateinische Sprache und empfand die Kopfarbeit als mindestens genauso anstrengend wie das Schuften im Stall auf der Hofreite. Er war mit solch einem Eifer dabei, dass sein Ludimagister voll des Lobes ob seines Fleißes war. Seinen Oheim Hans freute es, und so fand er allmählich Zutrauen zu seinem Ziehsohn. Schließlich nahm er den Carl gegen den erbitterten Widerstand seines zeternden Weibes offiziell an Sohnes statt an.
In der Schule hatte Carl bald einen Freund gefunden, der ihn aus seiner tristen Einsamkeit herausholte. Er wohnte genau gegenüber dem Haus seines Oheims in einem prächtig verzierten Fachwerkhaus. Es waren die einzigen Häuser in der Salzgasse, die sich mit den vorkragenden Giebeln zueinander neigten, als gehörten sie zusammen, zumindest in luftiger Höhe. Anton war etwas älter, einen Kopf größer und ein ausgesprochen lustiger Bursche, aber stinkfaul beim Lernen. Sein Vater Dietrich Lahnstein betrieb die Gaststätte ‚Im goldenen Adler’, ebenfalls in der Salzgasse, nur einige Schritte zum Kornmarkt hin gelegen. Seinen Reichtum schöpfte er jedoch aus dem schwungvollen und sehr profitablen Salzhandel.
Den Unterricht nahm Anton als reine Pflichterfüllung hin. Sein Vater hatte ihm eingebläut, ohne Schulausbildung würde er niemals einen guten Platz in der Gesellschaft finden können. Carl dagegen kannte ein solches Ziel nicht. Er war nur neugierig, wissbegierig und nahm vor allem den Religionsunterricht tief in sein Gedächtnis auf. Für ihn war der Scholaster das Sprachrohr Gottes, ihm vertraute er vollends. Die Geistlichen verkündeten doch Gottes Wort, die Wahrheit, die einzige Wahrheit. Wer die Wahrheit leugnete oder an ihr zweifelte, war ein Ketzer und wurde vom Allmächtigen verdammt. Das war Carls Philosophie, der er auch später treu blieb. Die Dogmen der Kirche verinnerlichte er so stark, dass die Glaubenssätze zum unverrückbaren Fundament seines Weltbilds wurden. Er sog die Lehrsätze über das christliche Leben und die Entstehung der Welt in sich hinein, wobei sich die Frage, ob richtig oder falsch, für ihn nicht stellte. Der Scholaster erzog Carl zu einem frommen, der römisch-katholischen Kirche treu ergebenen Christen.
Die Stiftsschule befand sich in einem zweigeschossigen Steinhaus zwischen der Michaelskapelle linker Hand des Stiftsfriedhofs und dem nördlichen Turm der Sankt Georg-Kirche.
„Weißt du, warum die Schule genau hier an diesem Platz steht?“, fragte Anton lachend. Carl zuckte mit den Schultern.
„Wenn du gut lernst, ist deine Seele gerettet. Dann wirst du nebenan in der Stiftskirche mit offenen Armen aufgenommen und kannst in den Himmel kommen. Bist du aber faul und dumm, droht dir die Hölle, und du landest im dunklen Keller der Michaelkapelle, im Beinhaus!“
„Wer hat dir denn solch eine hirnrissige Hühnerkacke erzählt, Antong?“ Anton schmunzelte über Carls Sprachfehler, der ihm nur dann auffiel, wenn er seinen Namen sagte.
„Mein erster Schulmeister, ob du es glaubst oder nicht. Da siehst du mal, mit welchen Methoden die Magister arbeiten. Zuckerbrot und Peitsche, mehr kennen die nicht. Und weil die Stiftscholaster angehalten sind, deine Seele zu retten, prügeln sie dich zu deinem Heil.“
„Sag nur, die greifen sogar zur Peitsche?“
„Nein, keine Peitsche, aber zum spanischen Rohrstock. Meine Fingerkuppen sind schon ganz blau von den Hieben.“
„Beinhaus? Da liegen Totengerippe?“
„Vor Jahren wurde der Friedhof der verfallenen Laurentiuskapelle beim Huttig aufgegeben. Die Knochen konnten sie doch nicht einfach wegwerfen, dann wären die Seelen der Verstorbenen nicht gerettet, also wurden sie im Beinhaus sorgfältig gestapelt. Der heilige Michael, Schutzpatron der Friedhöfe, bewacht sie. Man sagt, wenn die Totenruhe gestört wird, nehmen die Verstorbenen als Untote Rache, sie springen als Wiedergänger einem Lebenden auf den Rücken. Dort bleiben sie, bis er unter der erdrückenden Last stirbt. Ich rate dir, halte dich vom Beinhaus fern, sonst ist es um dich geschehen. Also pass auf, dass du in den Himmel kommst. Mein Opa hat immer gesagt: Ein frommer Christ lebt erst, wenn er im Himmel ist!“
3
Für Carl war das Leben in der Stadt spannend und aufregend, es machte ihn reifer und gebildet. An die bäuerliche Umgebung in Blumroth verschwendete er keinen Gedanken mehr. Warum auch. Im neuen Heim herrschte kein Mangel, Geldsorgen kannte sein Oheim Hans nicht. Die alte Dienstmagd Luzie, die im Hinterhaus gleich neben seiner Kammer hauste, hatte die Fünfzig gerade überschritten, dennoch rüstig, hellwach im Kopf und gottesfürchtig. Die gute Seele hatte bald einen Narren an Carl gefressen, wohl deshalben, weil ihr selbst keine Kinder vergönnt waren. Wahrscheinlich war sie sogar noch Jungfer. Ständig umsorgte sie ihn, wusch seine Kleider, räumte sein Zimmer auf, fragte, was er denn essen möge. Carl mochte sie und bedankte sich für ihre Fürsorge, indem er sie liebevoll ‚Oma Luzie‘ nannte. Sie war das einzige weibliche Wesen, zu dem Carl eine tiefere Zuneigung verspürte und das für ihn so etwas wie einen Mutterersatz darstellte. Er konnte sich nicht erinnern, von einer seiner beiden Muhmen je ein sanftes Streichen über sein Haar, geschweige denn einen Kuss erhalten zu haben. Im Gegenteil, seine Stadtmuhme ließ ihn nach wie vor eine gewisse kalte Distanz spüren, nicht feindlich, das wagte sie nicht. Dennoch brachte sie kein freundliches oder gar liebevolles Wort über ihre grellrot geschminkten Lippen, als wäre sie eine der lasterhaften Mätressen am französischen Königshof.
Carl verbrachte die meiste Zeit bei seinem Freund, sogar zum Mittagessen, vor allem, wenn es Antons Lieblingsgericht gab: Schweinepfeffer mit Korinthen. Seiner Muhme war es recht, so hatte sie mehr Zeit für sich und ihren ausgedehnten Vergnügungen in den honorigen, feinen, arroganten Lympurger Damenzirkeln. Auf sein Bitten hin und auf Geheiß seines Oheims durfte Carl schließlich eine eigene Stube im Obergeschoss zur Salzgasse hin beziehen. Er wollte doch seinem Freund gegenüber zurufen können, mit ihm über die Gasse hinweg schwatzen und vor allem dem hektischen Treiben im stark befahrenen Fahrweg zuschauen. Die Salzgasse mussten alle Fuhrwerke auf dem Weg von Franckfurt nach Cölln und umgekehrt passieren. Es faszinierte ihn, wenn die vorauseilenden Ausscheller freie Fahrt für die zahlreichen Gespanne einforderten. Meist war das Gezeter groß und so manches Mal kam es zu Unfällen, wenn die Fahrspur nicht rechtzeitig geräumt war. Immer gab es etwas zu schauen, immer war es spannend.
Mit der Zeit wuchs das Zutrauen zu seinem Oheim, der ihn aus vollem Herzen lieb gewonnen hatte. Das spürte Carl und dankte es seinem ‚Vater’, wie er ihn nun nannte, indem er immer wieder um seinen väterlichen Rat nachfragte und so sein uneingeschränktes Vertrauen erwarb. Carl war wissbegierig und stellte viele Fragen, auf die er in der Schule keine Antworten bekommen hatte. Sein Oheim nahm sich viel Zeit für seinen angenommenen Sohn, hoffte er doch, Carl werde einmal in seine Fußstapfen treten. Der Tuchhändler kaufte nicht nur feine Wollstoffe in Franckfurt und anderen Tuchzentren ein, um diese mit großem Reibach an die reichen Patrizier zu verkaufen, nein, er vertrieb auch die Lympurger Wollstoffe, sei es in Augsburg bei den Fuggern oder bis nach Italien. Die Zunft dankte es ihm. Die Sorge, sein Sohn würde an seinem Geschäft kein Interesse zeigen, erwies sich bald als unbegründet. Im Gegenteil. Carl faszinierte das Wollweben, und so reifte in ihm der Entschluss, das Tuchmacherhandwerk zu erlernen. Birkenbühl sah es mit großer Genugtuung und Freude. So hatte er sich einen Sohn gewünscht, wenn ihm seine Frau einen geschenkt hätte. Fleißig, klug und späterer Erbe seines Geschäfts. Ob leiblicher Sohn oder angenommen, das spielte längst keine Rolle mehr, dachte er, aber er hatte sich getäuscht. Der strenge Zunftmeister der Wollweber sah dies anders, als eines Tages in der Morgensprache im Zunfthaus ‚Der Zorn’ an der Plötze über die Aufnahme als Lehrjunge entschieden werden sollte. Birkenbühl konnte keine Urkunde vorlegen, welche die eheliche Geburt als Zeichen bürgerlicher Herkunft bescheinigte. Das war jedoch eine wesentliche Voraussetzung für die Zulassung zur Zunft. Schließlich versicherte Birkenbühl mit Nachdruck, dass sein Sohn ein ehrenwerter, tugendhafter Junge sei. Er selbst verbürge sich für das standesgemäße Verhalten seines Sohnes. Die Zweifel vermochte er jedoch nicht zu vertreiben. Als er schließlich sein Gesuch mit einer ordentlichen Geldzuwendung in die Zunftlade untermauerte und den Zunftmeistern je einen Sester des besten Weins spendierte, regte sich kein Widerstand mehr. Zusätzlich spendete Birkenbühl, wie es die Regularien vorsahen, ein Pfund Wachs für das Kloster der Minderen Brüder und zahlte die fällige Gebühr an die Churfürstliche Kellerei.
Carl wurde als Tuchmacherlehrling akzeptiert.
4
Anton ging seinem Vater ,Im Goldenen Adler’ zur Hand, weil dieser zum Bürgermeister gewählt worden war und wegen der Amtsgeschäfte und seines Salzhandels kaum Zeit für die Bewirtschaftung fand. Natürlich war Carl ein gern gesehener Gast in der Schänke, wo er auf Kosten des Hauses Bier schlürfen durfte. Anton sah in Carl einen großen Bruder, obwohl der doch kleiner und jünger war als er. Neidlos kannte er an, dass Carl klüger und ihm in vielen Dingen überlegen war. Bei ihm konnte er immer Rat finden und sogar Geheimnisse mit ihm teilen.
Carls wallendes, pechschwarzes Haar, sein beginnender Bartwuchs und seine schwarzen, funkelnden Augen gaben ihm ein etwas fremdländisches Aussehen. Er war als „Hotzel-Carl“ inzwischen stadtbekannt. Die Spuren der Hasenscharte waren bald hinter einem Bart verschwunden und auf den ersten Blick nicht mehr zu erkennen. Sein Uzname wurde jedoch nicht mehr mit Häme genannt, sondern eher mit Respekt vor seiner Bildung. Carl war wissbegierig und ein Bücherwurm. Sein Vater besaß eine gut sortierte Bibliothek – als echter Patrizier wollte man sich durch eine stattliche Sammlung von Büchern von den ‚unwissenden‘ Bürgern abheben, wobei man unter Wissen allein den Besitz von Druckwerken verstand. Und weil die Bücher recht teuer waren, gab es nur ein Häuflein Auserwählter, die sich zu den Wissenden zählen durften. Kamen Besucher ins Haus, so führte Birkenbühl sie natürlich in seine Bibliothek und genoss die Schmeicheleien der Gäste, wenn sie über die Anzahl weniger als über den Inhalt der Werke staunten. Sein ganzer Stolz waren Abhandlungen über das neue Weltbild eines Kopernikus; über den Unsinn von Aberglauben und Alchimisten, die ernsthaft vorgaben, Gold machen zu können; über die neuesten Erkenntnisse der Medizin; über Hofzeremonien am französischen Königshof und vieles mehr. Fraglich, ob Birkenbühl sie je gelesen hatte.
„Wenn du ein Buch aufschlagen kannst, dann bist du auch alt genug, um es zu lesen“, hatte Carls Vater gesagt. Die Bücher waren an der Seite mit zwei Bügeln verschlossen, die aufsprangen, wenn man mit der Faust kräftig auf das flache Buch schlug. Für Carl kein Problem, Kraft hatte er genug. Die meisten Werke waren in lateinischer Sprache gehalten, doch das war dank seiner schulischen Leistungen kein allzu großes Hindernis. Besonders faszinierte ihn die Bibel, die zu seinem Erstaunen gleich in zwei Ausgaben vorhanden war, eine in deutscher Sprache nach der Luther-Übersetzung und eine in lateinischer Sprache. Beide unterschieden sich inhaltlich nicht sonderlich, wie er herausfand.
Die Tuchmacherei lag einige Schritte entfernt, schräg gegenüber der Stadtwaage, die am Eckhaus zum Fischmarkt stand. Der Wollwebermeister Ölp hatte dem Ratsherrn Birkenbühl einen Geschäftsanteil von einem Drittel verkauft. Ein geschickter Schachzug von Birkenbühl, denn so sicherte er sich das Wohlwollen der Tuchmacher. Er war einer von ihnen und konnte in der Zunft mitreden, hatte er doch auch seinen Gesellenbrief als Wollweber in der Tasche. Carl eiferte ihm nach. Meister Ölp hatte den Lehrjungen zunächst im Wolllager eingesetzt, wo die angelieferte Wolle im Untergeschoss gewaschen wurde. Eine dreckige, nasse, unangenehme Arbeit, vor der sich die Lehrlinge in der Regel drückten, stank es doch bestialisch nach nassem Hammel. Aber Carl störte sich nicht im Geringsten daran, ihm waren die Gerüche aus seiner Kindheit vertraut. Zu seinen Aufgaben gehörte es auch, die Schafswolle von den Grasejungen in Creuch, Ahlbach und Staffel einzuholen. Er mochte es, mit dem Eselskarren zu den Schafhirten zur Stadt hinauszuziehen. Dabei freundete er sich mit den etwa gleichaltrigen Hirtenjungen an, vor allem mit dem Lorenz Menz aus Creuch und dem Staffeler Johannes Serve, den man den „Schwarzen Hans“ nannte. Die Schäfer freuten sich darüber, denn normalerweise wurden sie gemieden und als Schaframmler vorspottet – die einsame, lange Weidezeit trieb den Schäfern so manch verquere, lustvolle Gedanken in ihre leeren Hirne. Der schändliche Missbrauch von Tieren war nicht strafbar, die Kirche ahndete solch Sünden der Sodomie im Beichtstuhl nur mit einer längeren Fastenzeit als Buße. Meist hatte Carl bei seinen Besuchen eine Flasche guten Branntwein mitgebracht, die er heimlich seinem Vater stibitzte. Seine Stadtmuhme hatte keine Einwände, wenn er eine Nacht bei der Herde unter freiem Himmel verbrachte, die klare Luft atmete, der wehmütigen Musik der Sackpfeife lauschte, die Lorenz so vortrefflich zu spielen verstand, und die Sterne voller Ehrfurcht über die wundersame Schöpfung betrachtete und sich mit seinen Freunden dem Branntwein hingab. Nein, tierische Gelüste hegte er nicht.
Eines Tages tauchte überraschend Anton bei ihm im stinkenden Wolllager auf. Er war wie ein Schatten von Carl, ständig suchte er seine Nähe. Zuerst wollte Anton nicht mit der Sprache heraus und druckste herum. Er wolle sich umsehen, zuschauen, was der Tuchmacher denn so bei seiner Arbeit treibe.
„Ei, warst du schon mal hier im Keller?“
„Blöde Frage. Natürlich. Im Keller hat mein Vater das Tuchlager. Warum fragst du?“
„Ei, gibt es da auch einen Ausgang zur Rosengasse hin?“
„Sicher. Von dort werden die Tuchballen angeliefert. Sollen wir mal runtergehen?“
Sie stiegen eine steinerne, enge Treppe hinab in den dunklen, leicht muffig riechenden aber trockenen, gewölbten Kellerraum – die Tür leicht geöffnet, um etwas Licht hereinfallen zu lassen.
„Verdammich, Angdong, sage mir endlich, was du hier willst.“
Anton ging zielstrebig und wortlos auf eine Brettertür zu und öffnete sie. Die stickige Kellerluft wich nun dem üblichen Gestank der Gosse nach Kot, Verwesung und Urin. Sie standen in den brackigen Pfützen der ungepflasterten Rosengasse.
„Und nun, was suchst du hier?“
Anton sah sich um. Dann starrte er auf ein kleines, gegenüberliegendes, etwas heruntergekommenes Haus, als habe er gefunden, was er gesucht hatte. Am Eingang hing schlaff ein gelbes Fähnlein.
„Ei, da drüben, das Freudenhaus mit den Hübschlerinnen.“
„Sag bloß, du willst da rein?“
„Na und? Reizt es dich nicht auch, die Geheimnisse der Weiber zu ergründen?“
„Ich weiß nicht, das ist Sünde.“
„Sünde, Sünde … Sag mir, wo die Bibel verbietet, Lust zu haben. Ei, du bist doch so schlau. Gab es früher nicht sogar Tempelhuren? In den zehn Geboten ist nur von Ehebruch die Rede. Ich bin noch nicht verheiratet. Also …“
„Hör auf, Angdong, da mache ich nicht mit.“
„Du bist ein Waschlappen, feige und pfaffenhörig. Aber wenn ich mich mal heimlich zum Hurenhaus schleichen will, kann ich doch durch deinen Keller rüber, oder?“
Eine Woche später konnte Anton seinem Druck im Gemächt nicht mehr standhalten.
5
Anno 1678 war in Lympurg eine allgemeine Trauer angesagt, verordnet von den Stadtvätern. Die ehrwürdige Maria Magdalena Greiffenklau von Vollrads, Witwe des Johann Peter von Walderdorff, war im seligen Alter von 83 Jahren in Lympurg verschieden. Die verehrte Patronin des erlauchten Adelsgeschlechts, eine großzügige Gönnerin der Stadt und der Kirche. Es war ein trüber, kalter Februartag. Graue Wolken versprühten feine Regentropfen, gemischt mit ein paar Schneeflocken, als ob die himmlischen Engelchen weinten. Mit bärbeißigen Gesichtern zogen die Menschen durch die schmierigen Gassen. Das nasskalte Wetter schlug ihnen aufs Gemüt und fuhr in ihre frierenden Füße in den vor Jauche und Hundekot stinkenden, durchnässten Lederstiefeln. Der Stadtrat hatte zum Zeichen der allgemeinen Trauer über den bedeutsamen Verlust einer hochgeschätzten Lympurger Aristokratin angeordnet, alle öffentlichen Einrichtungen mit schwarzen Fahnen zu beflaggen und die Arbeit vier Tage ruhen zu lassen. Vier Tage! Selbst der Wochenmarkt fiel aus. Da musste wohl eine sehr wichtige hochwohlgeborene Person verstorben sein, mutmaßten die Ahnungslosen, die Knechte freuten sich über die freien Tage, die Kaufleute schimpften über die verlustigen Geschäfte.
Schon Wochen zuvor hatten die Lympurger über die zahlreichen, vierspännigen, prunkvollen Kutschen gestaunt, die in großer Zahl am Walderdorffer Hof in der Fahrgasse eintrafen. Dass die alte Witwe schwer erkrankt war, hatte sich herumgesprochen, auch dass honorige Professoren der medizinischen Mayntzer Fakultät im Stadtschloss ein- und ausgingen. Offenbar hatte man den Heilkünsten der hochrangigen Gelehrten nicht vollends vertraut, wurden doch in der Sankt Sebastian-Kirche der Franziskaner täglich Heilungsmessen gehalten. Ein einstündiges Hinleuten verkündete schließlich ihren Tod.
In der Klosterkirche wurde das Requiem gefeiert, an dem nur geladene Trauergäste teilnehmen durften – unter anderem auch die Stadtherren. Das gemeine Volk hatte draußen zu bleiben und vor dem Gotteshaus im kalten Regen und in stiller Ehrerbietung auszuharren. Vor dem Altar war der schwere Eichensarg aufgebahrt, umstellt mit langen, weißen Talgkerzen. Schlicht, aber edel. Birkenbühl hatte sich mit seinem Carl in der hinteren Reihe Plätze direkt am Mittelgang gesichert. Er hatte ihn hineingeschmuggelt, denn sein Sohn sollte unter allen Umständen dem großen, einmaligen Ereignis – wie er bedeutungsvoll meinte – beiwohnen.
„Schau dir die Leute sehr genau an. Eine solche Anhäufung von erlauchten, adligen Würdenträgern wirst du nicht noch einmal in Lympurg zu Gesicht bekommen!“ Carl verfolgte angespannt, mit aufgerissenen Augen und gespitzten Ohren das folgende Schauspiel mit den hochedlen Akteuren.
Angeführt vom Guardian Bruder Johannes und einer großen Schar von Ministranten hielt die ehrwürdige Familie Derer von Walderdorff mit versteinerten Gesichtern, die Augen starr auf den Sarg gerichtet, bei gedämpfter Orgelmusik feierlichen Einzug. Vorweg die fünf noch lebenden Söhne der hochwohlgeborenen Freiin, dahinter die große Zahl der übrigen Familienangehörigen.
„Das ist, als ob eine edle Fürstin gestorben ist. Wer sind all die Leute in feinsten Roben?“ Carl konnte sich nicht sattsehen.
„Da, der Bischof!“, flüsterte Birkenbühl.
Tatsächlich schritt direkt hinter dem Klostervorsteher ein kleiner, dickbäuchiger Mann in einer reich bestickten, schwarzen Soutane mit rubinroten Knöpfen und einem violetten Birett mit einer Quaste auf dem Haupt, die ihn größer erschienen ließ. Die einzigen Insignien, die ihn als Bischof auswiesen, waren der Bischofsring und das Pektorale, das goldene Brustkreuz. Carl stellte mit Genugtuung fest, dass der mächtigste Mann unter den Trauergästen fast genauso klein wie er war. Auch kleine Menschen können es zu etwas bringen, dachte er bei sich voller Genugtuung. Der nach vorn gebeugte Bischof stützte sich auf einen langen, einfachen, hölzernen Krummstab, als falle ihm das Gehen schwer. Sein Körper und vor allem sein Gesicht schienen aufgedunsen. Ein klarer Hinweis darauf, dass er von einer Krankheit gezeichnet war, wahrscheinlich Wassersucht.
„Das ist der zweitälteste Sohn der Verstorbenen. Freiherr Wilderich von Walderdorff, jetzt ist er Fürstbischof von Wien.“
„Was? Von Wien?“
„Ja, da staunst du. Wilderich war sogar erst Reichsvizekanzler des Kaisers Leopold und residierte in der Hofburg zu Wien. Er war nach dem Kaiser der zweitmächtigste Mann im Heiligen Römischen Reich! Hatte also das höchste Amt im Reich abgesehen vom Kaiser. Seine Kaiserliche Majestät hat ihn danach zum Erzbischof von Wien ernannt.“
„Wahnsinn. Was verdient so ein Mensch?“
„Das bringt ihm mehr als 20.000 Gulden im Jahr ein. Unter dem Krummstab lässt es sich wahrlich gut leben. Von seinen zahlreichen Einkünften aus verschiedenen Ämtern konnte er locker den Bau seines Stadtschlosses in Lympurg finanzieren.“
„Und der Geistliche hinter ihm im schwarzen Gewand?“
„Das ist sein Bruder Johann Philipp von Walderdorff, seines Zeichens Archidiakon der Lubentiuskirche in Dietkirchen und Domherr zu Trier, ein angesehener Geistlicher. Er wohnt im Stadtschloss. Der Mönch neben ihm ist der älteste Bruder Lothar, der war auch Domherr in Trier und ist jetzt dem Kapuzinerorden beigetreten. Er hat dem Reichtum abgeschworen und nennt sich ‚Petrus von Lympurg’.“
Der Ordensbruder in einer einfachen, braunen Kutte, gegürtet mit einem Strick, hatte seine Kapuze über den Kopf gezogen und verbreitete etwas Mystisches. Sein knöchriges Gesicht mit den tiefliegenden Augenhöhlen erinnerte an Gevatter Tod, sein langer, grauer Bart war ungepflegt wie bei einem Eremiten. Die Kapuziner gehörten dem radikaleren Teil des Bettelordens der Franziskaner an. Sie waren für ihre extreme Armut und ihre aufopfernde Seelsorge für Hungerleider und Kranke bekannt. Petrus von Lympurg! Weder der Name noch sein Aussehen passten zur adligen Familie. Er war eher das schwarze Schaf der Walderdorffs, dachte Carl.
„Was macht ein Archidiakon?“
„Johann Philipp beaufsichtigt den Kirchensprengel der Lubentiusbasilika in Dietkirchen. Unser Landesvater und geistliches Oberhaupt, der Fürstbischof von Trier, sah sich in der Vergangenheit gezwungen, Visitationen in der Basilika durchzuführen, weil einige Priester dort offen reformerische, ketzerische Gedanken vertraten und einer sogar in Verdacht geriet, er leiste sich eine Konkubine. Jetzt sorgt Johann Philipp im Namen des Trierer Erzbischofs für Ordnung in Dietkirchen. Und schau, hinter dem Kapuziner geht der grauhaarige Adam Diederich, der ist Domherr in Mayntz.“
„Noch ein Geistlicher? Dann haben die Walderdorffs großen Einfluss in der Kirche?“
„Nicht nur in der Kirche. Der Weg zur weltlichen Macht führt in der Regel über Kirchenämter. Die sind mit großen Pfründen verbunden, da kann man schnell reich werden. Und genau diese Strategie verfolgen die Walderdorffs.“
„Ihr meint, die sind Geistliche geworden, um der Macht und des Reichtums willen?“
„Gewiss doch. Entweder du wirst als Adliger in den Wohlstand geboren oder du beginnst eine geistliche Karriere. Das führt meist auch zu Macht und Geld. Bei den Walderdorff-Söhnen hat es jedenfalls geklappt, wie du siehst. Sogar bis zum Kaiserhof in Wien sind sie gekommen.“
Für Carl eröffnete sich eine neue Welt mit ungeahnten Chancen. Chancen auch für ihn? Er schmunzelte einen Moment, dann sah er sich die edlen Herren eingehend an, ob sie anders wären als das gemeine Volk. Nein, er konnte keine Besonderheiten ausmachen, abgesehen von der sündhaft teuren Garderobe. Waren das Lieblinge des Allmächtigen oder des Kaisers oder der Kirche?
„Aber wenn die alle zum Priester geweiht sind, dann dürfen sie nicht heiraten. Reich und ohne Nachkommen. Ende der Walderdorff-Familie.“
„Nein, nein. Da passen sie schon auf. Einer muss den Stammbaum fortsetzen. Siehst du, am Schluss geht der jüngste Sohn Emmerich Friedrich. Er ist Reichshofrat am kaiserlichen Hof in Wien, also kein kirchliches, aber ein sehr einflussreiches Amt beim Kaiser. Der ist auserwählt, Stammhalter zu zeugen.“
Die festliche Prozession von edlen Nobilisten führte dem jungen Carl nachdrücklich vor Augen, dass diese Leute in einer anderen Welt lebten, dass sie sich vom gemeinen Volk nicht nur in Ansehen und Reichtum unterschieden, sondern vor allem durch die Macht, die sie kraft ihrer Ämter innehatten und deshalben Respekt und unterwürfige Ehrerbietung einforderten. Und eines wurde ihm beim Anblick dieser honorigen Gesellschaft noch deutlicher: Er selbst war diesem noblen Stand nicht zugehörig, er war von niedrigem Rang, befand sich aufgrund seiner unehelichen Geburt sogar am untersten Rand der Gesellschaft. Aber das musste ja nicht so bleiben, dachte er und sandte ein flehendes Stoßgebet gen Himmel.
„Erzählt mir später noch mehr über die Walderdorffs. Ich wusste gar nicht, dass aus Lympurg so wichtige Leute kommen und dass es eine so enge Verbindung nach Wien gibt. Da möchte ich auch mal hin.“
„Ich habe früher feine Tuche an den Kaiserhof geliefert. Vielleicht ergibt sich einmal die Gelegenheit, nach Wien zu reisen. Aber jetzt müssen wir still sein, die Leichenpredigt beginnt.“
Zunächst lobte der Guardian Johannes die besonderen Verdienste der hochwohlgeborenen Verstorbenen und zeichnete ihren Lebenslauf nach. Maria Magdalena habe vierzehn Kinder in Lympurg geboren. Doch die meisten seien im Kindesalter gestorben oder der Pest zum Opfer gefallen. Anno 1635 habe sich ihr geliebter, kranker Ehemann Johann Peter von Walderdorff mit der ganzen Familie in ihr Refugium am Hallgarten nahe des Lympurger Weihers zurückgezogen. Sie wollten der Pestilenz entgehen, die in der Stadt wütete. Aber der schwarze Tod habe ihn und vier Kinder doch noch eingeholt, obwohl Maria Magdalena ihren Mann ohne Scheu vor der Seuche in der Isolation im Gartenhaus liebevoll gepflegt habe. Eine wahrlich tapfere und aufopferungsvolle Frau! Er pries die wohltätigen Stiftungen der Erhabenen von Walderdorff und die großzügigen Spenden an das Kloster in höchsten Tönen, lobte den Entschluss der geadelten Familie, die Sankt Sebastian-Kirche zu ihrer Grablege zu bestimmen und kündigte an, dass in der Kirche ein Epitaph für Johann Peter von Walderdorff und seine Frau Maria Magdalena errichtet werde. Seine Rede klang wie ein Appell an die Familie, das Kloster auch weiterhin großzügig zu unterstützen.
Die Totenmesse endete mit dem Chorgesang ‚Lux aeterna’ – das ewige Licht möge der Verstorbenen leuchten. Nach dem Schlusssegen und dem ‚Ite missa est‘ zogen sich die Hochwohlgeborenen in das Stadtschloss zum Leichenschmaus zurück. Sie schritten durch ein Spalier von gaffenden, schweigenden Menschen die Barfüßerstraße hinunter. Nur der vollleibige Wiener Fürstbischof nahm die Kutsche, ihm war der Fußweg zu beschwerlich. Die Trauer der Schaulustigen hielt sich in Grenzen. Die Walderdorffs waren in Lympurg nicht sonderlich beliebt, hielten sie sich doch für etwas Besseres, hatten sich zu viele Freiheiten herausgenommen, waren mit außergewöhnlichen Privilegien ausgestattet und schalteten und walteten nach eigenem Gutdünken ohne Rücksicht auf die Zunft- und Stadtregularien, die nur für das Volk zu gelten schienen und nicht für die Aristokratie. Sogar ein eigener Gerichtsstand war dem Adel zugestanden. Das Mitgefühl mit den Trauernden hatten sie daheim gelassen.