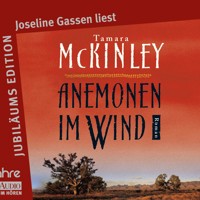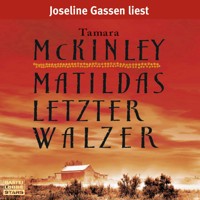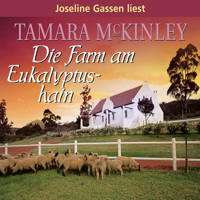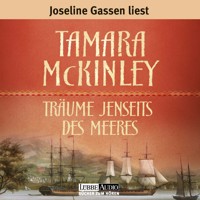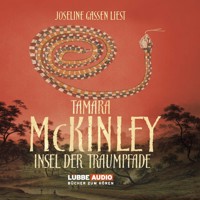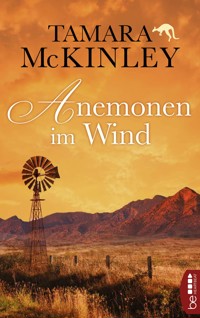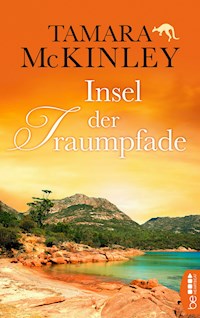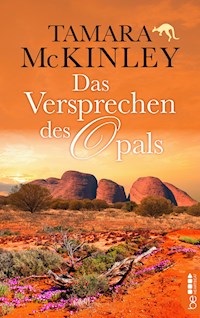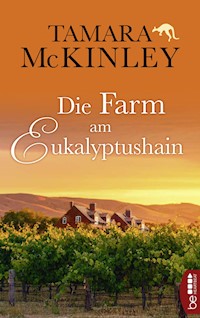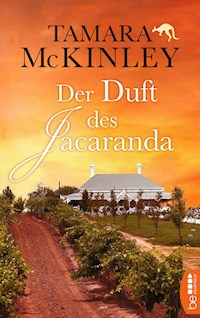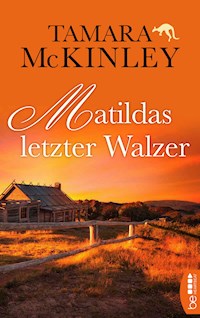4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Poesie und Drama
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2012
Dort am Horizont lag der unverkennbare Landfleck, den sie seit sechzehn Jahren nicht gesehen hatte. Ihr Herz hämmerte, und sie hielt sich an der Reling fest, vor Tränen fast blind, während die Rotamahana Richtung Süden dampfte und der Fleck immer deutlicher wurde. Tasmanien. Als Lulu nach vielen Jahren in ihre Heimat zurückkehrt, folgt sie einem rätselhaften Brief: Ein Fremder teilt ihr mit, dass sie auf der australischen Insel ein wertvolles Rennpferd besitzt. Doch in Tasmanien schlägt ihr nichts als Feindseligkeit entgegen. Schon kurz nach ihrer Ankunft wird sie beinahe von einem Wagen überrollt - ein dreister Anschlag auf ihr Leben. Lulu ahnt: In ihrer Familie gibt es ein dunkles Geheimnis, das den Hass vieler Menschen auf sie zieht. Nur Joe Reilly, der sympathische Trainer ihres Rennpferds, hält zu ihr. Er verliebt sich in die mutige Frau und bringt sie - ohne es zu ahnen - erst recht in Gefahr ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 657
Ähnliche
Inhalt
Cover
Titel
Impressum
Zitat
1
England, Februar 1920
Rennstall Galway House, Tasmanien, April 1920
2
Sydney, 1886
3
4
Der Hafen von London
5
Sydney, Australien, Dezember 1886
6
Sydney, Weihnachten 1887
Regierungssitz, am selben Abend
7
8
Sydney, Oktober 1888
9
10
Tasmanien, Januar 1895
11
12
13
Freitag, Hobart
14
15
Am nächsten Tag
16
Der Galway-Rennstall
17
18
Danksagung
Unsere Empfehlungen
Tamara McKinley
Der Himmel über Tasmanien
Roman
Übersetzung aus dem australischenEnglisch von Marion Balkenhol
BASTEI ENTERTAINMENT
Vollständige E-Book-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG
Titel der englischen Originalausgabe:
»Ocean Child«
Für die Originalausgabe:
Copyright © 2012 by Tamara McKinley
Für die deutschsprachige Ausgabe:
Copyright © 2012 by Bastei Lübbe AG, Köln
Textredaktion: Christina Neuhaus, Arnsberg
Umschlaggestaltung: Guido Klütsch, Köln
Umschlagmotiv: © getty-images / Harald Braun, Berlin
E-Book-Produktion: le-tex publishing services GmbH, Leipzig
ISBN 978-3-8387-1018-1
www.bastei-entertainment.de
www.lesejury.de
Die Liebe hat viele Gesichter –
ein jedes verlangt seine eigene Treue und ist
von besonderen Umständen,
Erfahrung und Erwartung überschattet.
Wahrhafte und beständige Liebe aber
erfordert das größte aller Geschenke –
erwidert zu werden.
1
England, Februar 1920
Die Wärme unter den weichen Daunen nahm zu, und Lulu Pearson warf sich unruhig hin und her, um ihr zu entkommen. Doch die erstickende Hitze legte sich immer schwerer auf sie, bedeckte ihre Augen, Nase und Mund. Sie wimmerte gequält, als ihr klar wurde, dass sie nicht die Kraft hatte, sie wegzuschieben. Ihr krankes Herz hämmerte, sie rang nach Atem und wusste, dass sie sterben würde.
Der Druck wurde stärker, das Blut rauschte in ihren Ohren, die Angst verlieh ihr die Kraft, gegen dieses schreckliche Ding anzukämpfen. Sie schlug wild um sich und versuchte laut zu schreien, ihr Herz strengte sich an – seine dumpfen, peinigenden Schläge schwächten sie immer mehr.
Sie hörte Stimmen. Nahm einen Lichtstrahl wahr. Und plötzlich war sie frei.
Mit einem tiefen Atemzug sog sie saubere, lebensspendende Luft ein, bäumte sich im Bett auf und öffnete die Augen. Der Raum lag im Dunkeln, und sie war nicht in dem kleinen Haus in Tasmanien. Ihr Herz raste auch weiterhin, während sie bemüht war, gleichmäßig zu atmen und die schreckliche Angst einzudämmen, die dieser immer wiederkehrende Albtraum erzeugte.
Sie war kein Kind mehr – sie war in Sicherheit.
Niemand hätte vermutet, dass er schon fünfundsechzig war, denn er hatte einen festen Gang, war von kräftiger Statur, und der Stock war eher eine Angewohnheit als eine Hilfe. Er passte in die ländliche Gegend, und da er diese Rolle viele Jahre lang gespielt hatte, fühlte er sich in der Tweedjacke, den Knickerbockern und Wanderstiefeln wohl. Das war nicht immer so gewesen, denn im Grunde seines Herzens war er ein Stadtmensch, aber er war in die Rolle hineingewachsen wie ein guter Schauspieler, und diese jährlichen Besuche in Sussex machten ihm Spaß.
Von den getüpfelten Schatten unter den Bäumen getarnt aß er sein letztes Sandwich und beobachtete die Reiterin, die in der Ferne langsam den Hügel hinab zur Pferdevermietung ritt. Sie war über eine Stunde fort gewesen, aber das Warten hatte ihm nichts ausgemacht. Das Wetter war mild, wenn auch ein wenig kühl, und er wurde großzügig bezahlt. Er steckte das Sandwich-Papier in den Leinenbeutel, streifte Krumen von seinem Schnurrbart und hob das Fernglas.
Lulu Pearson war ihm vertraut, dennoch waren sie sich nie begegnet oder hatten je miteinander gesprochen, und wenn alles nach Plan lief, würde das auch nie passieren. Vor vielen Jahren hatte seine sporadische Überwachung begonnen, und im Lauf der Zeit hatte er sie von einem verspielten Kind zu der hübschen jungen Frau heranwachsen sehen, die sich jetzt mit geschmeidiger Anmut über den Stallhof bewegte. Das Haar war ihre krönende Pracht, für gewöhnlich fiel es fast bis zur Taille herab, in Locken, die in der Sonne golden und kastanienbraun funkelten, aber heute hatte sie es zu einem dicken Knoten im Nacken gebunden.
Er erhob sich, als sie die Stallungen verließ und den langen, bergauf führenden Heimweg antrat. Die Leinentasche und das Fernglas baumelten an seiner Schulter, als er sich zurück ins Dorf und zu einem guten Bier begab.
Die Nachwirkungen von Lulus Albtraum hatten sich auf ihrem leichten Ausritt verflüchtigt, und obwohl die Ankunft des eigenartigen Briefes am Morgen ihr inneres Gleichgewicht noch immer störte, war sie beschwingt. Nach den langen Stunden in ihrem Atelier war es herrlich, an der frischen Luft zu sein, und jetzt war sie bestrebt, sich wieder an die Arbeit zu machen. Das Tonmodell war fast fertig, und sie wollte sicherstellen, dass sie Kraft und Bewegung richtig eingefangen hatte, bevor sie es der Gießerei übergab. Dennoch würde ihre Großtante Clarice sie zum Nachmittagstee zu Hause erwarten, und trotz ihres Arbeitseifers war der Gedanke an ein loderndes Feuer, Earl Grey und Teekuchen mit Butter verlockend.
Sie schob alle Gedanken an Tasmanien und den rätselhaften Brief beiseite. Es war ein perfekter englischer Winternachmittag, die Sonne schien von einem wolkenlosen Himmel, Frost glitzerte in den Schatten unter den Bäumen, und die kalte Luft roch nach Schnee. An solchen Tagen war sie dankbar, dass sie nicht der Kurzhaarmode gefolgt war, und während sie langsam nach Hause stapfte, zog sie die Kämme und Nadeln aus ihrem Dutt und ließ die Haare über die Schultern den Rücken herabfallen.
Clarice würde sich bestimmt wieder aufregen, weil sie so lange draußen gewesen war, doch ihr problematisches Herz schlug ziemlich gleichmäßig, und es war befreiend, nach dem Nebel und Lärm von London nur den Himmel und die stille Landschaft als Gesellschaft zu haben. Sicher, sie hatte die Unabhängigkeit genossen, in den dunklen Tagen des Ersten Weltkriegs einen Bus zu fahren, die Erregung, eigenes Geld zu verdienen und sich eine Wohnung mit anderen jungen Frauen zu teilen, aber die Downs waren wie ein Trost für sie.
Bei dem Gedanken musste sie lächeln, denn früher hatte sie einmal geglaubt, sie gehöre nirgendwo anders hin als nach Tasmanien. Sie war so jung gewesen, als sie hier eintraf – ihr Akzent und ihre familiären Umstände hoben sie von den anderen Mädchen im Internat ab –, ihr krankes Herz erschwerte ihr die Teilnahme an deren ausgelassenen Spielen. Als Fremde in einem fremden Land war sie verstört und einsam gewesen, hatte sich blind durch die bewegten ersten Jahre getastet, bis sie Freundinnen gewann und mit ihrem neuen Leben besser zurechtkam. Die Landschaft hatte ihr dabei geholfen, und obwohl die Bäume hierzulande anders waren, die Berge sanfter, die Flüsse nicht so wild, hatte sie in England doch den Wesenskern der australischen Insel vorgefunden, die sie noch immer als ihre Heimat bezeichnete.
Sie setzte sich auf den Zauntritt, um zu verschnaufen. Das Licht war außergewöhnlich, und ihre Künstleraugen tranken die Szene, als lechzten sie nach Schönheit. Ringsum wogten die South Downs, ließen hier und da Kirchtürme sehen und kleine Weiler, gepflügte Felder, die wie Teppiche ausgebreitet waren, Hecken und Schafe mit schwarzen Gesichtern. Ein einsamer Wanderer überquerte den nahe gelegenen Hügel, seine stämmige Gestalt als Silhouette vor dem Himmel, bis er allmählich außer Sichtweite verschwand und sie wirklich allein war in dieser prächtigen Umgebung.
Ein Sonnenstrahl erleuchtete das Haus unten am Fuß des Hügels, und sie betrachtete es liebevoll. Wealdon House war in mehr als nur einer Beziehung weit entfernt von der Holzkate mit Blechdach in Tasmanien. Es war verschachtelt und altmodisch, die Anzeichen von Alter und Vernachlässigung waren durch die Entfernung und durch den schützenden Bewuchs aus Glyzinien und wildem Wein verschleiert. Aus einigen der großen Schornsteine stieg Rauch, und die Sonne glitzerte auf den vielen Fenstern unter dem Schindeldach. Die geometrisch angelegten Gärten waren durch Hecken unterteilt und mit gepflasterten, von duftenden Kräutern übersäten Pfaden verbunden. An Lauben rankten Geißblatt und wilde Rosen empor, es gab einen Krocketrasen und einen Tennisplatz sowie einen Teich, in dem sich Trauerweiden und ruhender Rhododendron spiegelten. Am südlichen Rand befanden sich der Küchengarten und Gewächshäuser, und im Norden führte eine breite Kiesauffahrt in weitem Bogen von imposanten Toren durch Azaleenbeete zu einem großen Vorbau und einer Eingangstür aus Eichenholz.
Lulu kletterte vom Zauntritt, und als sie das Gatter am Fuß des Hügels erreichte, fiel ihr der erste Frühling vor sechzehn Jahren ein. Damals waren gerade die englischen Sternhyazinthen aufgeblüht, die sich wie ein weiter Teppich unter den uralten Eichen und Eschen ausbreiteten und für das kleine Mädchen, das dergleichen noch nie gesehen hatte, ein Wunderland darstellten. Dann waren die Narzissen, die wilden Anemonen und Butterblumen hinzugekommen – ein neuer Teppich aus Gelb und Weiß.
Sie machte das Tor zu und grub ihr Kinn in den Kragen, während sie in die Schatten ging, die nun über den verwilderten Rasen krochen. Wie Kristalle glitzerte der Frost im Gras, doch in den winzigen grünen Schösslingen der Schneeglöckchen und Krokusse, die ihre Köpfe durch das Unkraut streckten, lag die Verheißung neuen Lebens. Jede Jahreszeit besaß ihre eigene Schönheit, und wäre ihr nicht so kalt und ihr Hunger nicht so groß gewesen, hätte sie ihr Skizzenbuch zur Hand genommen und versucht, die Szenerie einzufangen.
Als sie in die Küche kam, schleuderte Lulu ihre Stiefel von sich und begrüßte stürmisch den alten Labrador, der sich vor dem Herd breitgemacht hatte. Das war der wärmste Raum im Haus, denn selbst das lodernde Feuer im Wohnzimmer kam nicht gegen die Zugluft an, die unter sämtlichen Türen hindurch und durchs Treppenhaus pfiff.
Die Haushälterin stürmte zur Küchentür herein und verschränkte ihre fleischigen Arme unter ihrem ausladenden Busen. »Wird auch langsam Zeit«, murrte Vera Cornish verärgert. »Ich hab genug zu tun, da muss ich nicht auch noch meine Teekuchen warm halten.«
Lulu biss sich auf die Lippe, um nicht zu kichern, und tätschelte den Hund weiter. »Tut mir wirklich leid, Vera«, brachte sie hervor. »Komme ich viel zu spät?«
Vera schnaubte und zupfte an ihrer geblümten Kittelschürze, doch ihre Züge wurden weicher, wie immer, wenn sie Lulu vor sich hatte, und sie seufzte. »Tee gibt’s um vier Uhr, wie du genau weißt, Missy, und wenn man das Haus nicht voller Diener hat, ist’s ’ne Heidenarbeit, alles in Ordnung zu halten.«
Lulu entschuldigte sich noch einmal, doch als sie dann beide schwiegen, unterstrich das nur die Leere der riesigen Küche, beschwor Bilder aus jener Zeit, in der die Köchin und die Dienstmädchen mit den Gärtnern um den geschrubbten Tisch herum saßen und plauderten. Der köstliche Duft nach Gebackenem war geblieben, doch das Scheppern von Pfannen und das Stapfen vieler Füße auf den Steinplatten war fort und hatte gespenstische Erinnerungen hinterlassen. Der Krieg hatte alles verändert.
Vera schnalzte verärgert mit der Zunge und griff nach dem Teewagen. »Wasch dir die Hände«, befahl sie. »Mit den ganzen Pferden und Hunden wirst du sonst mehr als nur deinen eigenen Dreck essen, und das bei deinem Herzen und allem …« Der Rest des Satzes ging im Quietschen der Räder und dem Klappern des Porzellans unter, als sie den Teewagen durch die Tür in die Eingangshalle schob.
Lulu lächelte noch immer, während sie sich die Hände unter dem Wasserhahn in der Küche wusch und dann in ihren dicken Socken durch die kühle Eingangshalle tappte. Unter Veras rauer Schale saß ein weiches Herz, und Wealdon House wäre ohne sie einfach nicht dasselbe.
Sie sah nach der Post, die mit der zweiten Lieferung gekommen war, und betrat das Wohnzimmer. Ein Brief von Maurice war dabei, aber sie hatte es nicht eilig, ihn zu lesen.
»Wie oft habe ich dich schon gebeten, dich umzuziehen, bevor du hier reinkommst, Lorelei? Die Ställe haften wie ein widerlicher Geruch an dir.« Clarice duftete nach franzö-sischem Parfüm, ihre Miene war streng, und ihre steife Haltung unnachgiebig, während sie darauf wartete, dass Vera den Teewagen zu ihrer Zufriedenheit aufstellte. Mit herrischem Kopfnicken wurde die Haushälterin entlassen.
Lulu und Vera waren an dieses ziemlich hochnäsige Verhalten gewöhnt und kümmerten sich nicht weiter darum. Clarice spielte gern die Grande Dame, aber dahinter steckte keine Bosheit, und da sie keine stillen Liebesbeweise mochte, widerstand Lulu dem Bedürfnis, ihr einen Kuss zu geben, und sank auf das Sofa neben dem Kamin. »Verzeih«, murmelte sie und fuhr sich mit den Fingern durch das wirre Haar, »aber ich konnte den Tee kaum erwarten. Ich bin ausgehungert.«
Clarice schenkte aus der verzierten Silberkanne ein, und Lulu nahm sich einen Teekuchen mit warmer Butter vom Rechaud und biss hinein.
»Teller, Lorelei, und Serviette.«
Sie gehorchte und mampfte den göttlichen Kuchen, während die Hitze des Feuers sie allmählich auftaute. Clarice hatte sich immer geweigert, ihren Namen abzukürzen – sie fand es ziemlich gewöhnlich –, und obgleich sie gern den Eindruck einer barschen Zuchtmeisterin aufrechterhalten wollte, hatte Lulu sie längst durchschaut. Trotzdem, wenn Clarice wirklich gereizt war, konnte sie mit ihrem zornigen Blick einen wilden Bullen in fünfzig Meter Entfernung zur Räson bringen – heute jedoch strahlten die blauen Augen humorvoll.
Clarice war um die siebzig – ihr wahres Alter war ein gut gehütetes Geheimnis, und Lulu hatte es nie zu brechen versucht –, doch sie hatte die Haltung, Vitalität und geistige Schärfe einer viel jüngeren Frau. Ihre kurzen silbergrauen Haare waren frisch onduliert, Perlen waren in ihren Ohren und an einer Kette, die in mehreren Schlaufen bis zu ihrer Taille reichte. Ringe glitzerten an ihren Fingern, Armbänder klimperten an ihren schlanken Handgelenken. Clarice war die Witwe eines längst verstorbenen Diplomaten, und an den strengen Verhaltens- und Erscheinungskodex, den er erzwungen hatte, hielt man sich noch immer. Solange sie atmete, würde Clarice keine Nachlässigkeiten dulden.
»Es ist unhöflich, so zu starren, Lorelei.«
»Ich dachte nur gerade, wie schön du heute Nachmittag aussiehst«, erwiderte sie wahrheitsgemäß. »Das weiche Grau steht dir wirklich gut.«
Clarice strich das niedrig taillierte Kleid über den Knien glatt, ihre geröteten Wangen zeigten die Freude über das Lob. »Danke, Liebes. Ich wünschte, ich könnte das Kompliment erwidern, aber in dem Aufzug siehst du aus wie ein Schmuddelkind.«
Lulu betrachtete die dreckige Reithose, den von Motten zerfressenen Pullover und die abgetragene Tweedjacke. »Den Pferden macht das nichts, und außerdem sind die Sachen sehr bequem.« Sie schnippte sich die Locken aus dem Gesicht und griff nach einem weiteren Teekuchen.
»Ich beneide dich so um deinen jugendlichen Appetit«, seufzte Clarice, »und trotzdem nimmst du kein Gramm zu. Äße ich nur die Hälfte von deinen Portionen, wäre ich groß wie ein Haus.«
Lulu verbarg ein Lächeln. Clarice war schlank wie eine Weide, und das schon immer, wenn man nach den alten Fotografien ging, obwohl sie einen gesunden Appetit hatte.
»Allerdings ist es gut«, fügte Clarice hinzu, »dich wieder essen zu sehen. Das zeigt, dass du gesund bist – aber ich mache mir Sorgen, dass du dir womöglich zu viel zumutest.«
»Ich kann nicht mein Leben lang herumsitzen und mich bemitleiden«, erwiderte Lulu mit vollem Mund. »Bewegung und frische Luft tun mir unendlich gut.«
»Das ist alles schön und gut, aber du weißt, was der Arzt gesagt hat. Dein Herz ist nicht stark, und es ist nicht gut, es zu überanstrengen.«
»Ich weiß, wann ich zu viel getan habe«, beruhigte Lulu sie, »und obwohl ich leicht ermüde, habe ich gelernt, damit umzugehen.«
Clarice beäugte sie über den Rand ihrer Teetasse und wechselte das Thema. »Hast du Maurice’ Brief gefunden?«
Lulu nickte, doch in Gedanken war sie wieder bei dem anderen Brief, der am Morgen eingetroffen war. Da er aus Tasmanien kam und der Inhalt wenig Sinn ergab, hatte es keinen Zweck, ihn mit Clarice zu besprechen – die ihr ziemlich deutlich zu verstehen gegeben hatte, dass sie nicht über Australien oder irgendetwas in dem Zusammenhang sprechen wollte.
»Maurice muss sehr einsam sein, dass er dir jeden Tag schreibt. Was mag er nur mitzuteilen haben?«
Lulu kehrte mit den Gedanken wieder in die Gegenwart zurück, während sie den duftenden Tee schlürfte. Sie wollte eigentlich nicht über Maurice sprechen und sich an diesem Tag die Laune verderben, doch Clarice wartete auf eine Antwort. »Er hält mich über sein neuestes Gemälde auf dem Laufenden, über die Menschen, die er in der Galerie kennenlernt, und über seine Gesundheit im Allgemeinen.« Sie erwähnte nicht die seitenlangen Innenansichten, auf denen er sich über seine Ängste ausließ und seine Unfähigkeit, sich mit irgendetwas allzu lange zu beschäftigen – es war niederschmetternd.
»Mir ist bewusst, dass es ihm in Frankreich schlecht ergangen ist, aber das ist keine Entschuldigung für Müßiggang. Höchste Zeit, dass er sich zusammenreißt.«
Diese Unterhaltung hatten sie schon oft geführt, und Lulu nahm ihre gewohnte Verteidigungshaltung ein. »Maurice gibt sich die größte Mühe«, murmelte sie, »aber es ist schwer, Arbeit zu finden, wenn man mit Menschenmengen und Lärm nicht zurechtkommt.«
Plötzlich hatte sie das Bild vor Augen, wie Maurice während eines heftigen Gewitters in einer Ecke kauerte und bei jedem Blitz vor Angst wimmerte, der das Haus in London erhellte, in dem sie zusammen wohnten. Damals hatte sie begriffen, dass die Schlachtfelder ihn noch immer verfolgten, und als das schreckliche Gewitter niederging, hatte sie ihn mit zu sich ins Bett genommen. Sie hatten hektisch miteinander geschlafen und sich wie verzweifelt aneinandergeklammert, als könnte die Wärme und die Berührung eines anderen Körpers beruhigen und heilen – die Erinnerungen auslöschen. Aber natürlich war es nur eine flüchtige Erleichterung gewesen, denn die Erinnerungen waren noch frisch.
»Ich hoffe doch, dass du dich nicht zu sehr darauf eingelassen hast. Offensichtlich verlässt er sich auf dich, und obwohl eure Kunst euch verbindet, spricht doch ansonsten nicht sehr viel für ihn.«
Unter Clarice’ durchdringendem Blick wurde Lulu rot. Zweifellos hegte Clarice den Verdacht, dass sie mit Maurice intim war, aber sie hätte sich keine Sorgen machen müssen. Es war nur eine kurze Affäre gewesen – ein Fehler, den sie beide bald selbst eingesehen hatten. »Wir sind uns einig, dass wir Freunde sind, mehr nicht«, erwiderte sie. »Seit Jimmy hat es niemand Besonderen mehr in meinem Leben gegeben.«
Es wurde still, bis auf das Zischen der Flammen an den feuchten Holzscheiten. Lulus Blick heftete sich auf das Foto, das auf dem Flügel stand. In seiner Uniform sah Jimmy gut aus – und unerträglich jung, mit breitem Lächeln und ehrlichen braunen Augen. Sie hatten sich seit Jahren gekannt und wollten heiraten, als der Krieg erklärt und Jimmy eingezogen wurde. Wenige Wochen nach der Landung in Frankreich war er gefallen.
Lulu wollte sich nicht der Trauer überlassen, belud den Teewagen und ging zur Tür. »Ich muss ein ausgiebiges Bad nehmen, bevor ich nach der Skulptur sehe.«
»Vergiss nicht, dass wir heute Abend beim Brigadier zu Cocktails und Dinner eingeladen sind, um über das Osterfest zu sprechen. Wenn du nicht mitkommst, wirst du dich mit kaltem Aufschnitt und Suppe zufriedengeben müssen. Vera hat heute ihren freien Abend.«
Der Brigadier war ein schroffer, rotgesichtiger Kerl, der jahrelang erfolglos um Clarice geworben hatte. Lulu hatte längst beschlossen, dass es bessere Möglichkeiten gab, einen Abend zu verbringen, und lehnte die Einladung ab.
Nachdem sie das Teegeschirr gespült und zum Trocknen auf den Abtropfständer gestellt hatte, fütterte sie den Hund und ging anschließend langsam die Treppe hinauf. Nach einem Bad kuschelte sie sich in ihren flauschigen Morgenmantel und setzte sich an ihren Frisiertisch, an dem sie die spärliche Wärme vom Feuer mitbekam, das gegen die Zugluft vom undichten Fenster ankämpfte.
Der rätselhafte Brief lag neben ihrer Haarbürste, und obwohl sie ihn am Morgen mehrfach gelesen hatte und beinahe auswendig kannte, faszinierte und beunruhigte er sie gleichermaßen. Sie zog den Bogen aus dem Umschlag und strich ihn glatt. Die Handschrift war kühn und maskulin – der Inhalt vollkommen verwirrend.
Verehrte Miss Pearson,
da ich Ihr Fohlen, The Ocean Child, jetzt seit über einem Jahr ausbilde und nichts von Ihnen gehört habe, dachte ich, Sie sollten über seine Fortschritte in Kenntnis gesetzt werden. Falls Ihr Agent, Mr. Carmichael, das bereits erledigt haben sollte, bitte ich um Entschuldigung, Kontakt mit Ihnen aufgenommen zu haben.
Child erweist sich als ein außergewöhnlich guter Zweijähriger und hat die meisten Probeläufe gewonnen– das sind Rennen, bei denen junge Pferde auf unterschiedlich langen Strecken geprüft werden, wobei weder Wetten noch Hindernisse einbezogen sind. Obwohl er noch bei längeren Rennen geprüft werden muss, habe ich große Hoffnung, dass er sich als Steher hervortun wird. Er hat ein gutes Temperament, besonders unter Bob Fuller, dem jungen Jockey, den ich für ihn eingestellt habe.
Child ist noch zu jung, um an wichtigeren Rennen teilzunehmen, aber er entwickelt sich gut, und ich habe ihn hart rangenommen mit Ruhezeiten dazwischen. In etwa sechs Monaten habe ich vor, ihn bei einigen kleineren Hindernisrennen laufen zu lassen, um zu sehen, wie er sich macht.
Ich hoffe, es macht Ihnen nichts aus, dass ich Ihnen schreibe, aber da ich nichts von Ihnen gehört habe, halte ich es für meine Pflicht als Trainer, Sie zu informieren.
Hochachtungsvoll.
Joe Reilly
Lulu zog die Stirn kraus. »Ich weiß nicht, für wen Sie mich halten, Mr. Reilly«, flüsterte sie, »aber offensichtlich verwechseln Sie mich mit jemandem.«
Mit einem schiefen Lächeln steckte sie den Brief wieder in den Umschlag. Näher als mit der Skulptur, die im Studio auf sie wartete, würde sie wohl nie an den Besitz eines Pferdes herankommen. Was für ein ungewöhnlicher Fehler für einen Mann, der sich offenbar in seinem Geschäft auskannte. Es hätte ihm doch eigentlich klar sein müssen, dass sie unmöglich die Eigentümerin sein konnte. Schließlich lebte sie am anderen Ende der Welt – warum um Gottes willen sollte sie so weit entfernt ein Pferd ausbilden lassen?
»Lächerlich«, zischte sie, zog den Gürtel an ihrem Morgenmantel fest und griff nach ihrer Schreibmappe. Ihre Antwort war höflich, aber knapp, und als sie den Brief versiegelt hatte, zog sie sich an und ging ins Dorf zum Postamt.
Er hatte ein Begrüßungsbier im Dorfpub getrunken und genoss eine abendliche Pfeife, als er sie die Straße entlanggehen sah. Er folgte ihr bis an den kleinen Laden, in dem es anscheinend alles gab, blieb an der offenen Tür stehen und lauschte ihrer Unterhaltung mit der dicken, geschwätzigen Frau hinter der Theke.
Als er genug gehört hatte, begab er sich zufrieden zum Bahnhof und nahm den letzten Zug nach Hause. Offensichtlich war der Brief aus Australien angekommen. Jetzt musste er nur noch seinen Arbeitgeber unterrichten und auf weitere Anweisungen warten.
Auf ihrem Rückweg zum Haus fragte sich Lulu, wie Mr. Reilly wohl auf ihren Brief reagieren würde. Peinlich berührt wahrscheinlich, vermutete sie.
Sie ging seitlich am Haus vorbei und folgte dem Pfad zum halbrunden Gartenhaus, das sie zu einem Atelier für sich umgewandelt hatte. Es schmiegte sich an die hohe Grenzmauer aus Backsteinen, seine hohen Fenster schauten über den Rasen und schufen selbst an kältesten Tagen einen sonnigen Platz. Lulu hatte sich an jenem Tag darin verliebt, als Clarice sie zum ersten Mal nach Sussex gebracht hatte. Damals war sie zehn gewesen und noch immer bemüht, mit den plötzlichen Veränderungen in ihrem Leben zurechtzukommen, und das Gartenhaus war zu ihrem Refugium geworden.
Großtante Clarice hatte Verständnis für ihr Bedürfnis nach Abgeschiedenheit, wenn sie Skizzen entwarf, malte oder Tonfiguren modellierte, und jene ersten Jahre hätte so mancher gewiss als eine einsame Zeit bezeichnet. Dennoch war Lulu in ihr langsam und allmählich erwacht und hatte erkannt, dass sie nun zu träumen wagen konnte und unter Clarice’ liebevollen, wachsamen Augen frei war, aufzublühen. Das war das größte Geschenk, das jemand gewähren konnte, und deshalb verehrte sie Clarice.
Sie ging hinein, zündete die Gaslampen an, steckte das Kinn vor der Kälte in ihren Mantelkragen und begann, die feuchten Tücher abzuschälen, die den Ton geschmeidig hielten, denn sie wollte die einen Meter hohe Skulptur in Augenschein nehmen. Sie musste über die Ironie lächeln, da ihr neuestes Kunstwerk ein Fohlen war. Das langbeinige, nicht zugerittene Geschöpf mit gestutztem Schwanz und kurzer Mähne schien die Armierungen, die es auf der hölzernen Drehscheibe festhielten, abwerfen zu wollen. Sie betrachtete die Linien und Kurven, die Andeutung von Muskeln und Kraft, die sie hatte einfangen können, und den Eindruck von verhaltener Energie und Bewegung, der sie so viel Mühe gekostet hatte. Es war ein gutes Kunstwerk, vielleicht das beste, das sie je geschaffen hatte.
Sie sah sich das Fohlen an, in Gedanken wieder bei dem merkwürdigen Brief. Womöglich war er ein Omen – ein Zeichen, dass er irgendwie mit dem Hengstfohlen in Tasmanien verbunden war. Die Vorstellung war natürlich lächerlich, und Clarice würde darüber spotten – trotzdem wurde ihr klar, wie verheißungsvoll dieser Augenblick war. Das Kunstwerk brauchte noch einen Namen, und da Joe Reilly seinen Brief an die falsche Adresse geschickt hatte, wusste sie jetzt, wie es heißen sollte.
Ihre Phantasie wurde beflügelt, während sie hastig nach einem Tonklumpen griff, um ihn weich zu kneten und zu formen. Vielleicht war es schwer, aber es war eine Chance, ihr Können auszuweiten und Spaß an der Herausforderung zu haben. Das echte Fohlen Ocean Child würde auf den Rennbahnen Tasmaniens laufen, alt werden und seine Tage auf Weiden beenden, doch ihr Ocean Child würde ewig jung bleiben und in den seichten Wellen einer bronzefarbenen Küste tänzeln.
Rennstall Galway House, Tasmanien, April 1920
Joe Reilly war mit dem Ausmisten fertig, der Hof war gefegt und abgespritzt, und Bob Fuller, der Jackaroo, wie die Zureiter genannt wurden, war gerade fort, um Ocean Child auf der Galoppbahn zu trainieren. Es war noch früh, doch die Eisvögel lachten bereits auf den Bäumen in der Nähe, und er vernahm den beklemmenden Ton eines Glockenvogels.
Er steckte die Hände tief in die Hosentaschen und betrachtete stolz den Hof. Als Joe damals aus Europa zurückgekehrt war, hatte es hier noch ganz anders ausgesehen, und obwohl er viel Zeit, Energie und die meisten seiner Ersparnisse darauf hatte verwenden müssen, hatte es sich gelohnt.
Die Stallungen waren zerfallen und von Ratten verseucht gewesen, doch jetzt waren sie stabil und erhoben sich zu beiden Seiten des gepflasterten Hofs, ihre neu gedeckten Dächer und die frische Farbe leuchteten in der Herbstsonne. Die Reparaturen an der Scheune, an der Sattelkammer und am Futterlager waren beinahe fertig, die Zäune ersetzt und die Weiden von schädlichem Unkraut befreit.
Galway House hatte früher einmal mehr als dreißig Pferde beherbergt, Stallburschen und Zureiter hatten sich um sie gekümmert. Doch das war in der guten alten Zeit gewesen – bevor ihnen Krieg und Pferdegrippe dazwischengekommen waren. Er war jedoch optimistisch, denn in letzter Zeit hatte der Hof bereits fünf Neuzugänge zu verzeichnen, zwei weitere Nachfragen standen an, und er hatte zwei Gehilfen einstellen müssen. Die Börsen waren noch nervös, doch die Welt schüttelte allmählich die Finsternis der vergangenen Jahre ab, und mit Beginn des neuen Jahrzehnts lag eine gewisse Erregung in der Luft, widergespiegelt in der Jazzmusik, die so populär wurde, und darin, dass die Menschen bereit waren, ihr Geld wieder für Vergnügungen auszugeben.
Sein Blick schweifte über den Hof hinaus zu den Hügeln ringsum, über deren Kämme sich die Galoppstrecken vier Meilen lang hinzogen. Er hatte gehört, dass Tasmanien mit England verglichen wurde, und jetzt war ihm der Grund dafür klar, denn diese Ecke der Insel war so grün und üppig wie das ländliche Sussex, wo das Militärhospital gestanden hatte, in dem er zur Genesung gewesen war.
Das zweistöckige, quadratische Gehöft stand zwischen den Bäumen und blickte über die kurze Auffahrt und das Doppeltor. Die Rückseite ging auf den schnell dahinschießenden, von Bäumen gesäumten Fluss im Tal. Auf der Veranda, die um das ganze Haus führte, standen die üblichen Stühle, Tische und die Blumenkübel seiner Mutter. Fensterläden und Fliegengitter waren ausgebessert, der Rasen war gemäht, die Bäume standen in vollem Laub. Es war das Zuhause, von dem er einst geglaubt hatte, dass er es nie wiedersehen würde. Dankbarkeit und Liebe zu dem alten Wohnsitz wallten in ihm auf.
Die Reillys hatten vier Generationen lang in Galway House gelebt, und ihr Name hatte stets für gut ausgebildete und erfolgreiche Rennpferde gestanden. Bereitwillig war Joe in die Fußstapfen seines Vaters getreten und hatte sich darauf gefreut, seine Kinderliebe Penny zu heiraten und alles zu übernehmen, wenn sein Vater in den Ruhestand ging. Dann kam der Krieg. Sein Vater war gestorben, kurz nachdem Joes Schiff abgelegt hatte, und während ihn unwillkürlich Erinnerungen an Gallipoli und Fromelles überkamen, fuhren seine Finger automatisch über die Narben, die über seinem linken Auge einen Wulst bildeten und seine Wange wie ein Spinnennetz überzogen.
Penny hatte ihm in ihren Briefen versprochen, sie würde ihn lieben, ganz gleich, wie schwer seine Verwundungen seien – sie würden heiraten und wie geplant den Hof übernehmen –, doch als er nach Hause zurückkehrte, hatte er gemerkt, wie sie vor seinen Küssen zurückwich, wie sie vermied, ihn anzusehen. Sie hatte sich die größte Mühe gegeben, ihren Widerwillen zu verbergen, doch das Mädchen, das er seit seiner Kindheit liebte, konnte die Veränderungen an ihm nicht hinnehmen. Und da er wusste, dass sie zu gutmütig war, um es von sich aus zu tun, hatte er ihre Verlobung gelöst. Die Erleichterung in ihren Augen hatte ihm das Herz zerrissen, die Narben waren eine stumme Erinnerung – falls er sie jemals brauchte –, dass der Krieg alles verändert hatte.
Er schüttelte die finsteren Gedanken ab, pfiff die beiden Hunde zu sich, kurbelte den Tieflader an und machte sich auf den Weg zu den Galoppstrecken. Er gehörte zu den Glücklichen, die es nach Hause geschafft hatten. Mit seinen dreißig Jahren war er gesund und gut in Form, und mit seinem Geschäft ging es beständig aufwärts. Er liebte sein Zuhause und seine Arbeit, hatte dankbar die Abgeschiedenheit und den Frieden angenommen, die sie ihm schenkten, und war zufrieden.
Bob Fuller ließ Child im Schritt gehen, damit sich das Hengstfohlen ausruhen konnte, doch selbst aus der Entfernung erkannte Joe die Erregung des flachsblonden Jungen. Kaum war er aus seinem Laster gestiegen, als Bob ihn ansprach.
»Es ist ein Prachtexemplar, Joe. Hat nicht mit der Wimper gezuckt, als ich ihn noch mehr gefordert habe.«
»Ich hoffe, du hast ihn nicht überstrapaziert.«
»Schon gut, Joe. Sieh ihn doch nur an! Er schnauft nicht mal.«
Die Begeisterung des Jungen war ansteckend, und Joe erwiderte sein Grinsen, als er das Fohlen betrachtete und ihm klar wurde, dass es noch jede Menge Reserven hatte. Ocean Child war ein Brauner mit heller Mähne und Schweif und einer weißen rautenförmigen Blesse auf der Stirn. Obwohl er noch jung und langbeinig war, strahlte er dennoch ein Selbstvertrauen aus, das nur Gutes versprach, denn er hatte im vergangenen Jahr bewiesen, dass er sich von Lärm und einer fremden Umgebung nicht abschrecken ließ.
Er fuhr mit der Hand über die wohlgeformte Kruppe und an den kräftigen Beinen hinunter. Dort waren gute Muskeln und Knochen zu spüren, die Fesseln hatten genau die richtige Länge. Die Brust war perfekt proportioniert und würde sich noch weiten und muskulöser werden, wenn er heranreifte, die Augen blickten intelligent.
»Du bist eine Schönheit, das steht fest«, murmelte er, während er den Hals streichelte und in die goldenen Augen schaute. »Lass ihn noch einmal kurz rennen, damit ich sehen kann, wie er sich bewegt, und dann sattle ihn ab. Er hat genug für heute.«
Er lehnte sich an den Zaun, den Hut in der Hand, das dunkle Haar von der Brise zerzaust, und sah zu, wie Pferd und Reiter über den Feldweg galoppierten. Child bewegte sich geschmeidig und schien begierig nach noch mehr Auslauf, doch unfertige Muskeln und Knochen im Wachstum brauchten Zeit und Geduld, ihr volles Potential auszubauen, und er hatte die tragischen Folgen gesehen, wenn andere Trainer ihre Tiere zu hart antrieben.
Begeistert sah er zu, wie Bob das Pferd wendete und auf ihn zugaloppierte. Der Hals des Tieres war gestreckt, die Ohren aufgestellt, jedes Bein setzte sicher auf, während er die Brust weitete und über den Weg rannte. Joes Puls schlug schneller. Ocean Child war ein verdammt gutes Pferd, und wenn es am Ende sein Versprechen erfüllen würde, dann hätte Galway House vielleicht einen wahrhaften Gewinner.
Der Morgen verging schnell, während ein jeder seiner üblichen Arbeit nachging, und Joe wollte sich schon den Geschäftsbüchern widmen, als er unterbrochen wurde. Seine Mutter trat ein. »Unsere Besucher sind da«, sagte sie außer Atem. »Ich wette, du hattest vergessen, dass sie kommen.«
Das hatte Joe tatsächlich, doch sobald er bei den Pferden war, vergaß er fast alles andere. »Entschuldige«, murmelte er und klappte widerstrebend das Hauptbuch zu. Lächelnd fuhr er sich mit den Fingern durch die Haare. »Ich nehme an, du kannst dich nicht um sie kümmern, Ma? Ich habe heute Morgen viel zu tun.«
Molly Reilly war klein und rundlich, stets emsig und trug einen Wust aus ziemlich wirren, ergrauenden Haaren spazieren. Nach dem Tod seines Vaters hatte sie sich bemüht, den Hof am Laufen zu halten, doch trotz ihrer Entschlossenheit und Energie war es ihr unmöglich gewesen. Er wusste, dass ihre Erleichterung über sein Überleben durch die Tatsache getrübt wurde, dass er den Umgang mit anderen Menschen nun extrem belastend fand.
»Du kannst dich nicht ewig hier drinnen verstecken«, sagte sie mit einer Heftigkeit, die im Widerspruch zu der Besorgnis in ihren Augen stand. »Hier geht es ums Geschäft.«
Er bemerkte ihr energisch vorgeschobenes Kinn und wusste, es hatte keinen Sinn, mit ihr zu streiten. Hoch über ihr aufragend nahm er seinen zerbeulten Hut vom Nagel an der Wand, setzte ihn mit einem Ruck auf und zog die Krempe tief herunter, damit sie die versehrte Seite seines Gesichts überschattete.
»Wie sind sie?«, murmelte er, während er neben ihr herschlenderte.
»Reich.«
»Das ist schon mal ein guter Anfang.« Ein Lächeln umspielte seine Lippen. Seine Mutter hatte ihre eigene, liebenswerte Art, auf den Punkt zu kommen. »Sonst noch was?«
»Sie haben zwei Pferde auf Len Simpsons Hof in Melbourne, aber sie haben sich mit ihm verkracht und wollen sie woanders unterstellen.«
»Klingt, als könnten sie uns Ärger bereiten. Len ist eigentlich ein guter Kerl.«
»Genau meine Meinung, aber wir können es uns nicht leisten, wählerisch zu sein.«
Joe kannte sie zur Genüge, die Geschichten von schwierigen Besitzern und ihre hohen, manchmal nicht zu erfüllenden Erwartungen an ihre Pferde. Anscheinend waren sie desto unangenehmer, je mehr Geld sie hatten. Er zupfte an seiner Hutkrempe und wappnete sich für die Begegnung. Seine Mutter hatte recht, sie brauchten das Geld.
Der protzige schwarze Wagen stand in der Auffahrt, die verchromten Scheinwerfer und das Trittbrett funkelten in der Sonne. Joe betrachtete die beiden Menschen, die auf der Veranda warteten. Der Mann war in Tweed gekleidet und hatte eine Zigarre zwischen den Zähnen. Die junge Frau hatte sich gegen den kühlen Wind in Pelz gehüllt, und Joe fiel nur das Wort »glanzvoll« ein, um sie zu beschreiben.
»Alan Frobisher«, sagte der Mann und schüttelte ihm die Hand, »und das ist meine Tochter Eliza.«
Joe warf einen kurzen Blick auf die junge Frau, die ihn mit unverhohlener Neugier betrachtete. Er schlug die Augen nieder, als er kurz die kühle, schlanke Hand schüttelte, trat dann zurück und zerrte hastig an seinem Hut. Er war sich ihrer fortwährenden Neugier bewusst, während sie zu den Stallungen zurückgingen, und so verunsichert, dass er verstummte. Seine Mutter hatte derlei Probleme nicht und zwitscherte auf ihrem Weg über den Hof wie ein Spatz.
Sie hatten alles inspiziert und standen jetzt am Weidezaun. Joe entspannte sich allmählich, als die Frau zum Haus ging und er mit Alan Frobisher allein war. »Wie haben Sie in Queensland von uns gehört, Alan? Sie sind einen weiten Weg gefahren.«
»Von einem Agenten für reinrassige Zuchtpferde namens Carmichael«, erwiderte er. »Soweit ich weiß, hat er Sie schon einmal empfohlen.«
Joes Interesse war geweckt. »Er hat mir Ocean Child geschickt, aber wir haben uns nie persönlich kennengelernt, nur korrespondiert. Wie ist er?«
Alan zuckte mit den Schultern. »Hab mit ihm nur über Fernsprecher geredet, aber die Victorian Breeders Association empfiehlt ihn.«
Joe nickte. Anscheinend erledigte der schwer erreichbare Carmichael seine Geschäfte auf Abstand, denn niemand, der mit ihm zusammenarbeitete, hatte ihn bisher persönlich getroffen. »Darf ich fragen, warum Sie Ihre Pferde woanders unterstellen wollen?«
Der Mann schaute zur Seite. »Es gab eine Meinungsverschiedenheit«, murmelte er. »Es wurde unangenehm.«
Joe wartete, dass er fortfuhr, doch allem Anschein nach war Frobisher der Ansicht, genug gesagt zu haben. Was immer unangenehm geworden war, würde zwischen ihm und seinem früheren Trainer bleiben – dennoch war Len Simpson in Rennkreisen für seine Umgänglichkeit bekannt, und Joe konnte sich nicht vorstellen, was schiefgelaufen war. »Len genießt einen guten Ruf«, sagte er, »wenn er die Tiere also weiter behalten würde, wäre ich froh. Aber ich muss Kontakt mit ihm aufnehmen, um sicherzustellen, dass er nichts dagegen hat.«
»Das geht in Ordnung, aber er wird nichts dagegen haben. Spricht sehr gut über Sie, weshalb ich Carmichaels Rat befolgt habe.« Alan löste sich vom Anblick der grasenden Pferde und lächelte. »Ich glaube, ich hab genug gesehen, Joe. Kommen wir zum Geschäftlichen.« Er setzte eine fragende Miene auf, als sein Blick sich auf Joes Gesicht richtete. »Frankreich, vermute ich?«
Joe nickte.
»Wenigstens sind Sie nach Hause gekommen«, murmelte der ältere Mann. »Sehr vielen war es nicht vergönnt.« Sie machten sich auf den Weg zum Haus. »Machen Sie sich nichts aus Eliza, Kumpel, sie ist noch jung, und ohne die führende Hand einer Mutter ist es um ihr Taktgefühl noch nicht zum Besten bestellt.« Er warf Joe einen kurzen Blick zu. »Ich hab bemerkt, wie sie Sie angestarrt hat, und möchte mich dafür entschuldigen.«
»Ich bin daran gewöhnt«, log Joe höflich.
»Wenn Eliza Sie erst einmal kennengelernt hat, wird sie die Narben vergessen, Sie werden schon sehen. Sie ist manchmal ein bisschen eigensinnig – das kommt davon, dass sie ihre Mutter verloren hat, als sie noch klein war, aber ich vermute, sie ist eine geborene Reiterin, und sobald sie sich mit ihren Tieren beschäftigt, ist sie wie ausgewechselt.«
Joe überkam eine böse Vorahnung, und er blieb stehen. Vielleicht hatten die Meinungsverschiedenheiten und Unannehmlichkeiten ja an Eliza gelegen, die sich beständig eingemischt hatte – und wenn das der Fall war, konnte er keine Geschäfte mit Alan machen, ganz gleich, wie sehr er dessen Geld brauchte. »Ich leite hier einen straff geführten Hof«, warnte er. »Die Besitzer dürfen jederzeit gern zu Besuch kommen, solange wir uns nicht auf ein Rennen vorbereiten, aber ich sehe es nicht gern, wenn sie sich ständig bei den Pferden aufhalten oder an ihnen herumfummeln. Das bringt den ganzen Ablauf in den Stallungen durcheinander.«
»Ganz recht, Kumpel. Wenn Sie das Gefühl haben, dass wir länger bleiben, als wir willkommen sind, sagen Sie es uns ruhig. Sie tragen die Verantwortung.«
»Wenn das klar ist?« Er hielt dem Blick des anderen Mannes stand.
Alans Miene war ernst. »Sie haben mein Wort, und ich werde dafür sorgen, dass auch Eliza auf Abstand bleibt.«
»Ich dachte, Sie wohnen in Queensland?«
»Vorläufig, ja, aber ich trage mich mit dem Gedanken, ein Haus in Deloraine zu kaufen.« Joes alarmierter Ausdruck angesichts dieser Neuigkeiten war ihm wohl nicht entgangen, denn er lachte leise und setzte hinzu: »Keine Bange, Kumpel. Wir kommen Ihnen nicht in die Quere. Verschaffen Sie uns hin und wieder nur einen ersten Platz, dann sind wir zufrieden.«
Joe war noch immer nicht überzeugt von den Verträgen, die er gerade unterzeichnet hatte, als er auf der Veranda stand und zusah, wie die Frobishers in einer Staubwolke davonfuhren. »Len hat nicht viel rausgelassen, als ich vorhin mit ihm sprach, aber er hat mir versichert, dass die Pferde vielversprechend sind und Alan seine Rechnungen umgehend bezahlt.« Er kaute auf seiner Lippe. »Alan scheint ja ganz nett zu sein, doch das Mädchen könnte den Erfolg gefährden, wenn sie hierher ziehen.«
»Sie ist nur jung und sehr von sich eingenommen. Ich werde nicht zulassen, dass sie dir Kummer bereitet.« Molly wedelte mit dem Scheck unter seiner Nase herum. »Die zahlen gutes Geld, Joe, und Eliza erwähnte, dass sie dich vielleicht ihren Freunden empfehlen. Mir ist klar, dass du sie ein bisschen einschüchternd findest, aber wenn du dir stets klarmachst, dass du hier die Verantwortung trägst, wird es schon werden. Wer weiß, in einem Jahr könnten wir einen vollen Hof haben.«
Joe wollte ihren Enthusiasmus nicht dämpfen, daher behielt er seine Meinung für sich. »Ist die Post schon da? Ich warte auf die Zahlungsanweisung aus Hobart.«
Molly griff in ihre Jackentasche. »Entschuldige, das hab ich in der Aufregung ganz vergessen. Nichts aus Hobart, aber eine Antwort aus England.«
Er riss den Brief auf und überflog die Seite. Es dauerte nicht lange, aber der Inhalt ließ ihn erbleichen. Er musste sich setzen.
»Was ist denn?«
»Ärger«, sagte er kurz angebunden. »Ich wusste, dass ich diesem Carmichael nicht hätte trauen sollen.«
»Aber das ergibt keinen Sinn«, flüsterte Molly, nachdem auch sie das Schreiben gelesen hatte und auf den Stuhl neben ihm sank.
»Schlimmer noch, wir haben ein Pferd ohne Besitzer. Einen vielversprechenden Zweijährigen, den ich nicht ins Rennen schicken und nicht weiterverkaufen kann, bevor das nicht geklärt ist. Was zum Teufel soll ich denn jetzt machen?«
»Wenigstens sind die Gebühren für die nächsten zwei Jahre im Voraus bezahlt, sodass wir nicht drauflegen müssen«, fuhr Molly ihn an. Sie schob den Brief wieder in den Umschlag. »Treib Carmichael auf und verlange eine Erklärung, dann schick ihr die Papiere und fordere sie in einem ernsten Anschreiben auf, ihre Spielchen einzustellen.«
Joe nahm den Brief wieder an sich, der Gefahr lief, zerfetzt zu werden, und steckte ihn in die Tasche. Mit finsterer Miene starrte er in die Ferne. »Das mache ich, aber Carmichael scheint mir ein harter Brocken zu sein. Das alles ist verdächtig, Ma, und ich will herausfinden, was zum Teufel da los ist. Niemand hält mich ungestraft zum Narren.«
2
Die Männer aus der Gießerei fuhren fort, und in der Stille, die nach ihrem Aufbruch eintrat, bewunderte Lulu die Bronzestatue. Ocean Child stand auf einem schwarzen Marmorsockel, den Kopf erhoben, als würde er das Meer zu seinen Füßen riechen, mit kurzem Schweif und vom Salzwind zerzauster Mähne. Er war alles, was sie sich erhofft hatte, und obwohl sie wusste, dass es ihre beste Arbeit war, fragte sie sich ängstlich, ob sie Maurice und Clarice gefallen würde.
»Sie ist sehr schön«, sagte Maurice, »aber ich denke mit Schrecken daran, was es dich gekostet hat, sie in Bronze gießen zu lassen.«
»Bertie hat dafür gezahlt«, erklärte sie. »Er wird das Geld zurückbekommen, wenn er sie verkauft.«
Maurice verzog verächtlich das hagere Gesicht. »Agenten sind Blutsauger. Denken immer zuerst an sich, kein Wunder, dass wir Künstler so arm sind.«
»Das ist ungerecht«, schimpfte sie. »Bertie ist ein Wohltäter, kein Agent. Er verlangt keine Provision, wie du sehr wohl weißt, und ich hab das Glück, dass er es für angebracht hält, meine Arbeit zu unterstützen.«
Maurice schnaubte und zog den Schal fester um seinen Hals. Immerhin war schon April, doch im Gartenhaus war es kalt, und sein Mantel war dafür einfach zu dünn. Er zog die knochigen Schultern hoch und steckte die großen Hände tief in die Taschen. Seine dunklen Augen betrachteten die Skulptur mit unverhohlener Bewunderung. »Ohne Zweifel hat er bereits einen Käufer ausfindig gemacht«, murmelte er. »Du warst schon immer sein Liebling.«
Lulu war empört. Es war immer die gleiche Meckerei, und sie konnte es nicht mehr hören. Bertie Hathaway war zugegebenermaßen ziemlich einschüchternd, denn er war ein sehr reicher Mann, der es gewohnt war, seinen Willen durchzusetzen. Maurice’ Beziehung zu ihm war, gelinde gesagt, heikel, und sie hatte Maurice in Verdacht, dass er sie um Berties Unterstützung beneidete. Hinzu kam auch, dass Bertie bisher kein sonderliches Interesse an Maurice’ Werk bekundet hatte. »Er hat dir Platz in der Ausstellung im Juni eingeräumt«, rief sie ihm ins Gedächtnis.
Er seufzte tief und verbarg seine lange Nase im Schal. »Das hätte er nicht, wenn du ihn nicht dazu überredet hättest.«
Am liebsten hätte sie ihm gesagt, er solle sich nicht wie ein bockiges Kind benehmen, wusste aber aus Erfahrung, dass ihm jede Art von Kritik tagelange Depressionen einbringen würde. »Das Angebot, deine Gemälde in London auszustellen, steht, wenn du willst«, sagte sie stattdessen. »Es könnte ein hervorragender Einstand sein.«
»Ich weiß nicht, ob ich bereit bin, auszustellen. Der ganze Lärm und das Getue, du weißt, wie mich das beeinträchtigt.«
Sie betrachtete seine Trauermiene und fasste sich in Geduld. Sie hatte Maurice in der Kunstakademie kennengelernt und sich sogleich mit ihm angefreundet, und nach dem Abschluss war es für ihn anscheinend nur logisch gewesen, in die Wohnung im ersten Stock von Clarice’ Haus in London einzuziehen und das Studio in der Mansarde mit Lulu zu teilen. Doch der Maurice, der vor ihr stand, war durch die als Kriegskünstler erlittenen Qualen psychisch zerstört, und von dem geselligen Mann von früher war nicht mehr viel übrig. »Geh doch rein und wärm dich auf«, sagte sie leise.
»Kommst du mit?« Seine dunklen Augen flehten sie förmlich an.
Sie schüttelte den Kopf. »Ich warte auf Clarice, aber die müsste gleich hier sein.« Sie sah ihm nach, wie er zum Haus ging, und ihr fiel auf, wie mager er in den letzten Monaten geworden war. Sein Gang war der eines viel älteren Mannes. Er wollte so viel von ihr, und ihr weiches Herz wurde erfüllt von dem Mitleid, das er verachten würde – doch selbst das nutzte sich durch seine ständige Bedürftigkeit allmählich ab.
»Gut, dass du allein bist.« Clarice trat ins Atelier und machte die Tür fest hinter sich zu. Sie zog den Pelzmantel etwas enger um ihre schlanke Gestalt und schauderte. »Maurice bedrückt mich, wenn er seine schlechten Launen hat.«
Eine Antwort erübrigte sich, daher zeigte Lulu auf die Skulptur. »Was meinst du?«
Clarice betrachtete sie schweigend aus jedem Blickwinkel. Dann streckte sie den Arm aus und fuhr mit den Fingern über die muskulöse Kruppe. »Perfekt«, flüsterte sie. »Du hast seine Jugend eingefangen, die Verheißung, was einmal aus ihm wird, und die Energie, die in ihm steckt.« Sie drehte sich zu Lulu herum, die Augen verdächtig hell. »Mir war nie klar, wie begabt du bist, meine Liebe. Gratuliere.«
Lulu war aufgewühlt. Clarice derart gerührt zu sehen war mehr, als sie sich hatte erhoffen können. Sie schlang die Arme um ihre Großtante und drückte sie an sich.
Clarice verharrte steif in der Umarmung, ihre Hände flatterten, als wüsste sie nicht so recht, wohin mit ihnen. »Es freut mich, dass du so glücklich bist, Liebes, aber pass bitte auf den Mantel auf. Das ist mein einziger Nerz, und obwohl er inzwischen ein bisschen von Motten zerfressen ist, möchte ich kein Make-up daran haben.«
Die Abfuhr war zwar nett formuliert, doch Lulu war verletzt, trat einen Schritt zurück und strich sich die Locken hinter die Ohren, während ihr Tränen in den Augen stachen.
Clarice’ weiche Hand tätschelte ihre Wange. »Du bist ein kluges Mädchen, und ich bin sehr stolz auf dich, Lorelei. Aber nur weil ich mich aus Prinzip nicht von meinen Gefühlen übermannen lasse, heißt das noch lange nicht, dass ich dich nicht liebe.«
Lulu nickte, ihre unvergossenen Tränen machten es ihr unmöglich zu sprechen. Natürlich wurde sie geliebt – das Zuhause, das Clarice ihr bot, das Atelier, die Sachen in ihrem Kleiderschrank und die Wohnung in London waren beredte Zeugen dafür. Dennoch sehnte sich Lulu nach mehr greifbarer Nähe. Zuweilen brauchte sie nichts weiter als eine Umarmung, einen Kuss, ein äußeres Zeichen, dass sie ihrer Tante etwas bedeutete – doch sie wusste, es war eine vergebliche Hoffnung, und sie schalt sich im Stillen, dass sie beinahe ebenso bedürftig war wie Maurice.
Clarice bemerkte anscheinend den inneren Kampf, den Lulu mit sich austrug, und wechselte rasch das Thema. »Mir gefällt, wie er in den Wellen tanzt. Gibt es einen besonderen Grund dafür?«
»Er heißt Ocean Child.«
»Was für ein interessanter Name«, murmelte Clarice. »Wie bist du darauf gekommen?«
Lulu fiel ein, dass sie Clarice noch nichts von dem Brief gesagt hatte. »Das war eigentlich ziemlich merkwürdig«, hob sie an. »Ich habe so einen komischen Brief aus Tasmanien erhalten und …«
»Einen Brief aus Tasmanien?«, unterbrach Clarice sie schroff. »Das hast du mir nicht erzählt.«
»Das ist schon Ewigkeiten her, und ich war so in meine Arbeit vertieft, dass ich es vergessen habe.«
»Von wem war er?«
»Joe Reilly, Galway House. Er ist ein …«
»Ich weiß, was Reilly ist«, unterbrach Clarice erneut. »Warum schreibt er dir?«
Lulu bemerkte die Anspannung in Clarice’ Stimme, ihren eindringlichen Blick, das Versteifen ihrer schmalen Schultern, und diese eigenartige Reaktion verwirrte sie. Sie teilte ihr den Inhalt des Briefes mit. »Offensichtlich war es ein Versehen«, schloss sie, »und ich habe es ihm geschrieben. Seither habe ich nichts mehr von ihm gehört.«
»Gut.« Clarice schnäuzte sich geziert in ein Spitzentaschentuch.
Lulu war neugierig. »Woher kennst du die Reillys?«
Clarice tat den Gedanken an die Reilly-Sippe mit einer wegwerfenden Handbewegung ab. »Ich habe sie vor Jahren kennengelernt, weil mein verstorbener Mann sich für Pferderennen interessierte.«
»Möchtest du denn nicht einmal zu Besuch dorthin zurück?«
Clarice zog den Pelzkragen mit respekteinflößender Miene an ihr Kinn. »Nichts würde mir weniger gefallen.«
»Vielleicht kann ich’s mir eines Tages leisten, zurückzukehren«, sagte Lulu wehmütig. »Es würde Spaß machen, meine alten Lieblingsplätze aufzusuchen und die Freunde zu treffen, die ich zurückgelassen habe.«
»Für dich gibt es nichts in Tasmanien«, fuhr Clarice sie an.
»Ja, vermutlich ist da nichts mehr – aber es wäre nett …«
»Fang bloß nicht wieder mit diesem Unsinn an, Lorelei. Du warst noch ein Kind, als du fortgingst, und jetzt Schluss mit Tasmanien.«
Lulu ging rasch in die Defensive. »Ich kann mich an den Strand erinnern, die Klippe, die Kiefern und Akazien. Ich erinnere mich an Primmy und die Pferde und die Hunde, und an die Freunde, die ich in der Schule hatte.«
»Du lebst jetzt hier«, sagte Clarice mit Nachdruck. »Eine gute englische Erziehung hat dir diesen scheußlichen Kolonialakzent ausgetrieben, und du würdest feststellen, dass du dort einfach nicht hingehörst, so wie ich.«
Lulu biss sich auf die Lippe, als sie an den furchtbaren Sprechunterricht dachte. Ihr Akzent war der letzte Rest von Tasmanien gewesen, an den sie sich geklammert hatte – doch anscheinend hatte auch der gelöscht werden müssen.
Als könnte sie Lulus Gedanken lesen, sah Clarice sie beinahe vorwurfsvoll an. »Kindheitserinnerungen können sehr unzuverlässig sein. Vieles, wie deine Erziehung vorher, habe ich übernommen«, fügte sie kaum hörbar hinzu. Sie schauderte und ging zur Tür. »Ich friere mich hier draußen zu Tode. Ich gehe rein.«
Lulu machte die Lampen aus, schloss die Tür hinter ihnen und folgte Clarice über den schmalen Weg zum Haus. Clarice’ strikte Weigerung, Lulus beständigem Wunsch nachzugeben, in die Heimat zurückzukehren, war höchst enttäuschend. Dabei wollte sie nicht einmal für immer dorthin zurück, doch im Laufe der Jahre hatte ihre Sehnsucht nicht nachgelassen. Joe Reillys Brief hatte sie nur noch verstärkt.
Clarice mied das Wohnzimmer, in dem Maurice sich ohne Zweifel am Kamin hinter einer Zeitung versteckte, und ging langsam die Treppe hinauf zu ihrem Schlafzimmer. Sie war nicht zu höflicher Konversation aufgelegt und schon gar nicht bereit, mit Lorelei eine Diskussion über Tasmanien fortzuführen.
Sie betrachtete das mickrige Feuer im Kamin und stieß kräftig mit dem Schürhaken hinein, um es zum Leben zu erwecken. Nachdem sie die schweren Samtvorhänge gegen die Zugluft zugezogen hatte, goss sie sich ein Glas Sherry ein, sank in den Sessel vor dem Kamin und grübelte über die Ereignisse des Abends.
Von Reillys Brief zu erfahren war ein furchtbarer Schock für sie gewesen, und obwohl Lorelei anscheinend vernünftig damit umgegangen war, hatte Clarice das ungute Gefühl, dass die Sache damit noch nicht ausgestanden war.
Sie zog den Kaschmirschal fester um die Schultern, trank einen Schluck Sherry und stellte das Glas ab. Obwohl so viel Zeit vergangen war und sie sich die größte Mühe gegeben hatte, Lorelei davon abzubringen, zog es sie wohl noch immer nach Tasmanien. Reillys Brief hatte nicht nur Loreleis Sehnsüchte neu entfacht, sondern Erinnerungen in Clarice wachgerufen, die sie längst begraben geglaubt hatte.
Während sie im flackernden Schein des Feuers dasaß, versuchte sie, sich die Gesichter der Menschen vor Augen zu führen, die sie einst geliebt hatte. Die Zeit hatte ihre Züge verwischt und ihre Stimmen verstummen lassen – sie waren zu flüchtigen Schatten geworden –, doch sie verfolgten sie noch immer.
Alles hatte im Januar 1886 begonnen, als sie und ihr Mann Algernon in Sydney eingetroffen waren. Sie konnte sich noch genau an den Tag erinnern – selbst jetzt noch –, denn sie hatte sich davor gefürchtet. Und während die Küste näher gerückt war, hatte ihr innerer Aufruhr sich verstärkt. Sie hatte inbrünstig darum gebetet, dass die Ehe mit Algernon und die vergangenen Jahre die verbotene Liebe erstickt hätten, die sie einst verzehrt hatte, und dass sie sich als die jugendliche Vernarrtheit schlechthin erweisen würde – doch schon wenige Stunden nach dem Anlegen war sie auf die Probe gestellt worden. Und hatte festgestellt, dass sie begehrte.
Sydney, 1886
Während die Matrosen in die Takelage stiegen, um die Segel einzuholen, musste Clarice wohl oder übel zugeben, dass ihre Erwartungen an diese lange Reise zu hoch gewesen waren. Sie hatte gehofft, die exotischen Orte, die sie besichtigten, und die sternenklaren Nächte auf hoher See könnten Leidenschaft in Algernon entfachen und sie einander näherbringen. Algernon jedoch schien ihren Bedürfnissen gegenüber gleichgültig, ihren Wünschen gegenüber blind und fest entschlossen, eine höfliche Distanz ohne unzulässige Intimität aufrechtzuerhalten.
Die Nachricht von Algernons Versetzung nach Australien war ein furchtbarer Schock gewesen, und obwohl es bedeutete, dass sie wieder mit ihrer älteren Schwester Eunice vereinigt würde, war ihr klar gewesen, wie gefährlich es sein würde, dem Mann von Angesicht zu Angesicht gegenüberzutreten, den sie einst geliebt hatte. Sie hatte versucht, Algernon davon abzubringen, doch die Stelle beim Gouverneur würde seinen Ehrgeiz befriedigen, in den Adelsstand erhoben zu werden, und er hatte sich geweigert, ihrem Flehen nachzugeben.
Sie schaute auf das glitzernde Wasser im riesigen Hafen, ohne ihn richtig zu sehen, steckte eine helle Haarsträhne hinter das Ohr und tupfte ihre Augen mit einem Spitzentaschentuch ab, um die Gefühle unter Kontrolle zu halten, die Algernon so entsetzlich fand.
Ihre Ehe mit dem Witwer Algernon Pearson war von ihrem Vater in die Wege geleitet worden, der ihm altersmäßig näher stand als sie, und zunächst hatte sie sich geweigert, eine solche Verbindung auch nur in Erwägung zu ziehen. Doch sie war inzwischen fünfundzwanzig und galt als graue Maus, und so war ihr nichts anderes übrig geblieben. Der Mann, den sie liebte, hatte eine andere geheiratet, es gab keine weiteren Freier, und ihr Vater hatte darauf bestanden.
Es war nicht die Liebesheirat, die Eunice eingegangen war, doch Algernon erwies sich als aufmerksamer, gebildeter Mann, und nach monatelanger Brautwerbung stimmte sie widerwillig ein, ihn zu heiraten. Ihre Hochzeitsnacht hatte sich nicht als die Qual herausgestellt, die sie erwartet hatte, denn Algernon war ein Mann mit Erfahrung und hatte beim Liebesakt erstaunliche Rücksicht und Begeisterung walten lassen.
Das alles hatte sich im Lauf der Jahre verändert, als keine Kinder kamen. Algernon weilte nun immer länger im Auswärtigen Amt, und wenn er dann nach Hause kam, schlief er in einem anderen Zimmer. Auch strahlte er inzwischen Überdruss und Resignation aus, seine Enttäuschung über sie war beinahe greifbar.
»Nimm deinen Sonnenschirm und zieh deine Handschuhe an. Die Sonne wird deine Haut sonst dunkel färben.«
Clarice erschrak, als sie die Stimme ihres Mannes vernahm, und da sie ein schlechtes Gewissen wegen ihrer unfreundlichen Gedanken hatte, kam sie seiner Aufforderung rasch nach.
Algernon stand neben ihr, die Hände hinter dem Rücken verschränkt, den Strohhut ordentlich auf den grauen Haaren. Er betrachtete die Küste mit geringem Interesse und schien unempfindlich gegenüber der lähmenden Hitze, obwohl er über dem gestärkten Hemd und einer Wollhose noch ein Tweedjackett trug.
»Ohne Zweifel wird ein Empfangskomitee uns begrüßen«, sagte er. »Als britischer Berater des Gouverneurs erwarte ich doch gewisse Standards – sogar hier.«
Clarice sah, wie seine Nasenflügel sich über dem gestutzten Oberlippenbart weiteten, als wäre schon der Geruch Australiens ein Affront. Algernons Ansprüche an Manieren, Kleidung und Umgangsformen hatten ein unerreichbares Niveau – weshalb sie trotz der Hitze ein enges Korsett trug. Ihr langer Rock und die Unterröcke klebten an ihren Beinen, während ihre Hände in Baumwollhandschuhen schwitzten. Eunice hatte sie gewarnt, dass es gefährlich sei, zu viel Kleidung zu tragen. Nun spürte sie, wie der Schweiß über ihren Rücken rann, und sah Schweißperlen in ihrem Dekolleté. Sie hoffte nur, dass sie nicht ohnmächtig wurde. Was Algernon dazu sagen würde, wagte sie sich gar nicht vorzustellen.
Sie warf einen Blick auf die am Kai Versammelten und bat im Stillen um einen offiziellen Empfang. Sollte keiner stattfinden, würde Algernon für den Rest des Tages in schlechte Laune verfallen. »Eunice hat geschrieben, dass Sydney für eine neue Kolonie ziemlich hoch entwickelt ist und dass Gouverneur Robinson sich auf dein Eintreffen freut.«
Die Nasenflügel wurden eingezogen. »Der Gouverneur wird wohl kaum auf deine Schwester hören«, erwiderte er herablassend. »Genug Geschwätz, Clarice. Ich möchte mich auf meine Rede vor dem Empfangskomitee konzentrieren.«
Clarice hatte sie schon oft gehört und hielt sie für außerordentlich hochtrabend, doch da ihre Meinung nicht zählte, wandte sie ihre Aufmerksamkeit dem Hafen zu, in den eine Flotte kleiner Schlepper die Dora May hineinbugsierte. Jetzt, da sie näher kamen, konnte sie die eleganten Häuser und Gärten sehen, die stattlichen roten Backsteinmauern der Regierungsgebäude und Kirchen und die breiten, gepflasterten Straßen. Das alles erschien ihr wesentlich zivilisierter als so manch anderer Hafen, in dem sie unterwegs angelegt hatten.
Ihr Herz schlug schneller, als sie die Menge auf dem Kai nach dem vertrauten, einst geliebten Gesicht absuchte. Sie hatte Angst, es zu sehen, konnte aber nicht widerstehen, danach zu suchen – doch zu viele Menschen warteten dort, und in ihre Enttäuschung mischte sich Erleichterung.
Das Gedränge der Passagiere an Deck wurde bald beengend, und die Verbindung von Hitze und Herzklopfen überwältigte sie. Sie hatte das Gefühl, als wäre ihr Kopf mit Watte gefüllt, und vor ihren Augen tanzten helle Lichtflecken. Aus Angst, in Ohnmacht zu fallen, begann sie sich durch die Menge zu schieben.
»Clarice? Wo willst du hin?«
Algernons Stimme klang wie aus weiter Ferne, und als die Dunkelheit immer näher rückte, begann sie, noch stärker vorwärtszudrängen. Wenn sie in Ohnmacht fiele, würde sie zertrampelt. Sie musste Schatten und Raum zum Atmen finden.
Endlich kam sie taumelnd aus dem Gewühl frei und sank dankbar auf eine Einstiegsluke. Eine schützende Persenning war darübergespannt, und Clarice seufzte erleichtert auf, als ihr schließlich klarer im Kopf wurde und der Luftzug ihres Fächers ihr Kühlung verschaffte.
»Steh auf«, zischte Algernon, dessen große Hand sich um ihr Handgelenk schloss. »Du fällst unangenehm auf.«
»Ein leichter Schwächeanfall«, erwiderte sie und wand sich aus seinem Griff. »Gönn mir ein bisschen Erholung.«
»Du kannst nicht wie ein schlaffer Wäschesack hier herumsitzen«, fuhr er sie an. »Ich werde dich in unsere Kabine bringen, wo du dich abseits fremder Blicke ausruhen kannst.«
Sie versuchte aufzustehen, doch die dunklen Wolken kamen wieder, und ihre Beine drohten unter ihr nachzugeben. »Ich kann nicht«, flüsterte sie. »Bitte, hol mir ein bisschen Wasser.«
Algernon funkelte sie wütend an, dann wurde ihm klar, dass man sie beobachtete, und er wurde sogleich beflissen. »Nehmen Sie sich meiner Frau an«, befahl er einer Kellnerin in der Nähe, »und zwar ein bisschen plötzlich.«
Clarice scherte sich nicht darum, dass die ganze Welt zuschaute, als sie ihren Kopf in den Schoß legte und versuchte, ihre fünf Sinne wiederzuerlangen. Die junge Frau wischte ihr mit einem kühlen Tuch über Stirn und Nacken und half ihr, Wasser aus einer Tasse zu trinken. Clarice nahm das Tuch, tupfte diskret den Schweiß von ihrer Brust und ihrem Gesicht und zog die verhassten Handschuhe aus.
Am Ende vertrieben das Wasser, der Schatten und der kühlende Fächer ihr Unwohlsein, und sie betrachtete den deutlich verstimmten Algernon, der das Deck abschritt und einen Blick auf seine Taschenuhr warf. »Wenn du mir helfen könntest«, murmelte sie, »denn ich bin noch ein wenig unsicher auf den Beinen.«
Seine Miene war grimmig. »Das geht einfach nicht, Clarice. Der Gouverneur wird von uns erwarten, dass wir als Erste von Bord gehen«, knurrte er. »Jetzt müssen wir mit dem gemeinen Volk an Land gehen und uns selbst vorstellen.«
Clarice packte seinen Arm, öffnete ihren Sonnenschirm und ließ sich von ihm zur Gangway führen. Ihre Beine zitterten noch immer, doch ihr war klarer im Kopf, und Algernon hatte noch nicht bemerkt, dass ihre Handschuhe fehlten. Sie legte das Lächeln auf, das man von ihr erwartete, schob das Kinn vor und bereitete sich darauf vor, den Gouverneur zu begrüßen.
Sie kamen auf den Anleger, doch Clarice war, als bewegten sich die Pflastersteine unter ihren Füßen, und sie klammerte sich noch fester an Algernons Arm.
»Ich sehe den Gouverneur nicht«, murrte er verärgert, befreite sich aus ihrem Griff und zupfte an seinen Jackenaufschlägen. »Auch ein Empfangskomitee ist nirgendwo zu sehen.«
»Nein, nur ich, Algie. Der Gouverneur sitzt in einer Debatte über Bewässerung fest und lässt sich entschuldigen.«