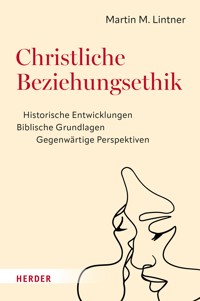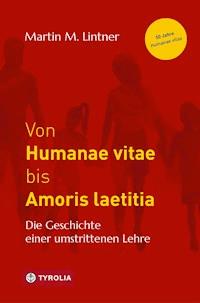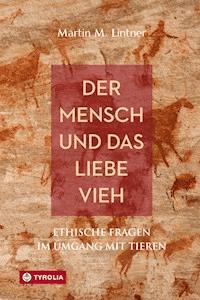
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Tyrolia
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2017
Tiere nehmen in unserer Gesellschaft sowie im Leben vieler Menschen einen wichtigen Stellenwert ein. Der Umgang mit ihnen ist aber zutiefst ambivalent. Manche Tiere werden geliebt und gehätschelt, andere hingegen unter tierquälerischen Bedingungen gehalten und geschlachtet. Immer mehr Menschen sind für das Tierleid sensibel, mit dem die intensive Tierhaltung bzw. die Massentierhaltung vielfach verbunden sind. Sie wählen einen Lebens- und Ernährungsstil, bei dem sie bewusst auf den Konsum von tierischen Produkten verzichten oder darauf achten, dass dieser aus ökologisch verantworteter und artgerechter Tierhaltung stammt. Dieses Buch setzt sich mit der Frage auseinander, wie der Umgang mit Tieren so gestaltet werden kann, dass der Mensch den artspezifischen und individuellen Bedürfnissen, Fähigkeiten und Vermögen eines Tieres gerecht wird. Nach einem geschichtlichen Streifzug und der Auseinandersetzung mit den wichtigsten gegenwärtigen philosophischen Positionen in der Tierethik wird auf die Haus- und Nutztierhaltung und die Jagd eingegangen. Auch theologische Aspekte wie der biblische Herrschaftsauftrag an den Menschen oder das Schicksal der Tiere nach dem Tod werden behandelt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 484
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Martin M. Lintner
DERMENSCHUND DASLIEBEVIEH
ETHISCHE FRAGEN IMUMGANG MIT TIEREN
Mit Beiträgen vonChristoph J. Amor und Markus Moling
Gedruckt mit Unterstützung der Südtiroler Landesregierung / Abteilung Deutsche Kultur
Mitglied der Verlagsgruppe „engagement“
2017
© Verlagsanstalt Tyrolia, Innsbruck
Umschlaggestaltung: stadthaus 38, Innsbruck
Layout und digitale Gestaltung: Tyrolia-Verlag
Druck und Bindung: FINIDR, Tschechien
ISBN 978-3-7022-3634-2 (gedrucktes Buch)
ISBN 978-3-7022-3635-9 (E-Book)
E-Mail: [email protected]
Internet: www.tyrolia-verlag.at
INHALT
VORWORT
EINFÜHRUNG
1.Zielsetzung und Aufbau dieses Buches
a) An wen wendet sich das Buch?
b) Warum ein weiteres Tierethikbuch?
2.Von der Selbsterkenntnis des Menschen durch das Tier
3.Von Tierethik, Tierschutz, Tierwohl und Tierrechten
a) Was ist Ethik?
b) Die Moralfähigkeit als „anthropologische Differenz“
c) Tiere als Mitglieder der moralischen Gemeinschaft
4.„Weh dem, der vor dem Leid eines Tieres die Augen verschließt …“
TEIL 1: GRUNDFRAGEN ZUM VERSTÄNDNIS DER NATUR UND DER STELLUNG DES MENSCHEN IN IHR
1.Der Mensch – weder Mittel- noch Höhepunkt der Schöpfung Ein verantwortungsethisches Verständnis der Gottebenbildlichkeit
1.1 Gottebenbildlichkeit als Repräsentationsfunktion
1.2 Der Herrschaftsauftrag über die Erde und über die Tiere
a) Die Hypothek, die auf dem Herrschaftsauftrag in Gen 1,28 lastet
b) Eine exegetische und bibeltheologische Erschließung von Gen 1,28
c) „Macht euch die Erde untertan und herrscht über …“
1.3 Die Stellung des Menschen in der Schöpfung aus verantwortungsethischer Perspektive
a) Freiheit macht verantwortlich
b) Der Eigenwert aller Geschöpfe
c) Die Verwundbarkeit von Tieren und Menschen
d) Eine verantwortungsethische Anthropozentrik
1.4 Ergebnissicherung und Ausblick
2.Ist die Schöpfung gut? Zum Problem der Übel und des Leidens in der Natur(Christoph J. Amor)
2.1 Stellenwert und Bedeutung des christlichen Schöpfungsbegriffs
2.2 Die Evolutionstheorie
a) Moderne Naturwissenschaft und Physikotheologie
b) Infragestellung klassischer Deutungsmuster
2.3 Vorbehalte und Öffnung des Christentums gegenüber dem Darwinismus
2.4 Das evolutionäre Weltbild und das Problem des Übels
TEIL 2: PHILOSOPHISCHE GRUNDFRAGEN DER TIERETHIK
1.Der schwere Stand der Tierethik in der abendländischen Tradition
1.1 Tierethik: ein „blinder Fleck“ in der Geschichte des Abendlandes
a) Tierschutz: ein folgenschweres Defizit in der christlichen Tradition
b) „Tiere lieben? Ja, aber …“ – das Tier im christlichen Mittelalter
1.2 Die „Entdeckung“ der Tierrechte im 18. und 19. Jahrhundert
a) René Descartes und der tierethisch verhängnisvolle Dualismus
b) Immanuel Kant und das „Verrohungsargument“
c) Arthur Schopenhauer und die Mitleidsethik
d) Jeremy Bentham und der Beginn des organisierten Tierschutzes in England
e) Die beiden Grundkonzepte von Tierschutzgesetzen
2.Tierethische Grundpositionen in der gegenwärtigen Philosophie(Markus Moling)
2.1 Sentientismus bzw. Pathozentrismus
2.2 Peter Singer – Befreiung der Tiere
2.3 Tom Regan – Tierrechte
2.4 Martha Nussbaum – Fähigkeitsansatz
3.Der Ansatz einer verantwortungsethischen Tierethik
3.1 Gibt es eine Mensch-Tier-Differenz?
a) Die evolutionsbiologische und genetische Nähe zwischen Mensch und Tier
b) Emotionale und kognitive Fähigkeiten von Tieren
c) Was unterscheidet den Menschen von den Tieren?
d) Menschliche Moralfähigkeit und tierliches moralanaloges Verhalten
e) Tierliche Agency
3.2 Zur ethischen Relevanz von Differenz und Ähnlichkeit zwischen Mensch und Tier
a) Die Formulierung eines tierethischen kategorischen Imperativs
b) Empathie gegenüber Tieren: eine Ethik des Hinschauens und die Pflicht der Schmerzvermeidung
c) Gerechtigkeit gegenüber Tieren: eine Ethik der Fairness
3.3 Eine kritische Würdigung unterschiedlicher Aspekte von tierethischen Ansätzen
a) Zu den Stärken und Grenzen von biozentrischen Ansätzen
b) Zu den Stärken und Grenzen von sentientistischen bzw. pathozentrischen Ansätzen
c) Zu den Stärken und Grenzen von anthropozentrischen Ansätzen
4.Von der Würde des Tieres
4.1 Kommt dem Tier Würde zu?
a) Von der Würde des Menschen
b) Die Differenz von bonitas und dignitas
c) Die Achtung der tierlichen als Erfordernis der menschlichen Würde
d) Tierwürde als Anerkennung des Eigenwertes der Tiere
e) Tierwürde als Ausdruck der Rechenschaftspflichtigkeit von Handlungen und Eingriffen, die Tiere betreffen
f) Abschließend: Zu den Chancen und Grenzen der Rede von der „Würde des Tieres“
4.2 Eine abgestufte Schutzwürdigkeit von Tieren
a) Den Tieren gerecht werden
b) Die Berücksichtigung von artspezifischen und individuellen Bedürfnissen, emotionalen Vermögen und kognitiven Fähigkeiten
4.3 Zur Problematik des Tötens von Tieren
a) Zur religiösen Praxis des Schächtens
b) Der ambivalente Umgang in unserer Gesellschaft mit dem Töten von Tieren
c) Dürfen Tiere getötet werden?
d) Zum Tötungsverbot von Tieren, die zu einem Selbstverhältnis in der Lage sind, das über einen rein situativen Gegenwartsbezug hinausreicht
TEIL 3: KONKRETE HANDLUNGSFELDER
1.Haus- und Nutztierhaltung
1.1 Eine kurze kulturgeschichtliche Hinführung
1.2 Tierschutzrechtliche Unterteilung der Tiere
1.3 Ethische Grundüberlegungen in der Tierhaltung
a) Positive Auswirkungen auf den Menschen
b) Positive Aspekte für das Tier
c) Mindestanforderungen an eine artgemäße und individuengerechte Haus- und Nutztierhaltung
d) Nutztierrechtliche Verordnungen für eine artgemäße Tierhaltung
e) Leistungsoptimierung in der Nutztierhaltung
f) Ethische Aspekte
1.4 Zusammenfassend: Keine „Alles-oder-nichts“-Mentalität im Bereich der Tierhaltung
1.5 … und schließlich: die Frage des Tötens
1.6 Exkurs: Ethische Aspekte der Tierhaltung in Zirkussen und Zoos
a) Zirkusse
b) Zoos und Tierparks
c) Zum Dilemma Tierschutz versus Artenschutz
2.Tierversuche
2.1 Zur Situation der Verwendung von Versuchstieren
a) Einige statistische Daten
b) Die Differenzierung von Tierversuch und Versuchstier sowie die Verwendungszwecke von Versuchstieren
c) Der Schutz des Tierwohls bei Tierversuchen in den Richtlinien der EU sowie in der Helsinki-Deklaration des Weltärztebundes
2.2 Ethische Aspekte
a) Die Berücksichtigung artspezifischer und individueller Bedürfnisse und Fähigkeiten
b) Der Forschungsnutzen
c) Kriteriologie für eine ethisch verantwortbare Güterabwägung
d) Tierversuche und Gentechnik
e) Ein Schritt in die richtige Richtung: Replacement – Reduction – Refinement
2.3 Politische Maßnahmen gegen Tierversuche
3.Jagdethik(Markus Moling)
3.1 Jagd und Werte
a) Schadensminimierung in der Forst- und Landwirtschaft und in der Kulturlandschaft
b) Hochwertige Nahrungsmittel
c) Gewährleistung der Verjüngung und der Schutzfunktion des Waldes
d) Berücksichtigung der Lebensraumkapazität durch Populationssteuerung
e) Nachhaltige Nutzung von selbst reproduzierenden Wildtierpopulationen
f) Pflege und Erhaltung eines gesunden Wildbestandes
g) Biodiversität
h) Habitatpflege und Artenschutz
i) Kulturelle Werte und Tradition
j) Die Rückkehr von Raubtieren wie Bär und Wolf
3.2 Welche Werte sollen die Jagdpraxis prägen?
3.3 Ethische Reflexion der Jagdpraxis
3.4 Die Folgen des Jagens
3.5 Absichten des Jägers
3.6 Haltungen des Jägers
a) Ehrfurcht und Achtung
b) Fairness statt Neid und Streit
c) Tierökologische Kenntnis
4.Ethische Aspekte beim Konsum von Tierprodukten
4.1 Von Veganern, Vegetariern, Pescetariern und Freeganern
4.2 Das Prinzip der Mitwirkung an einer unrechten Handlung
4.3 Ethische Kriterien für den Konsum von tierischen Produkten
a) Die Mitverantwortung des Konsumenten
b) Von der Pflicht, sich zu informieren
c) Zum Prinzip der Nachhaltigkeit bzw. der Verflochtenheit von ökologischen, ökonomischen und sozialen Fragen
4.4 Von der Macht und Ohnmacht des Konsumenten
a) Die unterschiedlichen Handlungsebenen
b) Einige notwendige Maßnahmen
c) Zur „Politik mit dem Einkaufswagen“
TEIL 4: EINE ETHIK DER MITGESCHÖPFLICHKEIT
1.Tier und Mensch als Gefährten
1.1 Sind Tiere die besseren Menschen – und Menschen die schlechteren Tiere?
1.2 Das Tier Tier, den Menschen Mensch sein lassen
a) Tier und Mensch als Gefährten und Freunde
b) Die Tiere als Mitgeschöpfe
c) Kurzer Exkurs: zur Bedeutung von Tieren im Leben von Heiligen
d) Tiere als Ersatz für menschliche Beziehungen?
e) Zur Problematik der Zoophilie
1.3 Abschließend: Aspekte einer christlichen Spiritualität der Mitgeschöpflichkeit
2.Kommen Tiere in den Himmel?(Christoph J. Amor)
2.1 Bestattungs- und Trauerkultur im Wandel
2.2 Die Stellung der Tiere in der Gesellschaft heute
a) Umweltkrise und ökologische Sensibilität
b) Herrschafts- und Bewahrungsauftrag
c) Schöpfungsspiritualität
d) Evolution des Menschen
2.3 Eschatologie der Tiere
a) Klassische Anthropologie auf dem Prüfstand
b) Bibeltheologisches Argument aus dem Tier-Mensch-Verhältnis
c) Schöpfungs- und bundestheologisches Argument
d) Anthropologisches Argument
e) Argument aus dem Leid der Tiere
2.4 Offene Fragen und Ausblick
ANMERKUNGEN
LITERATUR- UND QUELLENVERZEICHNIS
VORWORT
Erinnerungen und prägende Erlebnisse
Auf einem Bergbauernhof in den südlichen Dolomiten in Südtirol aufgewachsen, wurde mir die Liebe zur Natur und zu den Tieren in die Wiege gelegt. In meinen frühen Kindheitserinnerungen tummeln sich viele Tiere des elterlichen Hofes. Es sind dies nicht einfach Rinder oder Schweine, Katzen oder Hühner …, sondern ganz konkrete Tiere: eine Kuh, die besonders gutmütig war, sodass wir Kinder sie gerne streichelten oder das Ohr an ihren Bauch hielten, um den Verdauungsgeräuschen zu lauschen; eine andere, vor der wir gehörigen Respekt hatten, weil sie leicht reizbar war und ihre Drohgebärden, wenn wir ihr zu nahe kamen, uns sehr einschüchterten. An eine der vielen Katzen erinnere ich mich noch sehr lebendig, einen wunderschön getigerten Kater, den ich nach seinem plötzlichen Verschwinden tagelang in der Umgebung des Hofes suchte und miauend durch die nahen Wälder streifte, in der Hoffnung, ihn zu locken – bis ich ihn in einem Gestrüpp fand: erschossen. Oder an ein kleines Kätzchen, das wenige Wochen nach der Geburt verendet war – aufgrund eines Geburtsfehlers, sein Kopf war überdimensional groß und es konnte kaum laufen – und das ich in einem Wäldchen oberhalb des Hofes begraben habe. Noch heute weiß ich, bei welchem Baum das kleine Katzengrab liegt.
Auf einem Bergbauernhof lebt man nicht nur eng eingebunden in den Rhythmus der Natur und der Jahreszeiten, sondern auch in einer engen Gemeinschaft mit den Tieren. Sie sind der Obhut der Bauernfamilie anvertraut. Das Wohlbefinden und Gedeihen des Viehs hängt davon ab, wie es behandelt wird. Tiere sind aber auch die Lebensgrundlage der Bauern, eben Nutztiere. Das Wohlergehen der Bauern hängt deshalb auch vom Gedeihen der Tiere ab. Tier und Mensch bilden eine Art Schicksalsgemeinschaft. Die Tiere werden deshalb nicht nur als Nutztiere behandelt, sondern wie Individuen, die zum weiteren Familienkreis dazugehören. Die einzelnen Tiere haben einen Namen, man kennt ihr Temperament, man redet ihnen gut zu. Ist eines von ihnen krank, steht man auch in der Nacht regelmäßig auf, um nach seinem Befinden zu schauen. Wird ein Kälbchen geboren, herrscht freudige Aufregung; verendet ein Vieh, aufgrund einer Krankheit oder weil es vom Blitz erschlagen wurde, ist die Stimmung gedrückt. Es ist mehr als ein bloß wirtschaftlicher Verlust.
Schmerzlich war immer, wenn ein Kälbchen tot zur Welt kam oder während der Geburt verendet ist. In meiner Kindheit wurde es dann im Wald unter dem Hof an einer unwegsamen Stelle abgelegt, den Füchsen zum Fraß. Abends vor dem Einschlafen dachte ich an das tote Kälbchen, wie es allein im dunklen Wald lag, und stellte mir die Füchse vor, die an ihm zerrten und fraßen. Heute würde dies als „unkontrollierte Entsorgung von Tierkadavern“ und „mögliche Umweltverschmutzung“ geahndet. Mitleid hatte ich oft mit den Kälbchen, die nach damaligem Standard konventioneller Tierhaltung gleich nach der Geburt in eine Kälberbox gegeben wurden. Diese war zwar mit frischem Stroh ausgebettet, aber das Neugeborene lag allein und einsam darin, wie mir schien, noch nass und zitternd vor Kälte. Manchmal stieg ich zum Kälbchen in die Box, um es zu streicheln und seine Wärme zu spüren. Die zur Mast bestimmten Stierkälbchen verbrachten ihr ganzes kurzes Leben in einer solchen Box. Mittlerweile wurde die Viehhaltung auf dem Heimathof nach den Richtlinien der biologischen Landwirtschaft auf die tierfreundliche und artgerechte Muttertierhaltung umgestellt, wo die Kälber bei der Mutterkuh und in der Herde verbleiben.
Zum Leben auf einem Bauernhof gehört auch das Schlachten von Tieren. Wenn eine Kuh alt geworden ist und kaum mehr Milch gegeben hat, wurde sie zum Metzger gebracht. Während die übrige Herde auf die Weide gebracht wurde, blieb sie allein im Stall zurück. Um sie zu beruhigen, wurde ihr Futtertrog mit Heu gefüllt. So manches Mal stand ich als Kind nach einem solchen Abtransport am leeren Platz und sinnierte darüber nach, wo die Kuh nun sei und wie es ihr gehe. Miterlebt habe ich auch das Schlachten auf dem Hof, angefangen bei der Tötung von Kaninchen, die wir Kinder aufgezogen und gepflegt haben, von Hühnern oder von Schweinen. Eingeprägt hat sich mir das Bild eines besonders schönen Hahnes mit einem prächtigen schwarz-gelben Gefieder. Es muss früh an einem Morgen gewesen sein, der tote Hahn lag im noch taunassen Gras einige Meter vom Holzklotz entfernt, auf dem er geköpft worden war. Ich ließ die schönen glänzenden Federn traurig durch die Finger gleiten, während die Katze vom Blut schlecken wollte. Ich verscheuchte sie unsanft; mir war, als müsste ich den Hahn beschützen. In sicherer Entfernung blieb die Katze sitzen, wohl abwartend, dass ich weggehen würde und sie zu ihrer „Beute“ zurückkehren könnte. Ihr Blick zeigte wenig Verständnis für meine harsche Reaktion, wo ich sie doch sonst immer verhätschelt hatte. Verstörend wirkte auf mich jedes Mal die Schlachtung der Schweine. Sie wurde von einem Nachbarn, einem Jäger, fachkundig durchgeführt, aber das Quietschen der todgeweihten Tiere war für mich unerträglich und ich versteckte mich oft in einem fensterlosen Zimmer im Bauernhaus, in das kein Laut von außen hineindrang, und wartete dort so lange, bis ich annehmen konnte, dass die Schlachtung vorüber war.
In der Jugendzeit schließlich verbrachte ich viele Stunden draußen in der Natur, in den Wäldern und auf den Bergen, um Wildtiere zu beobachten. Bis heute gehört die Balz von Auer- und Birkhahn oder die Brunft der Hirsche zu den schönsten und beeindruckendsten Erlebnissen, aber auch das Beobachten von Rehen, Gämsen, Murmeltieren, Bussarden, Adlern und vielen anderen Tieren war und blieb ein Hobby. Wie froh war ich immer, dass niemand in meiner Familie Jäger war, so sehr mich die Jagdtrophäen der Jäger in der Nachbarschaft auch beeindruckten und faszinierten. Um kein Missverständnis aufkommen zu lassen: Ich verdanke befreundeten Jägern, dass sie mir Balzplätze von Auer- und Birkwild oder gute Einstände von Rotwild „verraten“ haben – aber ein Tier zu töten, von dessen Schönheit und Anmut ich fasziniert bin, würde ich nicht über mich bringen.
Die Liebe zu den Tieren und das Interesse an ihnen blieben in mir wach. So wollte ich später Verhaltensforschung studieren, doch mit der Entscheidung zum Theologiestudium nahm mein Leben eine andere Wendung. Während meines Studienbeginns in Innsbruck schätzte ich mich glücklich, mit dem Alpenzoo einen Tiergarten gleichsam „vor der Haustür“ zu haben, der sich dadurch auszeichnet, dass in weitgehend großflächigen Gehegen nur heimische Tierarten aus der Alpenregion gehalten werden. Aufgrund der artgemäßen und tierfreundlichen Haltung sowie der Erfolge in der Nachzucht und bei der Auswilderung von bedrohten und seltenen Tierarten der alpinen Region genießt der Zoo auf internationaler Ebene ein hohes Ansehen. Als Mitglied des Vereins der Freunde des Alpenzoos gehöre ich immer noch zu den regelmäßigen Zoobesuchern. In meiner 1999 an der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Wien eingereichten Diplomarbeit zum Thema „Zur wechselseitig kritischen Funktion von Soziobiologie und theologischer Ethik“ habe ich mich mit einigen Fragen der Tier-Mensch-Beziehung auf neue, wissenschaftlich reflektierte Weise auseinandergesetzt. Im Rahmen der Verfassung der Arbeit hatte ich damals die Möglichkeit zu interessanten Diskussionen mit dem Verhaltensforscher Kurt Kotrschal. Eine Vorlesung bei Rupert Riedl in der Konrad-Lorenz-Villa in Altenberg bei Wien über die evolutionäre Erkenntnistheorie bleibt mir als eine der interessantesten Lehrveranstaltungen meiner Studienzeit in Erinnerung. Die damals diskutierten Fragen „über Gott und die Welt“ beschäftigen mich weiterhin. – Des langen Vorworts kurzer Sinn: Mit diesem Tierethikbuch greife ich ein Thema auf, das mich seit jeher begleitet und mir sehr am Herzen liegt.
Dank
Es freut mich, dass zwei Kollegen an der Philosophisch-Theologischen Hochschule Brixen, Christoph J. Amor, Professor für Dogmatik, und Markus Moling, Professor für Philosophie, von diesem Buchprojekt angetan waren und spontan meiner Einladung gefolgt sind, daran mitzuwirken. Uns verbindet nicht nur eine große Naturverbundenheit, die in gemeinsamen Exkursionen und Wildbeobachtungen Ausdruck findet, sondern auch, dass uns philosophische, theologische und ethische Fragestellungen in Bezug auf die Tiere und die Tier-Mensch-Beziehung interessieren. Ich danke den beiden herzlich, dass sie jeweils zwei Beiträge beigesteuert haben, die im Inhaltsverzeichnis sowie im Textkorpus namentlich gekennzeichnet sind, sowie für die konstruktiv kritischen Rückmeldungen zu den einzelnen Abschnitten dieses Buches.
Schließlich gilt mein Dank dem Tyrolia-Verlag für die Aufnahme dieses Titels ins Verlagsprogramm und Frau Brunhilde Steger für die engagierte Betreuung der vorliegenden Publikation.
Widmung
Widmen möchte ich dieses Buch meinem Vater, der aus Überzeugung und mit Herz Bergbauer war. Er ist an den Folgen eines landwirtschaftlichen Unfalls verstorben. Sein Leben und sein Schicksal zeigen, dass das Leben mit und in der Natur schön und erfüllend ist, aber auch rau und hart sein kann. Für eine romantisch-sentimentale Naturbetrachtung bleibt oft wenig Platz. Die Natur ist unser Lebensraum, aber sie ist uns nicht nur freundlich gesinnt. Diese Ambivalenz ist auch der Beziehung zwischen Mensch und Tier eingeschrieben. Darüber und über weitere spannende Fragen nachzusinnen will dieses Buch anregen.
Brixen / Innsbruck, im Frühling 2017
Martin M. Lintner
EINFÜHRUNG
1.Zielsetzung und Aufbau dieses Buches
a) An wen wendet sich das Buch?
Das vorliegende Tierethikbuch richtet sich an einen möglichst großen Personenkreis. Es will auf wissenschaftlichem Niveau und zugleich auf verständliche Weise in die komplexe und interessante Thematik der Tierethik einführen.
Tierfreundinnen und Halter1 von Nutz- oder Haustieren finden viele Hintergrundinformationen zu ethischen und philosophischen Fragestellungen sowie einen Einblick in die aktuellen Debatten in Bezug auf die Tier-Mensch-Beziehung. Es werden Fragen vertieft wie: Welchen moralischen Status haben Tiere? Soll man von der „Würde des Tieres“ sprechen bzw. was kann man darunter verstehen? Welche ethische Relevanz haben die Unterschiede zwischen den verschiedensten Tiergattungen und -arten, welche hingegen die Gemeinsamkeiten, Ähnlichkeiten und Differenzen zwischen Menschen und Tieren? Ist der Mensch nichts anderes als ein Tier oder ist er ganz anders als ein Tier?2 Sind die Tiere die besseren Menschen und Menschen die schlechteren Tiere? Warum geht der Einsatz für und die Liebe zu den Tieren oft einher mit einer gewissen misanthropischen Grundhaltung? Eingegangen wird auch auf die schwierige, für Tierliebhaber oft schmerzliche Frage, wieso Tiere leiden müssen – und zwar auch unabhängig vom Handeln des Menschen –, oder was wir für die Tiere nach ihrem Tod erhoffen dürfen: Macht es Sinn, Tiere zu beerdigen? Und kommen auch Tiere in den Himmel?
Das Buch möchte aber über die Personengruppe hinaus, die einen direkten Umgang mit Tieren pflegt, eine möglichst breite Leserschaft erreichen, und zwar deshalb, weil die meisten Menschen in unserer Gesellschaft tierische Produkte bzw. Produkte mit tierischen Inhaltsstoffen konsumieren – angefangen von Nahrung, Bekleidung, Haushaltstextilien … bis hin zu Kosmetika, Medikamenten, Klebstoffen, Schaumstoffen usw. Deshalb wirken sich ihr Konsumverhalten sowie ihr Lebensstil auf das Leben von Tieren, auf deren Haltungs- und/oder Schlachtungsbedingungen aus. Das Buch will dafür sensibilisieren, dass jede und jeder als Konsumentin bzw. Konsument eine Mitverantwortung dafür trägt, wie Nutztiere behandelt, gehalten, gepflegt und schließlich getötet werden. Die Position, die in diesem Buch vertreten und begründet wird, ist nicht jene, dass die Tiernutzung radikal abgelehnt wird, sondern dass Tiere so gehalten und gepflegt werden, dass dies sowohl ihren artspezifischen als auch ihren individuellen Bedürfnissen und Vermögen auf der Empfindungs-, emotionalen und kognitiven Ebene gerecht wird.
Eine neuralgische Frage ist und bleibt die nach der ethischen Vertretbarkeit der Tötung von Tieren. Es werden die Bedingungen herauszuarbeiten sein, unter denen die Schlachtung oder die Bejagung von Tieren ethisch vertretbar sein kann. Vertreten wird allerdings die (zu begründende) These, dass das prinzipielle Tötungsverbot über den Menschen hinaus auf bestimmte Tierarten auszuweiten ist, und zwar ohne die Mensch-Tier-Differenz aufzuheben und ohne von den betroffenen Tieren deshalb zu sagen, dass ihnen dieselbe Würde zukommt wie einem Menschen.
b) Warum ein weiteres Tierethikbuch?
Seit einigen Jahren ist der erfreuliche Trend festzustellen, dass immer mehr Menschen für tierethische Fragen sensibel werden und dass es viele diesbezügliche Diskussionen und einschlägige Publikationen gibt. Das vorliegende Buch wird einige dieser Ansätze kritisch diskutieren, erhebt aber nicht den Anspruch, die klassischen wie auch neuere tierethische Positionen systematisch darzustellen.3 Es wird eine Auseinandersetzung stattfinden mit den bio- und tierethischen Konzepten von Albert Schweitzer, Peter Singer, Tom Regan, Martha Nussbaum u. a. Zu Wort kommen werden auch Ethikerinnen und Ethiker wie Richard David Precht, Ursula Wolf, Anne Siegetsleitner, Leonie Bossert u. a. m. Auch in der Theologie wurden die Tiere mittlerweile als wichtiges Thema entdeckt. Eine wichtige Vorreiterrolle spielt der im deutschen Sprachraum wenig rezipierte anglikanische Theologe Andrew Linzey, der sich als Mitglied einer interdisziplinären Gruppe an der Universität Oxford in England gemeinsam mit namhaften Philosophen wie Peter Singer u. a. intensiv mit tierethischen Fragen auseinandergesetzt und schließlich eine eigene Tier-Theologie entwickelt hat.4 Er wurde zum ersten Inhaber eines theologischen Lehrstuhls für Tierethik und gründete 2006 das Oxford Centre for Animal Ethics, dessen Direktor er seither ist. Erwähnenswert ist auch das von Anton Rotzetter und Rainer Hagencord 2009 gegründete Institut für Zoologische Theologie in Münster, das sich eine wissenschaftlich fundierte theologische Würdigung des Tieres sowie die Erarbeitung und Förderung einer schöpfungsgemäßen Spiritualität zum Ziel gesetzt hat. Zudem haben sich theologische Ethikerinnen und Ethiker – wie Heike Baranzke, Michael Rosenberger, Eberhard Schockenhoff, Gerhard Marschütz, Kurt Remele, um nur einige zu nennen – intensiv mit tierethischen Fragen auseinandergesetzt und zum Teil eigene tierethische Ansätze vorgelegt.
Die vorliegende Publikation reiht sich in diese Stimmenvielfalt ein. Sie versteht sich als Diskussionsbeitrag und möchte zugleich mit der verantwortungsethischen Begründung eines tierethischen kategorischen Imperativs einen originären Beitrag dazu leisten, dass die katholische Kirche und die Theologie das schwerwiegende Defizit überwinden können, das ihnen in Bezug auf die Tierethik anzulasten ist. Gerhard Marschütz ist recht zu geben, wenn er es als „ärgerlich“ bezeichnet, „dass kaum je christliche Einsprüche gegen die zunehmende Brutalisierung des heutigen Umgangs mit Tieren vernehmbar sind“5. Auf der theologisch-ethisch reflektierten und auf der praktischen Ebene hat die Kirche eine Bringschuld zu leisten, denn (auch das wird zu thematisieren sein) den Problemen und Anliegen der Tierethik wird weder die christlich-abendländische noch die diesbezügliche Position des Lehramtes der katholischen Kirche gerecht, wie sie beispielsweise im Katechismus der Katholischen Kirche nachzulesen ist. Es ist sehr zu begrüßen, dass Papst Franziskus in seiner Sozial- und Umweltenzyklika Laudato si’ (2015) diesbezüglich längst fällige neue Akzente gesetzt hat. Es geht dabei nicht zuletzt darum, das reichhaltige biblische Erbe neu zu entdecken und fruchtbar zu machen, angefangen von der Schöpfungstheologie bis hin zur Eschatologie, d. h. der Lehre von den Hoffnungen auf Vollendung nicht nur des Menschen, sondern der gesamten Schöpfung.
Die spezifischen theologischen Fragestellungen werden im ersten (schöpfungstheologischen) sowie im vierten Teil (Schöpfungsspiritualität und Eschatologie) vertieft, während im zweiten (philosophischen) und dritten (anwendungsorientierten) Teil auf unmittelbare theologische Bezüge verzichtet wird. Der Grund hierfür liegt nicht darin, dass zwischen Theologie auf der einen und Philosophie sowie angewandter Ethik auf der anderen Seite Gräben gezogen werden sollen. Dahinter steht vielmehr die Überzeugung, dass tierethische Forderungen ohne Rekurs auf die Theologie für jeden Diskursteilnehmer nachvollziehbar und von allgemein akzeptierten Annahmen ausgehend begründet und vermittelt werden können, dass umgekehrt aber – wie auch Papst Franziskus eindringlich unterstreicht – die Glaubensüberzeugungen einen Reichtum für eine ganzheitliche Ökologie, eine tiergerechte Ethik und eine volle Entwicklung der Menschheit bieten können. Die Naturwissenschaften, die Philosophie und die Theologie nähern sich von unterschiedlichen Ansätzen aus derselben Realität und können bzw. müssen in einen intensiven und für alle Seiten produktiven Dialog treten.6
In den folgenden Abschnitten der Einleitung sollen einige Grundannahmen hinsichtlich des Menschen-, Tier- und Weltbildes aufgezeigt werden, die für das Verständnis des Buches hilfreich sind.
2.Von der Selbsterkenntnis des Menschen durch das Tier
Im Juni 2016 kam der US-amerikanische Computeranimationsfilm Pets in die Kinos. Er erzählt vom geheimen Leben der Haustiere (so der englische Filmtitel The Secret Life of Pets) in Manhattan in New York. Über acht Millionen Einwohner zählt die Metropole. Durchschnittlich jeder vierte Einwohner – darunter besonders viele Singles – soll einen Hund halten, was die beeindruckende Summe von ca. zwei Millionen Vierbeinern ausmacht. Dazu kommen noch viele andere Haus- und Heimtiere: Katzen, Meerschweinchen, Kaninchen, Ziervögel, Fische … Die Tierliebe besonders von Menschen in Metropolen und Städten wird oft als stille Sehnsucht nach Wildnis und Ursprünglichkeit interpretiert. Manche deuten sie als Degenerationserscheinung des modernen Großstädters, der den Kontakt zur Natur verloren hat und durch die Haltung eines Heimtieres ein Stück Wildnis in seine Stadtwohnung holen möchte, obwohl manche noch nie in ihrem Leben einen Bauernhof besucht und eine Kuh, ein Pferd oder Schwein in echt gesehen oder Rehe, Hirsche usw. in freier Wildbahn beobachtet haben. Es werden auch Tiere gehalten, zu denen – etwa im Unterschied zu einem Hund oder einer Katze – keine wechselseitige emotionale Beziehung aufgebaut werden kann, z. B. Chamäleons, Geckos, Schlangen, Alligatoren, Käfer, Schildkröten usw. Zählt man die Wildtiere dazu, unter ihnen Nagetiere, Sing-, Greif- und Nachtvögel, Füchse, Kojoten, Alligatoren, Robben, ja sogar Bären, die sich bis in die Gärten der Vororte von New York vorwagen, und viele andere mehr, zeigt sich eine interessante Symbiose von Mensch und Tier, eine Durchmischung von Zivilisation und Wildnis, die nicht nur für die US-amerikanische Großstadt typisch ist.
Doch zurück zum Film über das heimliche Leben der Haustiere. Er ist eigentlich kein Film über Tiere, sondern über Menschen, denn – so der in tierethischen Fragen bewanderte Journalist und Jäger Eckhard Fuhr – „Tiere sind ein Spiegel. Das waren Tiere für Menschen schon immer.“7 Deshalb erzähle der Film „von der Selbsterkenntnis des Menschen durch das Tier“8. Die sprechenden Pets sind vermenschlichte Tiere, die mehr den menschlichen Protagonisten entsprechen als ihren wirklichen Artgenossen und die mehr über das Verhalten und Innenleben des Menschen aussagen als über jenes von Tieren – über die Einsamkeit, das Bedürfnis nach Nähe bis hin zur menschlichen Verantwortungslosigkeit, verkörpert in einem Alligator und einer Schlange, die ausgesetzt worden sind und nun in der Kanalisation ihre neue Heimat gefunden haben. Auch der Tierethiker Herwig Grimm betont: „Wer über Tiere spricht, macht den Menschen zum Thema“9, und zwar deshalb, weil wir immer nur die Position des Menschen einnehmen bzw. von uns selbst als Erkenntnissubjekt ausgehen können. In ein Tier können wir letztlich nie hineinschauen. Trotz der Empathiefähigkeit, uns in die Lage eines Tieres einzufühlen bzw. sein körperliches Verhalten und Anzeichen seines emotionalen Empfindens wahrzunehmen, bleibt es letztlich eine Form von Deutung und Interpretation, was wir glauben, wie es einem Tier geht bzw. wie es das, was es empfindet, subjektiv wahrnimmt.
Seit jeher leben Tiere und Menschen in einer engen Beziehung und Symbiose – und seit jeher ist unser Umgang mit den Tieren ambivalent und widersprüchlich. Die einen lieben wir, die anderen töten wir; die einen schützen wir, die anderen jagen wir; für die einen schaffen wir Tierfriedhöfe, die anderen enden in unseren Mägen. Selbst vegan lebende Menschen halten Hunde oder Katzen und nehmen in Kauf, dass andere Tiere getötet und zu Futter für ihre Lieblinge verarbeitet werden. Die meisten Menschen stimmen der Einschätzung zu, dass die Haltungs- und Schlachtungsbedingungen in der Massentierhaltung ethisch kaum zu rechtfertigen sind – und essen dennoch bedenkenlos tierische Nahrungsmittel, die aus solchen Betrieben stammen. Wir wissen um die tierquälerischen Umstände in den allermeisten Pelztierfarmen. Das Tragen von Pelzmänteln ist deshalb mittlerweile vielerorts verpönt – und dennoch erzielt die Pelzindustrie in Europa seit einem Einbruch in den 1990er-Jahren wieder jährliche Umsatzrekorde, weil Pelzteile in vielfacher Form als Krägen oder Futter von Winterjacken, als Modeaccessoires und anderes mehr verarbeitet werden. Tierversuche werden gemeinhin abgelehnt und viele Menschen haben abschreckende Bilder malträtierter Versuchstiere im Kopf – und doch nimmt seit Beginn der 2000er-Jahre die Anzahl der Tiere kontinuierlich zu, die in diversen Experimenten verwendet werden und zu Schaden kommen. Die Tierethiker Herwig Grimm und Markus Wild führen Studien an, denen zufolge „im Jahr 2014 über 23 Milliarden Nutztiere (Rinder, Schafe, Ziegen, Schweine, Geflügel) gehalten […], rund 64 Milliarden Tiere geschlachtet (Fische nicht eingerechnet) und rund 118 Millionen Labortiere verbraucht“10 worden sind.
Bei immer mehr Menschen führen diese Spannungen und Diskrepanzen zu einem Nach- und Umdenken. Sie werden besonders für das millionenfache Leid sensibel, das wir in unserer modernen Industriegesellschaft Tieren zufügen. Aus tierethischen Gründen beschließen sie einen tiefgreifenden Wandel ihres Ernährungs- und Lebensstils, werden entweder zu Vegetariern, verzichten also auf das Essen von Fleisch, oder zu Veganern, indem sie jeglichen Konsum von tierischen Produkten vermeiden, ja sogar die Nutztierhaltung als solche ablehnen. Dennoch, die meisten Menschen essen weiterhin Fleisch und konsumieren tierische Produkte, obwohl auch sie die Haltungs- und/oder Schlachtungsbedingungen der Tiere, die sie essen bzw. deren Produkte sie konsumieren, ablehnen oder ihnen zumindest kritisch gegenüberstehen. Man mag von einem paradoxen Zustand sprechen oder es schlichtweg als einen inkohärenten Lebens- und Konsumstil bezeichnen, dieser Umstand stellt uns jedenfalls vor große ethische Herausforderungen. Wir müssen uns kritisch fragen, warum wir so erstaunlich wenig Konsequenzen daraus ziehen, dass wir um das vielfache Tierleid wissen, das durch unseren Konsum- und Lebensstil verursacht wird.11 Grimm und Wild ist zuzustimmen: „Obwohl die Tierethik als Thema mitten in der Gesellschaft angekommen ist, hat sich damit die zentrale Fragestellung der Tierethik keineswegs erledigt, im Gegenteil.“12 Für sie lautet diese Grundfrage: „Was dürfen wir mit Tieren tun und was nicht?“13 In der vorliegenden Publikation soll sie wie folgt präzisiert werden: „Wie sollen wir Tiere behandeln, um ihnen gerecht zu werden?“
3.Von Tierethik, Tierschutz, Tierwohl und Tierrechten
Die Tierethik ist ein Teilbereich der Ethik und beschäftigt sich mit dem Verhältnis des Menschen zum Tier in moralischer Hinsicht. Jedes Konzept von Ethik ist an bestimmte anthropologische und weltanschauliche Denkmuster sowie an philosophische Argumentationsfiguren rückgebunden. In den folgenden Absätzen sollen sie – in sehr komprimierter Form – erklärt werden. Damit wird zugleich auch der tierethische Ansatz vorgezeichnet, der in dieser Publikation entfaltet wird.
Der philosophisch weniger interessierte Leser kann diese mehr theoretischen bzw. moralphilosophischen Ausführungen überspringen und zum vierten Kapitel der Einführung weiterblättern. Letztlich geht es – vereinfacht zusammengefasst – um drei Thesen. Erstens: Das Gute soll aus guten Gründen getan werden; und es gibt gute Gründe dafür, Tiere so zu behandeln, dass man ihren artspezifischen und individuellen Bedürfnissen, emotionalen Vermögen und kognitiven Fähigkeiten gerecht wird. Zweitens: Der Mensch ist im Sinne von Immanuel Kant ein moralisches Subjekt und als solches Adressat von kategorischen, d. h. unbedingten sittlichen Forderungen, die er erkennen kann und verwirklichen soll. Die Verantwortung für die Tiere ist Teil dieser sittlichen Forderungen. Drittens: Für das sittliche Handeln spielen auch moralische Gefühle wie Sympathie und Mitleid eine wichtige Rolle. Die Empfindungs- und Empathiefähigkeit stellen eine wichtige Motivationsquelle für tiergerechtes Handeln dar.
a) Was ist Ethik?
Ethik ist eine philosophische Disziplin und reflektiert – ganz allgemein formuliert – das Handeln des Menschen unter moralischer Perspektive. Im Unterschied beispielsweise zur Verhaltensbiologie, die versucht, die evolutionsgeschichtliche Entwicklung bestimmter Verhaltensweisen und deren evolutionären Nutzen zu verstehen, ist die Ethik keine rein deskriptive, sondern in erster Linie eine normative Wissenschaft, d. h. dass sie nicht nur den Ist-Zustand zu beschreiben und zu erklären versucht, sondern danach fragt, was sein soll. Sie ist das systematische Nachdenken über die Handlungen, das Verhalten und die Grundhaltungen des Menschen unter der spezifischen Rücksicht der sittlichen Beurteilung als gut bzw. böse auf der subjektiven sowie richtig bzw. falsch auf der objektiven Ebene. Die subjektive Ebene (gut bzw. böse) meint, dass der Mensch als das handelnde Subjekt mit seinen Motivationen, Intentionen, Interessen, Präferenzen … in den Blick genommen wird. Auf der objektiven Ebene hingegen (richtig bzw. falsch) wird danach gefragt, ob eine Handlung oder Grundhaltung „an sich“ sittlich richtig ist, d. h. ob sie mit allgemein gültigen sittlichen Prinzipien und Werten in Einklang gebracht werden kann, die in Normen verbindlich formuliert werden. Die Einsicht in das, was objektiv gesehen sittlich richtig ist, verdankt sich der vernünftigen Reflexion über die konkreten Erfahrungen einerseits sowie über abstrakte sittliche Werte andererseits, die man sich persönlich aneignet, und schließlich dem kritischen, vernunft- und wertegeleiteten Diskurs zwischen den moralischen Subjekten. Die Differenzierung zwischen der subjektiven und objektiven Dimension ist natürlich dahingehend eine abstrakte, als dass in einer konkreten Handlung die beiden Ebenen miteinander verflochten sind. Alle diese unterschiedlichen Aspekte machen die Moralität, d. h. die sittliche Güte einer Handlung aus. Dabei geht es darum, dass das, was auf der Ebene des handelnden Subjekts sittlich gut ist, mit dem in Einklang steht, was auch objektiv gesehen sittlich richtig ist, dass in diesem Sinne also das sittlich Gute dem sittlich Richtigen entspricht und umgekehrt. Das sittlich Richtige soll also auch mit einer sittlich guten Absicht getan werden. Umgekehrt reicht die gute Absicht allein nicht aus, um sittlich richtig zu handeln, sondern es bedarf der Sach- sowie ethischen Kompetenz und des Bemühens zu erkennen, wie in einer konkreten Situation das verwirklicht werden kann, was sittlich geboten ist. Der Volksmund bringt dies pointiert zum Ausdruck, wenn es heißt: Das Gegenteil von gut ist gut gemeint.
Die vorliegende Publikation will nicht eine Begründung des moralischen Anspruchs leisten, warum der Mensch überhaupt moralisch gut und richtig handeln soll, sondern es wird vorausgesetzt, dass die Erfahrung des Sollensanspruchs ein wesentliches Element menschlicher Selbsterfahrung und -beobachtung ist. Der theologische Ethiker Dietmar Mieth beschreibt die Grundstruktur der sittlichen Erfahrung in drei Elementen: in der Kontrast-, der Sinn- und der Motivationserfahrung.14 Kontrasterfahrung meint die erlebte Diskrepanz zwischen dem, was ist, und dem, was sein soll. Sie kann entstehen, weil unterschiedliche Normen miteinander in Konflikt geraten; weil die vorgefundene Situation einer wichtigen Norm und damit einem sittlichen Wert widerspricht; oder schlichtweg, weil jemand dank einer Art von moralischem Sinn intuitiv spürt, dass eine Situation nicht so ist, wie sie sein sollte, d. h. dass sie mit einem normativen Anspruch nicht in Einklang zu bringen ist. Für viele Menschen stellt in diesem Sinne das Wissen um artwidrige Haltungsbedingungen von Tieren und/oder von Schlachtungsvorgängen, die für das Tier physisch und psychisch mit Schmerzen und Belastungen wie Angst und Stress verbunden sind, eine Art von Kontrasterfahrung dar. Sie spüren, dass dies nicht richtig ist, und zwar unabhängig davon, ob sie das auch ethisch begründen können oder darüber ethisch reflektiert haben. In diesem Gespür, dass etwas nicht so sein soll, wie es ist, ist ein ebenso intuitives, d. h. zunächst noch nicht thematisiertes Wissen enthalten, wie die Situation sein könnte bzw. sollte. In unserem Fall bedeutet dies z. B., dass jemand angesichts malträtierter Tiere darum weiß, dass es nicht richtig ist, einem Lebewesen Schmerzen zuzufügen – wenigstens nicht grundlos. In der Auseinandersetzung mit der Wirklichkeit oder mit Werten und Normen, die es zu verwirklichen bzw. zu befolgen gilt, wird schließlich so etwas wie eine „Rationalität der Wirklichkeit“ erkennbar. Damit sind Sinnpotentiale gemeint, die der Wirklichkeit eingestiftet sind und die vom Menschen dank seiner Deutungsmöglichkeit des Vorgegebenen eingesehen und in Folge verwirklicht werden können. Vorausgesetzt wird dabei allerdings eine bestimmte Interpretation von Wirklichkeit, die jeder Mensch lebensweltlich, d. h. im Sinne einer vorwissenschaftlichen Selbstverständlichkeit und Erfahrbarkeit vornimmt. Den Glaubensvorstellungen kommt hier beispielsweise eine wichtige Funktion zu. Solche Sinnpotentiale können normativ formuliert werden, beispielsweise im Gebot, keinem Lebewesen zu schaden, bzw. dass es gute und vernünftige Gründe geben muss, die eine Schmerzzufügung rechtfertigen können. Diese Gründe deuten ihrerseits auf einen höheren Wert hin bzw. ein weiteres Sinnpotential, das ohne die Verletzung des ersten nicht verwirklicht werden kann. So wird z. B. in Bezug auf die Tierexperimente argumentiert, dass diese dann – und nur dann – ethisch vertretbar sind, wenn sie die einzige Möglichkeit darstellen, humanmedizinisch und veterinär wichtige Erkenntnisse zu erlangen, und dieser Erkenntnisgewinn auch mit hoher Wahrscheinlichkeit erzielt werden kann.15
Freilich muss der Mensch auch anerkennen, dass seiner Beziehung zum Tier mehr an Sinnpotentialen eingeschrieben ist als die Nutzung von Tieren zu seinen eigenen Zwecken. So kann er z. B. beobachten und wissenschaftlich untersuchen, wie positiv sich die Beziehung zwischen Mensch und Tier auf beide Seiten auswirken kann, und er kann den Eigenwert eines Tieres erkennen, der dessen Totalverzweckung verbietet, sowie Sinnwerte, die der Wirklichkeit von Tieren eingeschrieben sind. Die Kontrasterfahrung sowie die Auseinandersetzung mit einer Konfliktsituation – wie z. B. jener von Tierexperimenten, dass eine wichtige medizinische Erkenntnis nicht gewonnen werden kann, ohne einem Versuchstier Schaden zuzufügen – machen bestimmte Werte sichtbar bzw. rufen sie ins Bewusstsein. So wird eine Kontrasterfahrung zur Sinn- und schließlich zur Motivationserfahrung, weil sie einen Menschen drängt, etwas zu tun, um eine Situation so zu verändern, dass sie dadurch zum Besseren gewendet wird und etwas Sinnvolles für alle Beteiligten bzw. Betroffenen entsteht. Die Sinnerfahrung motiviert also einen Menschen, das ihm Mögliche zu tun, um sinnvoll zu wirken und eine negative Situation zu überwinden bzw. in einem Konfliktfall die richtige bzw. die je bessere oder – unter Umständen – die weniger schlechte Lösung zu finden. Der ethisch motivierte Vegetarismus und Veganismus sind z. B. Ausdruck dafür, dass jemand zur Überzeugung kommt: Es liegt auch an mir, die Haltungs- und Schlachtungsbedingungen von Nutztieren zu verbessern, indem ich durch meine Konsumverweigerung letztlich Druck ausübe auf jene, die Tiere halten und vermarkten. Auch der bewusste Konsum von Fleisch und tierischen Produkten ausschließlich von Betrieben, deren Haltungs- und/oder Schlachtungsbedingungen ethisch vertretbaren Kriterien entsprechen, zielt in diese Richtung.
Entsprechend dieser Beschreibung der Grundstruktur der sittlichen Erfahrung sind konkrete, moralisch reflektierte Erfahrungen ebenso wie kognitive und affektiv-emotionale Aspekte entscheidend für ein sittliches Urteil. Unter Kognition meint man die aus Erfahrungen und Nachdenken gewonnenen sittlich relevanten Einsichten wie z. B. das Prinzip der Schmerzvermeidung bei empfindungsfähigen Lebewesen oder den Eigenwert eines jeden Tieres. Moralische Gefühle und Motivationen hingegen bergen ein oft intuitives, weil vorreflexives Wissen um das, was sittlich richtig und geboten ist. So können beispielsweise Mitleid und Empathie dazu drängen, der Notsituation eines Tieres Abhilfe zu verschaffen, oder Empörung angesichts einer Unrechts- oder Leidsituation kann verhindern, dass man sich mit einem erlittenen oder beobachteten Unrecht einfach abfindet, wenn z. B. ein Tier durch nicht artgemäße und individuengerechte Haltungsbedingungen Schmerzen, Angst, Stress … erleidet. Moralische Gefühle sensibilisieren für das Leid und Unrecht, sie motivieren, dem entgegenzuwirken, und setzen entsprechende Kräfte frei. Nach dem Tierethiker Jean-Claude Wolf teilt der Mensch mit vielen Tieren die Empfindungsfähigkeit. In der natürlichen Fähigkeit des Mitfühlens sieht er eine der wichtigsten Motivationsquellen dafür, dass sich Menschen gegen jede Form von Tierleid oder Tierquälerei zur Wehr setzen.16
b) Die Moralfähigkeit als „anthropologische Differenz“
Im Lauf der Ausführungen wird eingehend auf die Gemeinsamkeiten, Ähnlichkeiten und Differenzen zwischen Mensch und Tier zurückzukommen sein. Ein Ergebnis sei vorweggenommen: „Weder ist der Mensch nichts anderes als ein Tier noch ist er ganz anders als ein Tier. Er ist das in Differenz zum Tier lebende Tier. Sein Dasein realisiert sich als Differenzgemeinschaft zum Tier. Zu bestreiten sind daher nicht die vielfältigen empirischen Einsichten der Zusammengehörigkeit von Mensch und Tier, sondern lediglich, dass hierin schon zugänglich wird, was der Mensch im Vergleich zum Tier ist.“17 Was den Menschen vom Tier unterscheidet, ist u. a. seine Moralfähigkeit. Von einem Menschen erwarten wir, dass er Verantwortung für sein Handeln übernimmt, auch für seinen Umgang mit den Tieren. Von einem Tier fordern wir eine solche Verantwortlichkeit nicht ein. Einen Menschen, der ein Tier misshandelt, ziehen wir dafür zur Rechenschaft, einen Löwen, der einen Menschen anfällt und verletzt, ja sogar tötet, machen wir dafür nicht verantwortlich.
Menschen haben die Fähigkeit, zwischen verschiedenen Handlungsmöglichkeiten zu wählen und sich für eine bestimmte zu entscheiden. Die jeweilige Entscheidung ist dabei nicht nur emotional-affektiv bedingt, sondern auch kognitiv begründet. Der Mensch kann sich einerseits seiner Emotionen vergewissern und sie kritisch reflektieren, er handelt also nicht nur „aus dem Bauch heraus“ oder bestimmten Impulsen oder Instinkten folgend, andererseits kann er vernünftig nachdenken und Gründe anführen, die seine Entscheidung bzw. sein Handeln rechtfertigen und als sittlich vertretbar ausweisen. Vereinfacht gesagt: Jemand handelt nicht nur aus Neigung oder impulsiv, motiviert durch Eigeninteresse oder Zweckdienlichkeit, sondern (auch) aus vernünftigen Gründen. Er will gewissen sittlichen Werten und Prinzipien entsprechen, von deren Richtigkeit und Verbindlichkeit er überzeugt ist, aber auch ein Ziel erreichen, das er für ethisch vertretbar hält. Willensfreiheit und Vernunftbefähigung begründen die Moralfähigkeit des Menschen. Beobachtet der Mensch sich, sein Handeln und Verhalten, wie er mit sich selbst und den Mitmenschen, aber auch mit den Tieren, der Umwelt und der Natur umgeht und zu ihnen in Beziehung steht, erfährt er sich als ein Wesen, das zu vernünftigem Wollen und Handeln befähigt und dafür verantwortlich ist, wie er diese Beziehungen gestaltet. Diese Fähigkeit, emotional reflektiert und vernünftig motiviert zu handeln, bzw. die Willensfreiheit und die Vernunft im Sinne praktischer Vernunft als Fähigkeit zur moralischen Entscheidung, markieren eine Differenz zwischen Mensch und Tier. Wie im Detail aufzuzeigen sein wird, bedeutet diese Differenz weder die Leugnung der Gemeinsamkeiten zwischen Mensch und Tier, noch begründet sie einen Ausschluss der nichtmenschlichen Lebewesen aus der moralischen Gemeinschaft. Das bedeutet: Auch wenn die nichtmenschlichen Lebewesen keine moralischen Subjekte im eben beschriebenen Sinn sind, sind sie moralische Objekte, d. h., dass der Mensch für das Verhalten ihnen gegenüber rechenschaftspflichtig ist. Der Mensch trägt Verantwortung für die Folgen seines Handelns und Verhaltens, als auch dafür, wie es sich auf die anderen – inklusive der Tiere und der Umwelt – auswirkt.
Der Verantwortungsbegriff setzt voraus, dass das handelnde Subjekt Urheber seiner Handlung ist und frei handeln kann. Eine Handlung lässt sich damit nicht – jedenfalls nicht zur Gänze – angemessen durch Rekurs auf sie bedingende äußere und innere Faktoren verstehen, etwa auf die äußeren Umstände, auf evolutionsbiologische Mechanismen oder die psychische Disposition eines Menschen. Nur unter dieser Bedingung wird ein Mensch zu einem verantwortlichen Subjekt. Als solches handelt er nicht (nur) aus Zweckmäßigkeit oder Neigung, sondern immer auch um des sittlich Richtigen wegen, um das er weiß – sei es mit dem zunächst noch unthematisierten, d. h. vorreflexiven „moralischen Gespür“, von dem bereits die Rede war, sei es im Sinne von vernünftig reflektierten und erkannten sittlichen Einsichten. Dem sittlichen Wissen wohnt ein verbindlicher Charakter inne, der als solcher nicht zur freien Disposition steht. Verantwortung erwächst aus der persönlichen Einsicht in das sittlich Richtige und in die Folgen des Handelns. Das moralische Gespür beispielsweise, dass es sittlich falsch ist, einem empfindungsfähigen Lebewesen Schmerzen zuzufügen, verpflichtet mich, Schmerzzufügung zu vermeiden – und wenn ich es trotzdem tue, unterliege ich hierfür der Rechenschaftspflicht, d. h. dass ich entsprechend vernünftige und gewichtige Gründe dafür aufweisen muss.
Verantwortliches Handeln bedarf schließlich neben dem genannten sittlichen Wissen auch der Sachkenntnis in Bezug auf das Handlungsobjekt. So macht es z. B. einen Unterschied, ob ein Organismus fähig ist, Schmerzimpulse im Sinne eines Reiz-Reaktions-Schemas zu verarbeiten, oder ob ein Individuum sie auch subjektiv als eine negative Empfindung wahrnehmen kann; und es macht einen Unterschied, ob ein Lebewesen zu kognitiven Leistungen fähig ist, die auf Selbstwahrnehmung und Ich-Bewusstsein schließen lassen, oder nicht. So wissen wir heute beispielsweise, dass Fische sehr wohl schmerzempfindlich sind und physiologisch die Voraussetzungen dafür haben, Schmerzen auch subjektiv wahrzunehmen, und dass Tiere wie Primaten, Delfine, Wale usw. die soeben genannten kognitiven Fähigkeiten besitzen. Diese naturwissenschaftlichen und verhaltensbiologischen Erkenntnisse sind von eminent ethischer Relevanz, sie bestimmen nämlich mit, was es bedeutet, sich diesen hochentwickelten und hochsensiblen Tieren gegenüber verantwortlich zu verhalten. Dabei bleibt in besonderer Weise die Tatsache zu berücksichtigen, dass uns gerade die faszinierenden Erkenntnisse der gegenwärtigen Verhaltensbiologie zugleich deutlich machen, wie wenig wir noch über bestimmte Tiere wissen. Unser Umgang mit den Tieren steht deshalb immer unter einem gewissen Vorbehalt eines möglichen Nichtwissens von ethisch relevanten Aspekten. Dieser Vorbehalt mahnt zu Zurückhaltung und Vorsicht.
c) Tiere als Mitglieder der moralischen Gemeinschaft
Die Forderung, Tiere als moralische Objekte und damit als Adressaten moralischer Verpflichtung anzuerkennen, bedeutet, sie in die moralische Gemeinschaft einzuschließen. Die Auswirkungen des menschlichen Handelns auf die Tiere sind Teil der menschlichen Verantwortung und damit sittlich rechenschaftspflichtig. Wir Menschen sind verantwortlich für unseren Umgang mit Tieren, allerdings – und hier wird die angesprochene anthropologische Differenz wiederum deutlich – nicht vor den Tieren. Ein Tier kann vom Menschen nicht Rechenschaft einfordern, wie er seine Verantwortung für es wahrgenommen hat. Menschen hingegen sind nicht nur füreinander verantwortlich, sondern können auch voneinander Rechenschaft verlangen: Sie sind für den anderen verantwortlich, aber auch vor ihm. Ein Kind kann beispielsweise seine Eltern zur Rechenschaft ziehen dafür, wie sie ihrer Verantwortung für ihr Kind nachgekommen sind, d. h., dass die Eltern für ihr Kind und auch vor ihm verantwortlich sind.18 Tiere stellen im Unterschied zum Menschen keine moralische Instanz dar, vor der der Mensch zur Verantwortung gezogen werden kann, aber sie sind moralische Objekte, für die er Verantwortung trägt.
In der vorliegenden Publikation wird an zentraler Stelle der tierethische kategorische Imperativ formuliert: Handle so, dass du die Tiere sowohl im einzelnen Individuum wie in der Gesamtgemeinschaft der Tiere nie bloß als Mittel zur Befriedigung eigener Interessen und Bedürfnisse brauchst, sondern ihnen zugleich auch entsprechend ihren je eigenen artspezifischen und individuellen Bedürfnissen, emotionalen Vermögen und kognitiven Fähigkeiten gerecht wirst.19 Sprachlich knüpft diese Formulierung an den kategorischen Imperativ von Immanuel Kant an. Im vorliegenden Kontext ist die Anekdote interessant und erwähnenswert, dass Kant über den kategorischen Imperativ nachzudenken begonnen hat, nachdem er eine für ihn zunächst unerklärliche Beobachtung bei Schwalben gemacht hatte. Sein wissenschaftlicher Assistent Ehregott Andreas Ch. Wasianski überliefert, wie Kant bei einem Spaziergang am Boden tote Schwalbenjunge sah, die von den Elternvögeln aus den Nestern geworfen worden sind. Die Erklärung für dieses Verhalten fand er darin, dass die Schwalbeneltern aufgrund von Futtermangel die schwächeren Jungen aus den Nestern drängen, um die anderen ausreichend ernähren zu können. Fasziniert von diesem „verstandesähnlichen Naturtrieb, der die Schwalben lehrt, beim Mangel hinlänglicher Nahrung für alle Jungen einige aufzuopfern, um die übrigen zu erhalten“, begann er, über ein Gesetz nachzusinnen, das den Menschen ebenso sicher leiten kann wie die Instinkte die Tiere.20
Doch zurück zum tierethischen Ansatz, der in der vorliegenden Publikation entfaltet und begründet wird: Das Wissen, das wir über Tiere haben, macht Sinnwerte einsichtig, die auch in die Wirklichkeit von Tieren eingeschrieben sind und die es zu achten gilt. Es wird entsprechend dem oben eingeführten Ethikverständnis für den Menschen in dem Moment ethisch relevant, in dem er Kenntnisse über die artspezifischen und individuellen Bedürfnisse, die emotionalen Vermögen und kognitiven Fähigkeiten von Tieren erlangt und sobald sein Handeln und Verhalten sich auf Tiere auswirkt, sei es im direkten Umgang mit den Tieren, sei es indirekt durch den Konsum von tierischen Produkten. Verantwortlichkeit bedeutet, dass jemand die unterschiedlichen Aspekte, Umstände, Folgen usw. seines Handelns bedenkt und in seinen Entscheidungen berücksichtigt. Tierethische Forderungen ergeben sich in diesem Sinne zuallererst aus der Moralität menschlichen Handelns, sodass sie weder im Tier als solchem noch in den Interessen bzw. Zwecksetzungen des Menschen zu begründen sind. Auch wenn auf die tierethisch intensiv diskutierten Fragen einzugehen sein wird, ob (manche) Tiere als Personen angesehen werden können, ob bzw. in welchem Sinn sie als Rechtsträger gelten können, ob bzw. in welchem Sinn Tiere eine Würde haben usw., liegt der Akzent des hier zu entfaltenden Ansatzes auf der sittlichen Verantwortung des Menschen, den in der Wirklichkeit von Tieren vorfindbaren Sinnpotentialen gerecht zu werden. Dieser Ansatz knüpft damit weniger an die unterschiedlichen Tierrechtstheorien an, denen zufolge die Pflichten des Menschen gegenüber den Tieren in Rechten oder im moralischen Status von Tieren zu begründen sind,21 sondern an den Anliegen des Tierschutzes, der sich am Tierwohl orientiert22 und – wie schon gesagt – die Pflichten des Menschen gegenüber den Tieren in der Moralfähigkeit des Menschen begründet. Diese Verhältnisbestimmung von Tierethik und Tierschutz durchzieht die vorliegende Publikation wie ein roter Faden. Etwas vereinfacht formuliert: Die Begründungslast, wie der Mensch Tiere behandeln und mit ihnen umgehen soll bzw. dass er dem Tierwohl nicht schaden, sondern es fördern soll, liegt nicht bei den Tieren, sondern beim Menschen und seiner Moralität.
Mit der Betonung, dass es um die Berücksichtigung von artspezifischen und individuellen Aspekten seitens der Tiere geht, denen der handelnde Mensch gerecht werden soll, wird auch deutlich, dass es „die“ Tierethik nicht gibt. Es gibt nämlich nicht „das“ Tier, sondern es gibt eine enorme Vielfalt von unterschiedlichsten Tierarten, die untereinander sehr divergent sein können, sodass der Unterschied zwischen Menschen und einigen Tierarten geringer ist als zwischen vielen Tierarten. Bei der Frage der Ähnlichkeit geht es nicht nur um die stammesgeschichtliche Verwandtschaft zwischen Menschen und einigen Tierarten, sondern auch um die evolutionsbiologische Entwicklung von vergleichbaren Verhaltensweisen sowie emotionalen und kognitiven Fähigkeiten aufgrund von sozial strukturierten Interaktionen bzw. der Anpassung an strukturierte Sozialsysteme. Ebenso ist das einzelne Tier nicht nur als ein Vertreter seiner Art zu sehen, sondern als Individuum mit einem individuellen Eigenwert und – je nach Stufe der organischen und psychischen Entwicklung einer Art – mit einem eigenen Temperament und Charakter bis hin zur Fähigkeit eines rudimentären Ich- und Identitätsbewusstseins.23
Tierethik wird schließlich nicht nur als „Bereichsethik“ der angewandten Ethik verstanden. Wie schon angeklungen ist, geht es in ihr auch ganz grundsätzlich um das Selbstverständnis des Menschen sowie um die Grundfragen der Ethik. Wie sich im Lauf des Buches zeigen wird, betrifft sie auch die unterschiedlichsten Bereiche von Ökologie, Ökonomie, Medizin usw. bis hin zu Fragen der sozialen Gerechtigkeit.24
4.„Weh dem, der vor dem Leid eines Tieres die Augen verschließt …“
Insgesamt versteht sich dieses Buch als eindringlicher Appell zu einem humaneren Umgang mit den Tieren und zu einem bewussteren Konsumverhalten und Lebensstil hinsichtlich seiner Auswirkungen auf die Tiere. Die Einleitung abrundend, soll nochmals der Bogen zur theologischen Motivation gespannt werden. Oft wird argumentiert, dass den Tieren und den Fragen der Tierethik in Theologie und Kirche nicht zuletzt deshalb zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt wurde und wird, weil zumal im Neuen Testament den Tieren kein besonderer Stellenwert zukommt. Abgesehen davon, dass diese Annahme so nicht zutreffend ist (wie aufzuzeigen sein wird), gibt es in apokryphen Texten, d. h. in Schriften aus der frühchristlichen Zeit, die nicht in den biblischen Kanon aufgenommen worden sind, Überlieferungen, in denen Jesus als Freund, Heiler und Befreier nicht nur der Menschen, sondern auch der Tiere dargestellt wird. Stellvertretend für viele solche Erzählungen soll eine Perikope koptischen Ursprungs angeführt werden. In ihr kommen einige zentrale tierethische Forderungen und Anliegen zur Sprache, wie: Misshandle kein Tier und füg ihm keine Schmerzen zu! Ein Tier ist keine Sache, und über es zu verfügen bzw. es zu besitzen berechtigt nicht dazu, mit ihm zu tun und zu lassen, was man will. Wie du ein Tier behandelst, wird letztlich auf dich selbst zurückfallen. Auch ein Tier hat Anrecht auf Mitleid. Verschließ deine Augen nicht vor dem Leid der Tiere!
„Und es begab sich, dass der Herr auszog aus der Stadt und ging über das Gebirge mit seinen Jüngern. Und sie kamen an einen Berg, dessen Straße war steil. Allda fanden sie einen Mann mit einem Esel. Das Tier aber war niedergestürzt, denn er hatte es überladen, und er schlug es, dass es blutete. Und Jesus trat zu ihm und sprach: Mensch! Was schlägst du dein Tier? Siehst du nicht, dass es Schmerzen leidet? Der Mann aber antwortete: Was geht es Euch an? Ich darf es schlagen, soviel es mir gefällt. Denn es ist mein Eigentum, und ich habe es gekauft um ein gutes Stück Geld. Frage die Leute, die bei dir sind! Denn sie kennen mich und wissen darum. Und einige von den Jüngern sprachen: Ja, Herr; es ist so, wie er sagt. Wir haben gesehen, wie er es gekauft hat. Aber der Herr sprach weiter: Sehet denn nicht auch ihr, wie es blutet, und höret denn nicht auch ihr, wie es jammert und schreit? Sie aber antworteten und sprachen: Nein, Herr; dass es jammert und schreit, hören wir nicht. Jesus aber ward traurig und rief: Wehe euch, dass ihr nicht hört, wie es schreit und klagt zum himmlischen Schöpfer um Erbarmen, dreimal wehe aber dem, über welchen es jammert und schreit! Und er trat herzu und rührte es an. Und das Tier stand auf und seine Wunden waren heil. Zu dem Manne aber sprach Jesus: Nun, treibe weiter; und schlage es hinfort nicht mehr, auf dass auch du Erbarmen findest.“25
TEIL 1
GRUNDFRAGEN ZUM VERSTÄNDNIS DER NATUR UND DER STELLUNG DES MENSCHEN IN IHR
1.Der Mensch – weder Mittel- noch Höhepunkt der Schöpfung
Ein verantwortungsethisches Verständnis der Gottebenbildlichkeit
Für die christliche Umwelt- und Tierethik ist das biblische Verständnis sowohl der Gottebenbildlichkeit des Menschen als auch des Herrschaftsauftrages, denen wir in Gen 1,26–28 begegnen, wichtig. Aus der Gottebenbildlichkeit ergeben sich bedeutsame Implikationen hinsichtlich der Frage, was den Menschen aus der biblischen Sicht vom Tier unterscheidet, aus dem Herrschaftsauftrag hingegen für die Problematik, wie sich der Mensch der Natur und besonders den Tieren gegenüber verhalten soll.
Zunächst eine grundsätzliche Vorbemerkung: Die entsprechenden Verse aus den ersten Kapiteln des Buches Genesis werden im Folgenden nicht als eine Art Bericht gelesen, wie Schöpfung geschehen ist, sondern als der Versuch darüber nachzudenken, was der Mensch um sich herum vorfindet und wie er sich in seiner Beziehung zu sich selbst sowie zu seiner natürlichen Umwelt erfährt. Es geht also nicht um Ursprung und Entstehung der Welt, als vielmehr um die Deutung von zutiefst menschlichen Erfahrungen der Geschöpflichkeit und wie sich der Mensch zur außermenschlichen Natur verhält.26 Die Erzählung von Schöpfung und Paradies stellt in dieser Perspektive vielmehr eine Art an den Anfang projizierte Vision davon dar, wie die Welt sein könnte, wenn es auf ihr kein Leid geben würde. In der Paradieserzählung in Gen 1–3 begegnen wir also einer tief im Menschen angelegten Ahnung, wie die vollkommene bzw. die vollendete, d. h. die von Leid und Übel erlöste Welt ausschauen könnte. Theologisch spricht man deshalb von der eschatologischen Dimension der Schöpfungserzählung, weil es um die letzte Hoffnung auf Heil und Vollkommenheit geht. Dabei ist interessant, dass die biblischen Autoren darüber nachgedacht haben, dass viel des Leids und Übels, dem der Mensch in der Welt begegnet ist, von Menschen zu verantworten ist, denn der Mensch hat die ambivalente Macht, Leben zu töten oder zu schützen, Lebensräume zu zerstören oder zu pflegen. Natürlich fügen auch andere Lebewesen einander Leid zu, etwa Raubtiere, die Beutetiere reißen. Allerdings – und darüber reflektieren die biblischen Autoren eingehend – ist der Mensch als einziges Lebewesen in der Lage, Rechenschaft für das abzulegen, was er tut; also auch dafür, dass er im Unterschied zu den Tieren dem Leben anderer Lebewesen auch dort nachstellt, wo dies nicht nur seinem Überleben dient, sodass seine konkrete Verfügungsmöglichkeit weit über die bloße Nutzung dieser Lebewesen zur eigenen Lebenserhaltung hinausgeht.
Doch nun im Detail zu den beiden Fragen: Was bedeutet die Gottebenbildlichkeit des Menschen und wie ist der Herrschaftsauftrag zu verstehen? Dabei soll die Schöpfung des Menschen im Kontext der Erschaffung der Tiere angeschaut werden, die am fünften (Vögel und Wassertiere) und sechsten Schöpfungstag (Landtiere und Menschen) stattfindet. Im Folgenden wird die Übersetzung der revidierten Elberfelder Bibel (2006) verwendet, die sich durch ihre Nähe zum hebräischen Urtext auszeichnet.
„Vers 20 Und Gott sprach: Es soll das Wasser vom Gewimmel lebender Wesen wimmeln, und Vögel sollen über der Erde fliegen unter der Wölbung des Himmels! 21 Und Gott schuf die großen Seeungeheuer und alle sich regenden lebenden Wesen, von denen das Wasser wimmelt, nach ihrer Art, und alle geflügelten Vögel, nach ihrer Art. Und Gott sah, dass es gut war. 22 Und Gott segnete sie und sprach: Seid fruchtbar und vermehrt euch, und füllt das Wasser in den Meeren, und die Vögel sollen sich vermehren auf der Erde! 23 Und es wurde Abend, und es wurde Morgen: ein fünfter Tag. 24 Und Gott sprach: Die Erde bringe lebende Wesen hervor nach ihrer Art: Vieh und kriechende Tiere und wilde Tiere der Erde nach ihrer Art! Und es geschah so. 25 Und Gott machte die wilden Tiere der Erde nach ihrer Art und das Vieh nach seiner Art und alle kriechenden Tiere auf dem Erdboden nach ihrer Art. Und Gott sah, dass es gut war.
26 Und Gott sprach: Lasst uns Menschen machen in unserm Bild, uns ähnlich! Sie sollen herrschen über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde und über alle kriechenden Tiere, die auf der Erde kriechen! 27 Und Gott schuf den Menschen nach seinem Bild, nach dem Bild Gottes schuf er ihn; als Mann und Frau schuf er sie. 28 Und Gott segnete sie, und Gott sprach zu ihnen: Seid fruchtbar und vermehrt euch, und füllt die Erde, und macht sie euch untertan; und herrscht über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über alle Tiere, die sich auf der Erde regen! 29 Und Gott sprach: Siehe, ich habe euch alles Samen tragende Kraut gegeben, das auf der Fläche der ganzen Erde ist, und jeden Baum, an dem Samen tragende Baumfrucht ist: es soll euch zur Nahrung dienen; 30 aber allen Tieren der Erde und allen Vögeln des Himmels und allem, was sich auf der Erde regt, in dem eine lebende Seele ist, habe ich alles grüne Kraut zur Speise gegeben. Und es geschah so.
31 Und Gott sah alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Und es wurde Abend, und es wurde Morgen: der sechste Tag.“
1.1 Gottebenbildlichkeit als Repräsentationsfunktion
Der Mensch wird nach Gen 1,26 als „Bild“ Gottes erschaffen. Mit dem entsprechenden hebräischen Begriff werden in der Regel Stelen oder Abbilder bezeichnet, die die Funktion haben, den Abgebildeten – sei es eine Gottheit, sei es eine Herrscherfigur – zu vergegenwärtigen. Dabei geht es gerade nicht um die äußere Form, sondern um die Funktion, Gott zu repräsentieren. Im Unterschied etwa zu anderen Kulturen wie beispielsweise jener Ägyptens oder Mesopotamiens wird diese Aufgabe nicht nur dem König zuerkannt, sondern jedem Menschen. Allerdings ist der Mensch nicht Gott; er ist nicht göttlich, wie die Ergänzung deutlich macht, dass er zwar nach dem „Bild“ Gottes, aber ihm nur „ähnlich“ geschaffen ist. „Ähnlichkeit“ bedeutet eine enge Zugehörigkeit, etwa im Sinne eines Verwandtschaftsverhältnisses, zugleich wird aber betont, dass zwei ähnliche Realitäten nicht ident sind. Auch darin kann zunächst eine scharfe Abgrenzung zu Vorstellungen herausgelesen werden, die sich in verschiedenen damaligen Kulturkreisen finden, wonach bestimmte Herrscherfiguren als göttlich verehrt worden sind. Dass der Mensch Gott als dessen Bild repräsentiert, liegt in dieser Ähnlichkeit begründet, die ihn zugleich von den Tieren unterscheidet. Beachtenswert ist, dass die Schöpfung des Menschen eingereiht wird in jene der übrigen Landtiere. Sie werden am selben, nämlich am sechsten Tag erschaffen, mit ihnen teilt er den Lebensraum „trockenes Land“, während die Vögel und die Wassertiere, die entweder die Luft oder das Wasser bewohnen – beides kein Lebensraum für die Menschen –, am fünften Tag geschaffen werden. Man kann also sagen, dass sich entsprechend diesem Text die Mensch-Tier-Differenz nicht auf der geschöpflichen Ebene ausmachen lässt, vielmehr ist der Mensch hineingenommen in die Reihe der anderen Landtiere. „Tier und Mensch sind in der Schöpfungsordnung von Gen 1 sehr nah beieinander angesiedelt.“27 Auch der sogenannte zweite Schöpfungsbericht in Gen 2,4b–25 lässt keinen Zweifel daran, wie nah sich Mensch und Tier sind: Beide sind aus dem Ackerboden geformt und teilen sich den Lebensodem sowie die Sterblichkeit. Sie bilden eine Schicksalsgemeinschaft, die Leben und Tod umfasst.28
„Denn das Geschick der Menschenkinder und das Geschick des Viehs – sie haben ja ein und dasselbe Geschick – ist dies: wie diese sterben, so stirbt jenes, und einen Odem haben sie alle. Und einen Vorzug des Menschen vor dem Vieh gibt es nicht, denn alles ist Nichtigkeit. Alles geht an einen Ort. Alles ist aus dem Staub geworden, und alles kehrt zum Staub zurück. Wer kennt den Odem der Menschenkinder, ob er nach oben steigt, und den Odem des Viehs, ob er nach unten zur Erde hinabfährt?“ (Koh 3,19–21)
Und dennoch: Nur vom Menschen heißt es, dass er „nach Gottes Bild, ihm ähnlich“ geschaffen ist. Auffallend ist, dass in Gen 1,26 von Gott im Plural die Rede ist. Dahinter könnte die Vorstellung von göttlichen Wesen stehen, die Gott im himmlischen Rat umgeben.29