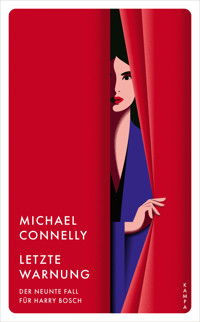Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Kampa Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Kampa Pocket
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2022
Jack McEvoy ist Polizeireporter bei den Rocky Moun tain News in Denver. Als er vom Tod seines Zwillingsbruders Sean, Detective bei der Mordkommission, erfährt, gerät sein Leben vollkommen aus dem Gleichgewicht. Die Polizei geht von Selbstmord aus: Jacks Bruder soll sich in seinem Auto erschossen haben. Einen Abschiedsbrief habe er auch hinterlassen, auf der Windschutzscheibe: Out of space. Out of time. Ein Zitat von Edgar Allan Poe. Jack glaubt nicht, dass sein Bruder sich selbst das Leben genommen hat und ermittelt auf eigene Faust. Dabei stößt er auf eine ganze Reihe ungelöster Todesfälle: Sean ist nicht der einzige Polizist, der unter ungeklärten Umständen umgekommen ist und Verse von Edgar Allan Poe hinterlassen haben soll. Jack sieht seine Zweifel an der Selbstmordthese bestätigt. Aber wer ist dieser »Poet«, der es vor allem auf Polizisten abgesehen hat? Was ist sein Motiv? Und wer wird das nächste Opfer sein?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 734
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Beliebtheit
Ähnliche
Michael Connelly
Der Poet
Der erste Fall für Jack McEvoy
Aus dem amerikanischen Englisch von Christel Wiemken
Kampa
Für Philip Spitzer und Joel Gotler
Großartige Ratgeber und Agenten, vor allem aber großartige Freunde
1
Tod ist mein Ressort. Ich lebe von ihm. Ich schmiede meinen beruflichen Ruhm mit seiner Hilfe. Ich behandle ihn mit der Leidenschaft und Präzision eines Bestattungsunternehmers – ernst und voller Mitgefühl, wenn ich mit den Hinterbliebenen spreche, wie ein erfahrener Handwerker, wenn ich allein bin. Ich war immer der Ansicht, das Geheimnis des Umgangs mit dem Tod bestünde darin, genügend Abstand zu ihm zu halten. Die Regel lautet: Man darf nicht zulassen, dass er einem ins Gesicht atmet.
Aber ich hatte keine Chance, mich an diese Regel zu halten. Als die beiden Detectives erschienen und mir von Sean erzählten, ergriff eine kalte Taubheit von mir Besitz. Es war, als befände ich mich in einem Aquarium. Ich bewegte mich wie unter Wasser – vor und zurück, vor und zurück – und betrachtete den Rest der Welt durch das Glas.
Vom Fond ihres Wagens aus konnte ich im Rückspiegel meine Augen sehen. Sie blitzten jedes Mal auf, wenn wir eine Ampel passierten. Ich erkannte den Blitz wieder. Aus den Augen der frisch verwitweten Frauen, die ich im Laufe der Jahre interviewt hatte.
Ich kannte nur einen der beiden Detectives, Harold Wexler. Ich hatte ihn ein paar Monate zuvor kennengelernt, als ich mit Sean auf einen Drink ins Pints Of gegangen war. Sie gehörten beide derselben Abteilung der Polizei von Denver an, der CAP, die für Verbrechen an Menschen zuständig war. Ich erinnerte mich, dass Sean ihn Wex genannt hatte. Cops reden sich immer mit Spitznamen an. Der von Wexler ist Wex, und der von Sean war Mac. Das ist so eine Art Stammesbindung. Einige der Namen sind nicht gerade schmeichelhaft, aber die Cops beschweren sich nicht. Ich kenne einen in Colorado Springs, der Scoto heißt und den die meisten Scroto nennen. Ein paar gehen sogar so weit, ihn Scrotum zu nennen, aber ich nehme an, man muss schon ein sehr guter Freund sein, um sich das erlauben zu dürfen.
Wexler war gebaut wie ein kleiner Bulle, kräftig, untersetzt, mit einer von Zigaretten und Whiskey verräucherten Stimme. Ein scharf geschnittenes, auffallend rotes Gesicht. Ich erinnere mich, dass er Jim Beam auf Eis trank. Mich interessiert immer, was Cops trinken. Es verrät eine Menge über sie. Wenn sie ihre Drinks unverdünnt zu sich nehmen, muss ich immer denken, dass sie vielleicht zu oft zu viele Dinge gesehen haben, die die meisten Menschen überhaupt nicht zu sehen bekommen. Sean trank an jenem Abend Lite Beer, aber er war auch noch jung. Obwohl er die Abteilung leitete, war er mindestens zehn Jahre jünger als Wexler. Zehn Jahre später hätte er seine Medizin vielleicht auch kalt und unverdünnt eingenommen wie Wexler. Doch das werde ich jetzt nie erleben.
Ich verbrachte den größten Teil der Fahrt damit, an jenen Abend im Pints Of zu denken. Nicht, dass dort irgendetwas Wichtiges passiert wäre. Nur ein paar Drinks mit meinem Bruder. Und das letzte Mal, dass wir uns richtig gut verstanden. Bevor Theresa Lofton auftauchte. Diese Erinnerung versetzte mich wieder zurück in das Aquarium.
Doch sobald die Realität es schaffte, das Glas zu durchdringen und in mein Herz vorzustoßen, überwältigte mich ein Gefühl des Versagens und des Kummers. Es war die erste wirkliche Seelenqual, die ich in meinen vierunddreißig Jahren durchmachen musste. Das schloss den Tod meiner Schwester mit ein. Damals war ich noch zu jung gewesen, um richtig um Sarah trauern oder auch nur den Schmerz eines nicht erfüllten Lebens begreifen zu können. Jetzt trauerte ich, weil ich nicht einmal gewusst hatte, dass Sean so dicht am Abgrund gestanden hatte. Er war Lite Beer gewesen, während all die anderen Cops, die ich kannte, Whiskey on the rocks waren.
Natürlich war mir bewusst, wie viel Selbstmitleid in dieser Art von Trauer steckte. Wir hatten einander lange Zeit nicht richtig zugehört. Wir hatten unterschiedliche Wege eingeschlagen. Und jedes Mal, wenn ich mir diese Tatsache eingestand, begann der Kreislauf des Kummers von vorn.
Mein Bruder hatte mir einmal die Theorie des Limits erklärt. Er sagte, jeder Cop, der in der Mordkommission arbeite, habe ein Limit, aber dieses Limit sei ihm unbekannt, bis er es erreicht habe. Er redete über Tote. Sean war überzeugt, dass jeder Cop nur soundso viele Tote ertragen konnte. Die Zahl lautete bei jedem anders. Manche klappten schon früh zusammen. Andere gehörten der Mordkommission zwanzig Jahre lang an und kamen nicht einmal in die Nähe des Limits. Aber eine Zahl gab es immer. Und wenn sie erreicht war, dann war Schluss. Man ließ sich ins Archiv versetzen, man gab seine Dienstmarke ab, man tat irgendetwas. Weil man den Anblick eines weiteren Toten einfach nicht ertragen hätte. Doch wenn man trotzdem blieb, wenn man sein Limit überschritt, nun ja, dann gab es Probleme, die damit enden konnten, dass man sich eine Kugel in den Kopf schoss. Genau das hatte Sean gesagt.
Mir wurde bewusst, dass mich der andere Detective, Ray St. Louis, angesprochen hatte.
Er war viel größer als Wexler. Selbst in dem schwachen Licht im Wageninnern konnte ich die Unebenheit seines pockennarbigen Gesichts erkennen. Ich kannte ihn nicht, aber ich hatte gehört, wie andere Cops über ihn redeten, und ich wusste, dass sie ihn Big Dog nannten. Als ich ihn und Wexler zusammen sah, als sie im Foyer der Rocky auf mich warteten, hielt ich sie für das perfekte Mutt-und-Jeff-Paar. Sie sahen aus, als wären sie direkt aus einem Spätfilm gestiegen. Lange, dunkle Mäntel. Hüte. Die ganze Szene hätte in Schwarz-Weiß sein sollen.
»Haben Sie gehört, Jack? Wir bringen es ihr bei. Das ist unser Job, aber es wäre uns sehr lieb, wenn Sie dabei sein könnten, vielleicht sogar bei ihr bleiben würden, wenn es hart auf hart geht. Sie wissen schon – wenn sie jemanden um sich braucht. Okay?«
»Okay.«
»Gut, Jack.«
Wir waren unterwegs zu Seans Haus. Nicht zu der Wohnung, die er sich mit vier anderen Cops in Denver teilte, damit er den Vorschriften entsprechend ein Einwohner von Denver war. Sondern zu seinem Haus in Boulder, wo seine Frau Riley uns die Tür öffnen würde. Ich wusste, dass niemand ihr etwas beizubringen brauchte. Sie würde wissen, was passiert war, sobald sie uns drei ohne Sean dastehen sah. Jede Frau eines Cops würde sofort Bescheid wissen. Diese Frauen verbringen ihr Leben damit, genau den Tag zu fürchten und sich auf ihn einzustellen. Jedes Mal, wenn jemand an die Tür klopft, rechnen sie damit, dass es Todesboten sein könnten. Diesmal würde es der Fall sein.
»Sie wird es sowieso wissen«, erklärte ich ihnen.
»Vermutlich«, sagte Wexler. »Sie wissen es immer.«
Mir wurde klar, dass sie darauf sogar bauten. Das würde ihren Job leichter machen.
Ich ließ mein Kinn auf die Brust sinken, schob die Finger unter die Brille und massierte meine Nasenwurzel. Mir war bewusst, dass ich zu einer Figur aus einer meiner eigenen Stories geworden war – dass ich die Zeichen des Kummers und Verlustes zur Schau stellte, die ich sonst so mühsam formulierte, damit eine fünfundsiebzig Zeilen lange Zeitungsstory besonders ergreifend wurde.
Ein Schamgefühl überfiel mich, als ich an all meine Anrufe bei einer Witwe oder den Eltern eines toten Kindes dachte. Oder bei dem Bruder eines Selbstmörders. Ja, sogar solche Leute hatte ich angerufen. Ich glaube nicht, dass es irgendeine Art von Tod gibt, über die ich nicht geschrieben habe, bei der ich nicht zum Eindringling in anderer Leute Schmerz geworden war.
Wie fühlen Sie sich? Worte, die einem Reporter geläufig sind. Immer die erste Frage. Vielleicht nicht so direkt gestellt, sondern sorgfältig hinter Worten getarnt, die Mitgefühl und Verständnis ausdrücken sollten – Empfindungen, die mir in Wirklichkeit abgingen. Ich habe sogar ein Andenken an diese Gefühllosigkeit. Eine schmale weiße Narbe auf meiner linken Wange, direkt oberhalb meines Bartes. Sie stammt von dem Diamanten am Verlobungsring einer Frau, deren Verlobter gerade in einer Lawine in der Nähe von Breckenridge ums Leben gekommen war. Ich stellte ihr die übliche Frage, und sie reagierte mit einer Rückhand quer über mein Gesicht. Damals war ich noch neu in diesem Job und glaubte, mir wäre unrecht geschehen. Heute trage ich die Narbe wie eine Medaille.
»Halten Sie bitte an«, sagte ich. »Ich muss mich übergeben.«
Wexler steuerte den Wagen sofort auf die Standspur des Freeways. Wir schlitterten ein wenig auf dem schwarzen Eis, doch dann gewann Wexler die Kontrolle zurück. Noch bevor der Wagen völlig zum Stillstand gekommen war, versuchte ich verzweifelt, die Tür zu öffnen, aber der Griff funktionierte nicht. Es war ein Polizeifahrzeug, begriff ich dann, und die meisten Leute, die auf dem Rücksitz mitfuhren, waren Verdächtige oder Gefangene.
»Die Tür«, brachte ich mühsam heraus.
Der Wagen kam schließlich mit einem Ruck zum Stehen, und Wexler löste die Sicherheitsverriegelung. Ich öffnete die Tür, beugte mich hinaus und erbrach mich in den schmutzigen Schneematsch. Eine halbe Minute lang rührte ich mich nicht, wartete auf mehr, doch es kam nichts. Ich war leer. Ich dachte an den Rücksitz des Wagens. Für Verdächtige und Gefangene. Ich nahm an, dass ich jetzt beides war. Verdächtig als Bruder. Und ein Gefangener meines eigenen Stolzes. Das Urteil würde natürlich lebenslänglich lauten.
Mit der Erleichterung, die der körperliche Exorzismus mit sich brachte, glitten diese Gedanken rasch hinweg. Ich stieg vorsichtig aus dem Wagen und ging bis an den Rand des Asphalts, auf dem die Lichter vorbeifahrender Wagen im Februarschnee in schillernden Regenbogenfarben reflektiert wurden. Es sah so aus, als hätten wir am Rande einer Viehweide angehalten, aber ich wusste nicht, wo wir waren. Ich hatte nicht darauf geachtet. Ich zog meine Handschuhe aus, nahm die Brille ab und steckte sie in meine Manteltasche. Dann bückte ich mich und grub durch die schmutzige Oberfläche, bis ich an Schnee kam, der weiß und sauber war. Ich nahm zwei Handvoll von dem kalten, sauberen Pulver, drückte es an mein Gesicht und verrieb es, bis meine Haut brannte.
»Alles okay?«, fragte St. Louis.
Er war mit dieser dämlichen Frage hinter mich getreten. Sie lag auf der gleichen Ebene wie das Wie fühlen Sie sich?, Ich ignorierte sie.
»Fahren wir«, sagte ich.
Wir stiegen wieder ein, und Wexler steuerte den Wagen wortlos zurück auf die Fahrbahn. Ich entdeckte das Schild für die Ausfahrt Broomfield und wusste nun, dass wir ungefähr die Hälfte der Strecke hinter uns hatten. Ich war in Boulder aufgewachsen und hatte die knapp fünfzig Kilometer zwischen Boulder und Denver bestimmt an die tausend Mal zurückgelegt, aber jetzt kam mir die Gegend wie ein Territorium auf dem Mond vor.
Zum ersten Mal dachte ich an meine Eltern und daran, wie sie auf die Nachricht reagieren würden. Stoisch, vermutete ich. So gingen sie mit allem um. Sie sprachen nie über irgendetwas. Sie machten einfach weiter. So war es bei Sarah gewesen. So würde es nun auch bei Sean sein.
»Warum hat er es getan?«, fragte ich nach ein paar Minuten.
Wexler und St. Louis antworteten nicht.
»Ich bin sein Bruder. Wir sind Zwillinge, verdammt noch mal!«
»Außerdem sind Sie Journalist«, sagte St. Louis. »Wir haben Sie abgeholt, weil wir möchten, dass jemand von der Familie bei Riley ist. Sie sind der Einzige …«
»Mein Bruder hat sich umgebracht!«
Ich sagte es zu laut, mit einem hysterischen Unterton, von dem ich wusste, dass er bei Cops nie wirkt. Man fängt an zu brüllen, und sie sind imstande, den Laden dichtzumachen, ganz cool zu werden. Ich fuhr mit gedämpfterer Stimme fort: »Ich meine, ich habe ein Recht darauf zu wissen, was passiert ist und warum. Ich habe nicht vor, irgendeinen gottverdammten Artikel zu schreiben. Himmel, ihr Kerle seid …«
Ich schüttelte den Kopf und beendete den Satz nicht. Wenn ich es versuchte, würde ich vermutlich wieder die Beherrschung verlieren. Ich schaute aus dem Fenster. Die Lichter von Boulder kamen näher. Erheblich mehr Lichter als in meiner Kindheit.
»Warum, wissen wir nicht«, sagte Wexler schließlich nach einer halben Minute. »Okay? Alles, was ich sagen kann, ist, dass so etwas vorkommt. Manchmal haben Cops die Scheiße satt. Vielleicht hatte Mac einfach genug davon. Wer weiß? Aber sie versuchen es herauszubekommen. Und wenn sie es wissen, werde ich es erfahren. Und ich werde es Ihnen sagen. Das ist ein Versprechen.«
»Wer untersucht den Fall?«
»Die Parkverwaltung hat es unserer Abteilung übergeben. SIU arbeitet daran.«
»Wie bitte? Das Dezernat für Sonderermittlungen? Die kümmern sich doch sonst nicht um Selbstmorde von Cops!«
»Normalerweise nicht. Das tun wir von der Abteilung CAP. Aber es ist so, dass sie uns nicht über einen unserer Leute ermitteln lassen wollen. Interessenkonflikt.«
CAP, dachte ich. Crimes Against Persons – Verbrechen an Menschen. Mord, Totschlag, Körperverletzung, Vergewaltigung, Selbstmord. Ich fragte mich, wer in den Berichten als derjenige Mensch benannt werden würde, an dem das Verbrechen begangen worden war. Riley? Ich? Meine Eltern? Mein Bruder?
»Es war wegen Theresa Lofton, stimmt’s?«, fragte ich. Obwohl es im Grunde keine Frage war. Ich hatte nicht das Gefühl, ihre Bestätigung oder ihr Dementi zu brauchen. Ich sprach nur laut aus, was für mich auf der Hand zu liegen schien.
»Wir wissen es nicht, Jack«, sagte St. Louis. »Belassen wir’s fürs Erste dabei.«
Der Tod von Theresa Lofton war die Art von Mord, die Leute aufhorchen ließ. Nicht nur in Denver, sondern überall. Er veranlasste jedermann, der davon hörte oder darüber las, zumindest eine Sekunde lang innezuhalten und über die Gewalttätigkeit nachzudenken, die diesen Tod begleitet hatte, über das flaue Gefühl im Bauch, das er verursachte.
Die meisten Tötungsdelikte sind kleine Morde. So jedenfalls nennen wir sie im Zeitungsgeschäft. Ihre Wirkung auf andere ist beschränkt, ihre Auswirkung auf die Imagination kurzlebig. Sie bekommen ein paar Absätze auf einer der Innenseiten, werden auf die gleiche Art in den Zeitungen vergraben wie die Opfer in der Erde.
Aber wenn eine hübsche College-Studentin an einem bis dahin friedlichen Ort wie dem Washington Park in zwei Teilen gefunden wird, dann ist für gewöhnlich in der Zeitung gar nicht genügend Platz für all das, was darüber geschrieben wird. Der Mord an Theresa Lofton war kein kleiner Mord. Er war ein Magnet, der Journalisten von überallher anzog. Und so fielen sie in Denver ein, aus Städten wie New York, Chicago und Los Angeles, Reporter von Fernsehsendern, von Massenblättern und von seriösen Zeitungen. Eine Woche lang wohnten sie in den besseren Hotels, durchstreiften die Stadt und den Campus der University of Denver, stellten bedeutungslose Fragen und erhielten bedeutungslose Antworten. Einige von ihnen trieben sich auch in der Umgebung der Kindertagesstätte herum, in der Lofton stundenweise gearbeitet hatte, oder fuhren hinauf nach Butte, wo sie herstammte. Wo immer sie aufkreuzten, erfuhren sie dasselbe – dass Theresa Lofton in die exklusivste aller Medienschablonen hineinpasste: die des typischen amerikanischen Mädchens.
Der Mord an Theresa Lofton wurde überall mit dem Fall der Schwarzen Dahlie fünfzig Jahre zuvor in Los Angeles verglichen. Damals war ein nicht ganz so typisches amerikanisches Mädchen, in der Mitte durchtrennt, auf einem unbebauten Grundstück gefunden worden. Eine reißerisch aufgemachte Fernsehshow erfand für Theresa Lofton den Namen Weiße Dahlie, weil sie auf einem schneebedeckten Feld in der Nähe des Lake Grasmere in Denver gefunden worden war.
Und so erhielt sich die Story aus sich selbst. Sie brannte fast zwei Wochen lang so heiß wie ein Feuer in einer Mülltonne. Aber niemand wurde verhaftet, und es gab andere Verbrechen, andere Feuer, an denen die nationalen Medien sich wärmen konnten. Meldungen über den neuesten Stand der Dinge im Fall Lofton wanderten auf die Innenseiten der Zeitungen von Colorado. Sie wurden zu Kurzberichten in der Rubrik Vermischtes. Und schließlich nahm Theresa Lofton nur noch einen Platz unter den kleinen Morden ein. Sie wurde vergraben.
Die ganze Zeit über blieben die Polizei im Allgemeinen und mein Bruder im Besonderen praktisch stumm und weigerten sich sogar, die Tatsache zu bestätigen, dass das Opfer in zwei Teilen gefunden worden war. Dieses Detail war nur zufällig durch einen Fotografen der Rocky bekannt geworden, der Iggy Gomez hieß. Er war auf der Suche nach Graffiti im Park gewesen, um jene Art von Fotos zu machen, die an einem Tag, an dem sonst nichts los ist, die Seiten füllen. Dabei war er vor allen anderen Journalisten oder Fotografen zufällig auf den Ort des Verbrechens gestoßen. Die Cops hatten den Coroner und die Kriminalbeamten telefonisch informiert, weil sie wussten, dass die Rocky und die Post ihren Funkverkehr abhörten. Gomez machte Aufnahmen von den beiden Tragbahren, die zum Abtransport der zwei Leichensäcke benutzt wurden. Er rief die Lokalredaktion an und sagte, die Cops arbeiteten an einem Doppelmord und der Größe der Säcke nach zu urteilen handele es sich vermutlich um Kinder.
Später machte sich ein Polizeireporter der Rocky an einen Informanten im Büro des Coroners heran, und von ihm erfuhr er die grauenhafte Tatsache, dass ein Mordopfer in zwei Teilen in die Leichenhalle gebracht worden war. Die Story, die die Rocky am nächsten Morgen veröffentlichte, war der Sirenengesang für sämtliche Medien überall im Lande.
Mein Bruder und seine CAP-Mannschaft taten so, als fühlten sie sich nicht im Mindesten verpflichtet, die Öffentlichkeit zu informieren. Jeden Tag gab der Pressesprecher der Polizei von Denver ein paar magere Zeilen als Presseinformation heraus, die besagten, dass die Ermittlungen fortgesetzt würden und es bisher noch keine Verhaftung gegeben hätte. Wenn sie sich in die Enge getrieben fühlten, erklärten die hohen Tiere, der Fall würde schließlich nicht von den Medien ermittelt, obwohl das im Grunde eine lächerliche Behauptung war. Da sie von den Behörden kaum Informationen erhielten, taten die Medien, was sie in solchen Fällen immer tun. Sie stellten ihre eigenen Ermittlungen an und betäubten die lesende und fernsehende Öffentlichkeit mit unzähligen Details über das Leben des Opfers, die in Wirklichkeit völlig unerheblich waren.
Nach ein paar Wochen war der Medienrummel dann vorbei, erstickt, weil es ihm an seinem Lebenselixier mangelte: an Informationen.
Ich schrieb nicht über Theresa Lofton. Aber ich hätte es gern getan. Es war eine Art von Story, die einem hier nicht alle Tage über den Weg läuft, und jeder Reporter hätte sich gern ein Stück davon abgeschnitten. Aber anfangs arbeitete Van Jackson daran, zusammen mit Laura Fitzgibbons, der für den Campus zuständigen Reporterin. Ich musste abwarten, bis meine Zeit gekommen war. Ich wusste, wenn die Cops die Sache nicht aufklärten, würde ich eines Tages zum Zuge kommen. Als Jackson mich im Frühstadium des Falles fragte, ob ich irgendetwas aus meinem Bruder herausholen könne, und sei es auch nur inoffiziell, sagte ich deshalb, ich würde es versuchen. Aber ich versuchte es nicht. Ich wollte die Story für mich und dachte nicht daran, Jackson zu helfen, indem ich ihm Material aus meiner eigenen Quelle überließ.
Ende Januar, als der Fall einen Monat alt und aus den Schlagzeilen verschwunden war, tat ich meinen ersten Schritt. Und machte einen Fehler.
Eines Morgens suchte ich Greg Glenn auf, den Lokalredakteur, und sagte ihm, dass ich mich gern umfassender mit dem Lofton-Fall beschäftigen würde. Das war meine Spezialität, mein Ressort. Lange Artikel über bemerkenswerte Morde im Rocky Mountain Empire. Ich erinnerte Glenn daran, dass ich einen Informanten hatte. Es sei der Fall meines Bruders, sagte ich, und er würde nur mir etwas darüber erzählen. Glenn dachte nicht lange darüber nach, welche Zeit und Mühe Jackson bereits in die Story investiert hatte. Ich hatte es geahnt. Alles, worum es ihm ging, war, eine Story zu bekommen, die die Post nicht hatte. Ich verließ sein Büro mit dem Auftrag.
Mein Fehler war, dass ich Glenn gesagt hatte, ich hätte einen Informanten, bevor ich mit meinem Bruder gesprochen hatte. Am nächsten Tag ging ich die zwei Blocks von der Rocky zur Polizeizentrale und traf mich mit ihm zum Lunch in der Cafeteria. Ich erzählte ihm von meinem Auftrag. Sean sagte, ich solle die Finger davon lassen.
»Gib’s auf, Jack. Ich kann dir nicht helfen.«
»Wie meinst du das? Es ist doch dein Fall.«
»Es ist mein Fall, aber ich arbeite weder mit dir zusammen noch mit sonst jemandem, der darüber schreiben möchte. Ich habe die wichtigsten Details bekannt gegeben, mehr brauche ich nicht zu tun, und dabei bleibt es auch.«
Er ließ den Blick durch die Cafeteria schweifen. Er hatte die ärgerliche Angewohnheit, einen nicht anzuschauen, wenn man anderer Ansicht war als er. Als wir noch klein waren, bin ich immer über ihn hergefallen, wenn er das tat, und habe ihm einen Stoß in den Rücken versetzt. Das ging jetzt leider nicht mehr.
»Sean, das ist eine gute Story. Du musst …«
»Ich muss überhaupt nichts, und es ist mir scheißegal, was für eine Story es ist. Diese Sache ist schlimm, Jack. Ich kriege sie nicht mehr aus dem Kopf. Und ich denke nicht daran, dir dabei zu helfen, mit ihr mehr Zeitungen zu verkaufen.«
»Sieh mich an, Mann. Ich bin Journalist. Mir ist es gleich, ob die Auflage steigt oder nicht. Mir geht es nur um die Story. Die Zeitung ist mir scheißegal. Du weißt ganz genau, wie ich in dieser Hinsicht denke.«
Endlich drehte er sich wieder zu mir um.
»Und du weißt jetzt, wie ich über diesen Fall denke«, sagte er.
Ich schwieg für einen Moment und zündete mir eine Zigarette an. Ich war damals auf ungefähr eine halbe Schachtel am Tag herunter und hätte darauf verzichten können, aber ich wusste, dass es ihn störte. Also rauchte ich.
»Rauchen ist hier nicht erlaubt, Jack.«
»Buchte mich doch ein! Dann hast du wenigstens irgendjemanden verhaftet.«
»Warum bist du nur gleich so ein Arschloch, sobald du nicht bekommst, was du haben willst?«
»Und weshalb bist du eines? Du kannst den Fall nicht aufklären, stimmt’s? Du willst nicht, dass ich herumwühle und über dein Versagen schreibe. Du hast bereits aufgegeben.«
»Jack, versuch es nicht mit solch einer Scheiße unter der Gürtellinie. Du weißt genau, das hat noch nie funktioniert.«
Er hatte recht. So etwas funktionierte nie.
»Was dann? Willst du diese kleine Horrorgeschichte einfach für dich behalten? Ist es das?«
»Ja. Ungefähr so könnte man es ausdrücken.«
Ich saß mit verschränkten Armen hinter Wexler und St. Louis. Es war tröstlich. Fast so, als hielte ich mich selbst zusammen. Je länger ich über meinen Bruder nachdachte, desto weniger Sinn machte die ganze Sache. Ich wusste, dass der Lofton-Fall ihm schwer zu schaffen gemacht hatte, aber nicht in dem Maße, dass er sich deshalb das Leben genommen hätte. Nicht Sean.
»Hat er seine eigene Waffe benutzt?«
Wexler musterte mich im Rückspiegel. Ich fragte mich, ob er wusste, was einen Keil zwischen meinen Bruder und mich getrieben hatte.
»Ja.«
Die Antwort traf mich wie ein Schlag. Es war einfach unvorstellbar. Der Lofton-Fall war mir egal. Was sie sagten, konnte einfach nicht stimmen.
»Das glaube ich nicht.«
St. Louis drehte sich um und sah mich an.
»Wie meinen Sie das?«
»Er hätte es nicht getan, das ist alles.«
»Hören Sie, Jack, er …«
»Er hatte die Scheiße, die aus dem Rohr kommt, nicht satt. Er liebte sie. Fragen Sie Riley. Fragen Sie irgendjemanden im … Wex, Sie haben ihn am besten gekannt, und Sie wissen, dass es Blödsinn ist. Er liebte die Jagd. So hat er es immer genannt. Er hätte sie gegen nichts auf der Welt eingetauscht. Er hätte inzwischen stellvertretender Polizeichef sein können, aber er wollte es nicht. Er wollte im Morddezernat arbeiten. Er blieb bei CAP.«
Wexler antwortete nicht. Wir waren mittlerweile in Boulder und fuhren auf der Baseline in Richtung Cascade. Ich hatte das Gefühl zu fallen.
»Was ist mit einem Abschiedsbrief?«, sagte ich schließlich. »Was …«
»Es gibt einen Abschiedsbrief. Jedenfalls etwas in der Art.«
Ich bemerkte, dass St. Louis Wexler einen Blick zuwarf, der besagte: Du redest zu viel.
»Was hat er geschrieben?«
Ein langes Schweigen.
Dann sagte Wexler: »Jenseits von Raum. Jenseits von Zeit.«
»Jenseits von Raum. Jenseits von Zeit. Sonst nichts?«
»Sonst nichts. Mehr stand nicht da.«
Das Lächeln auf Rileys Gesicht dauerte ungefähr drei Sekunden. Dann trat sofort der Ausdruck des Entsetzens an seine Stelle. Das Gehirn ist ein erstaunlicher Computer. Ein sekundenlanger Blick in die drei Gesichter an deiner Tür, und du weißt, dass dein Mann nie mehr nach Hause kommen wird. Damit könnte IBM nicht konkurrieren. Ihr Mund verwandelte sich in ein grauenhaftes schwarzes Loch, aus dem zuerst ein unverständlicher Laut hervorbrach und dann das unvermeidliche, nutzlose Wort: »Nein!«
»Riley«, versuchte Wexler. »Setzen Sie sich erst einmal hin.«
»Nein, oh Gott, nein!«
»Riley …«
Sie wich von der Tür zurück, bewegte sich wie ein in die Enge getriebenes Tier, zuerst in die eine, dann in die entgegengesetzte Richtung, ganz so, als glaubte sie, etwas ändern zu können, wenn sie uns nur entwischen konnte. Wir folgten ihr ins Wohnzimmer, wo sie mitten auf der Couch zusammenbrach und in einen nahezu katatonischen Zustand fiel. Tränen stiegen ihr in die Augen. Wexler setzte sich neben sie. Big Dog und ich standen einfach da, stumm wie Feiglinge.
»Ist er tot?«, fragte sie. Sie kannte die Antwort, wusste aber, dass sie dies noch hinter sich bringen musste.
Wexler nickte.
»Wie?«
Wexler schaute zu Boden und zögerte einen Augenblick. Dann sah er mich an und schließlich wieder Riley.
»Er hat es selbst getan, Riley. Es tut mir leid.«
Sie glaubte es nicht, ebenso wenig wie ich. Aber Wexler erzählte ihr die ganze Geschichte, und nach einer Weile hörte sie auf zu protestieren. Das war der Moment, in dem sie mich zum ersten Mal anschaute, tränenüberströmt. Auf ihrem Gesicht lag ein flehender Ausdruck, als wolle sie mich fragen, ob wir den gleichen Albtraum durchlitten und ob ich nicht etwas dagegen tun könnte. Warum weckte ich sie nicht auf? Konnte ich diesen beiden Typen aus einem Schwarz-Weiß-Film nicht sagen, wie sehr sie sich irrten? Ich setzte mich neben sie und nahm sie in die Arme. Dazu war ich da. Ich hatte diese Szene oft genug gesehen, um zu wissen, was von mir erwartet wurde.
»Ich werde hierbleiben«, flüsterte ich. »Solange du willst.«
Sie antwortete nicht, sondern löste sich aus meinen Armen und wandte sich an Wexler.
»Wo ist es passiert?«
»In Estes Park. Am See.«
»Nein, dorthin wäre er nie – was hat er da oben gemacht?«
»Er hatte einen Anruf bekommen. Jemand sagte, er hätte vielleicht Informationen zu einem seiner Fälle. Sean wollte sich mit ihm auf einen Kaffee im Stanley treffen. Danach … fuhr er zum See hinaus. Wir wissen nicht, weshalb er dorthin gefahren ist. Er wurde in seinem Wagen gefunden, von einem Ranger, der den Schuss gehört hatte.«
»Informationen zu welchem Fall?«, fragte ich.
»Hören Sie, Jack, ich möchte nicht …«
»Zu welchem Fall?«, brüllte ich, diesmal ohne Rücksicht auf meine Lautstärke. »Es war Lofton, stimmt’s?«
Wexler nickte kurz, und St. Louis trat kopfschüttelnd ans Fenster.
»Wen wollte er treffen?«
»Kann ich Ihnen nicht sagen, Jack. Details gehen Sie nichts an.«
»Ich bin sein Bruder. Und das ist seine Frau.«
»Es wird alles genauestens untersucht. Aber wenn Sie nach Unstimmigkeiten suchen – es gibt keine. Wir sind dort gewesen. Er hat sich selbst umgebracht. Er hat seine eigene Waffe benutzt, er hat eine Nachricht hinterlassen, und wir haben an seinen Händen Pulverrückstände gefunden. Ich wollte, es wäre nicht so. Aber er hat es getan.«
2
In Colorado schaufeln die Bagger beim Ausheben im Winter gefrorene Erdklumpen aus. Mein Bruder wurde im Green Mountain Memorial Park in Boulder begraben, kaum eine Meile von dem Haus entfernt, in dem wir aufgewachsen waren. Als Kinder kamen wir im Sommer auf dem Weg zum Chautauqua Park daran vorbei. Ich glaube nicht, dass wir je einen Blick auf die Grabsteine warfen und auch nur einen Gedanken daran verschwendeten, dass dies der Ort sein könnte, an dem wir einst enden würden. Doch genauso war es für Sean gekommen.
Der Green Mountain erhob sich über dem Friedhof wie ein riesiger Altar und ließ die kleine Versammlung am Grab noch kleiner erscheinen. Riley war natürlich da, zusammen mit ihren Eltern und meinen. Wexler und St. Louis, an die zwei Dutzend weitere Cops, ein paar Freunde von der Highschool, mit denen weder Sean, Riley oder ich in Verbindung geblieben waren, und ich. Es war kein offizielles Polizeibegräbnis mit Fahnen und dem ganzen Trara. Dieses Ritual blieb denen vorbehalten, die in Ausübung ihres Dienstes ums Leben gekommen waren. Obwohl man argumentieren konnte, dass es sehr wohl ein Tod in Ausübung des Dienstes gewesen war, wurde er von der Zentrale nicht als solcher betrachtet. Also bekam Sean keine große Schau, und der größte Teil der Polizei von Denver blieb der Zeremonie fern. Selbstmord wird von vielen der Männer in Blau für ansteckend gehalten.
Ich war einer der Sargträger. Ich ging vorn, zusammen mit meinem Vater. Zwei Cops, die ich vor diesem Tag noch nie gesehen hatte, die aber zu Seans Team gehörten, übernahmen die Mitte, und Wexler und St. Louis das Ende. St. Louis war zu groß und Wexler zu klein. Mutt und Jeff. Deshalb neigte sich der Sarg nach einer Seite. Es muss merkwürdig ausgesehen haben. Meine Gedanken schweiften ab, während ich mit dem Gewicht kämpfte, ich stellte mir vor, wie Seans Körper in dem Sarg hin und her rollte.
Ich sprach an diesem Tag nicht viel mit meinen Eltern, obwohl ich mit ihnen und Rileys Eltern zurückfuhr. Wir hatten seit Jahren nicht mehr über irgendetwas Bedeutsames gesprochen, und nicht einmal Seans Tod konnte daran etwas ändern. Nach dem Tod meiner Schwester vor zwanzig Jahren hat sich ihr Verhältnis zu mir geändert. Es sah so aus, als wäre ich, der Überlebende des Unfalls, verdächtig geworden, gerade weil ich überlebt hatte. Außerdem bin ich sicher, dass ich sie seit damals mit meinen Entscheidungen immer wieder enttäuscht habe. Ich stelle mir all diese kleinen Enttäuschungen wie Zinsen vor, die sich auf einem Bankkonto ansammeln, bis so viel vorhanden ist, dass sie sich damit zur Ruhe setzen können. Wir sind einander fremd geworden. Ich besuche sie nur an irgendwelchen Feiertagen. Deshalb gab es auch nichts von Bedeutung, was ich zu ihnen hätte sagen können, und nichts, was sie zu mir hätten sagen können. Abgesehen vom gelegentlichen Schluchzen Rileys war es im Innern der Limousine so still wie in Seans Sarg.
Nach der Beerdigung nahm ich zusätzlich zu der einen freien Woche nach einem Todesfall, den die Zeitung gewährte, zwei Wochen Urlaub und fuhr ganz allein in die Rockies hinauf. Ich bin immer wieder fasziniert von den Bergen. Dort verheilen meine Wunden am schnellsten.
Ich fuhr auf der 70 nach Westen, durch den Loveland Pass und über die Gipfel nach Grand Junction. Ich ließ mir dafür drei Tage Zeit, machte zum Skilaufen halt, hielt manchmal einfach in Überholbuchten an, um nachzudenken. Nach Grand Junction fuhr ich Richtung Süden und erreichte am nächsten Tag Telluride. Ich hatte den Cherokee die ganze Zeit auf Allrad-Antrieb geschaltet. Ich blieb in Silverton, weil die Zimmer dort billiger waren, und lief eine Woche lang jeden Tag Ski. Die Abende verbrachte ich Jägermeister trinkend in meinem Zimmer oder am Kamin der jeweiligen Skihütte. Ich versuchte, meinen Körper zu erschöpfen, in der Hoffnung, dass meine Seele ihm zur Ruhe folgen würde. Aber es gelang nicht. All meine Gedanken kreisten um Sean. Jenseits von Raum. Jenseits von Zeit. Seine letzte Botschaft war ein Rätsel, das mein Verstand nicht lösen konnte.
Aus irgendeinem Grund hatte meines Bruders edle Berufung ihn verraten. Sie hatte ihn umgebracht. Der Schmerz, den diese simple Schlussfolgerung mir bereitete, wollte einfach nicht nachlassen, nicht einmal dann, wenn ich die Hänge hinunterglitt und der Wind mir hinter meiner Sonnenbrille Tränen in die Augen trieb.
Ich zweifelte das offizielle Untersuchungsergebnis nicht mehr an, aber es waren nicht Wexler und St. Louis, die mich überzeugt hatten, vielmehr die Zeit und die Tatsachen. Mit jedem Tag, der verging, war seine grauenhafte Tat etwas leichter zu verstehen und sogar zu akzeptieren. Und dann war da noch Riley. Am Tag nach jenem ersten Abend hatte sie mir etwas gesagt, was damals nicht einmal Wexler und St. Louis wussten. Sean war einmal in der Woche zu einem Psychiater gegangen. Natürlich standen ihm die Dienste von Polizeipsychologen zur Verfügung, aber er hatte sich für die private Lösung entschieden, weil er nicht wollte, dass seine Position durch negative Gerüchte in Gefahr geriet.
Mir wurde bewusst, dass er den Therapeuten ungefähr zu der Zeit aufgesucht haben musste, als ich ihm sagte, dass ich über Theresa Lofton schreiben wollte. Ich nahm jetzt an, dass er vielleicht versuchen wollte, mir die Seelenqualen zu ersparen, die der Fall ihm bereitete. Mir gefiel dieser Gedanke, und ich versuchte, mich in jenen Tagen in den Bergen an ihm festzuhalten.
Eines Abends nach viel zu vielen Drinks stand ich vor dem Spiegel des Hotelzimmers und zog in Erwägung, mir den Bart abzurasieren und mein Haar so kurz zu schneiden, wie Sean seines getragen hatte. Wir waren eineiige Zwillinge – dieselben nussbraunen Augen, hellbraunes Haar, schlanker Körperbau –, aber es war nicht vielen Leuten aufgefallen. Wir hatten uns immer sehr viel Mühe damit gegeben, anders als der andere zu sein. Sean trug Kontaktlinsen und stemmte Gewichte, um Muskeln zu bekommen. Ich trug eine Brille und hatte seit meiner Collegezeit einen Bart; Gewichte habe ich seit dem Basketball in der Highschool nicht mehr in die Hand genommen. Außerdem hatte ich jene Narbe vom Ring dieser Frau in Breckenridge. Meine Schlammschlachtnarbe.
Sean ging nach der Highschool zuerst zum Militär und dann zur Polizei. Später hatte er eine Teilzeitstelle und studierte nebenbei an der University of Colorado. Er brauchte das Studium, um in seinem Job noch weiter voranzukommen. Ich hingegen bummelte ein paar Jahre herum, lebte in New York und Paris. Dann studierte ich gleichfalls. Ich wollte Schriftsteller werden und landete im Zeitungsgeschäft. Seitdem machte ich mir immer wieder vor, es wäre nur ein vorübergehender Job. So ging es jetzt schon seit zehn Jahren, vielleicht sogar länger.
An jenem Abend in dem Hotelzimmer betrachtete ich mich für lange Zeit im Spiegel, aber ich rasierte mir weder den Bart ab, noch schnitt ich mir die Haare. Ich dachte an Sean, der jetzt unter der gefrorenen Erde lag, und hatte ein drückendes Gefühl im Bauch. Ich beschloss spontan, dass ich nach meinem Tod verbrannt werden will. Ich will nicht tief unten in der eiskalten Erde liegen.
Was mir am meisten zu schaffen machte, war die Abschiedsbotschaft. Die offizielle Stellungnahme der Polizei lautete: Nachdem mein Bruder das Stanley-Hotel verlassen hatte und durch den Estes Park zum Bear Lake hinaufgefahren war, hatte er angehalten und eine Zeit lang bei eingeschalteter Heizung den Motor laufen lassen. Sobald die Windschutzscheibe von der Wärme beschlagen war, hatte er seine Botschaft mit einem behandschuhten Finger darauf geschrieben, und zwar spiegelverkehrt, sodass man sie von außen lesen konnte. Seine letzten Worte an eine Welt, zu der zwei Elternpaare gehörten, eine Frau und ein Zwillingsbruder.
Jenseits von Raum. Jenseits von Zeit.
Ich konnte es nicht begreifen. Zeit für was? Raum für was? Er war von irgendeiner Verzweiflung getrieben worden, hatte aber nie mit uns darüber gesprochen. Er hatte die Hand weder nach mir noch nach seinen Eltern oder nach Riley ausgestreckt. Wäre es an uns gewesen, ihm die Hand entgegenzustrecken, obwohl wir keine Ahnung von seinen seelischen Verletzungen hatten? In meiner Einsamkeit auf den Landstraßen kam ich zu dem Schluss, dass das nicht der Fall war. Er hätte nach uns greifen müssen. Er hatte uns der Chance beraubt, ihn zu retten. Und damit hatte er es uns unmöglich gemacht, uns vor unserem eigenen Kummer und unseren Schuldgefühlen zu retten. Mir wurde klar, dass ein beträchtlicher Teil meines Kummers in Wirklichkeit Zorn war. Ich war zornig auf ihn, meinen Zwillingsbruder, wegen dem, was er mir angetan hatte.
Aber es ist schwer, auf einen Toten zornig zu sein. Und der einzige Weg, den Zorn loszuwerden, bestand darin, die Story anzuzweifeln. Und so begann der Zyklus wieder von vorn. Abstreiten, hinnehmen, Zorn. Abstreiten, hinnehmen, Zorn.
An meinem letzten Tag in Telluride rief ich Wexler an. Ich spürte, dass er nicht gerade glücklich darüber war, von mir zu hören.
»Haben Sie den Informanten gefunden, den aus dem Stanley?«
»Nein, Jack, leider nicht. Ich habe doch gesagt, ich würde Sie auf dem Laufenden halten.«
»Ich weiß. Trotzdem habe ich noch Fragen. Sie etwa nicht?«
»Lassen Sie die Sache auf sich beruhen, Jack. Uns allen wird wohler zumute sein, wenn wir diese Geschichte hinter uns haben.«
»Was ist mit dem SIU? Hat es diese Geschichte auch schon hinter sich? Akte geschlossen?«
»Vermutlich. Ich habe diese Woche noch nicht mit ihnen gesprochen.«
»Weshalb versuchen Sie dann immer noch, den Informanten zu finden?«
»Ich habe Fragen, genau wie Sie. Ein paar lose Enden.«
»Sie haben Ihre Ansicht über Sean geändert?«
»Nein. Ich will nur, dass es seine Ordnung hat. Ich möchte wissen, worüber er mit dem Informanten gesprochen hat, wenn er es überhaupt getan hat. Wie Sie wissen, ist der Lofton-Fall immer noch ungeklärt. Ich hätte nichts dagegen, wenn ich ihn an Seans Stelle lösen könnte.«
Mir fiel auf, dass er ihn nicht mehr Mac nannte. Sean gehörte nicht mehr dazu.
Am darauffolgenden Montag kehrte ich an die Arbeit bei der Rocky Mountain News zurück. Als ich in den Redaktionssaal kam, spürte ich, dass etliche Augenpaare auf mich gerichtet waren. Aber das war nichts Ungewöhnliches. Ich hatte einen Job, den jeder Journalist gern gehabt hätte. Keine tägliche Hetze, kein Redaktionsschluss. Ich konnte in der gesamten Rocky-Mountain-Region herumreisen und über nur eine Sache schreiben. Mord. Eine gute Mordgeschichte las jedermann gern. Manchmal nahm ich ein paar Wochen lang eine Schießerei in einer Siedlung mit Sozialwohnungen auseinander, erzählte die Geschichte des Schützen und die des Opfers und über ihr verhängnisvolles Aufeinandertreffen. Ein andermal schrieb ich über einen Mord in den besseren Kreisen draußen in Cherry Hill oder über eine Schießerei in einer Bar in Leadville. Arme und Reiche, kleine Morde und große Morde. Mein Bruder hatte recht gehabt, man verkaufte mehr Zeitungen, wenn etwas richtig erzählt war. Und ich musste es richtig erzählen. Ich musste mir Zeit lassen und es richtig erzählen.
Neben meinem Computer lag ein ungefähr dreißig Zentimeter hoher Stapel Zeitungen. Sie waren die Haupt-Materialquelle für meine Stories. Ich hatte sämtliche Tages-, Wochen- und Monatszeitungen abonniert, die zwischen Pueblo und Bozeman publiziert wurden. Ich durchforschte sie nach kleinen Berichten über Morde, aus denen ich eine große Hintergrundstory machen konnte. Es gab immer eine Menge davon. Das Rocky Mountain Empire hat eine gewalttätige Ader, schon seit den Zeiten des Goldrauschs. Ich hielt immer Ausschau nach etwas Besonderem, nach einer neuen Art des Verbrechens oder ungewöhnlichen Ermittlungen, nach einem Element des Verblüffenden oder einer herzzerreißend traurigen Geschichte. Es war mein Job, solche Elemente auszubeuten.
Doch an jenem Morgen suchte ich nicht nach einer Idee für eine Story, sondern nach früheren Ausgaben der Rocky und unserer Konkurrenz, der Post. Selbstmorde sind normalerweise kein Thema für Zeitungen, es sei denn, es gibt ungewöhnliche Umstände. Das war beim Tod meines Bruders der Fall gewesen. Ich nahm an, dass darüber berichtet worden war.
Ich hatte recht. Zwar hatte die Rocky nicht darüber geschrieben, vermutlich aus Rücksicht auf mich, doch die Post hatte am Morgen nach Seans Tod am Rande des Lokalteils einen kurzen Artikel gebracht.
DPD-Ermittler nimmt sich in Nationalpark das Leben
Ein Detective der Polizei von Denver, Leiter der Ermittlungen im Mordfall Theresa Lofton, wurde am Donnerstag im Rocky Mountain National Park tot aufgefunden. Amtlichen Verlautbarungen zufolge starb er an einem Schuss, den er sich selbst beibrachte.
Sean McEvoy, 34, wurde in seinem Dienstwagen gefunden, der auf einem Parkplatz in der Nähe des Bear Lake stand.
Die Leiche des Detectives wurde von einem Park-Ranger entdeckt, der gegen siebzehn Uhr einen Schuss hörte und auf den Parkplatz eilte, um festzustellen, was passiert war.
Die Parkverwaltung hat die Polizei von Denver gebeten, den Tod zu untersuchen, und die Angelegenheit liegt jetzt in den Händen des Dezernats für Sonderermittlungen. Detective Robert Scalari, der die Ermittlungen leitet, erklärte, vorläufige Untersuchungen hätten ergeben, dass es sich um einen Selbstmord handelte.
Scalari berichtete, am Tatort sei eine Notiz gefunden worden, weigerte sich aber, etwas über ihren Inhalt verlauten zu lassen. Er sagte, man vermute, dass McEvoy aufgrund von Problemen bei der Arbeit zu dieser Tat getrieben worden sei, doch Einzelheiten waren nicht zu erfahren.
McEvoy, der in Boulder aufgewachsen ist und noch immer dort lebte, war verheiratet, hatte aber keine Kinder. Er hat der Polizei von Denver zwölf Jahre lang angehört und dort Karriere gemacht. Zuletzt arbeitete er in der Abteilung CAP, die für sämtliche Gewaltverbrechen in der Stadt zuständig ist.
McEvoy war Leiter dieser Abteilung und somit auch für die Ermittlungen im Mordfall Theresa Lofton, 19, zuständig, die vor drei Monaten erwürgt und verstümmelt im Washington Park gefunden worden war.
Scalari lehnte jeden Kommentar darüber ab, ob McEvoy in seinem Abschiedsbrief den bis heute ungelösten Lofton-Fall erwähnt hat.
Scalari sagte, man wisse nicht, weshalb McEvoy zum Estes Park gefahren sei, bevor er sich umbrachte. Die Ermittlungen über den Tod dauern noch an.
Ich las den Artikel zweimal. Er enthielt nichts, was ich nicht bereits wusste, trotzdem übte er eine starke Faszination auf mich aus. Vielleicht lag es daran, dass ich inzwischen zu wissen glaubte, weshalb Sean die ganze Strecke bis hinauf zum Bear Lake gefahren war. Aber es widerstrebte mir, an diesen Grund zu denken. Ich schnitt den Artikel aus und legte ihn in eine Schreibtischschublade.
Mein Computer piepte, und auf dem Bildschirm erschien eine Nachricht. Der Lokalredakteur beorderte mich zu sich. Die Arbeit ging wieder los.
Das Büro von Greg Glenn lag am hinteren Ende des Redaktionssaals. Die Wand bestand aus Glas. Sie ermöglichte es ihm, die Nischen zu überblicken, in denen die Reporter arbeiteten, und gleichzeitig durch die Fenster an der Westseite die Berge zu betrachten, wenn sie nicht gerade von Smog verhüllt waren.
Glenn war ein guter Redakteur, dem bei einer Story in erster Linie daran lag, dass sie sich gut las. Das gefiel mir an ihm. In unserer Branche gehören die Redakteure einer von zwei Schulen an. Die eine steht auf Fakten und stopft so viele in eine Story hinein, bis sie überladen ist und niemand Lust hat, sie zu Ende zu lesen. Die andere Schule mag die Sprache und lässt es nicht zu, dass die Fakten sie behindern. Glenn mochte mich und ließ mich weitgehend selbst entscheiden, worüber ich schreiben wollte. Er setzte mich nie unter Zeitdruck und verstümmelte nie, was ich ablieferte. Mir war seit Langem klar, dass sich all das vermutlich ändern würde, wenn er die Zeitung verlassen oder auf einen anderen Posten außerhalb des Redaktionssaals degradiert oder befördert werden sollte. Lokalredakteure schaffen sich ihr eigenes Nest. Wenn meins zerstört würde, würde ich vermutlich wieder zu einem ganz gewöhnlichen Reporter werden, der sein Material aus dem täglichen Polizeibericht erhält. Der über kleine Morde schreibt.
Ich ließ mich auf dem gepolsterten Stuhl vor Glenns Schreibtisch nieder. Er beendete gerade ein Telefongespräch. Glenn war ungefähr fünf Jahre älter als ich. Als ich vor zehn Jahren bei der Rocky anfing, war er ein Spitzenjournalist, genau wie ich heute. Aber dann hatte er den Schritt ins Management getan. Jetzt trug er jeden Tag einen Anzug, auf seinem Schreibtisch stand eine dieser kleinen Statuen von einem Bronco-Footballspieler mit nickendem Kopf, er verbrachte mehr Zeit mit Telefonieren als mit jeder anderen Tätigkeit und achtete stets sorgfältig auf die politischen Winde, die aus der Konzernzentrale in Cincinnati herwehten. Er war ein Mann von vierzig Jahren, mit einem Bauch, einer Ehefrau, zwei Kindern und einem guten Gehalt, das jedoch nicht ausreichte, um ein Haus in der Gegend zu kaufen, in der seine Frau leben wollte. Das alles hat er mir einmal bei einem Bier im Wynkoop erzählt. Es war in den vier Jahren das einzige Mal gewesen, dass wir uns außerhalb der Redaktion trafen.
An einer Wand von Glenns Büro hingen die Titelseiten der letzten sieben Tage. Seine erste Amtshandlung an jedem Morgen bestand darin, die sieben Tage alte Titelseite abzunehmen und durch die neueste zu ersetzen. Ich vermute, das tat er, um den Überblick über die Nachrichten zu behalten und die Kontinuität unserer Berichterstattung zu überprüfen. Glenn legte den Hörer auf und sah mich an.
»Danke, dass Sie gekommen sind«, begrüßte er mich. »Ich wollte Ihnen nur noch einmal persönlich sagen, wie leid mir die Sache mit Ihrem Bruder tut. Und wenn Sie das Gefühl haben, mehr Zeit zu brauchen – kein Problem. Dann lassen wir uns etwas einfallen.«
»Danke, aber ich bin wieder da.«
Er nickte, machte aber keinerlei Anstalten, mich zu entlassen. Ich wusste, dass hinter dem Herbeizitieren noch etwas anderes steckte.
»Also, dann zum Geschäft. Haben Sie im Moment irgendetwas laufen? Soweit ich mich erinnere, wollten Sie gerade mit Ihrem nächsten Projekt anfangen, als … als das passierte. Ich kann mir gut vorstellen, dass es Ihnen jetzt guttun würde, sich mit etwas zu beschäftigen. Sie wissen schon, sich wieder in die Arbeit zu stürzen.«
In diesem Moment wurde mir klar, was ich als Nächstes tun wollte. Oh, der Gedanke war schon die ganze Zeit da gewesen. Aber er war nicht an die Oberfläche gekommen. Nicht, bevor Glenn mir diese Frage gestellt hatte. Danach lag es natürlich auf der Hand.
»Ich werde über meinen Bruder schreiben«, sagte ich.
Ich weiß nicht, ob es das war, was Glenn von mir hatte hören wollen, aber ich nehme es an. Ich glaube, er hatte Interesse an der Story gehabt, seit die Cops unten im Foyer auf mich gewartet und mir mitgeteilt hatten, was mein Bruder getan hatte. Und er war vermutlich intelligent genug, um zu wissen, dass er mir die Story nicht nahezulegen brauchte, dass ich von selbst auf sie stoßen würde. Es genügte, wenn er mir seine simple Frage stellte.
Jedenfalls schluckte ich den Köder.
Danach änderte sich alles in meinem Leben. Damals glaubte ich, etwas über den Tod zu wissen. Ich glaubte, über das Böse Bescheid zu wissen. Aber ich wusste überhaupt nichts.
3
William Gladdens Augen musterten die glücklichen Gesichter, die sich an ihm vorbeibewegten. Es war wie ein riesiger Verkaufsautomat. Bitte wählen Sie. Den mögen Sie nicht? Hier kommt schon die Nächste. Ist sie die Richtige?
Diesmal war niemand der oder die Richtige. Außerdem waren ihre Eltern viel zu nahe. Er würde warten müssen, bis jemand einen Fehler machte. Auf die Pier hinausging oder hinüber zu dem Verkaufsstand, um Zuckerwatte zu kaufen, und sein Goldstück so lange allein ließ.
Gladden liebte das Karussell an der Pier von Santa Monica. Nicht etwa, weil es einmalig war und es – der Story in dem Schaukasten zufolge – sechs Jahre dauerte, eines der galoppierenden Pferde mit der Hand zu bemalen, es wieder in seinen ursprünglichen Zustand zurückzuversetzen. Er liebte das Karussell auch nicht, weil es in zahllosen Filmen zu sehen gewesen war, die er im Laufe der Jahre gesehen hatte, vor allem, während er in Raiford war. Und er liebte es auch nicht etwa, weil es Erinnerungen an die Runden auf dem Karussell beim Sarasota County Fair heraufbeschwor, die er dort zusammen mit seinem Best Pal gedreht hatte. Er liebte es wegen der Kinder, die darauf fuhren. Unschuld und Hingabe an reinstes Glück spiegelten sich auf jedem Gesicht wider, während das Karussell sich zum Klang der Drehorgel drehte. Seit seiner Ankunft aus Phoenix war er immer wieder hierhergekommen, jeden Tag. Er wusste, dass es einige Zeit dauern konnte, aber eines Tages würde sich das Warten schließlich auszahlen, und er würde seinen Auftrag erledigen können.
Seine Gedanken wanderten zurück in die Vergangenheit, wie es seit Raiford so oft geschehen war. Er erinnerte sich an seinen Best Pal, seinen besten Kumpel. Er erinnerte sich an den pechschwarzen Wandschrank, in den nur unter der Tür her ein wenig Licht fiel. Er kauerte sich in die Nähe des Lichts, in die Nähe der Luft über dem Boden. Er konnte seine Füße sehen, die auf ihn zukamen. Jeden Schritt. Er wünschte sich, er wäre älter, größer, damit er das oberste Bord erreichen konnte. Wenn es doch nur so wäre! Dann würde sein Best Pal eine Überraschung erleben.
Gladden kehrte in die Gegenwart zurück. Er schaute sich um. Die Fahrt war zu Ende, und die letzten Kinder liefen zu ihren wartenden Eltern. Es hatte sich bereits eine neue Schlange von Kindern gebildet, die darauf brannten, zum Karussell zu stürmen und sich ein Pferd auszusuchen. Er hielt abermals nach einem dunkelhaarigen Mädchen mit glatter, brauner Haut Ausschau, sah aber keines. Dann bemerkte er, dass die Frau, die den Kindern die Tickets abnahm, ihn anstarrte. Ihre Blicke trafen sich, und Gladden schaute weg. Er rückte den Riemen seines Seesacks zurecht. Das Gewicht der Kamera und der Bücher darin hatte ihn über seine Schulter nach unten gezerrt. Er nahm sich vor, die Bücher das nächste Mal im Wagen zu lassen. Gladden warf einen letzten Blick auf das Karussell und strebte dann auf eine der zur Pier hinausführenden Türen zu.
Als er die Tür erreicht hatte, warf er noch einen beiläufigen Blick auf die Frau. Die Kinder kreischten vergnügt. Und die Frau, die die Tickets einsammelte, hatte ihn bereits wieder vergessen. Er war in Sicherheit.
4
Laurie Prine schaute von ihrem Terminal auf und lächelte, als ich hereinkam. Ich hatte gehofft, dass sie da sein würde. Ich ging um den Tresen herum, zog mir einen Stuhl von einem leeren Schreibtisch heran und setzte mich neben sie. Es schien ein ruhiger Moment in der Rocky-Bibliothek zu sein. »Oh nein«, sagte sie vergnügt. »Wenn Sie kommen und sich hinsetzen, dann weiß ich, dass es ein langer Tag werden wird.«
Das bezog sich auf die ausführlichen Recherchen, um die ich sie gewöhnlich bat, wenn ich eine Story vorbereitete. Ich wollte immer wissen, was über das Thema geschrieben worden war und wo.
»Tut mir leid«, sagte ich mit gespieltem Bedauern. »Hiermit könnten Sie für den Rest des Tages an Lexis und Nexis beschäftigt sein.«
»Sie meinen, falls ich hineinkomme! Was brauchen Sie?«
Sie sah sehr gut aus, putzte sich aber nie besonders heraus. Sie hatte dunkles Haar, das ich noch nie anders als geflochten gesehen hatte, braune Augen hinter einer Nickelbrille und volle Lippen, die sie nicht schminkte. Sie zog einen Notizblock heran, rückte ihre Brille zurecht und griff nach einem Kugelschreiber, bereit, zu notieren, was ich haben wollte. Lexis und Nexis waren Computer-Datenbanken für die meisten großen und weniger großen Zeitungen im Lande, außerdem für Gerichtsurteile und eine Unmenge anderer Parkplätze auf der Datenautobahn. Wenn man herausfinden wollte, wie viel über ein spezielles Thema oder eine bestimmte Story geschrieben worden war, dann war das Lexis/Nexis-Network der Ort, an dem man die Suche begann.
»Selbstmorde von Polizisten«, sagte ich. »Ich möchte alles wissen, was sich darüber finden lässt.«
Ihre Haltung versteifte sich. Vermutlich dachte sie, ich würde privat danach suchen wollen. Computerzeit ist teuer, und der Konzern hat die Verwendung für private Zwecke strikt verboten.
»Keine Sorge. Ich arbeite an einer Story. Glenn hat gerade seine Zustimmung gegeben.«
Sie nickte, aber ich war nicht sicher, ob sie mir glaubte. Ich vermutete, dass sie bei Glenn rückfragen würde. Ihre Augen kehrten zu ihrem Block zurück.
»Was ich brauche, sind sämtliche nationalen Statistiken über derartige Vorfälle, sämtliche Statistiken über das Verhältnis von Polizisten-Selbstmorden zu denen in anderen Jobs und der Gesamtbevölkerung sowie jede Erwähnung von Regierungs- oder anderen Organisationen, die sich vielleicht mit diesem Thema beschäftigt haben. Ach ja, und außerdem alle Glossen.«
»Glossen?«
»Sie wissen schon, alles, was je über Polizisten-Selbstmorde geschrieben worden ist. Gehen Sie fünf Jahre zurück. Ich bin auf der Suche nach Beispielen.«
»Wie Ihr …«
Sie hatte den Satz ohne nachzudenken begonnen.
»Ja, wie mein Bruder.«
»Es tut mir so leid.«
Mehr sagte sie nicht. Ich ließ das Schweigen ein paar Augenblicke zwischen uns verharren, dann fragte ich sie, wie lange die Computersuche ihrer Meinung nach dauern würde.
»Also, es ist im Grunde eine Routinesache, nichts Besonderes. Es wird mich einige Zeit kosten, und wie Sie wissen, muss ich unterbrechen, wenn Dringenderes dazwischenkommt. Wie wäre es mit heute am späten Nachmittag?«
»Wunderbar.«
Nachdem ich in den Redaktionssaal zurückgekehrt war, warf ich einen Blick auf die Wanduhr und stellte fest, dass es halb zwölf war. Genau der richtige Zeitpunkt für das, was ich tun musste. Von meinem Schreibtisch aus rief ich einen Informanten bei der Polizei an.
»Hey, Skipper, sind Sie im Hause?«
»Wann?«
»Zum Lunch. Es könnte sein, dass ich etwas brauche. Das heißt, ich brauche bestimmt etwas.«
»Mist. Okay, ich bin hier. Wann sind Sie zurückgekommen?«
»Heute. Bis nachher.«
Ich legte den Hörer auf, zog meinen Mantel an und verließ das Gebäude. Ich ging die beiden Blocks bis zur Zentrale der Polizei von Denver zu Fuß, zeigte am Eingang einem Polizisten meinen Presseausweis und fuhr dann hinauf in den dritten Stock zu den Büros des Dezernats für Sonderermittlungen.
»Ich habe eine Frage«, sagte Detective Scalari, nachdem ich ihm gesagt hatte, was ich wollte. »Sind Sie als Bruder hier oder als Reporter?«
»Beides.«
»Setzen Sie sich.«
Scalari lehnte sich über seinen Schreibtisch, vielleicht, damit ich bewundern konnte, wie meisterhaft er seine Haare verwoben hatte, um die kahle Stelle auf seinem Kopf zu verdecken.
»Hören Sie, Jack«, sagte er. »Damit habe ich ein Problem.«
»Was für ein Problem?«
»Also, wenn Sie als Bruder zu mir gekommen wären, der wissen will, warum er es getan hat, dann wäre das eine Sache, und ich würde Ihnen wahrscheinlich erzählen, was ich weiß. Aber wenn damit zu rechnen ist, dass das, was ich Ihnen erzähle, in der Rocky Mountain News auftaucht, dann halte ich lieber den Mund. Ich habe viel zu viel Respekt vor Ihrem Bruder, um zuzulassen, dass das, was passiert ist, die Auflage Ihrer Zeitung erhöht. Möglicherweise haben Sie diesen Respekt ja nicht.«
Wir waren allein in einem kleinen Büro, in dem vier Schreibtische standen.
Scalaris Worte machten mich wütend, aber ich schluckte meinen Zorn hinunter. Stattdessen beugte ich mich ihm entgegen, sodass er mein gesundes, volles Haar sehen konnte.
»Lassen Sie mich etwas fragen, Detective Scalari. Wurde mein Bruder ermordet?«
»Nein.«
»Sie sind sicher, dass er Selbstmord begangen hat?«
»Ganz sicher.«
»Und der Fall ist abgeschlossen?«
»Richtig.«
Ich zog meinen Oberkörper zurück.
»Dann verstehe ich Sie nicht.«
»Und warum nicht?«
»Weil Ihre Reaktion unlogisch ist. Sie sagen, der Fall ist abgeschlossen. Trotzdem kann ich den Bericht nicht sehen. Wenn er abgeschlossen ist, dann sollte mir gestattet werden, einen Blick hineinzuwerfen, weil Sean mein Bruder war. Und wenn er abgeschlossen ist, dann bedeutet das, dass ich als Reporter auch keine laufenden Ermittlungen behindere, wenn ich mir den Bericht ansehe.«
Ich ließ ihn das ein paar Augenblicke lang verdauen.
»Also«, fuhr ich schließlich fort, »gibt es Ihrer eigenen Logik zufolge keinen Grund, weshalb es mir nicht gestattet werden sollte.«
Scalari sah mich an. Er konnte seinen Zorn nur mit Mühe beherrschen.
»Hören Sie, Jack, in dieser Akte stehen Dinge, die besser unbekannt bleiben und keinesfalls veröffentlicht werden sollten.«
»Ich glaube, das kann ich besser beurteilen, Detective Scalari. Er war mein Bruder. Mein Zwillingsbruder. Ich habe nicht vor, ihm wehzutun. Ich versuche lediglich, für mich selbst etwas Sinn in die Sache zu bringen. Wenn ich danach darüber schreiben sollte, dann deshalb, um es zusammen mit ihm endgültig zu begraben. Okay?«
Wir starrten einander an. Jetzt war er an der Reihe, und ich wartete.
»Ich kann Ihnen nicht helfen«, sagte er schließlich. »Selbst, wenn ich es wollte. Der Fall ist abgeschlossen. Die Akte befindet sich bereits zur Verarbeitung im Archiv. Wenn Sie sie haben wollen, müssen Sie sich an die Leute dort wenden.«
Ich stand auf.
»Danke, dass Sie mir das gleich zu Beginn unseres Gesprächs erzählt haben.«
Ich ging ohne ein weiteres Wort hinaus. Ich hatte geahnt, dass Scalari mir die kalte Schulter zeigen würde. Ich war zu ihm gegangen, weil ich den Schein wahren musste und weil ich erfahren wollte, wo sich die Akte befand.
Ich ging die Treppe hinunter, die gewöhnlich nur von Cops benutzt wird, und machte mich auf den Weg zum Büro des Captains, der für die Verwaltung der Polizeizentrale zuständig war. Es war Viertel nach zwölf und der Schreibtisch im Empfangsbereich folglich leer. Ich ging daran vorbei, klopfte an und wurde aufgefordert, einzutreten.
Captain Forest Grolon saß an seinem Schreibtisch. Er war so groß, dass der normale Dienstschreibtisch vor ihm aussah wie ein Kindermöbel. Er war ein Mann mit dunklem Teint und kahl geschorenem Kopf. Ich vermutete, dass eine Waage ungefähr 150 Kilo anzeigen würde, wenn er sich daraufstellte. Ich ergriff seine ausgestreckte Hand und lächelte. Er war seit sechs Jahren einer meiner Informanten. Damals war ich ein kleiner Polizeireporter gewesen und er Sergeant im Streifendienst. Seither waren wir beide die Leiter hinaufgestiegen.
»Jack, wie geht es Ihnen? Sie sagten, Sie sind gerade zurückgekommen?«
»Ja, es hat eine Weile gedauert. Aber jetzt geht es mir wieder besser.«
Er erwähnte meinen Bruder nicht. Er war einer der wenigen Polizisten bei der Beerdigung gewesen, und das bewies seine Empfindungen mehr als Worte. Er setzte sich wieder, und ich ließ mich auf einem der Stühle vor seinem Schreibtisch nieder.
Grolon hatte nicht viel für die Aufrechterhaltung von Recht und Ordnung in der Stadt getan. Er saß in der Wirtschaftsabteilung der Polizei von Denver und war für das jährliche Budget verantwortlich, für Einstellungen und Ausbildung. Und auch für Entlassungen. Das alles hatte mit Polizeiarbeit wenig zu tun, aber es gehörte zu seinem Plan. Grolon wollte eines Tages Polizeichef werden und sammelte ein breites Spektrum von Erfahrungen, damit er, wenn die Zeit gekommen war, den besten Eindruck für diesen Job machen würde. Zu seinem Plan gehörte auch, dass er Verbindung zu den lokalen Medien hielt. Wenn es so weit war, würde er sich darauf verlassen, dass ich in der Rocky einen positiven Artikel über ihn brachte. Und den würde ich auch schreiben. Bis dahin konnte ich mich darauf verlassen, dass er auch für mich einiges tat.
»Also, wofür muss ich heute auf meinen Lunch verzichten?«, fragte er mürrisch, was zu der Show gehörte, die wir immer abzogen. Ich wusste, dass Grolon es vorzog, mich zur Mittagszeit zu treffen, wenn sein Assistent zum Essen gegangen und weniger damit zu rechnen war, dass er mit mir zusammen gesehen wurde.
»Sie müssen nicht auf Ihren Lunch verzichten. Sie bekommen Ihr Essen nur ein bisschen später. Ich möchte die Akte über meinen Bruder sehen. Scalari sagte, sie sei bereits zum Verfilmen ins Archiv geschickt worden. Ich dachte, Sie könnten sie vielleicht dort rausholen und mich ganz kurz hineinsehen lassen.«
»Weshalb, Jack? Weshalb wollen Sie schlafende Hunde wecken?«
»Ich muss die Akte sehen, Captain. Ich habe nicht vor, irgendetwas daraus zu zitieren. Ich möchte nur einen Blick hineinwerfen. Holen Sie sie gleich, und ich bin damit fertig, noch bevor die Mikrofilm-Leute vom Lunch zurückkommen. Niemand wird etwas davon erfahren. Nur Sie und ich. Und ich werde es nicht vergessen.«
Zehn Minuten später händigte Grolon mir die Akte aus. Sie war so dünn wie das Telefonbuch für die ganzjährigen Bewohner von Aspen. Ich weiß nicht, weshalb, aber ich hatte etwas Dickeres, Schwereres erwartet, als müsse zwischen der Dicke der Ermittlungsakte und der Gewichtigkeit des darin behandelten Todes ein Zusammenhang bestehen.
Zuoberst lag ein Umschlag mit der Aufschrift Fotos, den ich ungeöffnet beiseitelegte. Danach kamen ein Autopsiebericht und mehrere mit einer Büroklammer zusammengeheftete Standardberichte.
Ich hatte oft genug Autopsieberichte studiert, um zu wissen, dass ich die Seiten mit den endlosen Beschreibungen von Drüsen, Organen und den Allgemeinzustand des Körpers außer acht lassen und mich gleich den letzten Seiten zuwenden konnte, auf denen die Zusammenfassung stand. Dort gab es keine Überraschungen. Todesursache war eine Schusswunde im Kopf. Darunter war das Wort Selbstmord eingekreist. Blutuntersuchungen auf gebräuchliche Drogen hin hatten Spuren von Dextromethorphan-Hydrobromid ergeben. Darunter hatte ein Labortechniker notiert: Hustensaft, Handschuhfach. Das bedeutete, dass mein Bruder, abgesehen von einem Schluck Hustensaft aus einer im Wagen befindlichen Flasche, stocknüchtern gewesen war, als er sich den Lauf seiner Waffe in den Mund gesteckt hatte.
Die gerichtsmedizinische Analyse enthielt auch einen Bericht mit der Überschrift GSR, was, wie ich wusste, Gunshot Residue – Schießpulver-Rückstände – bedeutete. Darin hieß es, dass bei einer Neutronen-Aktivierungs-Analyse der von dem Opfer getragenen Lederhandschuhe am rechten Handschuh Partikel von verbranntem Schießpulver gefunden worden waren, was darauf hindeutete, dass er diese Hand zum Abfeuern der Waffe benutzt hatte. Auch in der Kehle des Opfers waren Pulverrückstände und Gasverbrennungen gefunden worden. Daraus ergab sich, dass sich der Lauf in Seans Mund befunden hatte, als sich der Schuss löste.
Der nächste Bestandteil der Akte war eine Auflistung der Beweismittel, und daran fiel mir nichts Ungewöhnliches auf. Danach entdeckte ich die Zeugenaussage. Der Zeuge war Park-Ranger Stephen Pena, der in einer Ein-Mann-Station und an einem Informationsschalter am Bear Lake Dienst tat.
Der Zeuge sagte aus, dass er, wenn er in der Station arbeitet, den Parkplatz nicht überblicken kann. Um etwa 16:58 Uhr hörte er einen gedämpften Knall, den er aus Erfahrung als einen Schuss identifizierte. Als Ursprungsort vermutete er den Parkplatz und lief sofort hinaus, weil er an einen illegalen Jäger dachte. Zu jener Zeit stand nur ein Wagen auf dem Parkplatz, und