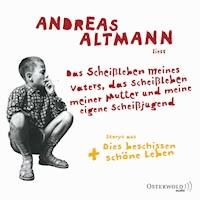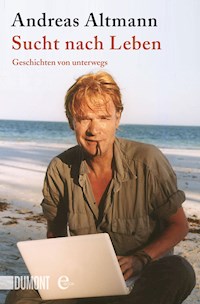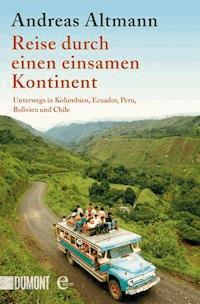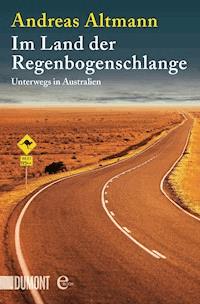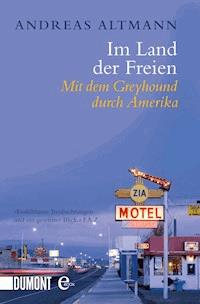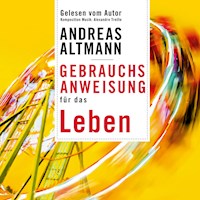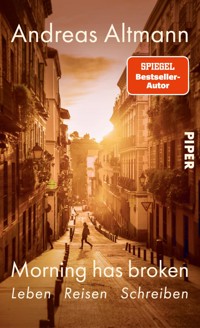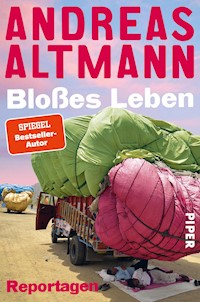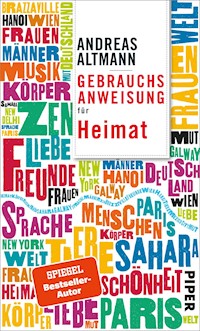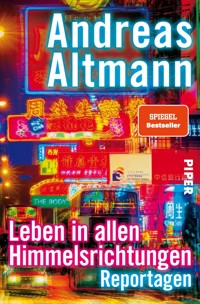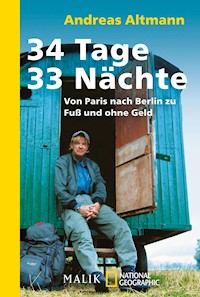12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks in Piper Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2012
Reisen, das Unterwegssein mit leichtem Gepäck, ist für Andreas Altmann eine Daseinsform. Sein Ziel dieses Mal: Südostasien. Thailand – mit einem Abstecher nach Myanmar-, Kambodscha, Vietnam. Ohne festen Plan, einzig seiner Intuition folgend. Er meidet die Touristenströme, begegnet Bettelmönchen und Schuhputzern, Zivilisationsmüden und Gestrandeten, einem alten Schriftsteller und einer exzentrischen Architektin. Sein Bericht strotzt vor Momenten praller Sinnlichkeit, ein wilder road movie und eine Reflexion über das Fremde und das eigene, reisende Selbst.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher:
www.malik.de
25 Farbfotos und einer Karte
Vollständige E-Book-Ausgabe der im Piper Verlag erschienenen Originalausgabe
5. Auflage Januar 2012
ISBN 978-3-492-95984-1
© Piper Verlag GmbH, München 2006
Redaktion: Karl-Heinz Bittel, München
Umschlaggestaltung: Dorkenwald Grafik-Design, München
Umschlag- und Bildteilfotos: Andreas Altmann, Paris
Kartografie: Eckehard Radehose, Schliersee
Satz: Sieveking GmbH, München
Datenkonvertierung: le-tex publishing services GmbH, Leipzig
Für Kathrin, the eye
Für Walter K., den fürsorglichen Tausendfüßler und Freund
Damals war das Leben warm, angesichts der ständigen Todesgefahr zeigte der Mensch Liebe.
Tran Duong, vietnamesischer Schriftsteller
Atme!
Yoko Ono zu John Lennon bei ihrer ersten Begegnung
Das hier ist die Gegenwart.
David Bowie
Vorwort
Ein rühriger Leser informierte mich einst über TV-Be-Gone, ein elektronisches Gerät. Eine Wunderwaffe, die man – diskret – Richtung Fernseher hielt, um ihn abzuschalten. In einem Café, in einem Bus, in einer Hotelhalle, ja, überall. Um am Leben zu bleiben. Um sich zu schützen vor den Zumutungen der Erniedrigung, der Gehirnwäsche.
Ich recherchierte unter der angegebenen Internetseite und fand einen erstaunlichen Text, vom (amerikanischen) Hersteller des Winzlings: »Durchschnittlich schauen die Leute in diesem Land täglich 4 1/2 Stunden fern. Lass mich dich fragen: All die Dinge, die du dir gewünscht hast – Leidenschaft, Romantik, Liebe, Abenteuer –, wann willst du dich darum kümmern? Stattdessen glotzt du auf ein Stück Möbel. (...) Wenn du Glück hast, wirst du 75 Jahre alt. Wie viel Zeit bleibt dir noch? Genug, um jede Woche mehr als einen vollen Tag und eine volle Nacht falschen Freunden bei ihrem falschen Leben zuzuschauen? Statt dein eigenes zu leben? TV verschafft dir keine Erfahrungen, keine Gefühle, kein Leben, es nimmt sie dir weg. Stell dir vor, auf deinem Totenbett böte dir jemand an, dir diese zehn gestohlenen Jahre zurückzugeben. Mit der Aussicht, sie anders, ganz anders zu verbringen. Würdest du dann aufwachen, endlich?«
Umgehend bestellte ich den High-Tech-Knebel. Das Gedröhn des Schwachsinns zum Schweigen zu bringen, schien mir ein wahrer Fortschritt. Leider stellte sich heraus, dass die TV-Industrie inzwischen Gegenmaßnahmen getroffen hatte. Die Glotze verstummte zwar, aber nur, um nach ein oder zwei Sekunden wieder anzuspringen.
Während der fast viermonatigen Reise durch Thailand, Kambodscha und Vietnam – reines Buddhaland – wurde mir einmal mehr klar, dass der Buddhismus hier aushelfen könnte. Nicht als Heilsverkünder, nicht als Erfinder von Paradiesen, nicht als Vertröster auf irgendwann, nicht als Alleswisser auf letzte Fragen, nein, nur als lästiger Erinnerer an die Gegenwart: Das da ist dein Leben, das Kostbarste, was du je besitzen wirst ! Hüte es!
Auf einer Flussfahrt durch das Mekongdelta hörte ich nachts im Radio ein Interview mit einem Mann, der zu Fuß die Strecke in Sibirien nachgegangen war, die einst Flüchtlinge auf sich genommen hatten, um den stalinistischen Gulags zu entfliehen. Der Franzose erzählte eine wunderbare Anekdote. Abends am Feuer schlug er das mitgebrachte Buch auf, eine Anthologie französischer Gedichte. Und immer versuchte er, die Verse einer Seite auswendig zu lernen. War es so weit, riss er das Blatt heraus und verbrannte es. Um nachzulegen. Wie klug: einmal den Verstand und das Herz, einmal den Körper zu wärmen mit Buchstaben.
Soll keiner denken, ich sei hier als Hausierer in Sachen Buddhismus unterwegs. Sprache, Poesie, auch sie taugen, um sich an jetzt, an heute zu erinnern. Alles taugt. Wenn es nur anfeuert, antreibt. Wenn es nur wach macht, weltwach, gegenwartsbegabt. Die drei Länder sind ein Geschenk an jeden Reisenden. Wer clever ist, wird sich an ihnen bereichern. Nicht als Krieger, nicht als business man, nur stets als einer, dem das Staunen den Kopf verdreht. In alle vier Himmelsrichtungen.
PARIS
Wintermorgen in Paris, die Stadt ist noch dunkel. Als ich an der Haltestelle den Rucksack absetze, lächelt mir eine Frau zu. Sie freut sich, weil jemand den einsamen Ort mit ihr teilt. So sagt sie. Das ist ein schöner Satz, so früh.
Im Bus zum Flughafen kommen Celia und ich ins Gespräch. Die 27-Jährige wohnt in Mexico City, verbrachte eine Zeit in Frankreich, um die Sprache zu lernen. Sie will Diplomatin werden, die Welt sehen und, wenn möglich, kein zweites Mal ihr Land betreten. »Zu viel Gewalt.« Sie weiß, wovon sie redet.
Vor drei Jahren fuhr ihr Bruder seine Frau ins Krankenhaus, zur Entbindung. Irgendwo auf der Strecke blockierten zwei Wagen den Weg, Raul wurde entführt, die Hochschwangere blieb geschockt zurück. Geldforderungen kamen, die Eltern zahlten. Zwanzig Tage später fand die Polizei eine Leiche in einem gestohlenen Kombi, Celias Bruder. Er war weder reich noch berühmt, aber in den letzten Jahren sind Mexikos Gangster bescheidener geworden. Sie kidnappen und beseitigen auch für tausend Dollar. Warum der 33-Jährige trotz Zahlung hingerichtet wurde? Die junge Frau weiß keine eindeutige Antwort. Vielleicht hat Raul einen der Entführer erkannt? Vielleicht aus Wut über die geringe Beute?
Celia erzählt irgendwann von ihren abendlichen Spaziergängen durch Paris und dem unglaublichen Gefühl der Sorglosigkeit dabei. In diesen Stunden entstanden ihre Fluchtpläne. Gleichzeitig kamen ihr Zweifel, ob sie genug Mut und Entschlossenheit mobilisieren könnte, um ihrer Heimat zu entfliehen. Dort liegt ihr Bruder begraben, dort scheint der Schmerz zu nah. Undenkbar, auf diesem Erdteil weiterzuleben. Undenkbar aber auch, die Familie, die Freunde zu verlassen. Sie schwankt. Seit Wochen, seit Monaten.
Abschied von Celia. Im Flugzeug fällt mir ein, dass ich kein tröstendes Wort für sie hatte. Dass ich, ohne nachzudenken, der Versuchung widerstand, sie mit ein paar platten Phrasen heimzuschicken. Im Gegenteil, ich habe an ihre Wut appelliert. Sie solle abhauen und woanders anfangen, weit weg. Mit ihren schwarzen Gedanken im Kopf hätte Mexiko keine Chance mehr. Dieses Kapitel Leben sei vorbei.
Schon vor der Reise hatte ich beschlossen, mich den Spielregeln des Buddhismus zu unterwerfen: kein schäbiges Mitleid, kein Betroffenheitsgestammel, keine flüchtigen Parolen. Dafür unduldsame Aufrufe zum Handeln, zum Widerstand, zur Veränderung. Get your lazy ass up!, der Imperativ stammt nicht vom Erleuchteten, sondern von dem amerikanischen Dichter Charles Bukowski. Der saß nie im Lotussitz, dennoch ist das ein lupenrein buddhistischer Merkspruch.
Nehru, Atheist und erster indischer Ministerpräsident, meinte einmal provozierend: »Alle intelligenten Menschen sind Buddhisten.« Weil keine Heiligen und keine heiligen Jungfrauen, auch keine Stellvertreter Gottes sich anmaßen, die Wahrheit zu besitzen. Buddhisten müssen suchen, müssen nichts glauben, müssen nur dem vertrauen, was sie selbst gefunden haben. Schön wär’s. Die Wirklichkeit ist komplizierter.
THAILAND
Am nächsten Morgen Ankunft in Bangkok. Direkt gegenüber dem Flughafen gibt es einen kleinen Bahnhof, ich nehme den Zug nach Lopburi. Die Stadt liegt drei Stunden weiter nördlich. Eine Brise weht durch die Waggons, die Türen und Fenster stehen weit offen. Nach einem Nachtflug wird Zugfahren zu einem leicht surrealen Erlebnis. Die feuchte Hitze und die Müdigkeit versetzen den Körper in Trance. Wer Opium raucht, kennt diesen Zustand glücklicher Erschöpfung. So ein Schweben zwischen Einheit und Versöhnung.
Als ich ankomme, rufe ich Yves W. an, wir kennen uns. Über Jahre hat der Belgier als Arzt in Prabat Nampu gearbeitet, dem Aids-Kloster, nur ein paar Kilometer außerhalb Lopburis gelegen. Es ist das zweite Mal, dass ich als Freiwilliger hierher komme, als Putzfrau, als Windelwechsler und Masseur. Um mein schlechtes Gewissen vor Ort abzuarbeiten. Weil es mir gut geht und anderen dreckig.
Ein buddhistischer Mönch hat hier Anfang der 90er Jahre einen verkommenen Tempel renoviert und als Hospiz für HIV-Kranke eingerichtet. Damit sie nicht in Heroinlöchern verwahrlosen oder als krätzekranke Wiedergänger durch die Straßen von Bangkok irren. Damit eine Ahnung von Würde und Fürsorge ihren Tod begleitet.
Yves’ Leistungen waren überirdisch, Tuberkulose, Burn-out, Depressionen, sogar den (folgenlosen) Kratzer mit einer infizierten Nadel hat er hinter sich. Jetzt scheint alles anders. Zwanzig Minuten nach meinem Anruf braust er mit seinem Moped vor das Restaurant, wo wir uns verabredet haben. Und packt aus.
Vorgeschichte: Seit kurzer Zeit gibt es in Thailand eine Art Sozialversicherung, konkret: Die Regierung produziert die Medikamente für die Dreifachtherapie in Eigenregie und stellt sie den versicherten Kranken kostenlos zur Verfügung. Diese seit Jahren im Westen angewandte Behandlung – die hochaktive antiretrovirale Therapie – gilt als medizinisches Wunderwerk, durchaus imstande, das Leben der Infizierten um Jahrzehnte zu verlängern. Jetzt kommt, laut Yves, der Skandal: Die Führung des Klosters Prabat Nampu weigerte sich, die neue Behandlungsmethode einzusetzen. Obwohl mit dem Belgier und drei Mitarbeitern (darunter zwei westliche Frauen) ein kompetentes Team zur Verfügung stand, um das Programm aufzubauen.
Warum die Weigerung? Die so einfache, so ungeheure Antwort: weil dann die Spendengelder nicht mehr einträfen. Denn zu den Brachialmethoden des Abtes gehört es, Heerscharen von Besuchern an den Betten der Todgeweihten vorbeizuschleusen. Damit sie mit eigenen Augen sehen, was aus einem werden kann, der sich nicht schützt.
Der Anblick rührte die Heerscharen, aus ganz Thailand trafen Spenden ein. In Form von Lastwagen voller Windeln, Klopapier, Wäsche, Leintücher, Mineralwasser, Baumaterial oder Geld, viel Geld. All das wäre zu Ende, sobald die Besucher nicht mehr an den Elendsgestalten vorbeizögen, sondern an Patienten, die sich auf dem Weg der Besserung befänden. Das Mitleid würde austrocknen, somit der Nachschub. Das Kloster verlöre seine Daseinsberechtigung.
Yves legt nach. Exorbitante Summen würden unterschlagen und geräuschlos auf ausländische Konten transferiert. Oder im Kloster gewaschen, das thailändische Militär würde Drogengewinne investieren, um Monate später sauberes Geld zu kassieren. Yves bleibt vage, bringt keine Beweise. Kein mitgeschnittenes Telefongespräch, keinen Bankauszug, keine eidesstattliche Erklärung eines Zeugen. Nur tausend Ahnungen. Das ist dürftig. Inzwischen hat er das Hospiz verlassen. Meine Absicht, dort wieder zu arbeiten, hält er für aussichtslos. Man würde mich wie jeden anderen Westler abservieren.
Wir wechseln das Thema, ich glaube kein Wort, ich habe den Abt mehrmals getroffen und will nicht fassen, dass hier ein buddhistischer Mönch als verkappter Totmacher fungiert. Yves halluziniert, ist am Ende seiner Kräfte, er braucht eine Pause. Er sagt es selbst.
Am nächsten Morgen wache ich von einem leisen Singsang auf, es ist 6 Uhr 32. Ich schaue durchs Fenster. Zwei Mönche stehen am Straßenrand, vor ihnen knien drei Frauen, mit gefalteten Händen hören sie die Gebete der jungen Männer. Wie oft habe ich dieses Bild gesehen, und jedes Mal verschafft es für Augenblicke einen sagenhaften Frieden. Novizen und Alte verlassen morgens ihr Kloster und machen die Runde, betteln. Und die anderen – hier die drei Frauen – geben. Und bedanken sich für die Chance, großzügig sein zu dürfen.
Ich fahre nach Prabat Nampu. Noch immer wacht eine weiße Buddhastatue über der Anlage, noch immer strahlen die roten Bougainvillea-Sträucher, noch immer liegen die Flachbauten in der Sonne. Doch etwas Entscheidendes ist anders: An den zwei Türen, die zu den Kranken führen, hängen Zettel mit der seltsamen Nachricht, dass freiwillige Helfer unerwünscht sind. Wurden sie früher willkommen geheißen, so sollen sie heute wieder nach Hause fliegen. Ich stelle mich im Büro vor, möchte den Manager sprechen. Kein Problem, nur würde er erst am späten Nachmittag eintreffen.
Ich gehe den Hügel hinauf, wo sich die Bungalows der Mönche befinden, die hier wohnen. Alle krank. Sha lädt mich ein. Der 39-Jährige infizierte sich vor zehn Jahren bei einer Prostituierten. Sha sieht kräftig aus, das lauernde Aids ist noch nicht ausgebrochen. 1999 wurde er Mönch und fand Unterschlupf in Prabat Nampu. Das sei der einzige Ort, wo er unbesorgt leben könne. Andere Klöster würden ihn verjagen. Er streckt mir seinen linken Arm hin, fragt, ob man die Krankheit schon sehen könne. In Thailand, meint der Ex-Lehrer, habe Aids etwas Dämonisches. Schon der Anblick eines Kranken, so glauben viele, könne den Betrachter anstecken. Natürlich meditiere er, »aber ich bin nicht stark genug, mich ins Nirwana zu retten«.
Auf dem Weg zurück zum Office komme ich an drei neuen Verbrennungsmaschinen für die Toten vorbei. Auf den riesigen Apparaten steht: Technology for tomorrow. Das zeugt, durchaus unbeabsichtigt, von feinstem schwarzen Humor.
Mister Chanterpol, der Manager, wartet bereits. Wir kennen uns, vor Jahren habe ich ein Interview mit ihm geführt. Er tut, als sei alles beim Alten. Natürlich könne ich als Freiwilliger anfangen, »no problem«. Auf meine Frage, warum dann die Schilder aushingen, antwortet der Mann eher ausweichend. Ich insistiere und höre, dass »jemand schlecht über den Ort gesprochen« habe. Ich halte den Mund, tue, als hätte ich keine Ahnung. Und fülle ein Formular aus, erkläre mich per Unterschrift mit den Bedingungen einverstanden. Der prekärste Punkt: Nicht mit den Patienten über Religion sprechen. Wichtig, denn immer wieder kommen christliche Besserwisser hier vorbei und versuchen den Todkranken ihre ewigen Wahrheiten einzubläuen. Ich kann morgen anfangen.
Thailand hat eine Landplage, die Hunde. Als ich nachts von einem Straßenrestaurant zurückkehre, muss ich mich mit einem Stock bewaffnen. Manche der Bastarde kommen auf einen halben Meter heran und fletschen die Zähne. Als ich den verwilderten Garten von Yves’ verwildertem Haus erreiche, wird es entschieden friedfertiger. Im Kerzenschein unter freiem Himmel lese ich das Buch einer thailändischen Autorin. Sie schreibt, dass wir im Zeitalter »der mächtigsten Ideologie, des rasend-globalen Konsumwahns, eine Gegenideologie brauchen«, etwas, das uns schützt vor unserer Gier nach allem.
Diese Weisheit wird die Gier nicht bremsen. Aber wie jeden Leser heilen mich, für Stunden allemal, die Zeilen einer Schriftstellerin, die von meinen Wundstellen und Brandherden weiß. Ich, der Leser, bin nach der Lektüre eine Nacht lang weniger allein.
Die nächsten Tage arbeite ich im Kloster. Meist mit Handschuhen und Mundschutz, Tuberkulose grassiert. Massieren, Windeln wechseln, Nahrung und Getränke einflößen. Zwischendurch Kranke zur Toilette begleiten, sie hinterher mit dem Rollstuhl unter die Dusche fahren, rasieren, Haare waschen, Haare schneiden, die ausgezehrten Glieder hochheben und einseifen, den ganzen Leib abspülen. Alles fällt leichter, weil ich gleich zu Beginn Michael Bassano kennen lerne. Seit Monaten ist er der einzige Ausländer.
Als er sich als katholischer Priester vorstellt, zucke ich zusammen. Grundlos. Der Amerikaner gehört zu einer Gruppe, die sich ausdrücklich missionars nennt, um den von vielen Gräueltaten besudelten Begriff missionaries zu vermeiden. Sie haben sich geschworen, keinen Ungläubigen zum allein selig machenden Glauben zu vergewaltigen, auch nicht positiv denken zu predigen, sondern positiv zu handeln: Weltweit packen sie an, wo Hilfe gebraucht wird. Die Liebe zu Jesus hat der 56-Jährige in dem Film Ben Hur entdeckt. So wäre er gern: eben einer, der nicht mit Hass heimzahlt, sondern sich anrühren lässt von der Einsamkeit und der Not anderer. Was zählt, sei com-passion, das Teilen von Gefühlen, das Mitgefühl. Das klingt sehr buddhistisch.
Bassano redet schnoddrig, ohne diesen gesalbten Weihrauchton derjenigen, die wissen, dass sie gut sind. Auch trägt er Straßenkleidung, keinen Pfaffenrock. Grundsätzlich fürchte ich mich vor den Religiösen. Sobald sie das Wort Gott auspacken, gibt es Stunk, kurz darauf Krieg. Wer nicht umgehend ihre unverbrüchlichen Weisheiten nachbeten will, geht besser in Deckung. Heute nicht. Als Bassano anfängt, sich über das Zölibat zu beschweren, ist aller Zweifel verflogen. Hier redet ein Mensch, kein Inhaber wohlfeiler Sprechblasen. Die Keuschheit macht ihm zu schaffen. Am heftigsten, wenn er an den »sweet Thai girls« vorbeigeht. Dann hadert er mit seinem Beruf, mit dem Gottessohn, mit der Wucht eines Lebens ohne sinnliche Wärme. Aber versprochen ist versprochen.
Wie verschieden die Motive sein können, die einen antreiben, hierher zu kommen. Den New Yorker inspiriert Jesus, die unverrückbare Gewissheit, dass irgendwo über uns ein göttlicher Wille waltet, der auf Erden erfüllt werden muss. Andere (auch mich) motiviert das genaue Gegenteil: dass keiner über uns wacht und dass nur wir im Universum herumgeistern. Nur wir allein. Wer sollte uns folglich helfen, wenn nicht einer dem andern? Das gottlose Weltall lässt keine andere Wahl. Dieser Zustand beraubt uns aller Ausreden. Wir sind verantwortlich, kein anderer.
Wir arbeiten zusammen, Michael kennt jeden Handgriff, jede Schublade, jedes Schicksal. Da inzwischen renoviert wurde und kein Patient mehr am Leben ist, den ich beim letzten Besuch gesehen habe, bin ich für jeden Wink dankbar.
Nach drei ersten Patienten, die als ruhig bekannt sind, traue ich mich an Ampang ran. Sie gilt als schwierig, während einer ihrer Wutanfälle biss sie Bassano in den Hals, Blut floss. (Er wartet noch auf das Ergebnis des zweiten Tests, leichte Unruhe, denn Bisse von einer tödlich Infizierten können ruinöse Folgen haben.) Aber Ampang hat das Recht auf Launen, sie hat einiges kassiert im Leben. Die dicke junge Frau mit dem wüsten Gebiss im wüsten Gesicht wurde von ihrem Mann angesteckt (bereits verstorben). Wochen später wird ein junger Kerl mit Aids-Diagnose eingeliefert, Ampang und Samai verlieben sich. Eine kurze Liebe, der 20-Jährige stirbt ebenfalls. Aus Kummer stürzt sich Ampang vom vierten Stock in die Tiefe. Sie überlebt – mit gelähmten Beinen.
Ich hieve sie aus dem Bett und fahre sie im Rollstuhl Richtung Kleiderschrank. Hier stapeln sich die gespendeten Nachthemden und Schlafanzüge. Die 27-Jährige lässt sich ausführlich beraten, ich muss Hemdchen und Höschen vor ihr ausbreiten, sie will sie genau sehen, sie anfassen und fühlen. Noch vor den Pforten des Todes legt sie Wert darauf, sich hübsch anzuziehen. Sobald wir die Dusche erreichen, will sie allein sein, sich allein waschen. Sie kann nicht gehen, hat aber die Kraft, eine Seife zu halten und die Haare zu shampoonieren.
Andere haben weder die Kraft, noch protestieren sie gegen Hilfe von außen. Für Augenblicke bin ich irritiert, als ich den katholischen Priester dabei beobachte, wie er eine nackte Frau wäscht (nachdem er die volle Windel entfernt hat), sie an den intimsten Stellen einseift, ihren Körper abtrocknet und mit Puder einreibt. Aber die Irritation legt sich. Weil es so sein muss, weil hier ein geschundener Mensch jemanden braucht, der ihm diesen Zustand von Würde – Sauberkeit zum Beispiel – ermöglicht. Und Bassano erledigt das mit leichten Worten (er spricht Thai) und aller gebotenen Zurückhaltung.
Eines Nachmittags stürmt Kanal 4 den Saal. Vorneweg sechs Mädchen, die aus Körben Süßigkeiten an die Patienten verteilen, hinterher drei Kameramänner, die umstandslos drehen. In Thailand wird keiner vorher gefragt, ob er gefilmt werden will oder nicht. Als westlicher Kranker würde ich ihnen mit einer infizierten Spritze drohen. Aber hier scheinen die Bettlägerigen ganz einverstanden, ja blühen und antworten nicht ungern auf die Fragen. Vielleicht halten sie die Neugier der Sensations-Kanaillen für einen Ausdruck von Wärme und Teilnahme. Oder sie spielen, setzen die Maske der Freude auf, um das Ausgeliefertsein ohne Gesichtsverlust hinter sich zu bringen. Ich weiß es nicht.
Bei anderer Gelegenheit sind Bassano und ich gerade dabei, das Leintuch von Supani zu wechseln und die Frau mit einem feuchten Waschlappen abzureiben, als eine Gruppe von Besuchern den Saal betritt. Reflexartig halte ich eine Decke als Paravent vor das Bett, glaube ich doch noch immer, dass der Welt kein Blick zusteht auf die persönlichsten Bedürfnisse eines Menschen. Auch das ist Teil seiner Würde: ihm seine Geheimnisse zu lassen, ihn nicht zu zwingen, sich herzeigen zu müssen vor aller Augen. Als keine Zuschauer mehr in Sicht sind, deutet Supani auf eine Tube neben dem Nachtkästchen. Mit der Health Creme möchte sie massiert werden.
Ich begleite Surasak ins Büro, ich muss ihn leicht stützen. Der 37-Jährige, der sich auf dem Straßenstrich den (baldigen) Tod geholt hat, will seine Familie anrufen, er ist pleite. Als wir ankommen, steht ein Offizier am Empfang, um ein Kuvert mit Spendengeld abzugeben. Viele Soldaten werden nach Prabat Nampu eingeladen, sie gelten als heldenhaft dämlich im Umgang mit käuflicher Liebe, mit Verve amüsieren sie sich gern unten ohne. Als der Mann das Anliegen von Surasak hört, übergibt er ihm spontan den Umschlag. Und verspricht, ihm eine monatliche Rente einzurichten, eine Leibrente. Bis zum Ende.
Von Lek muss noch berichtet werden. Er liegt seit zwei Jahren hier, die Infektion kam mit einer dreckigen Heroinnadel. Der 52-Jährige war der Liebling aller Frauen, die hier als Freiwillige arbeiteten. Er zeigt mir seine Fotomappe, mit jeder hat er sich fotografieren lassen. Lek ist nicht schön, nicht prominent, Lek ist hinfällig und schwer krank. Aber irgendetwas strahlt er aus, etwas Anmutiges, etwas Besänftigendes.
Nur mit angehaltenem Atem traue ich mich an ihn ran. Weil mir beim Öffnen seiner Windeln eine enorme Geruchsbombe – enormer als bei anderen – entgegenfaucht. Aber Lek genießt es, wenn man sich mit ihm beschäftigt. Auch als Wrack. Jede freie Stelle an seinem Leib muss mit einer Lotion behandelt werden, mit Puder, mit Salben. Er will es so. Auf bizarre Weise ist er eitel. Was ihm selbst Lebenskraft verschafft, hilft erstaunlicherweise auch den anderen. Viel mühseliger sind Patienten, die nichts mehr anspornt, die ohne einen Funken Zuversicht daliegen und auf das Sterben warten. Lek ist anders, er hilft mir, zeigt grinsend auf sein Men’s Ambition Cologne, das auf dem Nachtkästchen steht. »Bitte, die Achseln einsprühen.«
Nach den Tagen im Kloster verbringe ich den Sonntagnachmittag am Pool eines feinen Hotels. Will keine Schmerzensschreie hören, will schwimmen und lesen und das blaue Wasser und den blauen Himmel spüren. Das funktioniert nur teilweise, denn im Liegestuhl neben mir befindet sich Tina, ausgebildete Krankenschwester und noch vor kurzem Teil der Equipe um Yves W. Wie der belgische Arzt hat sie das Hospiz im Zorn verlassen. Tina sieht gut aus, gilt als fleißig und kompetent. Ich bin unkonzentriert und lasse mich zu einer Diskussion mit ihr hinreißen. Innerhalb Sekunden landen wir beim Lieblingsthema der Zornigen: dem jämmerlichen Zustand der Welt, sprich: dem teuflischen Bush, der furchtbaren Weltbank und dem grausamen Komplott des reichen weißen Mannes (allseits verbandelt mit nichtweißen Komplizen), der mit Heimtücke und perfiden Zinsforderungen das Weltreich des Bösen installiert hat. Tina braucht einen Schuldigen (Washington), einen Satan (den Kapitalismus), ein Opfer (die Entrechteten dieser Welt). Als Gegenmittel schlägt sie die »Arabische Liga« vor. Die solle den Amis einheizen. Die Idee, arabische Potentaten als Einsatztruppe für Frieden, Demokratie und Gleichberechtigung auf Erden zu rekrutieren, ist umwerfend komisch. Dummheit bringt mich zum Heulen, ich habe Lust, mich zu ertränken.
Es kommt noch schlimmer. Ein Mann, grauhaarig, Wohlstandsbauch, vielleicht sechzig Jahre alt, liegt auf der anderen Seite des Pools. Er liest eine schwedische Zeitung. In seiner Nähe sitzt eine junge Thai, vielleicht 23. Unübersehbar, die beiden gehören zusammen. Er zahlt, und sie steht zu Diensten. Tina stänkert, hasst spontan den Mann. Und bemitleidet spontan die Frau, sagt den braven Satz: »Ich bin privilegiert, ich brauche mich nicht zu erniedrigen, aber diese Frau hat keine andere Wahl.« Trüge Tina eine Latzhose, sie wäre untadelig.
Nicht, dass ich den Skandinavier verteidigen will. Schon aus ästhetischen Gründen nicht. Ich will weder einen Bauch haben noch mich mit der trostlosen Aussicht anfreunden, eines Tages eine Frau einkaufen gehen zu müssen, um an Sinnlichkeit und Wärme heranzukommen. Der Mann interessiert mich nicht, ein Daddy eben, der endet, wie so viele enden. Was mich interessiert, ist Tinas Urteil über das Mädchen. Sie kann nicht anders, als es als »Beute« zu sehen. Als ob es nicht Millionen von Thaifrauen gäbe, die nicht als Callgirl unterwegs sind. Eben in einem normalen, sprich lausig bezahlten Beruf arbeiten.
Was so nervt, ist die Umsicht des Gutmenschen, anderen Menschen – bevorzugt aus der Dritten Welt – den Opferlamm-Stempel aufzubrennen, kurz, sie zu infantilisieren. Als ob die 23-Jährige zu dumm wäre, um »nein« zu sagen. Wer so redet, redet dem politisch korrekten Rassismus das Wort. Für den gibt es nur zwei Menschenrassen: die (niederträchtigen) Täter und die (hochwertigen) Opfer. O.k., wenn die Swimmingpool-Schöne von einer miesen Mafia eingefangen worden wäre, um anschaffen zu gehen, dann hätten wir eine andere Story. Aber die haben wir nicht. (Ich stelle später diskret Recherchen an.) Wir haben ganz einfach eine junge Frau, die keine Lust auf ein Leben als Kassiererin mit 150 Euro Monatslohn verspürt. Und entschieden hat, als Hure ihr Brot zu verdienen. Das ist ihr verdammtes Recht. Ist ein Hurenleben ein würdeloses Leben? Ist 40 Jahre am Fließband stehen und drei Millionen Schrauben an 300.000 Backrohren festziehen oder an der Kasse von Aldi sitzen und lebenslang die Preise für Schnuller, Bananenmixer und Schuhcreme eintippen würdevoller? Geistreicher? Menschlicher?
Irgendwann verschwinden der Dicke und die Dünne, es wird friedlicher. Tina, die Kriegerin, schläft ein. Mir fallen die vier Unauslotbarkeiten des tibetanischen Buddhismus ein: Liebe, Mitgefühl, Freude, Gelassenheit. Das Wasser schaukelt, der Himmel wird noch himmelblauer, Spatzen zwitschern, eine Katze schleicht, kein Mensch redet. Eine Unauslotbarkeit ist immerhin angekommen, Gelassenheit.
Um sechs Uhr abends sitze ich in meinem Lieblingsrestaurant, ein einfacher Raum, zum Trottoir hin offen. Fünf Frauen wirtschaften hier, besorgen die Küche und einen Stand mit Fisch und Gemüse. Ich kenne die fünf seit drei Jahren, sie lachen noch immer. Eine erzählt was, und die anderen vier biegen sich. Ich darf in einer Ecke sitzen, schreiben, lesen, essen, rauchen und unberührbar sein. Keine käme je auf den Gedanken zu stören. Wenn ich etwas brauche, kommen sie. Und wenn nicht, respektieren sie das erste Menschenrecht: allein sein zu dürfen. Nur ihr Lachen schwappt herüber. Die fünf wollen sicher nicht die Menschheit retten, reden wohl nie über George W. Bush und die Arabische Liga, aber ihre Freude trägt zur Leichtigkeit der Welt bei. Frauen wie Tina lachen eher nicht. Eher geknickt geht man von ihnen weg.
Weiter. Ich fahre zum Wat (Kloster) Thamkrabok, das eine halbe Stunde südlich von Lopburi liegt. Vor Tagen kam ein Engländer zu Besuch nach Prabat Nampu. Wir wechselten ein paar Worte, Angus erzählte von dem Kloster, wo sie versuchen, Heroinsüchtigen die Sucht auszutreiben. Er selbst hat sich vor Ort einquartiert, weil sein jüngerer Bruder dort behandelt wird. Er will ihn anspornen und ihm die immer wiederkehrenden Fluchtpläne ausreden.
Problemlose Aufnahme, der Abt Luangpor ist einverstanden, dass ich hier schlafe. Hundert Thaimönche und zwanzig Nonnen leben und arbeiten hier, plus ein halbes Dutzend ausländischer Mönche. Einige sind als Betreuer der rund sechzig Patienten – Europäer und Thailänder, Junkies und Alkoholiker – tätig. Neben der Behandlung mit Heilpflanzen soll die Nähe von Buddha die Heilung vorantreiben.
Keiner garantiert den Erfolg, weder die Anwesenheit von Gautama noch die vom Abt ausgetüftelten Kräutlein. Ich treffe U., einen 40-jährigen Deutschen, der früher Stukkateur war und später wegen Übergewicht – augenblicklich mit 130 Kilogramm Lebendgewicht kämpfend – zum Busfahrer umgeschult wurde. Wir haben viel Zeit, und der schwere Junge hat viel zu erzählen.
Schon als Jugendlicher drückt er, kommt nach Thailand, drückt weiter und lernt in einem Edelpuff seine zukünftige Frau kennen. U. fliegt für eine Woche zurück in die kalte Heimat, verkauft alles und verbringt sieben Jahre im Land des Lächelns, wo der Stoff entschieden billiger ist. Er wird Vater, und irgendwann findet ihn seine dreijährige Tochter auf der Toilette. Im Drogenrausch. U. wacht auf und beschließt, die Hölle zu verlassen. Er zieht in Thamkrabok ein, verlernt das Drücken und mutiert zum Alkoholiker. Dennoch, irgendwann hat er genug Kraft, mit der Familie nach Deutschland zurückzukehren und eine neue Existenz aufzubauen. Als Busfahrer.
Die Ehe geht gut, aber der Alkohol lässt den Ehemann nicht los. Im Rausch wird der Dicke laut und erinnert seine Frau daran, dass er sie aus der Gosse geholt hat. Ebbt die Umnachtung ab, fällt ihm wieder ein, dass man entweder jemanden liebt oder nicht liebt, den anderen folglich nicht pausenlos spüren lässt, wie viel er ihm schuldet.
Der Koloss weiß sich gefährdet, noch immer. Deshalb kehrt er jedes Jahr – seit vielen Jahren – für ein paar Wochen in »sein« Kloster zurück, streift die Kutte über, spricht Thai, schwört dem Laster ab, arbeitet körperlich, mörtelt und zimmert, trinkt nur Wasser und darf – wie alle anderen – nur einmal am Tag essen, morgens um sieben. Sex gibt’s auch keinen, dafür ein extrem heißes Dampfbad. Gordon – Afroamerikaner, Ex-Vietnam-Marine und nun seit 24 Jahren Mönch – sorgt dafür, dass das Feuer im Höllenofen nicht ausgeht.
U. und ich schwitzen gemeinsam. Die Sehnsucht nach Bier macht ihm zu schaffen, in den Zeiten schlimmster Bedrängnis versucht er zu meditieren. Aber er kann nicht abheben, kann nicht »schweben«, bleibt immer zentnerschwer am Boden. Ob er hier im Kloster der Versuchung widersteht oder nicht doch heimlich ein paar Dosen konsumiert? U. weicht der Frage aus. Er kennt die (strengen) Regeln: Wer entdeckt wird, fliegt. Fest steht, dass U. bei circa 90 Grad Außentemperatur mich anpumpt und Geld will. Für »Transportkosten«, sagt er. In ein paar Tagen ist sein Aufenthalt zu Ende. Dann wird U. die alkoholfreie Zone verlassen und nachholen, was dreißig lange Tage und Nächte so schmerzhaft in ihm zu kurz kam. So ist zu vermuten. Trotzdem bin ich dumm genug und glaube seine Mär. Für meine Spende werde ich dennoch entlohnt: mit der Erkenntnis, welch unglaublichen Aufwand Säufer treiben, um ihre Sauftouren zu organisieren. Sie werden zu schillernden Märchenerzählern.
Das Kloster liegt am Fuß hoher Hügel, viel Sonne, viel Schatten. In den 50er Jahren zogen sich der Abt Luangpor, sein Bruder und die Tante, die Nonne Luangpor Yai, hier in eine Höhle zurück. Um zu fasten und zu meditieren. Zur gleichen Zeit wurde in Bangkok verstärkt Jagd auf Opium-Junkies gemacht. Die Legende sagt, dass eines Tages ein Süchtiger auf der Flucht an der Höhle vorbeikam und um Hilfe bat. Und die drei begannen mit Pflanzen zu experimentieren, wurden kundige Kräuterspezialisten, heilten. Sie verließen die Grotte und gründeten das Kloster Thamkrabok. Zehntausende sind in den letzten 45 Jahren hier vorbeigekommen. Auf der Suche nach Beistand.
Wer die (kostenlose) Therapie in Anspruch nimmt, muss klaren Prinzipien folgen. Ganz oben steht ein Gelübde, mit dem der Patient den rauschauslösenden Substanzen abschwört. Für den Rest seines Lebens. Wie ein Mantra soll sich das Versprechen im Unbewussten verankern. Sieben Tage dauert die Entgiftung, so lange muss jeder durchhalten. Falls nötig, kann jemand länger bleiben. Was er nicht kann: wiederkommen, wenn er rückfällig wurde. Die harsche Verordnung soll jedem klar machen, wie ernst die Lage ist. Nur der kann befreit werden, der befreit werden will. Jeder ist seines Unglücks Schmied. Besteht jemand auf seinem Ruin, so wird keine Macht auf Erden ihn aufhalten. Kein Schwur, kein Abt, kein Buddha. So hilft der Buddhismus auch Zeit sparen, da die Suche nach Sündenböcken aufhört. Denn es gibt nur einen, der verantwortlich ist: du.
Ein Bus mit Schülern kommt. Wie in Prabat Nampu soll Abschreckung vorbeugen. Die 13-Jährigen werden in die Hey geführt, jenen Trakt des Klosters, wo die augenblicklich 32 Patienten kaserniert sind, Männer und Frauen. Die Kinder stellen sich auf, und zwei Suchtkranke – zwei Thais, zwei Freiwillige – treten nach vorne, knien nieder, trinken Unmengen Wasser aus Eimern und beginnen zu – kotzen. Vor einer Stunde etwa haben sie die tägliche Ration Kräutersaft – aus 106 Ingredienzien bestehend – geschluckt, der den Körper entgiften soll. Damit das Gift aus dem Körper kann, wird die viele Flüssigkeit zugeführt. Um den Vorgang des Erbrechens zu forcieren, stecken die beiden ihre Finger tief in den Rachen. Es dauert nur Sekunden, und wahre Fontänen zischen heraus. Sanft sieht das nicht aus. Aber es soll helfen, die Quote der Winner – das grässliche Wort steht hinten auf den rosa T-Shirts der Junkies – ist erstaunlich hoch. Zwischendurch erklärt ein Mönch den Sinn der Übung, am Ende klatschen die Jugendlichen, die Vorstellung dauerte nicht länger als 25 Minuten. Die Zuschauer gehen zurück zum Bus, die Süchtigen machen sich auf den Weg zum Dampfbad. Auch das Kur, auch das Entgiftung.
Ich lerne Phra Hans kennen, Schweizer, Mönch, knapp 60, wunderbar hilfsbereit und von dem leidenschaftlichen Willen besessen, die Suche nach Erlösung und Erleuchtung voranzutreiben. »Noch hänge ich am Kreuz«, sagt er, und da müsse er herunter. Denn noch fühle er sich von der Schwere des Lebens gekreuzigt. Die er loswerden will, endlich. Dann, so phantasiert er, beginne die Leichtigkeit.
Hans – eher verwunderlich für einen Schweizer Staatsbürger – hat eine radikale Existenz hinter sich, ein »Sucherleben«. Er unterzieht sich mehreren Therapien, Einzeltherapien, Gruppentherapien, Männertherapien, heiratet eine Voodoo-Frau in Haiti, zeugt ein Kind mit ihr, quittiert mit 50 seinen Lehrerjob, lebt zwei Jahre in New Mexico, geht ans berühmte Esalen Institute in Kalifornien, reist in den brasilianischen Dschungel, verirrt sich in eine Mystery School und macht Bekanntschaft mit dem Halluzinogen Daime. Heute weiß er, dass er lieber hätte verzichten sollen. Vielleicht war die Dosis zu hoch. Jedenfalls fluteten Bilder durch seinen Kopf, die er nicht verkraftete. Verwüstet kehrt er aus dieser Erfahrung zurück. Auf der Suche nach einem Gegengift, das der gequälten Seele Frieden bringen soll, kommt er zum 41. (sic!) Mal nach Thailand. Er will für einen Tag das Kloster Thamkrabok besuchen. Und bleibt, nachdem er den Abt getroffen hat. Bei ihm fühlt er sich behütet. Seit fünf Jahren.
Warum er so oft dieses Land besuchte? Weil die Thais, sagt er, nicht hadern. Sie nähren das Helle. Er will auch hell sein, aber er kann nicht. Er muss grübeln. Hans gilt als der Intellektuelle, er spricht mehrere Sprachen, hat gerade eine komplette Neuübersetzung der Schriften Nostradamus’ abgeschlossen, kümmert sich um die (E-Mail-)Korrespondenz und die Website von Thamkrabok. Das sind die Momente, in denen er am innigsten nach Buddha ruft. Weil die Leitungen verstopft sind und er nicht in Lichtgeschwindigkeit mit der Welt kommunizieren kann. Ansonsten kämpft er mit anderen Gegnern, er nennt sie die »nahen Feinde«. Hans ist reich und kompliziert im Kopf. Der nahe Feind der Liebe heißt Abhängigkeit, beim Mitgefühl ist es das Mitleid und beim Gleichmut die Gleichgültigkeit. Allen dreien müsse man wach aus dem Weg gehen. Sonst seien die Liebe und das Mitgefühl und der Gleichmut nichts wert.
Hans führt mich herum. Das riesige Kloster ist eine Baustelle. Hunderte von Statuen – nagelneu, angerostet, im Rohbau, manche über zwanzig Meter hoch – sollen das Gelände beschützen. Hier wohnt ein rastloses Völkchen: Ein Schnellboot für den geliebten König Bhumipol steht vor der Fertigstellung, neue Tempel im Gedenken an die allseits verehrte Tante, die spirituelle Urmutter, wachsen in den Himmel, eine gigantische Wasserumwälzmaschine für die verstunkenen Kanäle Bangkoks wartet auf ihre Abholung (wahrscheinlich muss noch ein Vehikel erfunden werden, um das Ungetüm zu befördern), eine neue Unterkunft für Besucher ist im Entstehen, und mittendrin – zwischen all der Betriebsamkeit – liegt die Giftküche des Abts, in der er beharrlich nach den Geheimnissen der Natur fahndet.
Hans spricht über seine Erfahrungen mit Süchtigen. Wer hier anklopft, klopfe als Kühlschrank an: alle Sinne gefroren, somit auf befremdliche Weise beschützt vor einer als grausam empfundenen Wirklichkeit. Hier tauen einige wieder auf, spüren wieder die Wärme, die ihre Körper so hartnäckig und erfolgreich verdrängt haben. Fälle von Frauen sind bekannt, deren wiedererwachte Sinnlichkeit vor Mönchen nicht Halt machte. Hans grinst, solche Reaktionen seien ein gutes Zeichen: Ein Mensch traue sich wieder zurück zu den anderen.
Bedingung für eine – eventuelle – Heilung: Nur wer die Mühsal auf sich nimmt, sich für sein Leben zuständig zu fühlen, verfügt über die Kräfte, um heil wieder abzureisen. Er, der Junkie, muss spüren, wie ruinös er mit sich umgeht. Nie dürfe man jemanden zu einer Behandlung »überreden«. Hans nennt als Beispiel den Big-Brother-Glotzer, der nie das Glotzen sein lassen wird, solange er nicht begreift, was er mit seiner Lebenszeit anstellt.
Immer wieder, so der Mönch, erreichen uns, uns alle, »Briefe« in Form von Krankheit, Drogen, Alkohol, Gier, Apathie etc., Mahnschreiben aus der Seele, die uns eine Botschaft übermitteln wollen. Meist steht nichts anderes drin, als dass das Leben ein Geschenk ist und dass es eine andere Behandlung verdient als jene, mit der wir es augenblicklich in den Dreck ziehen. Aber wir lesen die Briefe nicht. Aus Trägheit, aus Mutlosigkeit, aus Mangel an Stärke. Hans spricht davon, dass er im Lauf der Jahre eine Entwicklung registriert habe: Immer mehr Menschen versuchen, einen anderen Weg zu gehen als den des willfährigen Konsumenten. Sie wollen ausscheren, wollen die Oberfläche verlassen, etwas finden, das tiefer liegt und tiefer befriedigt. Auf der anderen Seite würde der Haufen jener immer gewaltiger, die sich am Nasenring in Richtung großer Verblödung ziehen lassen. Sie – und daran bestehe kein Zweifel – bildeten die überwältigende Mehrheit.
Am späten Nachmittag finde ich ein stilles Zimmer mit einem großen Tisch. Die Hitze macht ohnmächtig, zweimal schlafe ich beim Schreiben ein. Und die Moskitos wecken wieder auf. Hinterher beginnt die Suche nach einer Toilette. Vergeblich, nur Nasszellen, die nass sind. Hätte man nicht die Installation des Steuerrads für das königliche Boot verschieben können? Oder das Aufstellen der 300. Statue? Um das gesparte Geld für die Installation einer Kloschüssel und eines Waschbeckens zu investieren? Das wäre sicher im Sinne des Erleuchteten. Auch der Menschenwürde durchaus förderlich. Spiritualität nervt, wenn sie die Grundbedürfnisse übersieht. Wie ein stilles Örtchen, wo man sich sorglos niederlassen und die Zeitung lesen kann. Hier kann man weder das eine noch das andere. Dafür fünfzig oder sechzig verschiedene Muskeln kennen lernen, die plötzlich und gleichzeitig zum Einsatz kommen müssen. Damit der Körper im Gleichgewicht bleibt und ein mittleres Desaster verhindert wird.
Nach dem abendlichen chanting, diesem Singsang aller Mönche, führt mich Hans in ein abgelegenes Eck. Hierher kommen täglich zur selben Zeit ein Dutzend Männer. Und schlucken dieselben Kräuter wie die Süchtigen. Nur sind sie nicht süchtig, wollen aber dennoch mit Hilfe der dunkelbraunen, gräulich schmeckenden Tinktur ihren Leib reinigen. Um an der Zeremonie teilnehmen zu können, musste ich gestern bei Phra Vichien eine Verpflichtung ablegen. Ich entschied mich für einen Satz, mit dem ich mich seit langem verbunden fühle: »Ich zähle nur auf mich selbst.« Nicht im Sinne eines permanenten Misstrauens anderen gegenüber, eher: Was immer ich tue, ich appelliere zuerst an meine eigenen Kräfte. Der Satz hilft, erwachsen zu werden.
Vichien reicht mir das volle Schnapsglas mit dem 106-Kräuter-Gebräu, ich bedanke mich, würge es hinunter, ex, setze mich, warte. Kurz darauf passiert etwas Ungeheuerliches. Ein Mönch schaltet den Fernseher ein, der an der Wand hängt. Ich hatte das Gerät bisher nicht bemerkt, so undenkbar schien mir seine Anwesenheit an diesem Ort. Ein Kung-Fu-Video aus Hongkong läuft, auf Chinesisch. Das Kommunikationsmittel bewirkt, dass wir ab sofort nicht mehr miteinander kommunizieren, weil die Mehrheit – auch sie haben den Saft bereits intus – jetzt auf die debile Story blickt, von der sie kein Wort versteht. Eine Minderheit dreht sich ab, Hans döst im dunkelsten Eck, zwei gehen spazieren, einer schläft, ich streichle den Hund und schaue beim Kotzen zu. Ich will nichts falsch machen.
Kurz nach 21 Uhr schleiche ich hinter das Haus, wo sich eine fußtiefe Rinne befindet. Ich tauche die Plastikschale in den Kübel und zwinge mich, zwei Liter Wasser zu trinken. Dann zaghaft mit dem rechten Mittelfinger nach dem Zäpfchen greifen, die ersten Magensäfte kommen. Gleichzeitig das Gefühl, dass meine Augäpfel ebenfalls den Körper verlassen, eine immense Druckwelle zieht durch den Kopf.
Aber meine Vorstellung ist eher kläglich, ich schaue nach links und sehe einen Mönch souverän die Rinne vollmachen. Jetzt habe ich verstanden: nicht scheu anfassen, sondern die halbe Hand in den Rachen stecken. Das funktioniert, der Körper fängt an zu beben, und die Reste der letzten hundert Mahlzeiten schießen nach draußen. Ich überwinde mich oft, trinke oft, schleudere mindestens zwanzig Ladungen in die Nacht.
Leer und angenehm geschwächt kehre ich in das Zimmer zurück, das ich mit Angus teile, den ich vor Tagen in Prabat Nampu traf. Der Mann ist ein Genie, heute war er in Bangkok, um sein Laptop aufzurüsten. Jetzt surft er – am Boden der Zelle hockend – durch das Netz, später ruft er über das Internet seine Firma in England an. (Er designt Zusatzgeräte für Computer.) Neben ihm lümmeln Elliot und Alister, zwei Landsleute, Ex-Junkies, die wie U. hier einen Monat Exerzitien absolvieren. Angus lehrt uns drei weniger Begabte, welche Konfiguration man wo einstellen muss, um kabellos und bei Kerzenschein an fast jeden Telefonbesitzer heranzukommen.
Der 34-Jährige ist eine Ausnahmeerscheinung. Seit Wochen steht er hier seinem Bruder Eugene bei, der Heroin spritzt, bereits 29 (gescheiterte) Detox-Versuche in London hinter sich hat und jeden Tag nach Ausreden sucht, um von hier wegrennen zu dürfen. Richtung Nadel und Erlösung. Angus erzählt von kaputten Eltern und seinem Glück, älter zu sein als Eugene. Denn zu seiner Zeit als Halbwüchsiger war the gear, das verführerische Pulver, noch nicht en vogue, eher die Ausnahme. Sonst hätte es ihn auch erwischt. Bruderliebe, was für ein altmodisches, berührendes Wort.
Ende der Leseprobe