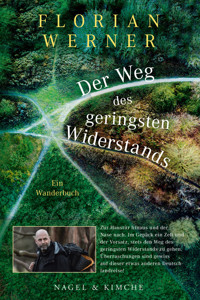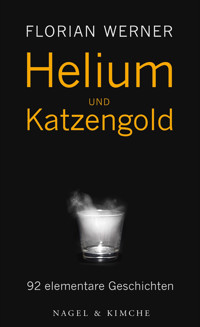15,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Klett-Cotta
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Warum wir alle ein bisschen Stuttgart sind Wutbürger und ökologische Transformation, Querdenker und Willkommenskultur. So wie Athen der Inbegriff der antiken Demokratie war und Manchester die Schlüsselmetropole des modernen Industriekapitalismus, ist Stuttgart jene Stadt, die emblematisch für Deutschland am Beginn des dritten Jahrtausends steht. Der Regierungssitz mag sich noch in Berlin befinden: Wir leben schon längst in der Stuttgarter Republik. Stuttgart ist die Stadt der Stunde. Hier führt mit Winfried Kretschmann der erste grüne Ministerpräsident eine ökologisch-christdemokratische Koalition. Hier ist fast jeder Fünfte in der Automobilindustrie beschäftigt, die Region ist von den bevorstehenden Transformationen der Arbeitswelt daher besonders betroffen. Hier erschüttert das Bahnhofsneubauprojekt »Stuttgart 21« nicht nur den Boden unter dem Stadtzentrum, sondern auch den Zusammenhalt der Gesellschaft und das Vertrauen in die Demokratie. Hier ist schließlich im Zuge der Corona-Pandemie eine postmoderne Protestbewegung entstanden, die ihren Unmut mit schwäbischer Gründlichkeit bis in die Bundeshauptstadt exportiert. Man könnte meinen, der berühmte Stuttgarter Talkessel sei in Wirklichkeit eine riesige Petrischale: Was hier keimt, wird demnächst auch im Rest der Republik virulent werden. In DER STUTTGART KOMPLEX stürzt sich Florian Werner in diesen Kessel und geht ihm in fünf Streifzügen auf den Grund.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 165
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Anna Ingerfurth, 14:29 Uhr, 2018, Collage
Florian Werner
Der Stuttgart Komplex
Streifzüge durch die deutsche Gegenwart
Klett-Cotta
Impressum
Klett-Cotta
www.klett-cotta.de
© 2022 by J. G. Cotta’sche Buchhandlung Nachfolger GmbH, gegr. 1659, Stuttgart
Alle Rechte vorbehalten
© 2022 Florian Werner
Cover: Rothfos & Gabler, Hamburg,
unter Verwendung einer Abbildung von © Anna Ingerfurth, Verwertungsgesellschaft Bild-Kunst
Gesetzt von C.H.Beck.Media.Solutions, Nördlingen
Gedruckt und gebunden von GGP Media GmbH, Pößneck
ISBN 978-3-608-96584-1
E-Book ISBN 978-3-608-11930-5
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Inhalt
Die Stuttgarter Republik
Petrischale der Republik
Der Stuttgart Komplex
Prinzip Nesenbach
Killesberg Baby
Lasst alle Hoffnung fahren
Die böse alte Hexis
In der Wertschöpfungskurve
Zu den Quellen
Entsorgungsberechtigter
Entleerte Geschichte
Vogel-Strauß-Architektur
Anti-Antifragilität
Treffpunkt Halbhöhenlage
Prinzip Protest
Ausweitung der Kampfzone
Vorsprung durch Technik
In Schillers Schatten
Verschworene Gemeinschaft
Grüner wird’s nicht
Wo die Roten Fahnen wehen
Apokalypsle now
Modell Korntal
Mein Freund, der Baum
Bürokratisch erhaben
Prinzip Pferd
Freie Fahrt
PS I Love You
Wappenrappen
Ross und Reiter
Eine Vernissage unter Einfluss
Das nächste Detroit?
Dirty Blvd.
Zum Fressen gern
Würfelhusten
Equus asinus 4.0
Prinzip Waldi
Singen und Klatschen
Versteinertes Stuttgart?
Ein stiller Schnupfen
Osmotisch, praktisch, gut
Ein Quäntchen Trost
Bio avant la lettre
Geburtshilfe …
… und Wiedergeburtshilfe
Anthroposophische Querdenker?
Die vierte Kränkung
Komplexitätskompensationskompetenz
Prinzip Schwabylon
Autobahn nach München
Antisuebianismus
Der Schwabe an sich
Palast der Republik
Integrier mich, Baby
Synthese im Bananenweizen
Lob der Kehrwoche
Ewige Wiederkehr
Epilog im Himmel
Dank
Verwendete und zitierte Werke
… das in der Dunkelheit glitzernde Lichternetz wie ein Sternenfeld, das sich aussät über die ganze Erde …
W. G. Sebald
Die Stuttgarter Republik
An einem Spätsommertag über Stuttgart wird mir alles klar. Ich fliege in etwa tausend Metern Höhe über den Westausläufern des Schönbuchs und nähere mich mit eklatanter Geschwindigkeit dem Stuttgarter Kessel. Zwischen meinen angewinkelten Beinen befindet sich ein Steuerknüppel, vor mir ein Armaturenbrett mit der Aufschrift »Kunstflug und Trudeln verboten!« sowie allerhand Anzeigen, Uhren und Armaturen, die ich nicht verstehe, über meinem Kopf die Plexiglashaube eines Motorseglers, zwei Sitzplätze, ein Propeller, sechzehn Meter Spannweite. Zum Glück fliege ich nicht allein, ungefähr drei Millimeter links von mir sitzt mein Freund Sven, ein erfahrener Flieger, er ist der Pilot, er hat ebenfalls einen Steuerknüppel, kann ihn im Gegensatz zu mir auch bedienen, im Moment unterhält er sich per Bügelmikrofon mit der Luftraumkontrolle des Flughafens.
Stuttgart Tower von Delta-Kilo-Sierra-Foxtrot-Uniform: eine Super Dimona, HK36, zwei Personen an Bord, vom Wächtersberg zum Wächtersberg, VFR, fliegen in 3000 Fuß Richtung Stuttgart, zur Info.
Ich schaue aus dem Fenster, sehe rechts unten die ersten Industrieareale, silbergrau schraffierte Fabrikhallendächer, ausgedehnte Parkplatzlandschaften, ein Autobahnkreuz wie ein Kleeblatt. Das muss Sindelfingen sein, Böblingen, irgendein Ort mit -ingen, vermutlich die Mercedes-Benz-Werke südwestlich von Stuttgart.
Es folgt ein Waldstück, das Laubwerk ist bereits spätsommerlich verfärbt, zeigt das ganze Spektrum wohlig warmer Töne von gelb bis karminrot, Swabian Summer. Eine weitere Autobahn, dann wieder Bäume, von hier oben sieht das Nebeneinander von Asphalt und Natur frappierend harmonisch aus. Wir überfliegen die Solitude, das ehemalige Jagdschloss des württembergischen Königs, einsam auf einer Anhöhe gelegen, dahinter die schnurgerade Achse, die der Herrscher zu seiner Residenz in Ludwigsburg schlagen ließ, ein Schmiss in der Landschaft.
Wieder Wald, weitere Straßen, ein paar Sportplätze. Zu unserer Linken grüßt, stramm wie ein Torwächter, der Bismarckturm auf dem Killesberg, rechts unten türmen sich die Weltkriegstrümmer des Birkenkopfs – dann öffnet sich der Abgrund: die Stuttgarter Bucht, ein gewaltiger Krater, als hätte ein Titan nach Diamanten gewühlt und dabei eine Wunde in den Keuper gerissen, Gesteinssplitter glitzern … ach nein, es ist nur die Abendsonne, die sich hier und da in schrägstehenden Fensterscheiben spiegelt.
Wir fliegen über den Rand, der Boden scheint innerhalb von Sekunden um mehrere hundert Meter abzusacken. Und dann, mit einem Mal, für einen flüchtigen, fiebrigen Augenblick, verstehe ich beim Anblick des unter mir liegenden Talkessels alles.
Petrischale der Republik
Natürlich gibt es auch andere Städte, die für sich in Anspruch nehmen, einem von Menschenhand geformten Gefäß zu gleichen: Die berühmteste ist vermutlich New York, eine Stadt, der gern nachgesagt wird, es handele sich bei ihr um einen melting pot – wobei der Begriff Schmelztiegel nicht auf die Topographie abzielt, New York ist bekanntlich topfeben, sondern auf die ethnische Durchmischung der Stadt. Das bekannteste Beispiel im deutschsprachigen Raum dürfte das Ruhrgebiet sein, das von seinen Bewohnern wahlweise als Kohlenpott, Ruhrpott oder schlicht Pott bezeichnet wird – aber man muss schon seine ganze Phantasie zusammennehmen, einen sehr weit gefassten Pott-Begriff haben oder vielleicht schlicht aus Norddeutschland stammen, um in dem flachen Becken, an dessen Südrand die Ruhr entlangsickert, ein Gefäß zu erkennen. Hinzu kommt die Unschönheit des Begriffs: Ein Pott ist ein Gefäß, in dem man bestenfalls Kohlen transportiert und schlechtestenfalls hineinpullert – zugegeben: Manche Leute trinken auch ihren Kaffee daraus. Stuttgart hingegen, das ist gerade in der Draufsicht aus dem Flugzeug unzweifelhaft zu erkennen, liegt in einem stattlichen Kessel.
Ein Kessel, das ist ein Gefäß, in dem man etwas kocht: Eintopf. Suppe. Gulasch, eine Bouillabaisse, einen Zaubertrank – auf jeden Fall ein Gericht, dessen Zutaten zusammen mehr sind als die Summe ihrer Teile, in dem etwas Neues entsteht. Begreift man das Wort in diesem Sinn, so ist Stuttgart der Inbegriff der Kesselhaftigkeit: Es ist aktuell der Ort in der Bundesrepublik, an dem sich die Zukunft dieses Landes zusammenbraut. Wollte man es etwas feinstofflicher, naturwissenschaftlicher formulieren, könnte man auch sagen: Stuttgart ist eine Petrischale; was hier keimt, wird demnächst auch im Rest der Republik virulent werden.
Hier wurde nicht nur die erste Motorkutsche der Welt zusammengeschraubt und folgerichtig mit dem ADAC auch der größte und einflussreichste Automobilclub Europas gegründet. Hier dampfen nicht nur die Schornsteine von Daimler, Porsche und Bosch. Hier liegt auch die Wiege der Waldorfschulbewegung, welche mittlerweile zu einem globalen Bildungsimperium angewachsen ist. Auch der Internationale Frauentag hatte hier seinen Ursprung, und die Partei Die Grünen stammt ebenfalls von hier: Das erste Treffen von Anhängern der ökologischen Bewegung, das schließlich in die offizielle Gründung der Partei münden sollte, fand 1979 in Sindelfingen statt.
In der Tat war Stuttgart gerade in jüngster Vergangenheit immer wieder eine Keimzelle für gesellschaftliche, politische und künstlerische Entwicklungen, seien sie nun progressiv oder reaktionär. Auf dem Höhepunkt der Finanzkrise 2008 erinnerte Angela Merkel bei einer Rede in Stuttgart an die Umsichtigkeit der »schwäbischen Hausfrau« – diese gilt seitdem als Sinnbild für eine solide Haushaltspolitik, ja als Deutschlands austerity postergirl. Wenig später entstand hier als Antwort auf die umstrittenen Baumaßnahmen für den unterirdischen Bahnhof »Stuttgart 21« die erste postmoderne Protestbewegung in Deutschland, deren Teilnehmer (je nach politischer Gesinnung der Beobachter) als Wutbürger gescholten oder zu Mutbürgern geadelt wurden. 2020 kam die Stadt wieder in die Schlagzeilen, als im Zuge der Proteste gegen die Corona-Eindämmungsmaßnahmen der Bundesregierung mit »Querdenken 711« ein weiteres heterogenes Protestbündnis gegründet wurde; der Begriff Querdenken ist seitdem, in diesem in Stuttgart geprägten Sinn, in ganz Deutschland verbreitet.
Unterdessen wurde Winfried Kretschmann, nicht zuletzt infolge der Auseinandersetzungen um Stuttgart 21, in das Amt des baden-württembergischen Ministerpräsidenten gewählt: Er führt damit als erster Grüner eine deutsche Landesregierung, ein Modell, das mittelfristig auch auf Bundesebene Schule machen könnte. 2013 bekam Stuttgart mit Fritz Kuhn zudem als erste Landeshauptstadt einen grünen Oberbürgermeister – das utopische Potenzial wie auch das realpolitische Scheitern lassen sich anhand dieser beiden Amtsinhaber studieren. Schließlich beherbergt die Region Stuttgart weiterhin eines der führenden Automotive Cluster der Welt, der verbrennungsmotorgetriebene Individualverkehr hat hier quasi Grundrechtsstatus. Zugleich ist die Luft in der Stadt, auch wegen der Kessellage, notorisch schlecht: Die Luftqualitätsmessstelle Am Neckartor gilt als »Deutschlands schmutzigster Feinstaub-Messpunkt«.
Auch die Musik ist in den letzten Jahren düsterer, rauer geworden: Nachdem »Benztown«, wie die Stuttgarter Hip-Hop-Crew Die Krähen die Stadt einst taufte, in den Neunzigerjahren als Brutstätte meist gut gelaunten deutschsprachigen Sprechgesangs berühmt war, gilt die Stadt seit ein paar Jahren aufgrund der hohen Anzahl an postpunkig-krachenden Gitarrenbands als »das neue Seattle«. Gruppen wie Die Nerven, Human Abfall, Jauche, All diese Gewalt oder Karies liefern keine tanzbaren Beats und abgefeimten Reime, sie bevorzugen stattdessen düstere Moll-Tonarten, die Lautstärkeregler sind auf 11 gedreht, die Texte abgründig wie der Stuttgarter Kessel.
Das Gefühl ist gänzlich verschwunden,
Die Wellen tragen Knochen ans Land,
Du kannst sie alle haben,
Ich denke, das ist okay,
raunt Sänger und Multiinstrumentalist Max Rieger von All diese Gewalt; der Song, aus dem diese Zeilen stammen, heißt nicht von ungefähr »Unfertige Stadt«.
Der Stuttgart Komplex
Auch Stuttgart ist unfertig, unabgeschlossen, unablässig im Wandel begriffen: Das berühmte Diktum des Kunstkritikers Karl Scheffler, die Stadt sei »dazu verdammt: immerfort zu werden und niemals zu sein«, trifft mittlerweile besser auf Stuttgart zu als auf Berlin, auf das es ursprünglich gemünzt war. Ohne »die Gosch«, wie der Schwabe sagt, zu voll zu nehmen, kann man behaupten: Wir leben in der Stuttgarter Republik. Ganz gleich, ob wir in Berlin, Bonn, Bielefeld oder Leipzig zu Hause sind: Wir sind sehr viel stuttgarterischer, als wir denken. Zumindest sind wir Einwohner von »Stuttgart«.
»Stuttgart«: Das ist mehr als eine konkrete Stadt in Südwestdeutschland. Wollte man es mathematisch fassen, könnte man sagen: »Stuttgart« ≠ Stuttgart. So wie »Athen« der Inbegriff der antiken Demokratie war, »Rom« die prototypische Stadt des christlichen Mittelalters und »Manchester« die Schlüsselmetropole des modernen Industriekapitalismus, so ist »Stuttgart« jene Stadt, die emblematisch für die Bundesrepublik zu Beginn des dritten Jahrtausends steht. Sie ist eine Stellvertreterin, eine Metapher, ein Prinzip – ja sogar ein ganzes Bündel an Prinzipien: ein Komplex.
Das Buch Der Stuttgart Komplex versucht dieses Bündel zu entwirren: Es folgt den roten Fäden durch die Stadt, kreuz und quer, von oben nach unten, vom Himmel über dem Kessel bis in die Tiefen des Abwasserhauptsammlers. Es arbeitet dabei fünf Prinzipien heraus, fünf Leitmotive, welche typisch und prägend für unser Land sind, sich aber in Stuttgart in besonders prägnanter Form offenbaren. Und es zeigt: »Stuttgart« ist weitaus mehr als die Summe seiner Prinzipien, ist mehr als Nesenbach, Protest, Pferd, Waldi und Schwabylon. Wer die deutsche Gegenwart verstehen, wer wissen will, wohin die Reise führt – der muss einen Blick auf die notorisch unterschätzte Metropole in Schwaben werfen.
Prinzip Nesenbach
Der Kessel formt sich, verdrängt seine Herkunft und kann das Wasser nicht halten
Das Erste, was beim Blick aus dem Flugzeug auf Stuttgart ins Auge fällt, ist die eigentümliche Konkavform der Stadt: Wie Tofu-Würfel in einem Kochtopf liegen die Gebäude am Boden des Talkessels, kleben an seinen Wänden, purzeln über den Rand, dazwischen verstreute Brokkoli-Rosetten, das sind die Baumkronen.
Das Zweite, was auffällt: Die Ursache für die Entstehung dieses Kessels, das Gewässer, das ihn einst gegraben hat, ist unsichtbar. Anders als beim Berliner Urstromtal, wo man schon von Weitem die Spree sieht, anders als bei Dresden und seiner Elbe oder bei Frankfurt am Main, bleibt bei der Vogelperspektive auf Stuttgart völlig unklar, warum sich diese Ansiedlung ausgerechnet hier gebildet hat. Man muss schon eine historische Karte konsultieren, um die Lebensader, an welcher entlang die Stadt entstanden ist, den sogenannten Nesenbach, zu entdecken.
Die dritte Einsicht bei der Draufsicht: Fast die gesamte Anlage der Stadt orientiert sich an diesem verborgenen Gewässer, alle wichtigen öffentlichen Gebäude liegen an seinem Verlauf, die großen Parks und Hauptverkehrsachsen folgen seiner Fließrichtung – nur ein einziges Bauwerk widersetzt sich ostentativ der Logik des Nesenbachs: der Neubau des Hauptbahnhofs, dessen Verkehrsströme derzeit ebenfalls in den Untergrund verlegt werden.
Zusammengenommen, und das ist die vierte Einsicht, versinnbildlichen diese topographischen Eigenheiten wie die keiner anderen deutschen Stadt die gesellschaftliche, ökonomische und ökologische Verfasstheit unseres Landes. Zugespitzt: Die Form des Stuttgarter Talkessels sowie der Umgang mit dem Nesenbach stehen exemplarisch für unser Leben in der spätkapitalistischen, von sozialer Ungleichheit, Klimawandel und anderen Krisen geschüttelten Klassengesellschaft. Und mit dieser steilen These ab ins kalte Wasser.
Killesberg Baby
Eine biographische Bemerkung vorweg: Ich bin kein gebürtiger Stuttgarter, aber ab meinem vierten Lebensjahr hier aufgewachsen, genauer gesagt in Sillenbuch, einem circa 8000 Einwohner starken bürgerlichen Quartier im Südosten der Stadt. Der Ort liegt unweit vom Fernsehturm, am oberen, waldreichen Rand des Kessels – und das bedeutet fast zwangsläufig: Er ist wohlhabend. Der ehemalige Daimler-Boss Dieter Zetsche wohnt hier, der langjährige Stuttgarter Oberbürgermeister Manfred Rommel war in Sillenbuch zu Hause, ja sogar die berühmte Sozialistin und Begründerin des Internationalen Frauentags Clara Zetkin zog aus der muffigen Stuttgarter Innenstadt hier hoch, als ihre finanziellen Verhältnisse es zuließen, Rosa Luxemburg kam regelmäßig zum Blumengießen. Wer es sich leisten kann, das mögen bereits diese wenigen Beispiele zeigen, der wohnt in Stuttgart in einer der Höhenlagen, wo die Luftqualität besser ist als unten im Kessel, wo der Blick weiter schweifen kann und der Weg ins Grüne vergleichsweise nah ist.
Ich weiß, ich leb mit den Reichen nicht unter einem Dach,
Die wohnen alle am Berg, ich bin aus Heslach,
heißt es entsprechend in dem Song »Killesberg Baby« des mit den Fantastischen Vier bekannt gewordenen Rappers Thomas D. Auch wer noch nie in Stuttgart war und mit der sozialen Obertonreihe der Ortsteilnamen nicht vertraut ist, wird die Verschränkung von Topographie und Status unmittelbar begreifen: Wer oben auf dem sonnigen Killesberg wohnt, dem geht es in aller Regel auch finanziell spitze – wer hingegen im feuchtklammen Talgrund lebt, gar im proletarischen Heslach, dem steht das Wasser, wie man sagt, auch in wirtschaftlicher Hinsicht oftmals bis zum Hals.
Fast alle europäischen Städte kennen eine solche toposoziale Spaltung: Spätestens seit der industriellen Revolution war für die Lebens- und Lungenqualität der Metropolenbewohner entscheidend, ob sie auf der Lee- oder der Luvseite der Fabrikschlote wohnten. »Selbstverständlich«, schreibt der Stuttgarter Schriftsteller Manfred Esser im Ostend-Roman, »die schwere Industrie siedelt gemäß den vorherrschenden Südwest- oder Nordwestwinden im Osten unserer Städte, aber …« Aber in Stuttgart, könnte man ergänzen, kommt zu dieser horizontalen Unterteilung noch eine vertikale Dimension dazu: Hier unterscheidet man nicht nur das proletarische Ostend und das privilegierte Westend, hier gibt es nicht bloß die sozial benachteiligten East End Boys und die poshen West End Girls – hier existiert auch noch die ebenso handfeste wie sinnfällige Spaltung in oben und unten.
Nicht von ungefähr befindet sich eine der sündhaft teuersten Wohnlagen der Stadt, ebender von Thomas D betextete Killesberg, am oberen und westlichen Rand des Kessels – der Bezirk Ostheim hingegen, der Ende des neunzehnten Jahrhunderts als Arbeitersiedlung gegründet wurde, liegt deutlich tiefer und, wie der Name schon sagt, im Osten der Stadt; die sogenannten sozialen Brennpunkte befinden sich von hier aus gesehen neckarabwärts, folglich ebenfalls alle im Tal. In Anlehnung an ein Bonmot von Sigmund Freud könnte man sagen: Die Topographie ist das Schicksal. Wer ökonomisch ganz unten gelandet ist, der findet – wie eine Wanderung aus dem Stuttgarter Kessel in Richtung der Höhenlagen eindrücklich zeigt – nur mit Mühe nach oben.
Lasst alle Hoffnung fahren
Was gern übersehen oder strategisch in Abrede gestellt wird: Nicht nur Stuttgart, nein, ganz Deutschland ist immer noch in soziale Schichten beziehungsweise, um den alten sozialistischen Kampfbegriff zu verwenden, in Klassen aufgeteilt. »Zieht man die Trennung von Produktionsmitteln und die abhängige Lohnarbeit als Kriterien heran«, schreiben Maria Barankow und Christian Baron in dem von ihnen herausgegebenen Band Klasse und Kampf, »dann war der Grad an Ausbeutung in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland sogar nie größer als heute.«
Tatsächlich nehmen die Vermögens- und Einkommensunterschiede immer weiter zu: Das reichste Prozent der Bundesdeutschen verfügt über fast ein Drittel des Volksvermögens – dem stehen mehr als fünf Millionen Menschen gegenüber, die auf staatliche Grundsicherung angewiesen sind, eine Million Menschen sind dauerhaft ohne Beschäftigung, geschätzte 700 000 sind wohnungslos. Am meisten Grund zur Sorge haben aber diejenigen, denen eigentlich die Zukunft gehören sollte: Jedes achte Kind wächst in einem Hartz-IV-Haushalt auf, mehr als jedes fünfte gilt als armutsgefährdet. In letzterer Hinsicht bewegt sich Stuttgart zwar eher im Mittelfeld, am stärksten von Armut gefährdet sind die Einwohner von Duisburg, Dortmund und Bremen – aber in keiner anderen Metropole ist das sprichwörtliche Gefälle zwischen Arm und Reich so plastisch sichtbar wie in der Stadt im Kessel.
Die Ungleichheit betrifft dabei nicht nur die finanzielle Situation, sondern auch Bereiche wie Gesundheit, Bildung, Wohnen, das sogenannte kulturelle Kapital. »Aber wie viele Leute aus armem und/oder nicht akademischem Elternhaus sitzen denn in den Macht- und Entscheidungspositionen der Dax-Konzerne, des Kulturbetriebs, der politischen Parteien?«, fragen Barankow und Baron – eine rhetorische Frage, klar, die Antwortet lautet: nur wenige. Im Vergleich zu anderen Industrienationen ist die soziale Mobilität in Deutschland nur gering, die Chancen, aus eigener Kraft auf den Killesberg zu kommen, sind bescheiden. Ich selbst hatte das Privileg, in einem Einfamilienhaus am oberen Stadtrand aufzuwachsen, weil meine Eltern dort wohnten, und meine Eltern hatten das Privileg, dort wohnen zu können, weil mein Großvater mütterlicherseits das Haus gebaut hatte. Er war Architekt, mithin bereits Akademiker: Auch Bildungsbiographien fußen meist auf bestehendem Fundament.
In dem humanistischen Gymnasium, das ich später besuchte, eine ähnliche Situation: Die Schule befand sich zwar unten im Kessel, aber fast kein Schüler kam aus der Nachbarschaft, so gut wie alle meine Klassenkameraden hatten einen vergleichbaren Schulweg und sozioökonomischen Hintergrund wie ich, sie lebten oben in den glückseligen Gefilden. Nur drei Kinder aus meiner Klasse hatten, was man später einen Migrationshintergrund nennen sollte, und nur ein Mitschüler kam, wie man heute sagen würde, aus einem bildungsfernen Milieu.
Auch das ist bezeichnend: Die erste Fremdsprache an meiner Schule war Latein, die dritte Altgriechisch, das Tympanon über dem Eingang gemahnte an einen antiken Tempel, und auch die darunterstehende römische Jahreszahl sowie die ionischen Säulen, welche die Fenster einfassten, signalisierten überdeutlich: Hochkultur. Lasciate ogni speranza voi ch’entrate, zu Deutsch: Habt besser einen Verwandten mit Großem Latinum oder genügend Kleingeld für Nachhilfeunterricht, bevor ihr hier eintretet. Das Erklimmen der mächtigen Granitstufen zur Schulpforte erforderte nicht bloß ökonomisches, sondern vor allem auch symbolisches Kapital.
Die böse alte Hexis
In dieser Hinsicht dürfte mein Gymnasium emblematisch für die akademische Gesamtsituation sein: In Deutschland ist nach wie vor die Bildungsherkunft ein entscheidender Faktor dafür, ob ein Kind Abitur macht, ein Studium beginnt, einen akademischen Abschluss erlangt, vielleicht sogar promoviert – oder eben nicht. In relativen Zahlen betrachtet nehmen von 100 Akademikerkindern 79 ein Studium auf, bei den Nichtakademikerkindern sind es nur 21. Von den Akademikersprösslingen macht fast jeder zweite einen Masterabschluss, bei den Nichtakademikern sind es bloß acht Prozent. Bis zur Promotion gelangt schließlich jedes zehnte Kind aus einem Akademikerhaushalt, bei den Nichtakademikern ist es nur jedes hundertste. Und: Der akademische Abschluss korreliert nach wie vor mit dem Einkommen; wer einen Doktortitel hat, verdient im Schnitt beinahe doppelt so viel wie ein Berufstätiger mit abgeschlossener Lehre.
Verantwortlich für diese Ungleichheiten, die mit dem Begriff Klassismus kaum zureichend beschrieben sind, dürften nicht allein finanzielle, sondern vor allem habituelle Unterschiede sein: Als Hauptursache nennt der Hochschulbildungsreport 2020, dem die genannten Zahlen entstammen, »unbewusste und möglicherweise ungewollte Selbstselektivität«, also die Tatsache, dass Kinder aus nicht akademischen Milieus sich von vornherein als chancenloser einschätzen als ihre Mitschüler. Die Selbstwahrnehmung legt ihnen nahe, es mit dem Gymnasium, dem Bachelor, dem Master oder gar der Promotion erst gar nicht zu versuchen.
Der Soziologe Pierre Bourdieu hat für diese Haltung, die sich auch äußerlich, also in Gestik und Mimik äußert, den Begriff der Hexis