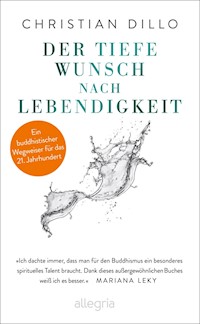
18,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ullstein eBooks
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2022
Wie fühle ich mich lebendig statt am Leben? Wie wollen wir leben? Wie ist es möglich, dass wir uns hier und jetzt wirklich lebendig fühlen – inmitten von vielfältigen persönlichen und globalen Problemen? Christian Dillo hat zwanzig Jahre als Mönch gelebt, heute ist er Zen-Lehrer, Familienvater und Abt des Boulder Zen Zentrums. In seinem Buch zeigt er, wie wir uns in der heutigen Zeit von der buddhistischen Lehre anleiten lassen können. Mit großer philosophischer Kenntnis und anhand praktischer Übungen legt er dar, wie wir das komplexe Zusammenspiel von Sinneseindrücken, Körperempfindungen, Gedanken, Gewohnheiten und Emotionen mit Aufmerksamkeit durchdringen und so unser Leben in Richtung Freiheit, Weisheit und Mitgefühl transformieren können. Ihm ist damit eine sowohl spirituelle als auch sehr pragmatische Gebrauchsanweisung für ein erfülltes Leben gelungen. Frisch, zugänglich und aktueller denn je. »Der tiefe Wunsch nach Lebendigkeit ist ein wagemutiges und atemberaubendes Buch. Christian Dillo dekonstruiert und rekonstruiert den Buddhismus auf der Grundlage seiner eigenen Erfahrung, seiner Praxis mit buddhistischen Lehrern und seiner Kenntnis der westlichen Phänomenologie und Psychologie.« Norman Fischer, Zen-Meister
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
Der tiefe Wunsch nach Lebendigkeit
Der Autor
CHRISTIAN DILLO, geb. 1971 in Hannover, seit 2003 mit erstem Wohnsitz in den USA, übernahm 2020 das Boulder Zen Center (Colorado) als ortsansässiger Zen-Lehrer und Abt nach klösterlicher Ausbildung und internationaler Lehrtätigkeit. Er wurde 2003 zum Zen-Mönch und Priester ordiniert (Ordinationsname: Zenki Myogen).
Das Buch
Christian Dillo zeigt uns, wie wir die Lehren Buddhas gerade heute zum Bestandteil unseres Lebens machen können. Wie wollen wir unsere Zeit auf dieser Erde wirklich verbringen? Leben wir wahrhaftig? Sind wir erfüllt? Es geht im Buddhismus nicht nur darum, zu innerer Freiheit und ausgleichendem Frieden zu finden. Die nützen wenig, wenn man sich trotzdem nicht lebendig fühlt. Viele von uns haben den Unterschied noch nie gespürt: Frei von äußeren Belastungen und Einflüssen zu denken, zu fühlen und zu handeln. Eine neue Absicht zu formen, mit der wir nicht nur für uns selbst, sondern auch für die Allgemeinheit Gutes tun und so das eigene Leben bereichern. Ein buddhistischer Ratgeber für das 21. Jahrhundert und ein erfrischend neuer Zugang zu dieser Lebensphilosophie.
Christian Dillo
Der tiefe Wunsch nach Lebendigkeit
Ein buddhistischer Wegweiser für das 21. Jahrhundert
Aus dem Amerikanischen von Christian Dillo
Ullstein
Besuchen Sie uns im Internet:www.ullstein.de
Allegria ist ein Verlag der Ullstein Buchverlagewww.ullstein-buchverlage.de
© für die deutsche Ausgabe Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin 2022Die Originalausgabe erscheint 2022 unter dem Titel The Path of Alivenessbei Shambhala Publications, Boulder, ColoradoUmschlaggestaltung: zero-media.net, MünchenTitelabbildung: © FinePic®, MünchenAutorenfoto: © privat
ISBN 9783843726757
Emojis werden bereitgestellt von openmoji.org unter der Lizenz CC BY-SA 4.0.
Auf einigen Lesegeräten erzeugt das Öffnen dieses E-Books in der aktuellen Formatversion EPUB3 einen Warnhinweis, der auf ein nicht unterstütztes Dateiformat hinweist und vor Darstellungs- und Systemfehlern warnt. Das Öffnen dieses E-Books stellt demgegenüber auf sämtlichen Lesegeräten keine Gefahr dar und ist unbedenklich. Bitte ignorieren Sie etwaige Warnhinweise und wenden sich bei Fragen vertrauensvoll an unseren Verlag! Wir wünschen viel Lesevergnügen.
Hinweis zu UrheberrechtenSämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken, deshalb ist die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Ullstein Buchverlage GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
Inhalt
Titelei
Der Autor / Das Buch
Titelseite
Impressum
VORWORT zur deutschen Ausgabe von Mariana Leky
VORBEMERKUNG des Autors
EINLEITUNG Wirklich lebendig sein
Teil 1 TRANSFORMATION
1 Elemente der Transformation
2 Die körperliche Haltung der Sitzmeditation
3 Die geistigen Haltungen der Transformation
4 Achtsamkeit und Leiblichkeit
5 Die vier Tore der Achtsamkeit
EXKURS Transformative Phänomenologie
Teil 2 BEFREIUNG
6 Was ist Befreiung vom Leiden?
7 Der vierfache Vollzug
8 Innige Vertrautheit mit dem Feld des Geistes
9 Leiblichkeit, Freundlichkeit, Präsenz
10 Emotionale Freiheit
11 Gewohnheitsmuster und Karma
12 Erfüllung
EXKURS Buddhismus und Psychotherapie
Teil 3 WEISHEIT
13 Was ist Weisheit?
14 Die Wirklichkeit entzieht sich
15 Die zwei Wahrheiten
16 Das Aufgeben aller Sichtweisen
17 Bewusstsein und Selbst
18 Ungetrennte Aktivität
19 Weisheit als Ausdruck
Exkurs Spürenswirklichkeit (Felt Sense)
Teil 4 MITGEFÜHL
20 Was ist Mitgefühl?
21 Die Rolle von Ritualen
22 Den Geist entgrenzen
23 Unabhängigkeit und Verbundenheit
24 Ethik als Ausdruck von Lebendigkeit
25 Ökologisches Mitgefühl
EPILOG
Anhang
Anmerkungen
Social Media
Vorablesen.de
Cover
Titelseite
Inhalt
VORWORT zur deutschen Ausgabe von Mariana Leky
Der tiefe Wunsch nach Erwachen und die umgebende Welt halten gemeinsam eine Hand auf – eine Hand frei aufgehalten, inmitten des Seins.
Dogen
VORWORT zur deutschen Ausgabe von Mariana Leky
In meiner Kindheit lebte in der Wohnung unter uns ein Jahr lang das Ehepaar Kordes. Weil Herr Kordes jeden Freitag um 18 Uhr eine Stunde lang meditierte, mussten wir in dieser Zeit absolut still sein (Herr Kordes hatte gleich nach dem Einzug darum gebeten; Frau Kordes war das sichtlich unangenehm gewesen). Jeden Freitag ab 18 Uhr schlichen wir durch unsere Wohnung, und mit der Zeit lernte auch unser beleibter Pudel, sich am frühen Freitagabend leichtfüßig über die Dielen zu bewegen. Eines Freitags stand um kurz vor sechs Frau Kordes vor unserer Tür. »Sind wir zu laut?«, fragte meine Mutter besorgt, obwohl das nicht sein konnte, weil bei uns freitags ab 18 Uhr nur die Stille laut war. »Überhaupt nicht«, sagte Frau Kordes, sie wolle nur fragen, ob sie die Meditationsstunde ihres Mannes vielleicht bei uns verbringen dürfe; sie habe einfach keine Lust mehr, sich alleine tot zu stellen. Von da an saß Frau Kordes freitags leise bei uns am Küchentisch, und ich fragte mich, warum wir uns alle verhielten, als schlummere in der Wohnung unter uns ein Drache oder ein Baby, nur weil Herr Kordes auf einem Kissen saß. Herr Kordes bedankte sich regelmäßig dafür, wie lautlos wir wieder gewesen waren. Das war für lange Zeit meine einzige Erfahrung mit Meditation: wenn jemand meditiert, muss es im Oberstübchen absolut leise sein, muss das Leben sich tot stellen oder sich lautlos bewegen; wenn jemand meditiert, müssen auch schwere Pudel das Schweben lernen.
Viele Jahre später gab Herr Kordes Meditationskurse und mir einen Gutschein. Herr Kordes ermunterte uns Teilnehmerinnen und Teilnehmer, in uns hineinzuspüren und unserem wahren Selbst zu begegnen. Ich traute mich nicht zu fragen, was das wahre Selbst ist – das schien mir eine peinliche Frage zu sein, etwa so, als würde man einen langjährigen Freund fragen, was er eigentlich noch mal beruflich macht. Ich saß auf meinem Kissen und versuchte, diesem wahren Selbst zu begegnen, verlief mich aber beim Hineinspüren und landete immer wieder im Oberstübchen, in dem niemand daran dachte, eine Stunde lang leise zu sein, in dem keiner schwebte, sondern alle in Plateaustiefeln herumstapften. Heimlich beobachtete ich Herrn Kordes und bewunderte, wie er auf seinem Kissen saß; sehr gern hätte ich auch so dagesessen, so gleichzeitig entrückt und ganz anwesend.
Fortan habe ich den Buddhismus immer von Ferne bestaunt – wie etwas Unbezahlbares im Schaufenster oder ein absonderliches Tier. Ich habe, womöglich aus Bequemlichkeit, geglaubt, dass man den Buddhismus nur durchdringen kann, wenn man ohne Anschluss und Alltag auf einem Berg lebt, weil der Buddhismus das herkömmliche Leben nur mit spitzen Fingern anfasst, dass man für den Buddhismus einen Wunsch nach unbeirrbarem Gleichmut und ein Diplom in Spiritualität braucht, dass Buddhismus etwas für Leute ist, die bei nichts mitfiebern. Ich ahnte, dass das Unfug ist, geglaubt habe ich es trotzdem. Buddhismus ist nichts für mich, glaubte ich, wegen meines trampeligen Alltags, meines sehr beirrbaren Gleichmuts und meines Armutszeugnisses in Spiritualität. Losgelassen hat mich das Thema aber nie, deshalb beschloss ich irgendwann, einen buddhistischen Mönch in einem Roman zu installieren.
Als ich diesen Plan gefasst hatte, rief ich Christian Dillo in Amerika an (wo er ganz und gar nicht auf einem anschlusslosen Berg lebt), in der Hoffnung, dass er mir den Buddhismus erläutern könne. Das tat er, und seine Darstellung war so einleuchtend und hat all meine Buddhismusvorurteile so spielend entkräftet, dass ich sehr froh bin über sein nun vorliegendes Buch. Es ist ein Buch für Kenner der Materie und eins für Leute wie mich, die immer bloß von Ferne zugeschaut haben. Der Buddhismus, wie er hier dargelegt wird, umgeht den Alltag nicht spitzfingerig, er passt diesem Alltag im Gegenteil wie angegossen. Ganz ohne esoterische Nebelmaschinen erzählt Christian Dillo den Buddhismus als eine Haltung, mit der man in der Welt steht und ihr begegnet – dem ganz großen Weltgeschehen wie auch den Dingen, die sozusagen vor der inneren Haustür geschehen. Er beschreibt den Buddhismus als eine Art Handwerk, für dessen Anwendung der Alltag nicht erst mal umständlich verräumt und vertröstet werden muss, ein Handwerk, das in ganz gewöhnlichen Situationen zum Einsatz kommen kann: auf Autofahrten, oder wenn man einen Schokoriegel isst, wenn man ein Gedicht liest, eine Mail schreibt oder bei Schmerzen jeglicher Art. Und was die sagenumwobene Meditation angeht: Christian Dillo setzt uns nicht mit einem irgendwie zu erspürenden wahren Selbst auf ein Kissen, sondern beschreibt die Meditation so detailliert und konkret, als erläutere er einen Motor, ein Organ, ein Uhrwerk. Klassische Buddhismusschlagworte – wie zum Beispiel die Achtsamkeit, das Anhaften, der Geist – werden von ihrer Klischeekruste befreit und ganz neu mit Leben gefüllt; und endlich wird auf sehr pragmatische Weise beschrieben, was es wirklich heißt, Gedanken nicht zum Tee einzuladen. Der tiefe Wunsch nach Lebendigkeit ist eine kolossale, haargenaue Gebrauchsanweisung für das Leben, gespickt mit Sätzen, die man sich über die Spüle hängen möchte. Ich wünschte, auch Herr Kordes würde es lesen.
VORBEMERKUNG des Autors
Was wir wollen, sagen und tun und wie lebendig wir uns dabei fühlen, hängt maßgeblich von unseren Überzeugungen ab. Was ist unsere Sicht auf die Wirklichkeit? Auf das Bewusstsein, den Körper, das Selbst und unser Gegenüber, auf die Zeit und den Raum? Ich habe mich schon immer dafür interessiert, wie unsere kulturell verankerten und häufig unbewussten Sichtweisen auf die Welt zunächst bemerkt und dann verwandelt werden können. Die westliche Philosophie, der ich mich als junger Mann zuwandte, blieb mir immer irgendwie zu abstrakt; meinen Wunsch nach Transformation, nach tiefgreifender, direkt erfahrbarer Veränderung hat sie nie wirklich stillen können.
Der Zen-Buddhismus, diese scheinbar unmoderne Tradition aus dem Osten, ist mir so wichtig geworden, weil sie hartnäckig auf Verkörperung beharrt. Im Zen reicht es nie, etwas begrifflich zu verstehen. Transformative Veränderung muss sich immer im Körper, durch den Körper und als der Körper zeigen. Seinem eigenen Verständnis nach hat Zen – als eine Schule des Buddhismus – die körperliche Praxis der Meditation über das Bemühen um begriffliches Verstehen gestellt. Das bedeutet nicht, dass das Rationale unwichtig wäre; es ist aber immer nur ein Werkzeug für das, was eigentlich wichtig ist: tiefgreifende, körperlich spürbare Veränderung. Aus diesem Grund habe ich mich in diesem Buch darum bemüht, scheinbar abstrakte Begriffe und Sichtweisen so weit wie möglich anhand konkreter Beispiele und mithilfe von Praxisanleitungen zu veranschaulichen.
Zen ist eine Antwort auf die uralten menschlichen Fragen nach Befreiung, authentischer Präsenz und Verbundenheit. Ich glaube, dass Zen in unserer Zeit, in der immer mehr Menschen unter Entfremdungsgefühlen, Ängsten und Depressionen leiden, einen Weg zu echter Lebendigkeit auftun kann. Durch seine Betonung von gewöhnlicher Erfahrung und Übung im Alltag stellt uns der Zen-Buddhismus – neben anderen körperorientierten Ansätzen – ein dringend benötigtes Korrektiv zur Verfügung, das dem gegenwärtigen gesellschaftlichen Trend zu immer mehr digitaler Kommunikation und virtuellen Realitäten und immer weniger körperlichem und sinnlichem Weltbezug entgegenwirken kann.
Dieses Buch basiert auf Erfahrungen und Einsichten, die ich über fünfundzwanzig Jahre durch meine Meditations- und Achtsamkeitspraxis gesammelt habe. Neben meiner eigenen Praxis habe ich in dieser Zeit aufmerksam meinen Lehrern und Lehrerinnen zugehört und ihr Verständnis der buddhistischen Lehre in mich einsickern lassen. Jetzt war es an der Zeit, meine eigenen Worte zu finden, und es ist dabei eine Art Handbuch entstanden. Jedes Kapitel steht mehr oder weniger für sich und behandelt einen bestimmten Aspekt der buddhistischen Lehre. Es geht mir darum, für die traditionellen Lehren ein neues, erfahrungsbasiertes und praktisch anwendbares Verständnis zu entwickeln. Gleichzeitig hoffe ich, dass diese Kapitel einen weiter gefassten und tiefer liegenden Wunsch nach Lebendigkeit berühren werden – einen Wunsch nach Verwirklichung von Freiheit, Weisheit und Mitgefühl in unserem eigenen Leben. Die Buchform zwingt mich, die Inhalte linear aneinanderzureihen; ich sehe den Buddhismus allerdings eher als eine Art Maschenwerk, in dem jede Lehre mit allen anderen Lehren verwoben ist und in das wir neue Fäden einweben, wenn wir die Lehren in unserem eigenen Leben zur Anwendung bringen. Ich hoffe, dass Sie, die Leserinnen und Leser, das von mir gewählte Webmuster hilfreich finden; Sie können es aber selbstverständlich auch auftrennen und die Fäden auf Ihre eigene Art verknüpfen.
Ich habe beim Schreiben dieses Buches zwei Zielgruppen im Kopf gehabt: diejenigen, die sich für Selbsttransformation interessieren, aber noch nicht wissen, wie eine buddhistische Perspektive dazu beitragen könnte, und diejenigen, die den Buddhismus bereits praktizieren, dabei aber an einer kontinuierlichen Verfeinerung von Sichtweisen und Übungsansätzen interessiert sind.
Ohne meinen Zen-Lehrer, Zentatsu Richard Baker Roshi, hätte ich dieses Buch nicht schreiben können. Ich bin ihm in tiefer Dankbarkeit verbunden. Er hat mir vorgelebt, dass es möglich ist, subtile Nuancen des Erlebens begrifflich zu artikulieren, ohne dabei die Verankerung im leiblich gespürten Körper und in der sinnlich erfahrenen Welt zu verlieren. Ich erwähne Baker Roshi an vergleichsweise wenigen Stellen, dabei hätte ich seinen Namen neben die Schlüsselbegriffe der meisten Kapitel stellen können – das allerdings hätte die Lesbarkeit des Textes unnötig beeinträchtigt.
Im Zen wird die Lehre durch einen Prozess weitergegeben, den Baker Roshi als »autodidaktische Lehrlingschaft« bezeichnet hat. Man unterweist sich selbst in der Gegenwart seines Lehrers oder seiner Lehrerin – in einem inneren Vollzug, der sich über viele Jahre oder sogar Jahrzehnte erstreckt. In diesem Prozess wird die Lehrlinie zwischen den Generationen in einer Weise weitergegeben, die sowohl Kontinuität als auch Wandel in den Inhalten und im Ausdruck der Lehre erlaubt. Neben Baker Roshi erwähne ich in diesem Buch immer wieder die Namen von Eihei Dogen, dem Gründer der Soto-Zen Lehrlinie im Japan des 13. Jahrhunderts, von Shunryu Suzuki Roshi, dem japanischen Lehrer meines Lehrers, und von verschiedenen chinesischen Meistern. Ich spreche von ihnen, als wären sie Familienmitglieder. Im Gegensatz zur westlichen Kultur, in der wir Originalität und geistiges Eigentum betonen, sehe ich mein eigenes Sprechen als nicht getrennt von dem meiner Zen-Vorfahren. Ich verstehe es vielmehr als einen Prozess, der die Lehre mit Kontinuität und Veränderung weiterträgt, hinein in diesen kulturellen Moment unserer Gegenwart.
Ich will hier auch meinem Freund und Mentor Bruce Tift sehr herzlich danken. Seine Lehre, die sich an der Schnittstelle zwischen Buddhismus und Psychotherapie bewegt, hat in den letzten Jahren mein eigenes Nachdenken darüber, was Befreiung vom Leiden wirklich heißt, tief geprägt. Der zweite Teil dieses Buches basiert in weiten Teilen auf seinen Ideen, die ich nach und nach meiner eigenen Zen-Lehre eingeschrieben habe. Ich bin ihm dankbar für sein unbeirrbares Bestehen darauf, dass es nicht darum geht, »unser Menschlich-Sein zu transzendieren«, sondern darum, immer vollständiger und freier darin anzukommen.
Ich verneige mich außerdem vor meinem Qigong-Lehrer Larry Johnson, der mir geduldig ein altes taoistisches System von dreimal 36 Übungen beigebracht hat, dessen Zweck es ist, den Körper, den Fluss der Energie und den Geist umfassend zu transformieren. Nur durch diese Praxis war es mir möglich, ein tieferes Verständnis der energetischen Dimensionen von Meditation, Achtsamkeit und Zen-Ritualen zu entwickeln. Die Saat dieser systematischen Qigong-Übung fiel auf den Boden eines viel freieren und intuitiveren Verständnisses von Verkörperung, das ich von Susan Aposhyan gelernt habe. Ihr Ansatz hat mein Verständnis von körperlicher Sensibilität und Ausdrucksfähigkeit tief beeinflusst.
Viele Menschen – mehr als ich hier erwähnen kann – haben zur Verwirklichung dieses Buches beigetragen. Alle, die im Crestone Mountain Zen Center, meinem Ausbildungskloster, mit mir praktiziert haben, und alle, die das Kloster und mich unterstützt haben, sind indirekt mit diesem Buch verbunden.
Meine Frau und Partnerin im Leben, Sophia Dixon Dillo, hat mein zeitweises Verschwinden aus unserem Familienleben mit viel Liebe ertragen und mich rückhaltlos darin unterstützt, dieses Buch in die Welt zu bringen, während sie mit unserem Sohn schwanger war und ihn zur Welt gebracht hat. Meine Schüler und Schülerinnen, die in der Entstehungszeit des Buches mit mir zusammen im Boulder Zen Center gelebt haben – Deborah Detchon, Reynold Bean, Bryant Colie, Kevin Miller und Serena Lewis – haben in meiner Abwesenheit Präsenz gezeigt und die gemeinschaftliche Zazen-Praxis fortgeführt. Darüber hinaus haben alle Praktizierenden der größeren Boulder Zen Sangha an der Formung der Ideen dieses Buches entscheidend mitgewirkt, indem sie sie in ihrem eigenen Leben ausprobiert und sich mit mir in einem fortdauernden und zutiefst nährenden Dialog über ihre daraus resultierenden Erfahrungen ausgetauscht haben. Mein besonderer Dank gilt Gary Hardin, dem Gründer des Boulder Zen Center. Er hat mir und meiner Familie in einem Akt der Freundschaft und Großherzigkeit, in Zusammenarbeit mit dem Vorstand, einen Ort zum Leben, Lernen und Lehren gegeben.
Ich hätte dieses Buch vielleicht nie geschrieben, wäre da nicht meine alte Freundin aus Universitätszeiten gewesen, Mariana Leky, deren Weg zur erfolgreichen Autorin ich mitverfolgen durfte und die mich über die Jahre immer wieder dazu angehalten hat, endlich mit meinem eigenen Schreiben voranzukommen. Als ich schließlich anfing, mit diesem Buch Ernst zu machen, hat sie die einzelnen Kapitel, sobald sie fertig wurden, eines nach dem anderen gelesen und kommentiert und mir nebenbei viel Zuspruch zukommen lassen, der mir half, Selbstzweifel und Bedenken zu überwinden. Ich reibe mir immer noch die Augen angesichts ihrer Hingabe an dieses Projekt. Was für ein Geschenk!
Mein Freund Jonathan Lee, der am Colorado College Philosophie lehrt, hat das Manuskript gelesen und viele wertvolle Kommentare und Vorschläge beigesteuert. Und schließlich hat sich Matt Zepelin, einer meiner Zen-Weggefährten und nun mein Lektor beim Shambhala-Verlag, dieses Prozesses von Schreiben, Lesen und Redigieren in einer professionellen und wunderbar unterstützenden Weise angenommen. Das Ringen mit den Beschränkungen sprachlichen Ausdrucks und redaktioneller Fristen hat so die Freude am gemeinsamen Schaffen nie wirklich beeinträchtigen können. Ich bin ihm unermesslich dankbar für seinen klugen Rat und seine sorgsame Begleitung. Für die kompetente Betreuung der deutschen Übersetzung danke ich ganz herzlich Marieke Schönian vom Ullstein Verlag und der Lektorin Vera Baschlakow.
Ich will auch meinen beiden guten Freunden Frank Hielscher und Elke Pfeifer danken, die mit der Entfaltung meines Lebens auf allen Ebenen sehr eng verbunden sind. Über viele Jahrzehnte haben mich ihre Ideen und ihre Weisheit, ihre freundschaftliche Liebe und Präsenz und ihr guter Rat inspiriert und auf unzählige Arten und Weisen gestützt und getragen.
Und schließlich danke ich meinen Eltern Gerda und Ulrich Dillo, dass sie mir und meiner Zwillingsschwester Ulrike das Leben geschenkt haben. Meine Schwester hatte, was verkörperte Intelligenz angeht, immer das größere Talent. Ihr Beispiel ist eine fortdauernde Inspiration und Motivation gewesen – es hat mir gezeigt, wie dringend notwendig es für mich war, eine regelmäßige, disziplinierte Praxis in meinem Leben zu etablieren.
Zur Verwendung der Begriffe Körper, Geist und Leib in der deutschen Übersetzung
Ich habe das Buch ursprünglich auf Englisch geschrieben. Weil es in ihm im Wesentlichen um die Erkundung und mögliche Neugestaltung der Beziehung zwischen Körper, Geist und Welt geht, kommt den englischen Begriffen body und mind eine zentrale Rolle zu. Ich habe sie mit Körper und Geist ins Deutsche übersetzt. Da beide Begriffe bei genauem Hinsehen erstaunlich komplex und etwas problematisch sind, hier kurz ein paar Anmerkungen dazu:
Der menschliche Körper ist ein seltsames Phänomen. Er ist einerseits ein Objekt unter anderen Objekten: Bäume, Vögel, Häuser, Autos, Ameisen, Ozeane, Atome, Galaxien. Man kann ihn, wie diese anderen Objekte auch, sehen, hören, tasten, riechen und schmecken. Andererseits kann man den Körper – wenn er der eigene ist – sozusagen von innen her spüren. In der deutschsprachigen Philosophie ist für den gespürten Körper das leicht verstaubt anmutende und mitunter religiös aufgeladene Wort Leib wiederentdeckt worden. Der deutsche Philosoph Hermann Schmitz hat den Leib als das definiert, was man in der Gegend seines Körpers von sich spüren kann. Er verweist dabei zu Recht darauf, dass der Leib die Grenzen des sicht- und tastbaren Körpers überschreiten kann. Einerseits wird dies von der Existenz von Phantomgliedern bei Amputierten bestätigt, andererseits können sich im unverletzten Zustand des Körpers, beispielsweise beim Sonnenbaden oder in bestimmten Meditationserfahrungen, die wahrgenommenen Körpergrenzen scheinbar auflösen. Man tritt dann in einen leiblich gespürten Weiteraum ein (davon wird im Verlauf des Buches noch die Rede sein). Der Leib ist also ein vom Körper verschiedener Phänomenbereich, der aber vom Körper nicht vollständig zu trennen ist.
Das Wort Leib bedeutet ursprünglich Leben, während das Wort Körper vom lateinischen Wort corpus abgeleitet ist und eher die physische Materialität des Körpers betont. Da es in diesem Buch um Lebendigkeit geht, habe ich mich entschieden, an den Stellen, an denen das eigenleibliche Spüren des Körpers und das Spüren der Welt am eigenen Leib im Vordergrund steht, die englischen Worte body und bodily mit Leib und leiblich zu übersetzen. An anderen Stellen spreche ich weiter von Körper und körperlich. Die im Englischen als bodyfulness bezeichnete Übung, spürend auf den eigenen Körper hinzuachten (es handelt sich um ein Wortspiel mit dem Begriff mindfulness, zu Deutsch Achtsamkeit), übersetze ich im Deutschen entsprechend als Leib-Achtsamkeit oder kurz Leiblichkeit. Anders als es vielleicht ein Philosoph tun würde, trenne ich bewusst nicht immer scharf zwischen Körper und Leib und lasse meinen Text zwischen den beiden Begriffen changieren. Oft spreche ich vom leiblich gespürten Körper (felt body), um die beiden Phänomenbereiche Körper und Leib nicht auseinanderzudividieren. Es geht in der Praxis darum, immer wieder neu zu entdecken, wie wir den eigenen Körper und die Welt der anderen Gegenstände durch leibliches Spüren beleben können. Das Einstreuen der eher ungewohnten Worte Leiblichkeit und leiblich kann uns stutzig machen und uns so immer wieder auf diese Möglichkeit gesteigerter Lebendigkeit hinweisen, die uns durch ein spürendes Hinachten auf den eigenen Körper jederzeit offensteht.
Auch das Wort Geist – meine Übersetzung für das englische mind – klingt etwas antiquiert. Es scheint aus einer anderen Ära zu stammen und weckt Assoziationen an die idealistische Philosophie, an Geister oder religiöse Begeisterung durch den Heiligen Geist. Das modernere Wort Bewusstsein könnte eine Alternative sein, greift aus meiner Sicht aber zu kurz. Mit Bewusstsein übersetze ich das englische Wort consciousness, das aber im Kontrast zu awareness (deutsch: Gewahrsein) steht. Gebraucht wird ein deutsches Wort, das wie das englische Wort mind den gesamten Phänomenbereich des Geistigen (Gewahrsein, Bewusstsein, Aufmerksamkeit, Wahrnehmung, begriffliches Denken) umfasst. Aufgrund meiner Entscheidung, mind letztlich doch mit Geist zu übersetzen, bleibt mir nun nichts anderes übrig als zu vertrauen, dass Sie, die Leserinnen und Leser, bereit sind, diesen zentralen Begriff – genauso wie die Begriffe Körper und Leib – von alten Assoziationen zu befreien und sich von meinem Text zu leicht abgewandelten, neuen Bedeutungen führen zu lassen.
EINLEITUNG Wirklich lebendig sein
Wir sind am Leben. Von der Geburt bis zu unserem Tod erfahren wir unseren Körper als den Ort, an dem sich biologische Lebendigkeit vollzieht. Biologisch am Leben zu sein bedeutet allerdings nicht, dass wir uns auch lebendig fühlen. Seltsamerweise können wir von dem, was uns am vertrautesten ist, entfremdet sein. Unsere eigene Lebendigkeit kann uns wie ein fernes Land vorkommen, obwohl wir eigentlich schon immer dort zu Hause sind.
Einer meiner Schüler – er hat eine nette Familie, einen interessanten Beruf und wirkt auf alle sehr ausgeglichen – erzählte mir, dass er jeden Morgen noch vor dem Frühstück von einer unterschwelligen Ängstlichkeit erfasst wird. Mit ihr ziehe ein Sturm sorgenvoller Gedanken und eine Stimmung auf, die ihn dann den ganzen Tag über nicht mehr verlassen würde. Fast jeden Abend gehe er mit dem Gefühl ins Bett, es durch einen weiteren Tag geschafft zu haben – als wären Tage etwas, das es durchzustehen gelte. Er verriet mir, dass die Welt, in der er lebt, sich wie hinter Glas anfühlt. Diese Glaswand existiere aber nicht nur zwischen ihm und der Welt, sondern ziehe sich mitten durch sein eigenes Dasein. Er habe zwar Gefühle, aber sie kämen ihm wie Tiere in einem Zoo vor. Einige seien vollkommen unbekannte Kreaturen, andere wären furchteinflößend, hätte er nicht gelernt, sie in Käfige einzusperren. Er komme sich vor wie ein Besucher seines eigenen Innenlebens, in dem sich alles ziemlich schal anfühlt. Dabei ist es nicht besonders hilfreich, dass sein Arbeitstag zunehmend vor einer wirklichen Glaswand stattfindet, einem flimmernden Bildschirm, auf dem alle möglichen Kommunikationen ablaufen. Die zwischenmenschliche Welt sei zwar ganz nah – direkt hier vor seiner Nase! – und doch gleichzeitig seltsam entzogen. Das Schlimmste sei das Gefühl, dass für diesen Zustand kein Ende in Sicht sei. Manchmal frage er sich, ob Menschsein sich eben einfach so anfühle.
Spiegeln sich Momente Ihres eigenen Erlebens in dieser Schilderung wider? Ich jedenfalls habe Aspekte meines eigenen Lebens aus jüngeren Jahren wiedererkannt. Natürlich sind wir nicht alle dermaßen in Gefühlen von Bedeutungslosigkeit und Entfremdung gefangen, und die meisten Menschen fühlen sich zu bestimmten Zeiten sehr lebendig. Zum Beispiel, wenn wir bis über beide Ohren verliebt sind oder beruflich einen Erfolg verbuchen. Es können auch Momente enormer sportlicher Leistung oder intensiver kreativer oder intellektueller Betätigung sein. Oder Momente stiller, sinnlicher Freude oder spirituelle Erfahrungen, in denen wir uns mit allem tief verbunden fühlen. Leider stellt sich diese Art von Erleben oft nur in Auszeiten ein – in den wirklichen oder metaphorischen Ferien.
Ein Moment besonderer Lebendigkeit ereignete sich für mich auf einer der Expeditionen in die Wildnis des amerikanischen Westens, die ich seit vielen Jahren leite und mit Bezug auf meine zen-buddhistische Praxis »Wildes Dharma« getauft habe.
Wir hatten unser Zeltlager in einem Seiten-Canyon des Dirty Devil-Flusses in Utah aufgeschlagen. Es war windig und eisig kalt – ungewöhnliches Wetter, denn im späten April sind die Temperaturen in der Wüste von Utah normalerweise sehr angenehm. Zur täglichen Morgen-Meditation mussten wir uns alle mitgebrachten Kleidungsstücke anziehen, um den widrigen Bedingungen zu trotzen. Eines Morgens, während ich in Stille dasaß, eingetaucht in meine eigenen Atembewegungen und Körperempfindungen, konnte ich hören, wie der Wind in den höheren Regionen des Canyons Hunderte von Metern über uns herumwirbelte, langsam Fahrt aufnahm und in den Blättern der Bäume raschelte. Dann, mit einem gewaltigen Stoß, erreichte er unser Lager und traf auf unsere Körper. Ohrenbetäubendes Pfeifen ging einher mit stechender Kälte in Gesicht und Fingern. Und im nächsten Augenblick: absolute Stille. Und bald darauf rollte schon die nächste Welle heran, in einem sich scheinbar endlos wiederholenden Prozess. Obwohl ich mich der Intensität dieser kalten, sandsturmartigen Böen ausgeliefert fühlte, war es zutiefst belebend, davon Zeuge zu sein, wie der Canyon ein- und ausatmete. Ich fühlte mich zu Hause in der vibrierenden Vitalität meines eigenen Erlebens.
Die Stille und Atem-Achtsamkeit der Meditationspraxis trugen sicherlich dazu bei, meine Sinne zu schärfen und meinen Körper und Geist empfänglicher zu machen. Sie stärkten auch ein Gefühl von Resilienz, von Standfestigkeit, im Angesicht des Widrigen. Ich erlebte eine innere Stabilität, an die vielleicht sonst nur schwer heranzukommen gewesen wäre. Trotz des Impulses, der Situation entfliehen zu wollen, fühlte ich mich vollständig lebendig – gewillt, an der existenziellen Gegebenheit meines Lebens teilzunehmen, die sich auf einmal nicht mehr von dem weiten Raum um mich herum unterscheiden ließ.
Wie bereits gesagt, diese Erfahrung im Canyon ereignete sich während einer Art von Ferienzeit. Aber was wäre, wenn diese begriffliche Unterscheidung zwischen Ferien und Alltag wegfiele? Wenn wir erkennen könnten, dass diese Unterscheidung in Wirklichkeit nie existiert hat, sondern nur in unserem Denkbewusstsein – genauso wie es zwischen uns und der Welt nie eine Glaswand gegeben hat? Was wäre, wenn wir diese außergewöhnlichen Momente von Lebendigkeit nicht als Ausnahmezustände verbuchen würden, sondern als Tore zu einem Praxisweg verstünden? Einer meiner Schüler bemerkte an einem Punkt seines Praxisweges, dass er manchmal auf gewöhnliche, unbelebte Gegenstände wie Pappkartons oder schmutziges Geschirr mit der gleichen Zärtlichkeit blickte wie auf seinen kleinen Sohn.
Das Gefühl des innigen Vertrautseins mit der Welt ist also unabhängig vom Erleben hoher Intensität oder grandioser Naturschönheit. Lebendigkeit kann sich einstellen, wenn man das Gewicht eines Glases Wasser in der eigenen Hand fühlt, während man sich mit einer guten Freundin unterhält, oder wenn man auf einem Spaziergang den Frühlingswind auf der Haut spürt. Lebendigkeit kann sogar zum Hintergrundempfinden all unseres Erlebens werden – es ist möglich, uns in unserem Traurig- und Glücklichsein gleichermaßen lebendig zu fühlen.
Das Grundproblem mit der Lebendigkeit ist, dass nicht alle Empfindungen angenehm sind. Manche sind so unangenehm, dass wir zu fast allem bereit sind, um sie nicht empfinden zu müssen. Die bevorzugte Art und Weise, wie wir Menschen uns von unserer Lebendigkeit abkehren, ist Aufmerksamkeit auf unser Denken und Geschichtenerzählen zu lenken. Indem wir im Kopf verweilen, können wir uns vom Spüren unserer körperlichen Lebendigkeit abkoppeln. Und in dieser Abtrennung können wir die Sinnesempfindungen auf Distanz halten, statt sie ganz erleben zu müssen. Eine andere Form dieses Abtrennens ist, unser Herz zu verschließen. Das ist eine Schutzmaßnahme, denn unser Herz offen zu halten hieße, genau die Gefühle spüren zu müssen, die wir vermeiden wollen. Obwohl uns diese Strategien, die wir normalerweise schon in der Kindheit lernen, dabei helfen, unangenehme Gefühle – diese gefährlichen Tiere – sicher wegzusperren, distanzieren wir uns durch sie ungewollt auch von allen angenehmen Gefühlen – und auch von dem in seinen verschiedenen Texturen und Schattierungen unendlichen nuancenreichen Spektrum der »neutralen« Gefühle, die nicht in die Kategorien von angenehm und unangenehm passen. Das ist ein hoher Preis, den wir da bezahlen, denn nun steht uns die gesamte Bandbreite unseres Erlebens nicht mehr offen – und normalerweise bemerken wir das nicht einmal in seinem ganzen Ausmaß.
Wie fühlt sich diese Abgetrenntheit eigentlich in unserer unmittelbaren Erfahrung an? Wenn wir genau hinschauen, können wir feststellen, dass es sich im Grunde um eine weitere Art von unangenehmer Körperempfindung handelt, diesmal aber um eine Art von Taubheit. Wir scheinen diese Taubheit den intensiveren schmerzlichen Empfindungen vorzuziehen, gegen die uns die Abgetrenntheit schützt. Ich verstehe »wirklich lebendig sein« als eine bestimmte Art von Präsenz, eine radikale Offenheit für alle Formen des Erlebens – und das schließt sogar die Erfahrung des Abgetrenntseins mit ein.
Wirklich lebendig sein, diese Offenheit für alles, was das Leben mit sich bringt, muss kultiviert werden. Und diese Kultivierung involviert grundlegende Aspekte unseres Lebens: unser Verständnis von Freiheit, die sinnlichen und kognitiven Funktionen, mit denen wir uns die Welt erschließen, sowie unsere Fähigkeit zum Miteinander mit anderen Lebewesen. Vor allem aber müssen wir, um wirklich lebendig zu sein, das Geben und Aufrechterhalten von Aufmerksamkeit kultivieren. Mal einen Moment lang ganz präsent zu sein, reicht dafür nicht. Wir müssen lernen, was es heißt, mit der Absicht des Ganz-da-Seins Ernst zu machen. »Wirklich lebendig sein« ist eine Lebenskunst, die sich unendlich verfeinern lässt. Sie speist sich aus der Praxis von Meditation und Achtsamkeit, in die ich in diesem Buch im Detail einführen möchte. Und sie beruht letztlich auf der Fähigkeit, alle Empfindungen, die durch unseren Körper fließen, zunächst zuzulassen, dann zu akzeptieren und schließlich als Ausdruck unserer eigenen Lebendigkeit zu lieben – und das gilt auch und vor allem für die unangenehmen und unerwünschten Empfindungen. Daraus entwickelt sich die Standfestigkeit, sowohl angenehmen als auch unangenehmen Sinnesempfindungen ins Auge sehen zu können. Neben dieser inneren Stabilität gehört zur Lebenskunst echter Lebendigkeit außerdem die Fähigkeit, aus Gefühlen subtile Informationen zu gewinnen und in angemessenes Sprechen und Handeln zu übersetzen. Schließlich brauchen wir darüber hinaus auch die Fähigkeit, unser Handeln in Einklang mit unseren höchsten Absichten zu bringen und unsere Weltsicht (und Selbstsicht) so anzupassen, dass sie ein freudvolles und zufriedenes Leben ermöglicht.
Was ich Kultivierung von Lebendigkeit nenne, wird gemeinhin als das Streben nach Glück verstanden, nämlich der Wunsch, sich möglichst zu jeder Zeit gut zu fühlen. Wer will das nicht? Die Wirklichkeit sieht aber anders aus: Unangenehme, angenehme und neutrale Sinnesempfindungen tauchen auf und gehen. Dazu kommt noch, dass wir »angenehm« nur im Kontrast zu »neutral« und »unangenehm« erleben können. Wenn wir also all die guten Dinge des Lebens erfahren wollen, dann müssen wir paradoxerweise auch mehr von den schlechten willkommen heißen. Im Gegensatz zum herkömmlichen Verständnis von Glücklichsein bedeutet wirklich und ganz lebendig zu sein nicht, sich besser zu fühlen, sondern sich selbst besser zu fühlen.1
Glücklichsein im Sinne eines kontinuierlichen Sich-gut-Fühlens ist unmöglich. Sich zu allen Zeiten lebendig zu fühlen – auch inmitten von schmerzvollen Gefühlen – ist dagegen durchaus möglich, wenn auch nicht einfach. Diese Art von Lebendigkeit ist wahres Glück – oder wie ich es gerne nenne: bedingungslose Zufriedenheit. Bedingungslos deswegen, weil die Zufriedenheit nicht davon abhängt, ob ich mich gut fühle oder nicht. Aus diesem Grund finden wir dort auch wahre Freiheit. Ich bin freier, wenn mein Glück (meine Zufriedenheit) nicht davon abhängt, dass ich »gute« Gefühle anhäufe und »schlechte« vermeide. Mit anderen Worten: Bedingungslose Lebendigkeit zu kultivieren, ist ein transformativer Weg. Das bedeutet, sich auf eine Reise zu begeben, auf der wir ein anderer Mensch werden – wie wir im Leben stehen, fängt an, sich grundlegend zu verwandeln. Diese Reise ist das Thema dieses Buches: Was für eine Transformation wird möglich, wenn wir unseren Fokus darauf verlegen, bedingungslos lebendig zu sein?
Seit fünfundzwanzig Jahren schöpfe ich aus der Tradition des Zen-Buddhismus, um diese bedingungslose Lebendigkeit zu erkunden und zu entwickeln. Die Frage Wie kann ich wirklich lebendig sein? war mein Einstieg in die Zen-Praxis. Ehrlich gesagt, habe ich das damals nicht in diesen Worten formuliert. Die Frage, so wie ich sie jetzt stelle, war verpackt in ein vages Gefühl von ständigem, aber manchmal akut heftigem Unbehagen. Ich war leicht depressiv, verstrickt in ungesunde Loyalitäten zu Familie und Kultur und lebte unter dem Gewicht eines diffusen und übertriebenen Verantwortungsgefühls. Ich konnte nicht mal klar auf dieses Gefühl hindeuten, auf diese untergründig beunruhigenden Körperempfindungen. Mein eigener Körper war mir verschlossen. Ich war in erster Linie damit beschäftigt zu denken, angetrieben von einem panikhaften Anliegen, mich selbst zu verstehen. Es gab bestimmte hervorstechende psychosomatische Körperempfindungen, beispielsweise eine eingeschnürte Kehle und ein Engegefühl in der Brust, aber darunter lag das viel weitreichendere Gefühl, dass alle Zellen meines Körpers irgendwie von größeren Dimensionen menschlichen Leidens blockiert waren.
Als ich begann, dieses Buch zu schreiben, lebte ich schon seit fast zwanzig Jahren in den USA. Ich bin hier verheiratet, habe einen Sohn und bin inzwischen amerikanischer Staatsbürger geworden. Aber ich bin 1971 in Deutschland geboren. Die deutsche Kultur der Siebziger- und Achtzigerjahre, wie ich sie erlebt habe, stand noch viel erkennbarer als heute unter der Last des Holocausts. Aufgrund der Präsenz dieses kollektiven Traumas bin ich in einer geistigen Haltung aufgewachsen, die ich als Heranwachsender »negativer Nationalismus« genannt habe. Es war mir unmöglich, mich auf positive Weise mit meinem Herkunftsland und seiner Kultur zu identifizieren – gleichzeitig schien es unmöglich, meine deutsche Identität zu ignorieren. Die unfassbare Hölle des Holocaust, die kollektive Erinnerung daran, wie die deutsche Demokratie unter Hitler zu Diktatur und Polizeistaat degenerierte, ohne dass es nennenswerten Widerstand von meinen deutschen Vorfahren gab, die Art und Weise, wie der öffentliche Diskurs um Schuld, Scham und Verleugnung kreiste – all das wies mich ständig auf mein Deutschsein hin. Ich konnte meine eigene Lebendigkeit unter dieser Last nicht richtig spüren.
Der Zweite Weltkrieg war in meiner Familie noch in anderer Weise präsent. Meine beiden Eltern haben als kleine Kinder ihr Zuhause verloren, als sie mit ihren Eltern vor der russischen Armee fliehen mussten. Die Familie meines Vaters war durch den Verlust ihrer ostpreußischen Heimat besonders traumatisiert. Es hat lange gebraucht, bis ich verstanden hatte, dass ich mir durch einen wie auch immer gearteten transgenerationalen Prozess psychologischer Vererbung den traumatischen Verlust meines Vaters angeeignet hatte. Als Kind und später als Erwachsener habe ich mich nie irgendwo richtig zu Hause gefühlt, und bis heute fühle ich mich besonders durch das Schicksal von Flüchtlingen berührt.
1986 war das Jahr der Atomkatastrophe von Tschernobyl. Ich war fünfzehn. Für Umweltfragen war ich bereits durch die beinahe täglichen Nachrichten zum sauren Regen und dem daraus resultierenden Waldsterben in Deutschland sensibilisiert. Wegen der radioaktiven Wolke, die in jenem Jahr aus der Ukraine über ganz Europa driftete, durften wir keinen Sport im Freien machen und weder Pilze aus dem Wald noch Gemüse aus dem Garten essen. Diese Erfahrung bestätigte mein Gefühl, dass etwas mit der Welt im Argen lag. Ich sah mich in einer aus dem Lot geratenen Zivilisation leben, die in einen Atomrüstungswettlauf verstrickt und unfähig war, im ökologischen Einklang mit der Erde zu leben.
All dies – zusammen mit einer normal neurotischen Familiendynamik – drückte auf mein Gefühl von Lebendigkeit. An diesem Szenenbild menschlichen Leidens ist nichts Besonderes außer der Tatsache, dass es meines war. Es steht im Kontext einer alles in allem guten, ziemlich privilegierten Kindheit innerhalb der deutschen Mittelschicht. Ich bin mir jetzt und war mir auch damals bewusst, dass andere Menschen mit viel widrigeren Umständen zu kämpfen hatten und haben. Aber hier geht es gar nicht um einen Vergleich, sondern um den Versuch, das Webmuster des Leidens sichtbar zu machen, das in mir einen Geist der Wegsuche hat entstehen lassen.
Was ist der Hintergrund Ihres eigenen Leidens? Wie beeinflusst es Ihr Gefühl von Lebendigkeit? Haben Sie dies als Normalität akzeptiert? Oder glauben Sie, dass da ein transformativer Wandel möglich ist?
An vorangegangener Stelle hatte ich bereits erwähnt, dass sich mein Körper auf zellulärer Ebene blockiert anfühlte; gleichzeitig wussten diese Zellen aber, dass es auch anders sein könnte. Dieser Funke an Freiheit war ein Wegweiser, eine unterschwellige Ahnung von Möglichkeit und Potenzial. Durch den Mut, dem Wegweiser zu folgen, entdeckte ich zunächst einen inneren Antrieb und dann eine existenzielle Sehnsucht, meine biologische Lebendigkeit in vollständig erlebte Lebendigkeit zu verwandeln. Es muss einen Weg geben, so empfand ich es, mich trotz allem, was an der Welt verstörend war, in ihr zu Hause zu fühlen. Einen Weg, mir meinen eigenen Ausdruck zu erlauben statt zu glauben, immer an den Erwartungen anderer entlangleben zu müssen. Einen Weg, meinen eigenen Fähigkeiten entsprechend ins Handeln zu kommen, ohne zu versuchen, Verantwortung für alle Übel der Welt zu übernehmen. Ich sehnte mich danach, wirklich lieben zu können – vorbehaltlos und ohne Schutzmechanismen. Trotz der etwas niedergedrückten Energie wussten die Zellen meines Körpers bereits, dass sie frei und lebendig sein konnten. Aus dem anfänglichen Flimmern eines wegsuchenden Geistes formte sich allmählich die Einsicht, dass sich meine Weltsicht ändern musste, um diesem bereits vorhandenen zellulären Wissen gerecht zu werden. Ich brauchte neue Fragen und Antworten.
Und da trat der Buddhismus in mein Leben. Für mich war es eine Zufallsbekanntschaft. Ganz unerwartet. Ich war Mitte zwanzig und für ein Jahr zum Auslandsstudium in den USA, als mich eine Freundin eines Tages in eine Zen-Meditationshalle einlud. Meine erste Zen-Belehrung, die ich an jenem Tag erhielt, fühlte sich an, als ob endlich jemand zu dem sprach, was für mich wesentlich war. Ich war überrascht und begeistert, dass es hier im Rahmen der westlichen Kultur solch eine Weisheitslehre gab. Natürlich hatte ich vom Buddhismus gehört, aber ich wusste bis dahin nicht, dass man ihn auch hier praktizieren konnte. Im Vergleich erschienen mir plötzlich die westlichen Disziplinen, mit denen ich vertraut war – Wissenschaft, Philosophie, Literatur und Psychologie – seltsam lebensfremd. Sie hatten ihren eigenen Wert, aber in meinem Fall hatten sie bisher fast überhaupt keine echte Hilfestellung geleistet, meinen tiefen Wunsch nach Lebendigkeit zu erfüllen.
Zen-Buddhismus hat ein bestimmtes Prestige, aber passt er auch in unsere westliche Welt des 21. Jahrhunderts? Kann er unser Leben wirklich in einer transformativen Weise berühren?
Meiner Erfahrung nach funktioniert die buddhistische Lehre. Sie bricht eine Reihe von verkrusteten Ideen in der westlichen Kultur auf und führt einen neuen Begriff von Transformation ein. Und was noch wesentlicher ist: Sie bietet Praktiken an, um diese Transformation im eigenen Leben auch verwirklichen zu können.
Das funktioniert allerdings nur, wenn wir in tiefer Verbindung mit unserer eigenen Erfahrung bleiben und darauf vertrauen, dass sie unser primärer Referenzpunkt sein kann. Das ist leichter gesagt als getan. Die menschliche Tendenz ist es, wie bereits erwähnt, ins Denken und Geschichtenerzählen zu entfliehen. Den Buddhismus als eine weitere »interessante Perspektive« auf das Leben zu behandeln ist einfacher, als ihn dazu zu verwenden, ein neues Verständnis von Selbst und Welt zu erlangen.
Meiner Meinung nach besteht die korrekte Übertragung einer Tradition darin, sie fortwährend zu rekonstruieren. Wenn wir nicht den Mut haben, buddhistische Lehren und Praktiken zu de- und zu rekonstruieren, sodass sie in wirklicher Resonanz mit unserem zeitgenössischen Leben stehen, dann wird der Buddhismus entweder zu einem weiteren Glaubenssystem oder zu einem der vielen Selbsthilfe-Titel in unserem eklektischen, postmodernen Bücherregal. Wir müssen deswegen nicht die gesamte Tradition zum Fenster hinauswerfen und ganz von vorne anfangen. Im Gegenteil, wir müssen alle Kernlehren hervorholen und sie wie Kleider anprobieren, um herauszufinden, ob sie uns passen. Diese Art von Rekonstruktion ist die Reise, die dieses Buch unternimmt.
Shunryu Suzuki Roshi, mein spiritueller Großvater, verwendete die Redewendung »der tiefste innere Wunsch«. Sie verweist auf das, was wir zutiefst mit oder aus unserem Lebendigsein machen wollen. Man könnte diesen tiefsten inneren Wunsch als »Berufung« verstehen: Was ist mein Auftrag im Leben? Ich stehe dieser Interpretation skeptisch gegenüber, weil sie zu implizieren scheint, dass es einen vorherbestimmten Plan oder Zweck in jedem menschlichen Leben gibt. Ich persönlich bin an solch metaphysischer Festlegung nicht interessiert, sondern sehe das Leben eher als einen Weg, der sich ständig auf unvorhersehbare Weise weiterentfaltet. Die Interpretation des tiefsten inneren Wunsches als Berufung tendiert außerdem dazu, uns das Leben als eine Geschichte zu verkaufen, in der es um Erfolg und Scheitern geht. Das kann uns dazu verführen, unser Glück und unseren Selbstwert vom Finden und Erfüllen dieser sogenannten Berufung abhängig zu machen.
Ein subtileres Verständnis ist, in unserem tiefsten inneren Wunsch eine Sehnsucht nach wirklichem Lebendigsein zu erkennen – nach einem Zufriedensein, das außer Lebendigkeit keines anderen Grundes bedarf und nicht von diesem oder jenem Erlebnis, Erfolg oder Besitzgegenstand abhängt. Es reicht, wenn sich die Glaswand in Luft auflöst. Haben wir nicht alle solch einen tiefen Wunsch? Er mag verschüttet, verborgen, vergessen oder verdrängt sein, aber wir alle tragen ihn in uns. Ich formuliere ihn hier als Frage: »Wie kann ich wirklich lebendig sein?« Und die Antwort will ich auf vierfache Weise geben: Transformation, Befreiung, Weisheit und Mitgefühl. Diese vier Aspekte, die ich auch die »Vier Grundannahmen des Zen« nenne, liefern die Struktur für dieses Buch. Es sind die fundamentalen Haltungen und Absichten, die dem zugrunde liegen, was den Buddhismus aus meiner Sicht transformativ sein lässt. Sie sind adäquate begriffliche Annäherungen an unseren tiefsten inneren Wunsch. Mit anderen Worten: Wenn wir diese vier Aspekte in unserem Leben verwirklichen – das heißt, wenn wir sie verstehen und verkörpern – dann erfüllt sich dadurch mit hoher Wahrscheinlichkeit unser tiefer Wunsch nach Lebendigkeit.
Der tiefste innere Wunsch ist nicht auf Zen oder den Buddhismus beschränkt. Wie ich gerne sage: Der Buddhismus hat nichts Buddhistisches an sich. Die buddhistische Tradition gibt mir sozusagen nur eine Hilfestellung beim Artikulieren dieses tiefsten aller Wünsche und beim Etablieren von Praktiken, mit denen er sich erfüllen lässt. Ich verstehe den Buddhismus deshalb eher als eine Ansammlung aller Sprach- und Praxisformen, mit denen Generationen von Praktizierenden versucht haben, ihrem formlosen, im tiefsten Inneren gefühlten Anliegen gerecht zu werden. So betrachtet ist die buddhistische Tradition eine Schatzkammer angereicherter Weisheit – dabei aber ohne jeden Status von Exklusivität. Andere Lehren und Traditionen haben auch Antworten auf das innerste Anliegen gegeben. Es ist sogar so: Wenn der Buddhismus lebendig und relevant bleiben will, dann muss er sich offen halten für alle Lehren, die auf fruchtbare Weise zu unserem tiefsten Wunsch sprechen, egal ob sie nun alt oder neu, religiös oder säkular sind.
Ich präsentiere hier ein Verständnis von Buddhismus, das keinen Glauben an etwas Transzendentes wie Gott, ein Leben nach dem Tod oder Wiedergeburt erfordert. Die moderne Säkularisierung der Gesellschaft hat mit großer Plausibilität unbeweisbare transzendente Glaubensüberzeugungen entthront. Ich nenne eine Gesellschaft »säkular«, wenn der Glaube an etwas Transzendentes in ihr optional geworden und nicht mehr unhinterfragt oder quasi-verpflichtend ist. So gesehen sind alle westlichen Gesellschaften säkular. Es ist inzwischen beinahe unmöglich, auf naive Weise an die Existenz von Gott, Gottheiten, Geistern oder ein Leben nach dem körperlichen Tod zu glauben. Wenn doch, dann tut man es, obwohl es in der Gesellschaft andere, damit unvereinbare Überzeugungen gibt und obwohl die moderne wissenschaftliche Weltsicht all diese Glaubensinhalte in Zweifel gezogen hat. Die Lösung ist dann oft, religiöse Geschichten als Metaphern zu interpretieren, die auf Mysterien verweisen, die jenseits der prosaischen und wissenschaftlich erschlossenen Welt liegen.
Einerseits befreit uns die Säkularisierung davon, Geschichten über die Wirklichkeit mit der Wirklichkeit selbst zu verwechseln. Wir sind nicht mehr verpflichtet, mit metaphysischen Behauptungen mitzugehen oder an Wunder zu glauben, die mit unserer eigenen Erfahrung oder wissenschaftlichen Erkenntnis überkreuz liegen. Andererseits tendiert die auf Wissenschaftlichkeit beruhende Säkularisierung dazu, die Wirklichkeit auf messbare und wiederholbare Datenpunkte zu reduzieren. Was Ausnahme oder einzigartig ist, wird herausgefiltert. Darüber hinaus lässt uns die Wissenschaft in der Illusion leben, dass sie ein wahres und vollständiges Bild der Wirklichkeit erzeugen kann. Sie verdeckt dabei, dass die Wirklichkeit immer mehr ist als das, was wir von ihr wissen können. Die säkulare Welt ist entmystifiziert – aber auch entzaubert. Der Verlust an Zauber trägt dazu bei, dass unser tiefster innerer Wunsch oft unbeantwortet bleibt. Viele sogenannte religiöse Lehren, die unseren tiefsten Wunsch ansprechen, sind im Zuge der Säkularisierung der westlichen Kultur absichtlich oder unabsichtlich diskreditiert worden; dabei könnten viele dieser Lehren gut ohne einen Glauben an etwas Transzendentes auskommen.
Dazu zwei Beispiele aus der Lehre des Jesus von Nazareth: »Liebe deinen Nächsten wie dich selbst« und »Liebet eure Feinde« sind mächtige Werkzeuge für Transformation, die bei genauerer Untersuchung aber überhaupt nicht auf einen Glauben an Gott angewiesen sind.
Der Buddhismus kann meiner Erfahrung nach in unserer heutigen Zeit sinnvoll und wirksam sein, wenn wir uns erlauben, ihn zu rekonstruieren. Wenn wir transzendente Orientierungen aufgeben, die mit der säkularen Moderne über Kreuz liegen, dann kann sich unser tiefer Wunsch nach wirklicher Lebendigkeit erfüllen, ohne dass wir dafür bestimmte Glaubenssätze unterschreiben müssten.
Im Gegensatz zu den meisten westlichen Religionen wurzeln östliche Traditionen wie der Buddhismus oder Taoismus nicht primär in einem Glauben an transzendente Wesen und Welten, auch wenn sie Teil der Tradition sein können. Stattdessen fußen sie auf Gesetzen, die als universal betrachtet werden, dabei aber vollkommen natürlich und diesseitig sind. Buddhistische Lehren, die sich damit befassen, wie Leiden entsteht und beendet werden kann, können überall zur Anwendung kommen – sie ähneln damit den Gesetzen der Physik. Und taoistische Lehren zum kosmischen Wechselspiel von Yin und Yang mögen esoterisch anmuten, sie beziehen sich aber wie die moderne Physik auf die natürliche und nicht auf eine übernatürliche Welt. Genauso wie Einsteins Gleichungen über Newtons physikalische Gesetze hinausgingen, so können auch wir neu formulieren, wie Leiden entsteht und beendet werden kann oder wie es möglich ist, stärker im Einklang mit den Dingen zu leben, so wie sie wirklich existieren.
Auf meiner Suche nach einer tragfähigen Transformationslehre, die meiner Skepsis gegenüber unfundierten religiösen Glaubensüberzeugungen standhalten kann, hat der Buddhismus letztlich am meisten Sinn ergeben. Und ich habe im Zen – diesem Amalgam aus Buddhismus und Taoismus – diejenige Form des Buddhismus gefunden, die am besten zu mir passt. Die Zen-Praxis hat mir bei der Kultivierung meiner Lebendigkeit und der Befreiung meines Lebens unendlich viel geholfen. Die Lehren, die ich aus meinem Praxisweg gezogen habe und die ich hier mit Ihnen teile, können jetzt hoffentlich dazu beitragen, dass Sie Ihre eigenen Antworten finden und Ihren Wunsch nach Lebendigkeit auf Ihre persönliche Weise erfüllen. Ich hoffe auch, dass sich auf der Reise durch das Buch ein paar Vorurteile auflösen werden, die viele Menschen gegenüber der Zen-Praxis haben, ohne dass dabei die Tiefendimension der Tradition verloren geht. Im Gegensatz zu den verbreiteten Zen-Klischees von meditativer Nabelschau, unverständlichen Koan-Rätseln, selbstverneinender Askese und unerschütterlicher Gelassenheit geht es im Zen letztlich um das Erlernen der Fähigkeit, uns mit ganzem Herzen auf die Herausforderungen eines menschlichen Lebens einzulassen.
Wirklich lebendig sein klingt attraktiv. Tatsächlich verlangt es uns aber sehr viel ab. Ein Streben nach Glück, verstanden als maximales Sich-gut-Fühlen, ergibt instinktiv viel mehr Sinn. Wer will schon Schmerzen haben? Aber an einem bestimmten Punkt in unserem Leben – zunächst vielleicht mit einigem Zweifel – fangen wir tatsächlich an, dem Schmerz zuzustimmen. Und zwar, weil wir den Preis nicht mehr bezahlen wollen, hinter einer Glaswand zu leben oder unsere problematischen Gefühle wegzusperren. Wenn wir versuchen, den schmerzhaften Herausforderungen in unserem Leben zu entkommen, bleiben wir paradoxerweise an sie gebunden. Unbewusst fangen wir an, unser Leben um den Schmerz herum zu organisieren – mit dem Ziel, ihn nicht erleben zu müssen. Dieses zur Gewohnheit gewordene Vermeidungsmuster kostet viel Energie, aber das ist nicht der einzige Preis, den wir dabei bezahlen. Wir opfern auch unsere Lebendigkeit und unsere Freiheit; wir erschweren uns unsere Beziehungen und verlieren das Gefühl, in der Welt wirklich zu Hause zu sein. Das Schlimmste daran: Die Fähigkeit, sich einfach so und spontan am eigenen Lebendigsein zu erfreuen, ist dann oft schon so weit entrückt, dass sie nicht einmal mehr als Möglichkeit erscheint. Wenn wir das klar erkennen und dieser Einsicht Raum in unserem Leben geben, dann können wir beginnen, unsere Lebendigkeit zu kultivieren.
Die vier Grundannahmen: Transformation, Befreiung, Weisheit und Mitgefühl
Um Lebendigkeit zu kultivieren, braucht es keine besonderen Glaubensüberzeugungen. Glaubensüberzeugungen sind Konzepte, die mit einer Wahrheitsbehauptung aufgeladen sind. Glaubenssätze über die Wirklichkeit sind nicht nur kein guter Anfangspunkt für das Kultivieren von Lebendigkeit, sie stehen dieser Kultivierung sogar im Wege. Vom Gesichtspunkt einer ungehinderten Lebendigkeit aus ist es viel besser, an nichts zu glauben. Im Zen sagen wir: »Nicht-Wissen ist das Innig-Vertrauteste.« Nicht-Wissen ist keine Ignoranz oder Abwesenheit von Wissen. Es ist auch nicht als Strategie gemeint, mit der man vermeidet, einen Standpunkt zu beziehen, oder als Totschlagargument, um die Meinung anderer Menschen abzuwerten. Es ist vielmehr die Erkenntnis, dass das Erleben immer mehr ist als das, was wir abschließend darüber wissen können. Nicht-Wissen ist eine Form der Bescheidenheit, eine Offenheit dafür, alle Formen des Wissens ständig revidieren zu können.
Statt mit Glaubensüberzeugungen beginnen wir mit der Unmittelbarkeit unseres eigenen direkten Erlebens – noch bevor es in Worte gefasst wird. Weil wir unser Erleben aber in Richtung von mehr Lebendigkeit kultivieren wollen, können wir ihm locker gehaltene Annahmen hinzufügen, die diese Richtung definieren. Eine Annahme ist keine Wahrheitsbehauptung, sondern ein Konzept, das wir wie ein Werkzeug in die Hand nehmen und dann auch wieder aus der Hand legen können, wenn es nicht mehr nützlich ist. Eine Annahme bezieht sich auf einen Erfahrungsbereich und schlägt eine bestimmte Art von Praxis vor, so wie das Halten eines Hammers die Möglichkeit impliziert, einen Nagel in die Wand zu schlagen. Wir machen bestimmte Annahmen, weil sie uns Hilfestellung beim Beantworten unseres tiefsten inneren Wunsches leisten. Wenn das gelingt, dann werden aus Annahmen Lehren.
Es ist natürlich schwer, auf etwas zu vertrauen, das wir selbst noch nicht erfahren haben. Lehren jeder Art – nicht nur spirituelle – weisen über unsere gegenwärtige Erfahrung hinaus auf etwas, das wir noch nicht verkörpern. Eine Lehre spricht zu uns, wenn sie die Grenze zwischen einer uns bereits vertrauten Erfahrung und einer uns noch unvertrauten Erfahrung beleuchtet, die aber bereit ist, gemacht zu werden. Wenn ich noch nie einen Hammer benutzt habe, ist es mir keinesfalls völlig klar, wie er zu benutzen ist. Mit der Zeit und einiger Übung aber kann mir das Benutzen des Hammers zur zweiten Natur werden. Deswegen ist es auf dem Weg der Kultivierung von Lebendigkeit fast unerlässlich, einen Lehrer oder eine Lehrerin zu haben, der oder die bereits verkörpert, was ich noch zu verwirklichen habe. Der Lehrer oder die Lehrerin ist eine Art provisorischer Beweis für das, was ich im eigenen Erleben noch nicht selbstständig bestätigen kann.
Mein eigener Lehrer, Zentatsu Baker Roshi, hat die vier Grundannahmen als die Grundabsichten gelehrt, die allen buddhistischen Lehren Leben einhauchen. Damit irgendeine buddhistische Praxis funktionieren kann, sagte er, müssten wir zunächst einmal lernen, darauf zu vertrauen, dass es in unserem eigenen Leben wirklich möglich ist:
unsere Erfahrung zu transformieren,
uns von unnötigem Leiden zu befreien,
im Einklang mit den Dingen zu leben, so wie sie wirklich sind, und
zum Wohle aller Wesen zu handeln.
Dazu bedarf es keiner Metaphysik und keiner Transzendenz. Ein spezieller spiritueller Raum wie zum Beispiel ein Himmelreich ist nicht vonnöten. Man braucht auch nicht an ein spezielles Wesen wie Gott zu glauben. Und man muss kein heiliges Dogma unterschreiben. Alles, was zum Weg der Kultivierung von Lebendigkeit produktiv beiträgt, ist willkommen. Die vier Grundannahmen sind ganz und gar diesseitig. Ihre Wirksamkeit beweist sich dadurch, dass sie uns tatsächlich dabei helfen können, unsere Erfahrung zu transformieren. Als Kurzformel beziehe ich mich auf diese vier Grundannahmen als:
Transformation
Freiheit
Weisheit
Mitgefühl
Buddhismus zu praktizieren bedeutet, die vier Grundannahmen als Antworten auf unseren tiefsten inneren Wunsch verstehen zu lernen. Im Zen genügt es allerdings nie, etwas nur intellektuell zu verstehen. Manchmal erscheinen bestimmte spirituelle Wahrheiten als völlig offensichtlich, vielleicht sogar als trivial. Es ist nicht schwer, die Grundidee in Jesus’ zentraler Lehre, seinen Nächsten wie sich selbst zu lieben, zu verstehen. Aber wie schwer ist es, diese Idee zu verkörpern! Und ähnlich verhält es sich, wenn wir unser Leben so transformieren wollen, dass wir anfangen, Befreiung vom Leiden, Weisheit und Mitgefühl tatsächlich zu verkörpern – also den Worten Taten folgen zu lassen. Dafür müssen wir viele der kulturellen Sichtweisen, die unser Leben unterbewusst steuern, infrage stellen. Und wir müssen bereit sein, neue Sichtweisen auszuprobieren, und überprüfen, ob diese neuen Sichtweisen einen Unterschied machen.
Ich will nun nacheinander einen ersten Blick auf Freiheit, Weisheit und Mitgefühl werfen, und abschließend fragen, was Transformation bedeutet. Der frühe Buddhismus – und damit meine ich die über Asien verteilten Schulen, die nicht zum sogenannten Mahayana-Buddhismus2 gehören – gründet auf der Annahme, dass es möglich ist, allem unnötigen Leiden ein Ende zu setzen. Was für eine spektakuläre Vision! Gibt es überhaupt irgendetwas, das wichtiger wäre? Aber ist das wirklich möglich? Im zweiten Teil dieses Buches werden wir uns Praktiken anschauen, mit denen sich die Befreiung vom Leiden tatsächlich realisieren lässt – von Moment zu Moment.
Spätere Formen des Buddhismus erweiterten diesen engen Fokus auf das Beenden unnötigen Leidens und betonen, dass Befreiung ohne die Verwirklichung von Weisheit und Mitgefühl nicht möglich sei. Wir können nicht wahrhaft frei sein, so die Einsicht, wenn wir in Verblendung und Ignoranz leben – also nicht verstehen, wie die Dinge wirklich existieren und wie wir wechselseitig mit anderen Wesen verbunden sind.
Das klassische buddhistische Beispiel für Verblendung ist, ein Seil fälschlicherweise für eine gefährliche Schlange zu halten. Wenn ich meine Wahrnehmung nicht infrage stelle, dann lebe ich in völlig unnötiger Furcht vor einem Seil. Unsere Wahrnehmung von Dingen ist zutiefst in die Geschichten verwickelt, die wir uns über diese Dinge erzählen. Die meisten Menschen betrachten Steuersätze und Fußballmannschaften – mal ganz abgesehen von gewichtigeren Dingen wie Kapitalismus, Menschenrechten und dem Charakter meines Ehepartners oder meiner Ehepartnerin – nicht als Geschichten, sondern als Realitäten. Es geht allerdings nicht nur darum, dass eine bestimmte Geschichte vielleicht falsch ist. In irgendeiner Geschichte oder begrifflichen Darstellung eine abschließende Wahrheit zu suchen, ist die grundlegendste Verblendung. Dann obendrein ein Narrativ oder einen Begriff in den Status einer Glaubensüberzeugung zu heben, ist Verblendung inmitten von Verblendung. Weisheit ist im Gegensatz dazu die Fähigkeit, von Moment zu Moment im Einklang mit den Dingen zu leben, so wie sie sind – das heißt frei von den Rahmungen oder Fixierungen, die den Dingen von Begriffen und Geschichten auferlegt werden. Im dritten Teil dieses Buches werden wir uns einer Reihe von Lehren und Übungen zuwenden, die uns dabei helfen können, uns aus unserer verblendeten Beziehung zur Wirklichkeit zu befreien.
Weisheit ist eine kultivierte Geisteshaltung, die in der Lage ist, situativ angemessenes Handeln hervorzubringen. Ob eine Handlung als angemessen gelten kann, hängt am Ende davon ab, ob sie zur Befreiung vom Leiden beiträgt – bei einem selbst und bei anderen. Weisheit hat deshalb immer eine ethische Dimension. Ohne Mitgefühl gibt es keine wirkliche Weisheit. Wir können nicht im Einklang mit den Dingen sein, so wie sie wirklich sind, wenn wir nicht gleichzeitig ein tiefes Verständnis dafür haben, wie innig wir mit allem in wechselseitiger Abhängigkeit immer schon verbunden sind. Und wir können nicht auf befriedigende Weise in unserer eigenen Freiheit ruhen, wenn wir uns nicht auch für die Linderung des Leidens anderer einsetzen. Die Welt entspringt in jedem Moment dieser Innigkeit zwischen dem Selbst und dem anderen – unabhängig davon, ob wir uns dessen nun bewusst sind oder nicht. Der vierte Teil des Buches erklärt im Detail, wie wir mithilfe eines sensibilisierten Körpers so mit dieser Innigkeit in Resonanz treten können, dass sie sich in mitfühlendes Handeln übersetzt.
Die transformative Verwandlung, in der unser tiefster innerer Wunsch zur Erfüllung kommt, hat also drei miteinander zusammenhängende Aspekte: Befreiung vom Leiden (oder kurz: Freiheit), Weisheit und mitfühlendes Handeln. Aber was bedeutet Transformation genau? In der Praxis zeigt sich Transformation als befreites, weises und mitfühlendes Handeln. Warum kommt ihr dann in der Liste der vier Grundannahmen ein eigener Platz zu? Das ergibt dann Sinn, wenn man den transformativen Prozess als eine Lebenskunst mit eigenen Prinzipien begreift. Um die notwendige Kunstfertigkeit zu erlangen, braucht man eine bestimmte Art von Vertrauen und Feinfühligkeit. Im Buddhismus wird Transformation als der Prozess verstanden, durch den sich ein fühlendes Wesen, also ein Wesen mit sinnlichen Fähigkeiten, in einen Buddha (wörtlich übersetzt: ein erwachtes Wesen) verwandelt. Fühlendes Wesen und Buddha sind Namen für das, was ich zuvor als biologische Lebendigkeit und vollständig verwirklichte Lebendigkeit bezeichnet habe.





























