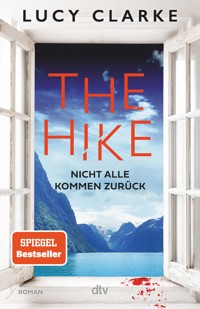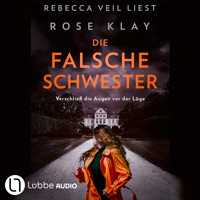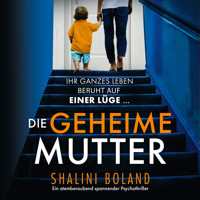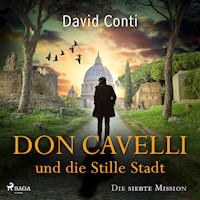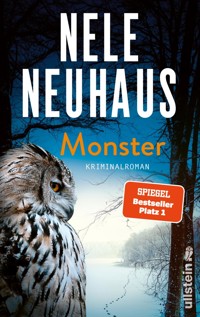N & K Nagel & Kimche E-Book
Silvio Huonder
Die Dunkelheit in den Bergen
Roman
Der Autor dankt der Schweizer Kulturstiftung PRO HELVETIA für die Unterstützung dieser Arbeit.
Der Verlag dankt SWISSLOS/Kulturförderung, Kanton Graubünden und Migros-Kulturprozent für ihre freundliche Unterstützung.
© 2012 Nagel & Kimche im Carl Hanser Verlag München Herstellung: Andrea Mogwitz und Rainald Schwarz Satz: Satz für Satz. Barbara Reischmann Druck und Bindung: Friedrich Pustet ISBN 978-3-312-00548-2 E-Book-Konvertierung: Beltz Bad Langensalza GmbH
Unser gesamtes lieferbares Programm und viele andere Informationen finden Sie unter www.hanser-literaturverlage.de
Erfahren Sie mehr über uns und unsere Autoren auf www.facebook.com/HanserLiteraturverlage oder folgen Sie uns auf Twitter: www.twitter.com/hanserliteratur
www.silviohuonder.de
Die in diesem Roman beschriebenen Ereignisse basieren auf historischen Fakten. Einige der Figuren und Handlungen sind jedoch frei erfunden.
So oft der Dienst es ihm erlaubte, wanderte der Landjäger Karl Rauch im Herbst des Jahres 1821 in der Abenddämmerung auf den Galgenhügel im Süden der Stadt Chur. Oberhalb der Straße, die nach Malix führte, setzte er sich auf einen Stein und wartete auf den Einbruch der Nacht. Von hier oben hatte er einen guten Ausblick auf den Galgen und die am Fuß des Hügels beginnende Stadt.
Am Galgen hing ein Strick, und am Strick hing ein Leichnam. Oder das, was Wind und Wetter und die Krähen nach Monaten von ihm übrig gelassen hatten. Noch am 28. August hatte der Bürgermeister einen Brief an den hochlöblichen Kleinen Rat des Kantons Graubünden geschrieben. Darin beschwerte er sich in höflichem Ton, mit untertänigster Hochachtung und aller nötigen Ehrerbietung über den Leichnam, der schon viel zu lange am Galgen hing und einen solch widerwärtigen Anblick und Geruch verbreitete, dass die in unmittelbarer Nähe wohnenden Einwohner um ihre Gesundheit fürchteten. Der Rat ließ sich Zeit mit der Antwort. Der Delinquent war im Juli vom Kriminalgericht dazu verurteilt worden, so lange am Galgen hängen zu bleiben, bis er von alleine herunterfallen würde. Unter Androhung einer hohen Strafe war es verboten, den Kadaver zu entfernen. Der Geruch wehte, je nach Windrichtung, direkt zu den nächstliegenden Häusern oder in Richtung Wald oberhalb der Stadt. Der Anblick war im Herbst nicht schöner geworden. Die Krähen hatten alles Weiche bis auf die Knochen weggepickt. Das Hemd hing in Fetzen über den Brustkorb, der wie ein leerer Käfig im Wind baumelte. Immer noch flatterten die Vögel schreiend um den Galgen herum. Einzig die Hosen hatten dem Verfall Widerstand zu leisten vermocht.
Der Landjäger Karl Rauch hatte sich freiwillig zu diesen Kontrollgängen gemeldet. Anfang November kam der Frost, und das Geruchsproblem schien gelöst. Vor Weihnachten jedoch setzte Tauwetter ein, und der Rest des Kadavers fiel eines Abends, vor den Augen des Landjägers, zu Boden. Sofort überquerte der große und kräftige Mann die Straße und ging zum Galgen hinunter, wo er unverzüglich damit begann, auf den Überresten des Verurteilten herumzutrampeln und die einzelnen Körperteile, die sich voneinander lösten, in alle Richtungen wegzutreten. Am weitesten flog der Schädel, der anschließend den Hügel hinunterkollerte und unter den Büschen verschwand, welche die Stadtmauer säumten. Der Landjäger trat die Knochen so lange vom Galgen fort, bis in der nächsten Umgebung nichts mehr von ihnen zu sehen war. Er tat dies zwar mit geduldigem Eifer, aber mit einem stoischen Gesichtsausdruck, als empfinde er dabei nichts. Um den Rest würden sich die Ratten und die Füchse kümmern.
Danach ging er vom Galgenhügel in die Stadt hinunter und berichtete seinem Vorgesetzten, dass der Leichnam vom Galgen verschwunden sei und dass gewiss niemand berichten könne, wie dies geschehen sei.
Damit war die Sache für ihn abgeschlossen.
I
Das Reich einer hauptlosen Ungebundenheit, der Volksaufläufe, einer wilden und launischen Gesetzgebung aus der Mitte des tobenden, frevelnden und strafbaren Haufens, der Verwahrlosung der Gerechtigkeit, bürgerlichen Zucht und Polizei darf nicht wieder zurückkehren. Bünden soll wissen, dass es als ein enges Bundesglied einer unter geehrten Gesetzen lebenden Eidgenossenschaft sich ihr anähnlichen muss, um dieses Bandes wert zu sein.
Schreiben des russischen und österreichischen Gesandten an die Regierung in Graubünden im Jahr 1814
1 Sonntagabend, 8. Juli 1821. Nach Einbruch der Nacht hatte es zu regnen begonnen. Es war so finster, dass man den Boden unter den Füßen nicht sah. Von den umliegenden Bergen war erst recht nichts zu erkennen. Von ihren bewaldeten Hängen ging vielleicht eine noch tiefere Finsternis aus als vom Himmel. Das konnte auch bloße Einbildung sein, eine Täuschung der Augen, die weit aufgerissen auf der Suche nach Formen und Farben ins lichtlose Nichts starrten.
In die Dunkelheit mischten sich das leichte Rauschen des Regens und ein feines Schmatzen, wenn unsichtbare Schuhe im Schlamm versanken. Hin und wieder ein kurzes leises Bimmeln, wie von einem Totenglöcklein, das von unsichtbarer Hand gleich wieder angehalten wurde. Wer sich in dieser Landschaft auskannte, der wusste von den Kühen, Rindern und Kälbern, die auf den Wiesen ruhten und die manchmal ihre von Müdigkeit schweren Köpfe bewegten. Wer sich hier auskannte, wusste von den Maiensässhütten, in denen die Bauern mit ihren Familien, Mägden und Knechten schliefen. Er wusste auch, dass das Vieh in wenigen Tagen weiter den Berg hinaufgetrieben würde. Noch standen die Alpwiesen leer. Das Gras war dieses Jahr nur langsam gewachsen. Der Winter war lange und kalt gewesen, der Schnee auf den Schattenseiten der Täler bis in den Sommer hinein liegen geblieben.
Nebelfetzen trieben über die Weiden, sie waren nicht zu sehen, aber als kalter Hauch im Gesicht zu spüren, und von irgendwo her war ein leises Flattern wie von Vogel-schwingen zu vernehmen. Wer in dieser Nacht unterwegs war, der musste froh sein, nicht gesehen zu werden. Wer nämlich angehalten wurde und keinen redlichen Grund nennen konnte, wohin und weswegen er so spät unterwegs war, wurde als lichtscheues, übles Gesindel beschimpft, von dem es in diesen Zeiten jede Menge gab. Seit Napoleons Armee Graubünden mit Krieg, Zerstörung und Verderben überzogen hatte, waren die Landstreicher zu einer Plage geworden. Deserteure, vertriebene Bauern, verarmte Handwerksleute auf der Wanderschaft und halbwüchsige Waisen – alle versuchten sie, irgendwie zu überleben. Von dem, was sie zufällig fanden, oder was sie sich mit List oder Gewalt aneignen konnten. Sie hatten nicht viel vom Leben zu erwarten, höchstens die Peitsche, den Pranger oder, wenn einer Gemeinde die Geduld gerade ausgegangen war, gar einen Strick an einem starken Ast.
Bald würden die Bauern aus Laax für einen kurzen Sommer ihre Alp wieder in Besitz nehmen, sie würden die Fenster und Türen öffnen und den Wind durch Hütte und Stall ziehen lassen. Der Senn würde das Fehlen eines Kupferkessels bemerken und sich fragen, ob sie den Kessel vergangenen Herbst ins Tal mitgenommen hatten. Auch wenn sie das sonst nie taten. Plötzlich würde einer feststellen, dass ein Fensterladen aufgebrochen war. Im grauverwitterten Holz waren helle Kerben zu sehen, von einem Hebel oder einer Waffe.
2 Ich, Baron Johann Heinrich von Mont, geboren auf Schloss Löwenberg in Schleuis, schwöre hier und jetzt vor Gott dem Allmächtigen und Allwissenden und vor dem Kleinen Rat des Kantons Graubünden, dass ich alle Pflichten meines Amtes als Kantonsverhörrichter sowie die besonderen mir von kompetenten Standesbehörden erteilten Aufträge getreulich erfüllen, den Nutzen des Kantons befördern und seinen Schaden abwenden, besonders aber, dass ich die vorfallenden Kriminaluntersuchungen unter Beachtung eines ordnungsmäßigen Rechtsganges und mit tunlichster Beförderung führen, danach angemessene Anklage abfassen, und in den Fällen, in welchen ich als Mitrichter aufzutreten habe, nach reifer Überlegung aller aus dem geführten Prozess sich ergebenden Umstände, nach Recht und Gerechtigkeit, best meines Wissens und Gewissens, erkennen und urteilen will, wie ich es mir getraue, dies dereinst vor Gottes gerechtem Richterstuhl zu verantworten –
3 Der Baron wälzte sich im Schlaf unruhig hin und her. Seine Gemahlin, geborene Gräfin Josepha von Salis-Zizers, nun Baronin von Mont, lag neben ihm und schnarchte. Es war ein feines Damenschnarchen, leise und regelmäßig. Davon wurde der Hausherr nicht wach, aber er schlief sehr unruhig. Der Baron kämpfte im Traum mit Gespenstern, die ihn seit seiner Kindheit heimsuchten, auch mit solchen aus jüngerer Zeit. Bedrückend waren sie alle. Er kämpfte gegen sie und gegen die Decke, in die er sich unglücklich verwickelt hatte, und stöhnte. Erholsam war das nicht. Wenn einer seine Probleme, die er tagsüber nicht lösen konnte, mit in den Schlaf nahm, dann wurde auch das Schlafen zu schwerer Arbeit. Wieso konnte er seine Probleme nicht tagsüber lösen? War er vielleicht zu faul, unbegabt, ungeschickt oder alles zusammen? Vor solchen Unzulänglichkeiten war auch der Adel nicht gefeit.
Aber bei ihm lagen die Dinge anders. Die Aufgaben waren zu groß, und die Mittel, über die er zu ihrer Bewältigung verfügte, waren lächerlich klein. Zuviel lastete auf seinen Schultern (die auch nicht übermäßig breit waren). Der Baron war für die Ordnung und Sicherheit im größten Kanton der Schweiz verantwortlich. Er war Verhörrichter, oberster Ankläger, Polizeidirektor und Leiter der Zuchtanstalt Sennhof. Die Obrigkeiten und die Einwohner verließen sich darauf, dass er das Böse, Schlechte, Gefährliche, Gesetzeswidrige von ihnen fernhielt. Niemanden kümmerte es, wie er dies mit nur zwanzig Landjägern schaffen sollte, in einem Berggebiet mit hundertfünfzig Tälern und vier Dutzend Gerichtsgemeinden, in denen Deutsch, Romanisch und Italienisch gesprochen wurde und die auf ihre Unabhängigkeit großen Wert legten. Es war nicht zu schaffen. Die Landjäger brauchte er fast alle zur Kontrolle der Grenzen mit Italien, Österreich und dem Fürstentum Liechtenstein.
Der Baron redete im Schlaf. Was er sagte, hörte sich an wie schroffes Befehlen. Ihm war heiß, er schwitzte, als wäre ein Fieber in ihm. Er träumte von drei riesigen Kugeln, drei Planeten im All, die sich langsam um ein unsichtbares Zentrum drehten. Und er, der Baron, sollte ihre Bahnen verändern, sie in eine gemeinsame Richtung lenken. Eine übermenschliche Aufgabe. Er stöhnte lauter, die Frau Baronin unterbrach ihre nächtlichen Atemgeräusche und fragte: Heinrich? Bist du wach?
Nein, der Herr Baron schlief bloß mit geschäftiger Unruhe. Drei gewaltige Planeten – und er war nur ein Mensch, wenn auch ein adeliger, beurkundet vom Bayerischen König. Die Familie von Mont war im Besitz eines Schlosses in Schleuis, in der Nähe von Ilanz, dem Hauptort des Grauen Bundes. Schloss Löwenberg stand seit mehr als zwanzig Jahren leer und war inzwischen verwahrlost. Türen und Fenster waren aufgebrochen, und lichtscheues Gesindel hielt sich gelegentlich dort versteckt. Landrichter Christian von Marchion hatte ihn wiederholt darauf hingewiesen, dass sich auf dem Familiensitz der von Monts heimatloses Pack eingenistet habe. Die Eltern des Barons lebten im Tirol, und er selbst bewohnte mit seiner Gemahlin ein standesgemäßes Haus in Chur, zu Füßen des bischöflichen Hofes. Die Zuchtanstalt, in der er seinen Amtssitz hatte, war nur hundert Schritte vom Wohnhaus entfernt. Er konnte morgens zu Fuß aus dem Haus, an den bischöflichen Ställen vorbei, und schon stand er vor dem schweren, mit Eisenbändern gesicherten Tor des Sennhofs.
Das Gefängnis bereitete ihm ebenfalls Sorgen, da es nicht sicher war. Vor wenigen Tagen waren zwei Weibsbilder ausgebrochen, die sich in Hinterzimmern der Churer Schankhäuser der Wollust gegen Bezahlung hingegeben hatten und die außerdem des wiederholten Diebstahls beschuldigt wurden. Gleichzeitig mit ihnen war ein falscher Arzt geflohen. Der Mann wurde für den Tod einer angesehenen Churer Bürgerin verantwortlich gemacht. Einige Wochen zuvor hatte er eine Annonce in der Churer Zeitung veröffentlichen lassen und sich darin als Chirurgus mit zahlreichen Referenzen empfohlen. Er werde vom 1. bis zum 6. Juni im Hotel Lukmanier weilen und dort für die Durchführung von Operationen verschiedenster Art zur Verfügung stehen. Frau Foppa, die Gattin des Meisters der Schneiderzunft, hatte sich von ihm operieren lassen und war verblutet. Nachfragen hatten ergeben, dass der Mann keine Lizenz als Arzt besaß. Es sollte ihm nächste Woche der Prozess gemacht werden, nun war er zusammen mit den beiden Weibern geflohen.
Weshalb ihnen die Flucht aus dem Sennhof gelungen war, konnte der Wärter nicht erklären. Er gab aber zu, in der Wachstube für einen Augenblick eingenickt zu sein. Als er wieder aufwachte, waren die Weiber und der falsche Arzt verschwunden. Die Zellentüren standen offen, der Schlüsselbund lag im Hof. Darauf machten sich Venzin und Arpagaus, die beiden in der Hauptstadt stationierten Landjäger, sofort an die Verfolgung. Es hieß, die Flüchtigen seien in Maienfeld gesehen worden und wollten sich rheinabwärts aus dem Staub machen.
Als der Baron aus seinem unruhigen Schlaf erwachte, stellte er erschrocken fest, dass das Nachtlicht im Zimmer erloschen war. Er ärgerte sich, sowohl über die Magd, die solch schlechte Nachtlichter besorgte, als auch über den Krämer Moritzi am Kornplatz, der solch schlechte Ware anbot. Ein Nachtlicht sollte die ganze Nacht hindurch brennen können, dafür war es doch vorgesehen. Lange konnte der Baron aber nicht bei seinem Ärger verweilen. Seine Phantasie pflegte in der Dunkelheit sogleich Ungeheuer zu gebären. Es machte keinen Unterschied, ob er sich seiner Einbildung bewusst war oder nicht. Die Gestalten waren nicht weniger grässlich, nur weil sie seiner Vorstellung entsprangen. Einbildungskraft, vermutete er, war außerdem die Grundlage für den Wahnsinn. Die Vermischung von Realität und Phantasie konnte auf eine ernsthafte Geisteskrankheit hinauslaufen. Es war dumm und gefährlich, sich freiwillig solchen Zuständen hinzugeben.
In panischer Angst saß er im Bett und nahm den röchelnden Atem seiner Gemahlin als diffuse Bedrohung wahr, wie auch das Bellen eines Hundes, das von Ferne durch die Mauern drang. Er befreite sich von der Decke, in die er sich verheddert hatte, und tastete mit den Händen auf der Kommode neben dem Bett herum, bis er die Phosphorhölzer fand und den Messinghalter mit der Talgkerze. Mit zitternden Fingern versuchte er, ein Hölzchen aus der Dose zu nehmen, verschüttete dabei einige, bis es ihm endlich gelang, eines anzuzünden und an den Docht zu halten. Im ersten Augenblick, als die Flamme flackerte und seltsame Schatten über die Wände huschten, schienen die Ungeheuer zu tanzen, aber dann brannte das Nachtlicht gleichmäßig, der Baron erkannte die Einzelheiten seines Schlafzimmers und beruhigte sich einigermaßen.
An Schlaf war aber nicht mehr zu denken. Seine Panik war einer angespannten Aufmerksamkeit gewichen. Die Welt war zurechtgerückt, und er wusste wieder, dass er sich vor nichts anderem fürchtete als vor seinen eigenen Erinnerungen. Genaugenommen war es nur eine, eine ganz bestimmte Erinnerung. Er war damals zehn Jahre alt und hätte in Begleitung einer Magd ins Südtirol reisen sollen. Die Reise war zu einem Albtraum geworden. Gegen die Erinnerung würde nur Beschäftigung helfen. Er wusste nicht, wie weit die Nacht vorangeschritten war, aber er hatte keine Wahl. Er zog das Nachthemd aus, schlüpfte in seine Kleider, in die Schuhe, band sich vor dem Spiegel das Halstuch um, legte den Gehrock an und hängte sich zum Schluss die Degenkoppel mit der Messingschnalle um. Dann nahm er das Nachtlicht und verließ geräuschlos das Zimmer. Er durchquerte das große Entrée und betrat die Stube, deren Fenster auf die Süßwinkelgasse hinausgingen. Draußen war es finster. Als der Baron endlich fertig angezogen und gerüstet im Sessel saß, das Nachtlicht auf dem Sims neben sich, und die neueste Ausgabe der Churer Zeitung in die Hand nahm, war er gefasst und bereit, jeder Aufgabe und jedem Problem gegenüberzutreten.
Wie gewohnt, begann er die Zeitung auf der letzten Seite zu lesen. Er überflog die kurzen Meldungen aus der Umgebung. Ein Unglücksfall hatte sich ereignet: Im Waisenhaus der Stadt Chur war eine Frau in einen Kessel mit siedender Lauge gefallen und bald darauf unter unsäglichen Schmerzen gestorben. Der Baron hatte bereits davon gehört. Ein tragisches Missgeschick.
Er entdeckte eine Ankündigung der Buchhandlung und Druckerei Orell, Füßli und Compagnie aus Zürich. Vom Monat Juli an würde die Neue Zürcher Zeitung dreimal wöchentlich erscheinen und nebst dem Kern der Neuheiten aus dem Ausland besonders auch die Nachrichten aus der Schweiz enthalten. Der Preis des halben Jahrgangs wurde auf sechs Schweizerfranken festgelegt. Die Redaktion der Neuen Zürcher Zeitung, so wurde angekündigt, wolle sich alle Mühe geben, ihren werten Lesern in bündiger Kürze das Wichtigste der Zeitbegebenheiten, nach Tatsachen, ohne Parteilichkeit und Leidenschaft, in würdiger, ernster, aber freier Sprache und mit möglichster Schnelligkeit mitzuteilen.
Er blätterte weiter durch die Zeitung und überflog die Überschriften. Auf einer Seite blieb er plötzlich hängen: Napoleon Bonaparte, ehemals Kaiser der Franzosen, war am 5. Mai dieses Jahres auf der Insel St. Helena gestorben. Es hieß, er habe sich in seiner letzten Stunde die Uniform anziehen und den Degen umgürten lassen. General Bonaparte, so wurde aus verlässlicher Quelle berichtet, habe als Soldat sterben wollen.
Baron Johann Heinrich von Mont, dreiunddreißig Jahre alt, saß auf einem Sessel in seinem Wohnzimmer, mitten in der Nacht, vollständig bekleidet mit einem eng geschnittenen taubenblauen Gehrock, dessen schwarze Naht und schwarze Knöpfe den Uniformcharakter unterstrichen, und mit umgehängtem Degen zum Ausgang gerüstet. Er ließ die Zeitung sinken, betrachtete im Fensterglas sein eigenes Spiegelbild und fühlte sich ertappt.
Obwohl er seine juristische Ausbildung und Karriere im bayerischen Königreich und davor in der Habsburger Monarchie absolviert hatte, bei Kriegsgegnern der Franzosen mithin, und obwohl die Franzosen verheerendes Unheil über Graubünden gebracht hatten, hegte der Baron große Bewunderung für Napoleon. Er sah in ihm einen genialen Feldherrn von schier unerschöpflicher Energie. Darin war er sich mit seinem Herrn Vater einig. Peter Anton Moritz von Mont war früher Offizier in der französischen Schweizergarde gewesen.
Etwas Napoleonisches wollte er in sich selbst sehen, der Herr Baron, ein unermüdlicher Feldherr gegen Unordnung, Ungesetzlichkeit und Zwielicht, ein Soldat im Kampf gegen das Ungefähre, das Undurchschaubare und Ungreifbare. Als Zehnjähriger war er von Graubünden nach Meran ins Gymnasium gegangen und hatte sich brennend für das Recht zu interessieren begonnen. Die Reise selbst stand damals unter einem denkbar unglücklichen Stern (nicht daran denken!), was sein Interesse an der Justiz aber noch entschieden beförderte. Nach dem Gymnasium studierte er in Innsbruck, danach in Landshut, und in München legte er seine Staatsprüfung ab. Obwohl er Assistent beim Oberappellationsgericht wurde und eine glänzende Karriere in königlich bayerischen Staatsdiensten vor ihm lag, hatte er sich vor drei Jahren entschieden, nach Graubünden zurückzukehren und hier das Amt als Verhörrichter und Polizeidirektor zu übernehmen. Es war noch schwieriger, als er es sich vorgestellt hatte. In den Gerichtsgemeinden des Kantons herrschten Anarchie und Missbrauch. Recht wurde nach Gutdünken gesprochen. Die einflussreichen Familien in den entlegenen Talschaften und Gemeinden wollten weder Macht abtreten noch Geld abführen. Besonders die Katholischen (zu denen er selbst auch gehörte) versuchten, die Anstrengungen des Kantons zu verhindern oder wieder abzuschaffen: Kantonsschule, Sanitätswesen, Polizei.
Der Baron musste behutsam vorgehen und die Autorität seines Amtes langsam, aber beständig ausdehnen. Dafür brauchte er mehr Männer, die unter seiner Führung richtig zupacken konnten. Tatkräftige Soldaten im Kampf gegen das Unrecht. Landjäger wie Venzin und Arpagaus. Er brauchte entschieden mehr Landjäger, als die Kantonsregierung ihm bisher zugebilligt hatte.
4 Auf der Straße, die vom Bodensee das Rheintal hinauf führte, gingen zwei recht ungleiche Männer nebeneinander her. Der eine war ein baumlanger Kerl mit breitem Kreuz, der andere von schlanker Gestalt, mit hellem, wildem Lockenkopf und einem Backenbart, wie er zur Zeit Mode war. Während der Lange drei Schritte machte, nahm der Blonde vier, so blieben sie gleichauf. Das ergab einen eigenartigen Rhythmus, der sie aber nicht zu stören schien. Wortlos schritten sie nebeneinander her, nicht so frisch und beschwingt wie am ersten Tag, aber mit einem festen Ziel vor Augen. Sie wollten ankommen, wie müde Pferde mit Stalldrang. Seit mehreren Wochen schon waren sie unterwegs, unermüdlich in brütender Sonne und bei Regen. Sie gingen mit dem Nordwind im Rücken oder mit dem Südwind im Gesicht. Sie marschierten bei Tag und schliefen nachts im Freien unter Bäumen, in Heuställen und, selten genug, in einem Bett.
Sie waren Richtung Süden unterwegs, in die Heimat. Von Bergen op Zoom, wo sie die letzten vier Jahre in der königlich-niederländischen Armee gedient hatten, immer rheinaufwärts durch die deutschen Fürstentümer bis zum Bodensee und von dort weiter das Rheintal hinauf. Gut versteckt am Leib trug jeder von ihnen, was er an Sold gespart hatte, und ein Transitschreiben mit Unterschrift und Siegel des Obersten Jakob von Sprecher, dem Befehlshaber des Bündner Regiments in der Armee König Wilhelms I.
Linus Hostetter und Karl Rauch – so hießen der Blonde und der Lange – hatten sich zusammen mit anderen jungen Bündnern anwerben lassen. Nach Ablauf der vereinbarten Dienstzeit hätten sie nun im Frühjahr in die Ostindische Kompanie eintreten können. Aber das Heimweh und die Sehnsucht nach einer vertikalen Landschaft zogen sie zurück in die Berge.
Der kleine Karli, wie er trotz seiner enormen Körpergröße zu Hause genannt wurde, hatte als elftes und jüngstes Kind eines Lugnezer Bergbauern ein hartes Leben gehabt. Mit neun wurde er an einen Allgäuer Großbauern als Kuhhirte verdingt, sechs Jahre später, in denen er Hunger, Schläge und Schlimmeres auszuhalten hatte, bekam er eine geflickte Jacke und ein paar gebrauchte Schuhe und wurde mit einem fahrenden Händler nach Graubünden zurückgeschickt.
Zum Glück ließ sich ein Vetter seines Vaters darauf ein, ihn als Lehrjungen anzunehmen. Onkel Mohn war Mitglied der Churer Schmiedezunft und dachte sich, dass ein so großer stämmiger Kerl mit einem breiten Kreuz durchaus geeignet sei, schwerknochige Kutschpferde zu beschlagen. Das erste Jahr hatte Karli denn auch nichts anderes zu tun, als das Bein des Pferdes festzuhalten, während Onkel Mohn oder sein Geselle den Huf beschlug. Er hatte alle Zeit der Welt, um zuzuschauen, wie man das richtig anstellte. Tag für Tag stand er in gebückter Haltung neben dem Pferd und hielt mit eiserner Hand das Vorderbein oder das Hinterbein fest, das auf seinem Oberschenkel lag, während der Huf beschnitten, das glühende Eisen aufgepresst und nach dem Abkühlen angenagelt wurde. Der Rauch des verbrannten Horns stieg ihm ins Gesicht und wurde zu seinem eigenen Geruch, den er nicht mehr loswurde. Es gab faule Pferde, die ihr ganzes Gewicht auf seinen Oberschenkel stützten, und andere, die nervös, unruhig und bockig waren. Karli stand ruhig und beschwerte sich nicht. Nur manchmal, wenn ein Gaul sich besonders widerspenstig und unwillig gebärdete, schlug er mit der flachen Hand von unten an den Pferdebauch, so schwungvoll und klatschend, dass der Gaul sofort zitternd stillhielt. Nach dem Beschlagen fegte Karli die Hornsplitter zusammen und kippte sie in die Holzkiste. Einmal die Woche wurden sie vom Winzer des Bischofs abgeholt, der mit ihnen die Reben düngte. War gegen Abend noch etwas Zeit vor dem Eindunkeln und die Glut auf der Esse noch nicht erloschen, durfte Karli die dünnen abgelaufenen Hufeisen geradehämmern und aus ihnen Messerklingen schmieden.
Nach einem Jahr hatte Karli seinen Onkel gefragt, wann er selbst denn einmal ein Pferd beschlagen dürfe.
Wenn die Zeit gekommen sei, antwortete der Onkel und stocherte in der Glut, dass die Funken stoben.
Und wann diese Zeit gekommen sei, fragte Karli.
Onkel Mohn packte das rotglühende Eisen mit der Zange, hielt es prüfend über den Huf und presste es an. Qualm von verbranntem Horn stieg auf und nebelte Karli ein. Das war die Antwort.
Die Berge, die das Rheintal flankierten, rückten näher zusammen und wurden höher. Die Landschaft vor ihnen wurde felsiger, auf den Gipfeln waren weiße Flecken zu sehen, Sommerschnee. In zwei Tagen würden sie endlich zu Hause sein. Wenn man zu Fuß ging, hatte man Zeit, über einiges nachzudenken. Karl Rauch war damals Hufschmied geworden, und er war sehr zufrieden damit. Hostetter blickte ihn von der Seite an und entdeckte den Anflug von guter Laune in seinem Gesicht.
Freust du dich, nach Hause zu kommen?, fragte er ihn.
Weiß nicht, antwortete Rauch.
Am Nachmittag ließen sie das Städtchen Dornbirn hinter sich, mehrere Gespanne zogen an ihnen vorbei, ohne sie zum Mitfahren einzuladen, bis sich ein Fuhrmann mit einer großen Ladung Salzfässer der winkenden Wanderer erbarmte und sie aufsteigen ließ. Rauch setzte sich rittlings auf eines der Fässer, während Hostetter auf den Kutschbock kletterte und gleich anfing, mit dem Fuhrmann über das Gespann zu fachsimpeln. Hostetter hatte schon als Kind eine Leidenschaft für das Lenken von Pferden gezeigt und in der väterlichen Viehhandlung jede Gelegenheit genutzt, die Leinen in die Hand zu nehmen. Nun hatte er ein offenes Ohr gefunden und erzählte von den schweren Kutschpferden der Brabanter Rasse, von ihrer Kraft und Gutmütigkeit, und von seinem Sechsergespann, mit dem er in den Niederlanden die dreipfündige Kanone gezogen hatte. Hostetter hatte irgendwann die Aufmerksamkeit eines Artillerieoffiziers auf sich ziehen und sein wahres Talent als Fahrer zeigen können. Für ihn gab es keine schlimmere Vorstellung als die, das Leben eines Fußgängers zu führen (wie in den zurückliegenden Wochen). Während er über sein Lieblingsthema redete, bemerkte er eine gewisse Trägheit beim Lenker der Salzfuhre, eine faule Art, die Leinen hängen und die Pferde ihren Weg selber wählen zu lassen. Er musste sich stark zusammenreißen, um dem anderen nicht in die Leinen zu greifen.
Kurz vor Feldkirch, die Straße war auf beiden Seiten von hohen Hecken gesäumt und beschrieb einen Bogen, den man nicht bis zum Ende überschauen konnte, mussten sie hinter einer Kutsche anhalten. Der Fuhrmann verlor seine Trägheit und begann zu brüllen. Was denn da vorn los sei, ob da jemand betrunken oder eingeschlafen sei. Er bekam keine Antwort. Hostetter sprang vom Bock und ging nach vorn um nachzusehen, Rauch folgte ihm. Vor ihnen versperrte ein dunkelgrüner Landauer mit einem Schimmelgespann die Straße, zwei Herren schauten sorgenvoll aus dem Fenster, der Kutscher auf dem Bock zuckte die Achseln und wies mit seinem Arm nach vorn. Vor dem Landauer stand ein Heuwagen, davor noch ein Gefährt, und so ging es weiter. Eine lange Reihe Gespanne staute sich vor ihnen. Dann sahen sie auch den Grund dafür. Da, wo die Straße durch einen Baum beengt wurde, hatten sich die Räder zweier Fahrzeuge ineinander verkeilt. Das eine war ein mit Holzstämmen beladener Vierspänner, das andere ein leichtes Einspänner-Cabriolet. Auf der Seite des Holzwagens wäre genügend Platz gewesen, um auszuweichen. Der Fuhrmann schlug mit der Peitsche auf seine Pferde ein, um mit Gewalt den Durchbruch zu erzwingen, aber es gelang ihm nicht. Im Cabriolet saßen ein älterer Herr und eine jüngere Frau. Der ältere Herr versuchte vergebens, seinen großen Braunen rückwärts zu bewegen. Das Cabriolet war fest zwischen dem Holzwagen und dem Baum eingekeilt. Die Frau schaute hilflos die beiden Freunde an, und der lange Rauch ging zu ihr hin und half ihr beim Aussteigen.
Hostetter wunderte sich ordentlich darüber, war sonst doch er für die Sorgen der Damen zuständig (neben den Pferden seine andere Leidenschaft). Seit er Rauch kannte, da war dieser noch Lehrjunge beim Schmied, hatte er ihn nicht ein einziges Mal mit einem weiblichen Wesen reden sehen. Und jetzt reichte er dieser Unbekannten die Hand? Kannten sie sich etwa? Sie war ziemlich groß für eine Frau und bewegte sich langsam, aber nicht ohne Anmut. Obwohl es warm war, trug sie ein wollenes Tuch über der Schulter. In der Hand eine Tasche. Sie war gekleidet wie für eine Reise.
Dann wurde Hostetters Aufmerksamkeit wieder vom zornigen Kutscher gefangen, der fluchte und mit der Peitsche knallte. Der Kerl war offensichtlich nicht mehr nüchtern und übersah, dass er ohnehin nicht an den wartenden Gespannen vorbeikommen würde. Er war derjenige, der ein paar Schritte zurücksetzen musste, um die anderen vorbeiziehen zu lassen. Hostetter griff dem Gespann in die Zügel und versuchte die Pferde zu beruhigen. Er sah, dass sich sein Kamerad weiter mit der Frau unterhielt und rief ihn zu Hilfe: He, Rauch! Da spürte er plötzlich ein Brennen an der Wange, als hätte ihn eine Hornisse gestochen. Der betrunkene Kutscher holte erneut mit der Peitsche aus. Rauch war mit ein paar Schritten bei ihm, riss ihm die Peitsche aus der Hand und schleuderte sie über die Hecke. Der Kutscher ließ die Leinen fallen und erhob seine Fäuste gegen Rauch, aber das hätte er sich überlegen sollen. Rauch fing seinen Arm ab, riss den Kutscher zu sich herunter, packte ihn an der Jacke und warf ihn ebenfalls über die Hecke. Da der Kutscher etwas schwerer war als die Peitsche, landete er oben auf der stachligen Brombeerhecke, wo er wie am Spieß zu schreien begann.
Während der Fuhrmann sich mühselig aus den Dornen zu befreien versuchte und dabei übel zerkratzt wurde, ließ Hostetter den Vierspänner rückwärts rollen, bis die Räder nicht mehr verkeilt waren. Rauch stemmte das Cabriolet hinten hoch und rückte es etwas vom Baum weg. Dann half Rauch der Frau wieder in den Wagen. Sie fragte ihn, ob er das letzte Stück bis Feldkirch mit ihr und dem Herrn Doktor mitfahren wolle. Der Herr Doktor habe sicher nichts dagegen, nachdem er ihnen so geholfen habe. Hostetter traute seinen Augen nicht, als Rauch das Angebot annahm. Der ältere Herr rückte an den linken Rand des Cabriolets, die hochgewachsene Frau setzte sich in die Mitte, Rauch nahm rechts von ihr Platz.
Bis Feldkirch!, bestätigte Rauch und nickte Hostetter zu.
Die Pferde warfen sich ins Geschirr, die Gespanne setzten sich nacheinander wieder in Bewegung, und die Räder ächzten und rumpelten an Hostetter vorbei, der warten musste, bis die Salzfuhre auftauchte und er sich wieder neben den Kutscher setzen konnte.
5 Das Cabriolet war eigentlich für zwei Personen ausgelegt, zu dritt war es etwas eng auf der gepolsterten Sitzbank. Die junge Frau war jedoch vergnügt und schien es lustig zu finden, zwischen zwei Männern eingeklemmt zu sein.
Ich heiße Franziska, sagte sie und schenkte Rauch ein Lächeln. Er blickte geradeaus auf den Fahrweg. Der große Braune ging im Schritt hinter dem vorausfahrenden Gespann.
Und unser Retter?, fragte sie, als Rauch auch nach längerer Pause keine Anstalten machte, sich seinerseits vorzustellen. Hat er auch einen Namen?
Rauch, sagte er.
Rauch? Das ist ja lustig. Gibt es da auch ein Feuer?
Er dachte angestrengt nach, was auf diese Frage zu antworten war, aber es fiel ihm nichts ein.
Hat er auch einen Vornamen?, wollte sie wissen.
Ja, sagte er, und nach einer Pause, in der er noch über den Zusammenhang von Rauch und Feuer nachdachte und sie lachte, fügte er hinzu: Karl.
Er wusste nicht, wie ihm geschah. Noch nie hatte eine junge Frau nach seinem Namen gefragt. Überhaupt hatte sich selten eine Frau mit ihm unterhalten, seit er aus der Obhut der Mutter entlassen war. Seine Welt war eine männliche, als Schwabengänger, beim Hufschmied in der Lehre, in der Armee. Frauen kamen darin allenfalls am Rande vor. Er nahm sie aus der Distanz wahr, als fremde Wesen, denen seine Kumpane im Freigang nachstellten (allen voran Hostetter). Und nun presste sich ein warmer, weicher Körper an seine Seite, und die Frau stellte ihm Fragen, die ihn verwirrten. Er brauchte eine Weile, um die Bedeutung ihrer Worte zu erfassen. Ob es ein Feuer gibt? Ein Haus mit Herd hatte er jedenfalls nicht. Und an einer Esse hatte er schon lange nicht mehr gestanden. War es das, was sie wissen wollte?
Da stellte die neugierige Person schon die nächste Frage: Woher kommt er denn?
Aus Vrin, sagte er, im Lugnez.
Das ist doch im Bündnerland, lachte sie, er kommt aber aus der anderen Richtung. Geht er nach Hause?
Ja, sagte er.
Was für ein maulfauler Kerl, dachte der ältere Herr, der die Zügel in der Hand hielt und so tat, als würde er sich auf den Verkehr konzentrieren und gar nicht zuhören.
Der jungen Frau schien die Wortkargheit ihrer neuen Begleitung nichts auszumachen. Und wo war er?, fragte sie.
In Holland, im Militär.
Dann ist er ein Söldner auf dem Heimweg?, sagte sie. Deshalb kann er so zupacken, ich meine den Streit mit dem Kutscher vorhin, was für ein Grobian und betrunken dazu. Ich bin ja froh, dass der Herr Doktor so nett ist, mich bis Feldkirch mitzunehmen. Ich bin aus Dornbirn und will auch ins Bündnerland, sagte sie.
Rauch war froh, dass er zuhören durfte und keine komplizierten Fragen mehr beantworten musste.
Heut schlaf ich in Feldkirch bei meiner Tante, erzählte sie offenherzig, morgen früh nehm ich die Postkutsche. Ich will zu meinem früheren Dienstherrn, der schuldet mir Geld. Hat er auch einen Beruf?
Hufschmied.
Hufschmied ist gut, sagte sie ernsthaft, Pferde wird es geben, solang der Mensch reisen muss, also immer. Trinkt er auch manchmal?, wollte sie nach einer Pause von ihm wissen.
Schnaps?, fragte er.
Ja?
Nicht viel.
Das ist gut so. Ein Mann darf nicht zuviel trinken, und er muss groß sein. Das sind die wichtigsten zwei Dinge, sagte sie.
Er war groß, und er trank selten Branntwein, dachte er.
Wo würde ich ihn denn finden, wenn ich mit meinem Dienstherrn fertig bin und Karl Rauch besuchen wollte?,
fragte sie und lachte dabei, als würde sie einen Scherz machen.
Beim Hufschmied Mohn in Chur, erwiderte Rauch ernst, das ist mein Onkel, vielleicht stellt er mich wieder ein.
Das war ja ein langer Satz, dachte der Herr Doktor, der besonders aufmerksam die Räder beachtete, wenn er andere Wagen kreuzte.
6 Auf dem Hauptplatz