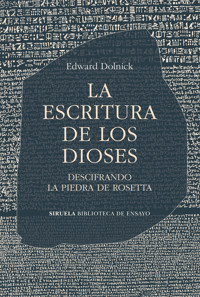18,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Nagel & Kimche
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2022
Der Engländer Thomas Young und der Franzose Jean-François Champollion ringen Anfang des 19. Jahrhunderts darum, als erster das Geheimnis der Hieroglyphen des Alten Ägyptens zu lösen. Bis es Jean-François Champollion schließlich im September 1822 gelingt.
Der Rosetta-Stein wurde 1799 in einem Schutthaufen entdeckt. Er wurde im Alten Ägypten mit den Inschriften versehen und trug dieselbe Botschaft in drei verschiedenen Sprachen – auf Griechisch mit griechischen Buchstaben, auf Demotisch, der Sprache, die in Ägypten im 7. Jahrhundert v. Chr. gesprochen wurde, und mit einer Bilderschrift, den Hieroglyphen.
Thomas Young und Jean-François Champollion: beide wollten den Wettkampf um die Entschlüsselung der Hieroglyphen gewinnen. Der eine war Engländer, der andere Franzose, zu einer Zeit, als England und Frankreich verfeindet und die beiden großen Supermächte der Welt waren.
Dolnicks Buch ist die Geschichte dieses intellektuellen Wettstreits, bei dem für den Gewinner Ruhm für sich und seine Nation winkt, es ist ein fesselndes Porträt antiker und moderner Imperien und eine faszinierende Geschichte über Irrwege und Entdeckungen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 490
Ähnliche
Die amerikanische Originalausgabe erschien 2021 unter dem Titel The Writing of the Gods. The Race to Decode the Rosetta Stone
bei Scribner, An Imprint of Simon & Schuster, Inc. New York
© 2021 by Edward Dolnick
Alle Rechte der deutschsprachigen Ausgabe:
© 2022/2023NAGELUNDKIMCHE in der Verlagsgruppe HarperCollins Deutschland GmbH, Hamburg
Covergestaltung von wilhelm typo grafisch
Coverabbildung von Musée Condé, Chantilly / Bridgeman Images, Luisa Ricciarini
E-Book-Produktion von GGP Media GmbH, Pößneck
ISBN E-Book 9783755600152
www.harpercollins.de
WIDMUNG
Für Lynn, Sam und Ben
ZITAT
»Da sind wir nun in Ägypten, dem Land der Pharaonen, dem Land der Ptolemäer, der Heimat der Cleopatra … wir sind da und leben da, und der Kopf ist kahler als ein Knie, und wir rauchen aus langen Pfeifen und trinken auf Diwanen Kaffee. Was soll ich darüber sagen? Was wollen Sie, dass ich Ihnen davon schreibe? Ich habe mich kaum erst vom ersten Taumel erholt.«
– Gustave Flaubert, 1850 1
ZEITTAFEL
3100 v. Chr. – Früheste Hieroglyphen
2686–2181 v. Chr. – Altes Reich
2600 v. Chr. – Sphinx; Cheopspyramide
2040–1782 v. Chr. – Mittleres Reich (goldenes Zeitalter der ägyptischen Literatur)
1570–1070 v. Chr. – Neues Reich (die reichste Ära in der Geschichte Ägyptens)
1334–1325 v. Chr. – Herrschaft von König Tut
1279–1213 v. Chr. – Herrschaft von Ramses II. (der mächtigste Pharao Ägyptens)
332 v. Chr. – Alexander der Große erobert Ägypten
196 v. Chr. – Der Stein von Rosette wird beschriftet
30 v. Chr. – Rom erobert Ägypten; Cleopatra begeht Selbstmord
394 n. Chr. – Niederschrift der letzten Hieroglyphen
642 – Die Araber erobern Ägypten
1773 – Thomas Young wird geboren
1790 – Jean-Francois Champollion wird geboren
1798 – Napoleon fällt in Ägypten ein
1799 – Der Stein von Rosette wird entdeckt
(Sämtliche Zeitangaben zur Antike basieren auf begründeten Vermutungen von Historikern und Archäologen)
PROLOG
Stellen Sie sich einen Archäologen in ein paar tausend Jahren vor, wie er mit seinem Spatel auf etwas Festes, Hartes trifft, das in der Erde verborgen liegt. In diesen fernen Zeiten weiß niemand mit Sicherheit zu sagen, ob es die Vereinigten Staaten wirklich gab, oder ob es vielleicht bloß der Name eines legendären Ortes ist, wie Atlantis etwa. Niemand spricht Englisch. Ein paar kümmerliche Reste von Schrift sind erhalten geblieben, aber es gibt niemanden, der sie lesen kann.
Der Stein unter dem Spatel des Archäologen ist auf einer Seite ganz glatt, aber es ist auf den ersten Blick erkennbar, dass es sich um ein Fragment eines möglicherweise einst viel größeren Blocks handeln kann. Dennoch genügt schon diese Glätte der Oberfläche, um den Puls des Forschers höher schlagen zu lassen: Die Natur arbeitet nur selten derart makellos. Ein genauerer Blick verspricht noch einiges mehr. Diese Linien und Kurven, die da in den Stein gemeißelt sind – könnte es sich um eine Art Inschrift handeln?
Über Wochen und Monate begeben sich ganze Forscherteams auf die Spur dieser eingeritzten, verwitterten Zeichen. Endlos wägen sie die zahllosen Möglichkeiten ab, auf der Suche nach irgendeiner Bedeutung in den mysteriösen Symbolen. Manche davon sind zu stark beschädigt oder verblasst, um etwas darin zu erkennen, andere fehlen sogar völlig.
OUR SC E AN SEV
Manche Gelehrten meinen gar, die Botschaft wäre von rechts nach links zu lesen:
VES NA E CS RUO
Wie sollten unsere Detektive der fernen Zukunft nun weiter vorgehen? Würden sie, des Englischen nicht mächtig und ohne Kenntnis von der Geschichte Amerikas, jemals in der Lage sein, zu erkennen, dass einst ein steinerner Tempel eine Botschaft verkündet hatte, die mit folgenden Worten begann: »Four score and seven years ago«? (Die ersten Worte von Lincolns berühmter Rede in Gettysburg am 19. November 1863: »Vor 87 Jahren…«, Anm. d. Übers.)
1:Der Einsatz
Im Jahr 1799, als der Stein von Rosette entdeckt wurde, war Ägypten ein brütend heißer, verarmter Flecken Erde. Aber was heißt das schon? Es war das Alte Ägypten, das den Westen in seinen Bann zog, und es hatte seinen Zauber niemals verloren.
Herodot, der »Vater der Geschichtsschreibung«, beschrieb als erster Fremder überhaupt die Wunder Ägyptens. Im Jahr 440 vor unserer Zeitrechnung verzückte er seine Leser mit Geschichten aus einem Land, das für diese Leser in jeder Hinsicht fremdartig war. Die Ägypter hatten neben »dem Himmel, der bei ihnen besonders ist«, auch diesen Fluss, »der eine andere Natur aufweist als die übrigen Flüsse«. Vor allem aber hatten sich die Ägypter selbst als Volk »in fast allen Dingen Gewohnheiten und Sitten zugelegt, die denen anderer Menschen entgegengesetzt sind.« 1
Ägypten war anders als andere Länder, weil es ein schmaler Streifen Grün war, zu beiden Seiten umgeben von Tausenden Meilen Wüste. Der Nil war anders als andere Flüsse, weil er von Süden nach Norden floss, scheinbar der natürlichen Ordnung zuwiderlaufend, und vor allem, weil er jedes Jahr über die Ufer trat, obwohl es in Ägypten selbst fast niemals regnete. Wenn die Fluten wieder zurückwichen, ließen sie fruchtbaren, schwarzen Schlamm zurück, ideal für den Ackerbau.
In der Welt der Antike drehte sich alles um die Landwirtschaft, aber überall in der Welt – mit Ausnahme von Ägypten – war der Ackerbau ein unsicheres Geschäft. Anderswo konnte durchaus Regen fallen und den Menschen für eine Jahreszeit Blüte und Wohlstand bringen; er konnte aber auch ausbleiben, mit der Folge, dass die Feldfrüchte verdorrten und Familien Hunger litten.
Ägypten, von den Göttern gesegnet, hatte kaum derlei Sorgen. Trotz des stets wolkenlosen Himmels war die Flut fast immer gekommen, und sie würde auch in Zukunft immer wieder kommen, dieses Jahr und nächstes Jahr und für alle Zeit. Es war ein Geschenk, wie man es nur ganz selten findet, ein Wunder mit Ewigkeitsgarantie. Ägypten lag geschützt vor Feinden durch Wüsten im Osten und Westen, durch das Meer im Norden und durch wilde Stromschnellen und Wasserfälle im Süden, wohlbehütet in seinem gedeihenden Wohlstand, beneidet vom Rest der Welt.
Und vor allem war Ägypten unermesslich reich. »Gold gibt es wie Dreck [in Ägypten]«, bemerkte ein König im benachbarten Assyrien neidvoll zu Zeiten des Königs Tut. 2 Und das stimmte sogar fast. Tut selbst war eigentlich ein Niemand, und doch versetzen die Reichtümer, die mit ihm begraben wurden, die Museumsbesucher bis zum heutigen Tag in Erstaunen. Er wurde bestattet in einem Sarg innerhalb eines zweiten Sargs innerhalb eines dritten Sargs, der innere der drei bestand aus massivem Gold und wog an die 100 Kilogramm. Darin lag Tuts in Leinentuch eingewickelte Mumie, das Haupt und die Schultern bedeckt mit einer eleganten, glitzernden Maske aus Gold, die dreitausend Jahre lang kein Mensch zu Gesicht bekam.
Ägypten war die bekannteste und die langlebigste aller antiken Kulturen. Die Zeitspanne ist schier unvorstellbar. Die Pharaonen herrschten von ca. 3100 v. Chr. bis 30 v. Chr., dem Jahr von Cleopatras Selbstmord. Die Geschichte der USA reicht noch nicht einmal drei Jahrhunderte zurück. Das Reich der alten Ägypter überdauerte dreißig Jahrhunderte.
Wollte man Markierungen an einer Zeitachse der Ägypter setzen, könnte es einem beinahe schwindlig werden. Die Cheopspyramide und die Sphinx, Ägyptens berühmteste Monumente, sind älter als Stonehenge. Beide stammen etwa aus dem Jahr 2600 v. Chr. (zum Vergleich: Die Entstehung von Stonehenge wird etwa auf 2400 v. Chr. datiert.) Als die Sphinx und die Pyramide errichtet wurden, war Ägypten bereits fünfhundert Jahre alt. 3
Zwischen den Pyramiden und der Herrschaft Cleopatras liegt eine größere Zeitspanne als zwischen Cleopatra und den Gebrüdern Wright. Und während nahezu dieser ganzen, enorm langen Zeit thronte Ägypten über dem Rest der Welt.
In den folgenden zweitausend Jahren, von den Zeiten Cleopatras und Cäsars bis heute, sollte der Mythos Ägypten niemals verblassen. In jenem wunderbaren Land, schrieb ein Reisender aus der Türkei im Jahr 1671, hatte er »wundersame und fremdartige Dinge zu Hunderttausenden gesehen. … Im Angesicht jedes einzelnen davon blieb uns nichts als ungläubiges Staunen.« 4
Heute verschwendet kaum mehr jemand einen Gedanken auf einst mächtige Königreiche wie Assyrien oder Babylon, Ägypten jedoch hat seinen machtvollen Glanz niemals eingebüßt. So ist es seit jeher, und am hellsten erstrahlte dieser Glanz in den letzten Jahren des 18. Jahrhunderts, als Napoleon eine Armee nach Ägypten führte.
Neben den diplomatischen Überlegungen hinter dieser Invasion gab es ein Motiv eher schlichter Natur – Napoleons Helden, Alexander der Große und Julius Cäsar, hatten Ägypten erobert, also würde er es ihnen gleichtun. Mit ihm kamen auch Kader von Forschern und Künstlern, die die Aufgabe hatten, Ägypten zu studieren und dem Land die Segnungen der französischen Zivilisation zu bringen. Ihre atemlosen Berichte von den dortigen Wundern lösten einen regelrechten Rausch aus – das Schlagwort dafür lautete Ägyptomanie.
In den Augen der Europäer beschwor Ägypten ein Potpourri aus Schönheit (Cleopatra!), Großartigkeit (diePyramiden!) und Mysterium (die Sphinx!) herauf. All dies wurde noch gewürzt durch eine Portion Gänsehaut und Horror (Mumien!), was die Erregung nur noch steigerte. (Bei seiner Rückkehr nach Frankreich brachte Napoleon seiner Gemahlin, Kaiserin Joséphine, den Kopf einer Mumie als Geschenk mit.) 5
Von Anfang an hatten sich nur besonders wagemutige Europäer in dieses entlegene Land aufgemacht. Sie bestaunten den Anblick dessen, was nach örtlichen Maßstäben so alltäglich war wie das Aufgehen und Untergehen der Sonne. »Ich sah den Nil bei meiner ersten Reise bei hohem Wasserstand, aber nicht überflutend«, 6 schrieb ein englischer Reisender namens William Bankes anno 1815. »Einen Monat später sah ich, wie er sich gleich einem See über die gesamte Fläche Ägyptens erstreckte, die Dörfer schienen auf der Wasseroberfläche zu treiben, die Menschen und das Vieh wateten von einem Ort zum anderen.«
Für westliche Augen war einfach alles erstaunlich – das schmale grüne Band des Nil, kontrastierend zum riesigen, ockerfarbenen Hintergrund der Wüste, aber natürlich auch Palmen, Luftspiegelungen, Heuschrecken, die endlose Ausdehnung des Wüstensands. »Für einen Europäer«, schrieb Bankes, »ist es nicht bloß ein anderes Klima, es ist eine ganz andere Natur, die er da vor sich hat.«
Diese Ehrfurcht galt auch den Hieroglyphen, dem ebenso altertümlichen wie eindrucksvollen Schriftsystem der Ägypter. 7 In der ganzen riesigen Zeitspanne, die verging, bis der Stein von Rosette seine Geheimnisse preisgab, stach das Mysterium der Hieroglyphen jedem Fremden, der nach Ägypten kam, regelrecht ins Auge. Verlockend, geradezu quälend waren Ägyptens Monumente und Gräber über und über mit filigraner Bildschrift überzogen – eine »Unendlichkeit an Hieroglyphen« in den Worten eines frühen Forschers –, und niemand wusste, wie diese zu deuten waren. 8
Tempelmauern trugen lange Botschaften, dasselbe galt für jede Säule, jeden Balken in diesen Tempeln (ebenso wie für jede Oberfläche, einschließlich Decken und der Unterseite von Balken), sowie für Obelisken und zahllose Papyrusblätter; auch die Särge, in denen die Mumien lagen, und selbst die Tücher, in die die Mumien eingewickelt waren, konnten beschriftet sein. »Es gibt kaum eine Fläche auch nur von der Größe eines Nadelöhrs«, schrieb ein Reisender aus Bagdad im Jahr 1183, »die nicht irgendein Bild oder eine Gravur oder eine unverständliche Schrift trug.« 9
© Jan Wlodarczyk / Alamy Stock Photo
Hieroglyphen aus dem Tempel der Isis, Philae
Herodot hatte ratlos auf jene Inschriften gestarrt. Geschlagene zwei Jahrtausende lang zerbrachen sich Gelehrte, die nach ihm kamen, die Köpfe über in Obelisken eingeritzte Inschriften, die Eroberer in ihre Heimat mitgebracht oder Reisende sorgfältig kopiert hatten. Am Ende standen sie mit leeren Händen da und konnten die mysteriösen Zickzacklinien und Vögel und Schlangen und Halbkreise nur bestaunen.
Konfrontiert mit Symbolen, die zu entziffern sie nicht in der Lage waren, hätten sie die geheimnisvollen Zeichen auch als bloße Verzierungen abtun können. Sie taten jedoch genau das Gegenteil.
Europas größte Denker erklärten die Hieroglyphen zu einer mystischen Form von Schrift, die allen anderen überlegen war. Hieroglyphen standen nicht für Buchstaben oder Laute wie die Zeichen gewöhnlicher Schriften, ließen diese Gelehrten wissen, sie standen für Ideen. Es ging nicht nur darum, dass die Hieroglyphensymbole Bedeutung ohne Worte vermittelten, wie das Zeichen für »Rauchen verboten!«, eine rot durchgestrichene Zigarette. Für die Gelehrten stand fest, dass Hieroglyphen keinesfalls bloß banale Botschaften transportierten, sondern tiefe, universell gültige Wahrheiten.
Sprachwissenschaftler und Historiker waren fest überzeugt, diese seltsamen Symbole hätten nichts mit den Alphabeten gemein, die man von anderen Kulturen kannte. Diese alltäglichen Alphabete wie diejenigen der Griechen und Römer mögen für Liebesbriefe oder Steuerbelege ausreichen, Hieroglyphen jedoch dienten einem höheren Zweck. Im Grunde verwarfen die Gelehrten die Vorstellung, Hieroglyphen könnten für gewöhnliche Botschaften oder Listen genutzt worden sein – Milch, Butter, etwas zu essen für die Kinder – in der festen Überzeugung, jeder hieroglyphische Text wäre eine Meditation über das Wesen von Raum und Zeit.
Die Schönheit der Hieroglyphen mag wohl manches von dieser falsch verstandenen Verehrung erklären. Vor allem die Tiersymbole wirken eher wie kleine Kunstwerke denn wie eine Schrift; die schönsten Beispiele machen den Eindruck, als stammten sie geradewegs aus den Feldnotizen eines Naturforschers.
© Nikreates / Alamy Stock Photo
Wenn die Linguisten zunächst andere, weniger eindrucksvolle Schriften studierten, begingen sie tendenziell den genau umgekehrten Fehler – diese Kritzeleien können doch gewiss nicht die Bedeutung von Buchstaben oder Wörtern haben. Der Wissenschaftler, der für eine der langlebigsten und bedeutendsten aller frühen Schriften den Begriff »Keilschrift« prägte, glaubte beispielsweise niemals, dass es sich dabei überhaupt um eine Schrift handelte. Thomas Hyde war eine Autorität auf dem Gebiet der Alten Sprachen – er war Professor für Hebräisch und Arabisch in Oxford – und veröffentlichte im Jahr 1700 ein dickes Buch über das antike Persien. Von den kunstvollen keilförmigen Markierungen, die man auf zahllosen Tontafeln in ganz Persien gefunden hatte, wollte er gar nichts wissen. Das war keine Schrift, erläuterte Hyde gegen die Überzeugung anderer Gelehrter, sondern lediglich eine ausgefeilte Anordnung dekorativer Keile und Pfeile.
Wie sich herausstellte, wurde die Keilschrift in unterschiedlichen Formen 3000 Jahre lang zum Schreiben einer Vielzahl von Sprachen im Nahen Osten verwendet. Hydes einziger bleibender Beitrag zur Wissenschaft bestand nach Einschätzung eines heutigen Experten darin, »ein hervorragendes Beispiel dafür [zu liefern], wie sehr ein Professor, in diesem Fall sogar ein zweifacher, sich irren kann.« 10 (Die Keilschrift war nach Ansicht der meisten Fachleute die erste aller Schriften überhaupt. Sie tauchte erstmals um das Jahr 3100 v. Chr. auf. Das war noch ein wenig vor den frühesten ägyptischen Hieroglyphen, die auf die Zeit um 3000 v. Chr. datiert werden. Die frühesten chinesischen Schriften stammen ungefähr aus der Zeit um 1200 v. Chr.)
Ein weiterer enorm bedeutender archäologischer Fund traf zunächst auf eine ganz ähnliche verächtliche Ablehnung, und zwar aus fast dem gleichen Grund. Die sogenannte Linearschrift B, ein Vorläufer des Griechischen, wurde in den 1880er-Jahren auf Kreta entdeckt, eingeritzt in riesige Steinblöcke. Kreta war ein Land voller Geschichte und Mythen. Es war die Insel Kreta, auf der der König Ikarus und Dädalus in einen Turm einsperrte und wo Vater und Sohn aus der Gefangenschaft flohen, indem sie sich auf aus Federn gefertigten Schwingen in die Lüfte erhoben.
Die Linearschrift B, die etwa auf das Jahr 1450 v. Chr. datiert wird, sollte sich als früheste Schrift erweisen, die jemals in Europa niedergeschrieben wurde. Es wäre verzeihlich gewesen, hätten die Archäologen, verblüfft durch die sich bietende Gelegenheit, mehr Bedeutung in jene Symbole hineininterpretiert, als diesen letztendlich zukam. Aber das taten sie nicht. Als die Experten erstmals Inschriften in Linear B untersuchten, kamen sie zu dem Schluss, es handle sich um »Zeichen eines Steinmetzes«. 11
Kaum jemand aber begegnete den Hieroglyphen mit derlei Geringschätzung. Eingeritzt in Tempelmauern und Obelisken wurden sie gepriesen, als würden sie tiefe Einblicke mitten ins Herz der Natur gewähren.
In den Worten des Philosophen Plotinus aus dem 3. Jahrhundert: »[Ägyptens Weise] wandten … nicht das vieldeutige und missverständliche Instrumentarium von Buchstaben, Wörtern und Sätzen an.« Die gelehrten Männer Ägyptens hatten einen viel besseren Weg gefunden – sie vermittelten Ideen anhand von Zeichen. »Stattdessen benutzten sie die Zeichen ihrer heiligen Schriften, ein eigenes Zeichen für jede Idee mit dem sie deren ganze Bedeutung auf einmal ausdrückten. Jedes einzelne Zeichen ist für sich schon ein Stück Weisheit, ein Stück unmittelbar gegenwärtiger Wirklichkeit.« 12
Aber das war schlicht geraten, da kein Mensch die Bedeutung auch nur einer einzigen Hieroglyphe kannte. Ägypten war übersät mit zahllosen Botschaften, und sie alle waren stumm.
Das Aufkommen des Christentums führte den Niedergang der Hieroglyphen herbei. Anfang des 4. Jahrhunderts konvertierte der römische Kaiser Konstantin zum Christentum. Dieser eine Schritt löste einen der bedeutendsten Kurswechsel der Weltgeschichte aus. Noch im gleichen Jahrhundert wurde das Christentum zur offiziellen Religion Roms. Und am Ende des Jahrhunderts war der einst marginale neue Glaube so mächtig geworden, dass er seine Konkurrenten an den Rand drängen konnte.
Im Jahr 391 n. Chr. befahl der römische Kaiser Theodosius der Große, sämtliche Tempel Ägyptens niederzureißen, weil sie das Christentum beleidigen würden. (Das Anbeten der alten heidnischen Götter war, selbst wenn es im eigenen Heim geschah, bei Todesstrafe verboten.) 13 Der letzte Mensch, der eine Nachricht in Hieroglyphen schrieb, ritzte diese im Jahr 394 in die Mauer eines Tempels in Philae, einer Insel weit im Oberlauf des Nil.
Edikte wie dasjenige des Theodosius waren etwas Neues. Krieg und Verfolgung waren so alt wie die Menschheit, aber es ging dabei nur selten darum, dass eine der Kriegsparteien an die falschen Götter glaubte. In den Zeiten des mehr oder weniger omnipräsenten Polytheismus neigten Eroberer dazu, zusammen mit dem Territorium, das sie sich aneigneten, die örtlichen Götter gleich mit zu übernehmen. Wer bereits mehrere Dutzend Götter anbetete, hatte kaum ein Problem damit, noch ein paar mehr davon unterzubringen.
Dann kam der Monotheismus, der Glaube an einen einzigen, wahren Gott, und alles veränderte sich. »Die Griechen und Römer hatten die alten Götter noch respektiert [vor Konstantins Konvertierung] …«, schreibt die Ägyptologin Barbara Mertz, »aber der Monotheismus ist schon seinem Wesen nach intolerant.« 14 Speziell die Hieroglyphen als Embleme der schlechten alten Gewohnheiten wurden zum Gegenstand der Verdammnis. Und nachdem sie verboten waren, gerieten sie auch bald in Vergessenheit.
In Ägypten war dem jedenfalls so. In Europa und der arabischen Welt hörten die Versuche einer Entzifferung niemals ganz auf, kamen aber auch nicht wirklich vom Fleck. Man denke nur, wie lange dieser Schleier der Unkenntnis Bestand hatte. Rom erlebte Aufstieg und Niedergang, und dennoch behielt die »Unendlichkeit der Hieroglyphen« ihre Geheimnisse für sich. (Rom war so besessen von Ägypten, dass die römischen Eroberer dreizehn riesige mit Hieroglyphen verzierte Obelisken in ihr Reich schafften. Bis auf den heutigen Tag stehen mehr ägyptische Obelisken in Rom als in Ägypten.) Es kam das Mittelalter, und gewaltige Kathedralen wuchsen in den Himmel Europas – die ersten von Menschen errichteten Bauwerke seit viertausend Jahren, die höher waren als die Pyramiden –, und in all den Jahren stellte sich bei der Entschlüsselung der Hieroglyphen nicht der geringste Fortschritt ein. Es kam die Renaissance und mit ihr das Zeitalter der Wissenschaft, die Geburtsstunde der neuen Welt, und noch immer … nichts, keine Spur.
Der Redewendung zufolge ist ein unbekanntes Objekt wie ein geschlossenes Buch, aber in Ägypten lagen die Dinge anders. Ägypten war ein offenes Buch, mit Abbildungen auf jeder Seite, nur dass es eben kein Mensch lesen konnte.
2:Der Fund
Niemals hat sich jemand auf die Suche nach dem Stein von Rosette gemacht. Niemand wusste, dass es ihn gab, wenngleich Reisende und Gelehrte schon lange davon geträumt hatten, dass es dergleichen geben könnte. Der Stein hatte unbemerkt fast zweitausend Jahre lang verborgen gelegen. Er hätte ohne Weiteres auch für immer verschollen bleiben können.
Dann aber tauchte er auf, in einem Haufen Schutt in einer wohlhabenden, jedoch abgelegenen Stadt Raschid, an einem schwülheißen Tag im Juli 1799. Frankreichs Armee war im Jahr davor in Ägypten eingefallen, angeführt von einem jungen General namens Napoleon Bonaparte, dessen Aufstieg zum Ruhm gerade erst begann. Schon bald aber würde ihn die ganze Welt kennen, sein Name erweckte größte Ehrfurcht oder wurde aus Angst oft nur geflüstert. (In England warnte man die kleinen Kinder, wenn sie nicht brav ins Bett gingen, würde »Boney« kommen, sie aus dem Bett holen und auffressen.) 1
Einem Trupp französischer Soldaten war befohlen worden, eine verfallene Befestigung in Raschid wieder aufzubauen. (Die Franzosen nannten die Stadt Rosette.) Die Festung hatte einstmals dort kompakt, aber eindrucksvoll gestanden, ein quadratischer Bau mit gut siebzig Meter Seitenlänge, mit mehreren kleinen Zinnen und einem größeren Turm in der Mitte. Sie war über Jahrhunderte vernachlässigt worden, und als die Franzosen dort eintrafen, bedurfte sie dringender Reparaturen. »Ich rechne jeden Moment damit, attackiert zu werden«, schrieb der örtliche Kommandeur an Napoleon und schickte seine Männer sogleich an die Arbeit, damit aus dieser Ruine wieder ein anständiges Fort wurde, mit Soldatenunterkünften und festen Mauern. 2
Wer genau den Stein von Rosette entdeckte, werden wir niemals erfahren. Der eigentliche Finder war mit einiger Wahrscheinlichkeit ein ägyptischer Arbeiter, aber wenn es so war, hat niemand seinen Namen festgehalten. Der Mann, dem die Entdeckung zugeschrieben wurde, war Leutnant Pierre-François Bouchard, der für den Wiederaufbau verantwortliche Offizier. Jemand machte Bouchard auf ein Bruchstück einer großen Steinplatte inmitten eines ganzen Haufens ähnlicher Steine aufmerksam. Unter dem Staub und Schmutz waren auf der dunklen Oberfläche des Steins einige seltsame Markierungen auszumachen. Konnte dies vielleicht etwas Besonderes sein?
Bouchard, der nicht nur Soldat, sondern auch Forscher war, erkannte sofort, dass der schwere Stein auf einer Seite über und über mit Schriftzeichen bedeckt war. Zeile um Zeile eingeritzter Symbole erstreckten sich über die ganze Breite des Steins. Das war schon überraschend genug, aber was sein Herz wirklich höherschlagen ließ, war dies: Es waren drei verschiedenartige Inschriften.
Oben standen vierzehn Zeilen mit Hieroglyphen – Zeichnungen von Kreisen und Sternen und Löwen und knienden Menschen. Dieser Abschnitt war unvollständig. Irgendwann in früheren Zeiten war das obere Ende des Steins und Teile der Ecken oben links und rechts verloren gegangen, und mit ihnen verschwanden viele Zeilen mit Hieroglyphen.
© SuperStock / Alamy Stock Photo
Mehrere Zeilen mit Hieroglyphen auf dem Stein von Rosette, in Großaufnahme
Im mittleren Teil befand sich ein längerer Abschnitt mit einfachen Kurven und Schnörkeln, insgesamt 32 Zeilen. Diese sahen wie Buchstaben irgendeiner unbekannten Schrift aus, vielleicht auch wie Symbole eines Geheimcodes, jedenfalls ganz anders als die Bilder im Teil mit den Hieroglyphen. Sollten diese ganzen Striche und Linien eine Schrift sein, war diese nicht lesbar; sollten sie nur Verzierungen sein, wirkten sie merkwürdig systematisch und zweckgerichtet.
© SuperStock / Alamy Stock Photo
Ein Abschnitt der mysteriösen Schrift in der Mitte in Großaufnahme. Niemand vermochte die Schrift zu erkennen oder zu sagen, welche Sprache sie abbildete.
Der dritte Teil der Zeichen, unter den beiden anderen, gab keinerlei Rätsel auf. Das war Griechisch, genau 54 Zeilen (ein kleines Stück unten rechts war abgebrochen), es war auf Anhieb zu erkennen. Es war nicht ganz einfach zu lesen, da es eher nach einem amtlichen Dokument aussah als nach Alltäglichem, aber es war doch auch nicht sehr schwierig.
© SuperStock / Alamy Stock Photo
Zeilen des griechischen Teils, den die Gelehrten problemlos lesen konnten, in Großaufnahme
Der Stein selbst war 112,3 cm hoch und 75,7 cm breit und wog 762 Kilogramm. Der gezackte obere Rand ließ darauf schließen, dass es sich um ein Fragment eines ursprünglich größeren Stücks handelte. In Ägypten, wo Bäume Mangelware sind, waren bedeutende Gebäude stets aus Stein errichtet worden. Seit alter Zeit stellten sie so eine Art Recycling in Zeitlupe dar: Die Steinblöcke eines Gebäudes wurden für ein anderes wiederverwendet, mitunter auch für zahlreiche andere im Verlauf vieler Jahrhunderte. (Selbst die Pyramiden wurden geplündert und ihre Steine wiederverwendet – deshalb sind sie nicht mehr glatt an den Seiten.) 3
Genau dies schien auch hier der Fall gewesen zu sein. Der Stein von Rosette hatte ursprünglich an prominenter Stelle in einem Tempel gestanden, zu einer Zeit, die dem Jahr 196 v. Chr. entsprach. Soviel ging aus dem griechischen Text hervor. Mehrere Jahrhunderte später, der Tempel war inzwischen abgerissen worden, lag der Stein von Rosette vermutlich unbemerkt in einem Haufen Schutt.
Vielleicht lag er da unberührt über viele Generationen. Vielleicht wurde er in einem oder mehreren anderen Gebäuden »recycelt«. Niemand weiß das. Im Jahr 1470 – inzwischen gab es seit tausend Jahren auf der Welt niemanden mehr, der Hieroglyphen hätte lesen können – begann ein arabischer Herrscher mit dem Bau einer Befestigung nicht weit von der Stelle, wo einst der Tempel gestanden hatte.
Zu den Baustoffen für des Sultans neue Festung zählte auch ein Haufen Steine, die von irgendwoher herbeigeschafft worden waren. Die Arbeiter, die die Steine an die richtige Stelle zu schleppen hatten, haben die Inschriften auf dem Stein von Rosette vielleicht überhaupt nicht beachtet. Vielleicht haben sie sie noch nicht einmal bemerkt. Jedenfalls setzten sie den Stein an seine Position, zusammen mit zahllosen anderen, ein namenloser Steinblock in einer namenlosen Wand in einer namenlosen Festung. Es ist ungefähr so, als würde man eine Gutenberg-Bibel als Türstopper benutzen.
© Trustees of the British Museum
Der Stein von Rosette mit seinen drei verschiedenen Schriftformen. Die Hieroglyphen befinden sich oben, eine unbekannte Schrift liegt in der Mitte, der untere Teil ist Griechisch. Die Gelehrten konnten das Griechische lesen, hatten aber keine Vorstellung davon, was sie mit den beiden anderen Inschriften anfangen sollten.
Zuerst dachte man, es wäre eine Frage von wenigen Wochen, vielleicht nur Tagen, bis die Inschriften auf dem Stein von Rosette entziffert wären. 4 Daraus wurden am Ende zwanzig Jahre. Die ersten Linguisten und Gelehrten, die die Inschriften zu Gesicht bekamen, machten sich eifrig ans Werk, getragen von der Überzeugung, wenn sie sich tüchtig ins Zeug legten, würde ihnen gewiss schon bald der verdiente Lohn zufallen. Bald jedoch wurden sie nacheinander von Verwunderung, dann Frustration und schließlich Verzweiflung gepackt – das Einzige, was sie der Nachwelt zurücklassen konnten, war die Warnung, hier hätte man es mit einem unlösbaren Rätsel zu tun.
Zwei rivalisierende Genies, ein Franzose und ein Engländer, trugen den Löwenanteil zum Knacken des Codes bei. Beide waren Wunderkinder gewesen, beide besaßen eine schier unheimliche Begabung für Sprachen, ansonsten jedoch waren sie denkbar gegensätzliche Charaktere. Der Engländer, Thomas Young, war eines der vielseitigsten Genies aller Zeiten. Der Franzose, Jean-François Champollion, war jemand, für den es immer nur um eine einzige Sache ging: Ihm lag Ägypten am Herzen, und nichts sonst außer Ägypten. Young war gelassen und von weltmännischer Höflichkeit. Champollion sprühte nur so vor Ungeduld und Empörung, wenn ihm etwas nicht passte. Young machte sich lustig über den »Aberglauben« und die »Verderbtheit« des Alten Ägypten. 5 Champollion staunte über Glanz und Gloria des mächtigsten Imperiums, das die antike Welt je gesehen hatte.
Selten stand bei solchen intellektuellen Gefechten so viel auf dem Spiel wie hier. Die Nationen der beiden Forscher waren seit jeher verfeindet und führten Kriege gegeneinander, deshalb ging es für den Franzosen wie für den Engländer nicht allein darum, den anderen zu besiegen, sondern auch um Ruhm und Ehre fürs jeweilige Vaterland. Denn Ägypten, das war das größte aller Mysterien und der erste Mensch, der herausfände, wie diese Mysterien zu lesen waren, würde ein Rätsel lösen, das die Welt seit über tausend Jahren zum Narren gehalten hatte.
Jeder, der den griechischen Text auf dem Stein von Rosette sah, verstand sofort, worum es bei der Sache ging. Wenn die drei Inschriften eine einzige Botschaft auf drei unterschiedliche Arten vermittelten – und warum sonst hätte man sie auf den gleichen Stein platzieren sollen? –, dann könnten auf einen Schlag die Hieroglyphen ihre ganzen Geheimnisse verraten. Eine Schatzkammer, bei der der Schlüssel im Schloss steckte, hätte nicht einladender sein können.
3:Die Herausforderung
In den Tagen Napoleons stellten die über Ägypten verstreuten Pyramiden, Monumente und Tempel schon Jahrtausende alte Berühmtheiten dar, aber kaum jemand wusste, wer sie gebaut hatte, oder wann, oder warum. Man wusste nur, dass, während ein Großteil der Menschheit in Höhlen fror und im Dreck nach Schnecken und anderen Leckereien wühlte, Ägyptens Pharaonen in Saus und Braus lebten und herrschten.
Zur Zeit der Entdeckung des Steins von Rosette gab es in der Welt zwei große, den ganzen Globus umspannende Supermächte: Frankreich und England. Zu der Zeit, als der Stein von Rosette beschriftet wurde, also im Jahr 196 v. Chr., hießen Frankreich und England noch Gallien und Britannien, und die Aktivitäten der wilden Stämme, die durch diese Regionen zogen, erstreckten sich im Wesentlichen auf Plünderungen, Raubzüge und Vergewaltigungen. Das Bild hatte sich bis zum Jahr 54 v. Chr. nur unwesentlich gewandelt, als Cäsar sich Gallien unter den Nagel riss und in Britannien einfiel. Dort traf er auf ebenso mutige wie brutale Widersacher, die sich blau anmalten und in Tierfelle kleideten. In jenem fernen Land teilten die Männer ihre Frauen untereinander, lästerte Cäsar, »Brüder mit Brüdern, und Väter mit Söhnen.« 1
Zur Zeit Cäsars – seine Affäre mit Cleopatra begann im Jahr 48 v. Chr. – hatte Ägypten seine Glanzzeiten schon lange hinter sich. Dennoch blieb Cäsars Rom deutlich hinter dem in Ägypten zelebrierten Luxus zurück, und dasselbe gilt für Athen und jede andere Metropole jener Zeit.
In der Ära Cäsars und Cleopatras war Ägyptens Hauptstadt Alexandria die größte und prachtvollste Stadt der Welt. 2 Mit ihren zahllosen Statuen, schmucken Parks und Besuchern, die zum Einkaufen oder zum Sightseeing kamen, war es gewissermaßen das Paris der Antike für die Provinzler aus dem Römischen Reich. Die größte Avenue der Stadt war fast dreißig Meter breit, genug für acht Streitwagen nebeneinander. Die Bibliothek von Alexandria nannte zehntausende Papyrusrollen ihr Eigen, bei Weitem der größte derartige Schatz, der sich jemals angesammelt hatte, und das in einer Zeit, als noch jedes einzelne Manuskript von Hand kopiert werden musste. Zu ihrer größten Zeit hatte die Bibliothek die bedeutendsten Gelehrten der Antike angezogen, darunter solche Titanen wie Euklid und Archimedes, die mit lebenslangen Anstellungen und fürstlichen Honoraren gelockt wurden.
Aber der Name Ägypten stand eher für Pomp und Prunk denn für seriöse Wissenschaft. Als Cleopatra den Nil hinauf reiste, glitt sie in einem güldenen Schiff dahin, mit purpurnen Segeln und silbernen Rudern. Weihrauch waberte durch die Luft, zu sanften Flötenklängen und jungen Burschen an der Seite der Königin, die ihr mit Fächern ein leichtes Lüftchen verschafften.
Und Cleopatra markierte wohlgemerkt das absolute Ende der Ära von Ägyptens Herrschern, dreizehn Jahrhunderte nach König Tut, zwanzig Jahrhunderte nach dem goldenen Zeitalter der ägyptischen Literatur, 26 Jahrhunderte nach der großen Pyramide.
Heute kennen wir diese Zeitachse, und wir kennen zahllose Einzelheiten über den Glauben der alten Ägypter, über ihr Alltagsleben, ihre Ängste und Hoffnungen. Dennoch ist hier Vorsicht angebracht. Wenn wir von »Ägypten« sprechen, betrifft jedwede Verallgemeinerung nur einen winzigen Bruchteil der Bevölkerung. Die Ägypter waren größtenteils Bauern ohne jede Bildung, die ein hartes, brutales, anonymes Leben führen mussten. »Sie kämpften sich durch ein von Armut, Entbehrung und Plackerei geprägtes Dasein, und wenn sie starben, hinterließen sie keinerlei Spuren in der Nachwelt«, in den Worten des argentinischen Ägyptologen Ricardo Caminos. »Ihre Leichen legte man einfach am Rand der Wüste ab, bestenfalls wurden sie in flachen Gruben im Sand verscharrt, ohne auch nur den einfachsten Grabstein, auf dem ihre Namen verewigt gewesen wären.« 3
Doch selbst unter diesem großen Vorbehalt, was die völlige Unsichtbarkeit der Armen angeht, wissen wir weit mehr über Ägypten als über jede andere Kultur des Altertums. Wir haben Kenntnis davon, weil es die Ägypter selbst uns erzählt haben – sie schrieben es nieder –, und wir können ihre Inschriften und Briefe und Geschichten lesen. All dies wissen wir, weil uns der Stein von Rosette den Weg gewiesen hat.
Die meisten Menschen verstehen nicht, worum es beim Stein von Rosette geht. Sie verstehen zwar, dass die Sache mit Texten in verschiedenen Sprachen zu tun hat, und sie haben so etwas wie eine Speisekarte in einem Restaurant vor Augen, das seine Spezialitäten für internationale Touristen präsentiert: roast chicken with French fries; poulet rôti avec frites; Brathähnchen mit Pommes frites. Bewaffnet mit dieser Speisekarte könnte sich jemand mit englischer Muttersprache durchaus daran machen, Französisch oder Deutsch zu entschlüsseln.
Dies war denn auch die Erwartungshaltung der ersten Menschen, die den Stein von Rosette zu Gesicht bekamen. Und damit lagen sie gründlich daneben. Stattdessen fanden sich die Forscher in einem Labyrinth wieder, verführt von verlockenden Anreizen, die sie aber nur in Sackgassen führten und jeder Hoffnung beraubten, dann aber fanden sie wieder neue Wegweiser und machten sich ein weiteres Mal jubelnd auf.
Ein Grund für ihre Schwierigkeiten – hätten sie etwas geahnt, sie wären vielleicht gar nicht erst aufgebrochen – lag in der Tatsache, dass sich die drei Inschriften keineswegs als wörtliche Übersetzungen der jeweils anderen herausstellten. Sie entsprechen einander zwar sehr wohl, aber auf eine ungenaue, verschwommene Art und Weise – es ist eher wie bei drei Menschen, die ihnen eine Beschreibung ein und desselben Films geben, den sie im Kino gesehen haben.
Dabei war das nur ein Hindernis von vielen. Um uns vorstellen zu können, vor welcher Aufgabe unsere Sprachdetektive standen, denken wir noch einmal an die Speisekarte mit roast chicken und poulet rôti. Selbst wenn wir kein Wort Französisch sprechen – selbst wenn wir noch nicht einmal wüssten, dass es eine Sprache namens Französisch gibt –, hätten wir dennoch einige Vorteile, die diesen frühen Forschern fehlten.
Zunächst einmal erkennen wir das Alphabet, in dem unsere Speisekarte geschrieben ist. Das bedeutet, dass wir uns dem Klang der Worte zumindest annähern können. Mit den Inschriften auf dem Stein von Rosette vor Augen konnten die frühen Sprachforscher hingegen nur verdattert staunen. Woher hätten die ersten Ägyptologen wissen sollen, ob Geier und Zaunkönige, oder vertikale und diagonale Striche, für Buchstaben, Silben, Wörter oder Gedanken stehen? Und selbst wenn wir noch nicht einmal sicher sein konnten, ob wir unsere Speisekarte von links nach rechts oder von rechts nach links lesen müssen, hätten wir zumindest erraten können, dass poulet rôti irgendwie plausibler klingt als itôr teluop.
Unsere Forscher hingegen hatten gar keine Anhaltspunkte. Schriften können von links nach rechts zu lesen sein wie im Englischen und Deutschen, oder von rechts nach links wie das Hebräische und Arabische, oder von oben nach unten wie Chinesisch und Japanisch. Und es gab noch weitere raffinierte Möglichkeiten in Erwägung zu ziehen. Einige antike griechische Texte verliefen in abwechselnder Richtung, vor und wieder zurück, wie ein Bauer, der sein Feld pflügt. Eine Zeile verlief von links nach rechts, die nächste von rechts nach links, und immer so weiter (und in jeder neuen Zeile veränderten auch die einzelnen Buchstaben ihre Richtung). Die Schriftzeichen der Azteken »wanden sich über die Seite wie ein Gebilde aus Schlangen und Leitern, wobei die jeweilige Richtung durch Punkte oder Linien angezeigt wurde« – so beschreibt es der Schriftsteller und Sachbuchautor Alberto Manguel. 4
Unsere Speisekarte hätte im Vergleich dazu noch mehr Anhaltspunkte zu bieten. Wenn ein Engländer versucht, poulet auszusprechen, könnte das zumindest vage Erinnerungen wecken. Ein »pullet« ist doch ein Huhn oder Hahn, jedenfalls irgendein Geflügel, oder nicht? So könnte es weitergehen. Das kleine Hütchen auf dem o in rôti springt ins Auge, zumal rôti zumindest irgendwie ähnlich aussieht wie roast (rösten) oder roasted (geröstet). Und schließlich könnten wir auf einen ganzen Stapel Texte und Inschriften aus dem Land des poulet stoßen (immerhin wollen wir eine ganze Sprache entschlüsseln und nicht bloß eine Speisekarte lesen). Dort würden wir noch weitere Os mit einem solchen Hütchen finden, und auch Es und Is, die ein Dach über dem Kopf haben. Wir würden forêt finden, und bête und côte und île, und vielleicht könnten wir aus dem Kontext oder aus Bildern zum Text am Ende an so etwas denken wie Forst oder Biest oder Küste oder Insel. Irgendwann könnten wir erraten, dass dieses Hütchen über dem Vokal etwas mit der Auslassung des Buchstabens S zu tun hat.
So würden wir Schritt für Schritt immer weiter vorankommen. Und jetzt denken wir wieder an die Not unserer armen Sprachdetektive, wie sie auf den Stein von Rosette starren.
Die Symbole entsprachen keiner bekannten Schrift, und es gab keine Möglichkeit, sich ein Lautbild zurechtzulegen und irgendwelche akustischen Anhaltspunkte zu nutzen. Die grundlegendste aller Fragen schien, dem Wissensdurstigen gleichsam Hohn lachend, außerhalb jeder Reichweite zu bleiben. Die Symbole waren beispielsweise ohne jede Unterbrechung aneinandergereiht, eines neben dem anderen. Wie sollte man herausfinden, wo ein Wort endete und das nächste anfing (sofern es überhaupt Wörter waren)?
Und noch schlimmer – viel schlimmer – war Folgendes: Der letzte aktive Sprecher des Altägyptischen war seit Jahrtausenden tot. (Die Ägypter sprechen seit dem 7. Jahrhundert unserer Zeitrechnung Arabisch.) Wenn Sie einen aktuellen Vergleich haben möchten, stellen Sie sich vor, sie wollten versuchen, die chinesische Schrift zu lesen, ohne die Sprache zu sprechen. Und nun stellen Sie sich vor, sie wollten die chinesische Schrift lesen, ohne dass es irgendjemanden gäbe, der die Sprache spricht.
Angenommen, Sie haben irgendwie eine Möglichkeit gefunden, die Hieroglyphen zu lesen. Da stehen sie nun und lassen den Klang von Worten erklingen, die seit der Zeit der Pharaonen niemand mehr gesprochen hat. Was nun? Was würden Ihnen diese Klänge verraten?
Angenommen, der letzte Sprecher des Englischen wäre vor 2000 Jahren gestorben. Wie sollte irgendjemand auf die Idee kommen, dass die den Buchstaben c-a-t zugeordneten Phoneme, kurz nacheinander ausgesprochen, ein »pelziges Tier mit Schnurrhaaren« bezeichnen?
Was dieses Rätsel so kompliziert machte, ist ein wichtiger Teil unserer Geschichte. Aber ein anderer Aspekt ist nicht minder wichtig – dies war ein Rätsel, das verlockend aussah, wie etwas, das jeder ambitionierte Amateur mit genug Grips wohl würde lösen können. Da ergibt sich ein scharfer Kontrast zu den meisten berühmten Codes, wie Enigma beispielsweise. Ein Laie könnte ewig auf die geheimen, mit der Enigma-Maschine verschlüsselten Botschaften der Nazis starren, er würde nie etwas anderes erkennen als einen völlig beliebigen Buchstabensalat, eine Zeile wäre für ihn von der nächsten nicht zu unterscheiden. Für alle, mit Ausnahme von Mathematikern, ist Enigma so abweisend wie eine Felswand.
Eine Seite mit Hieroglyphen hingegen besteht aus Vögeln und Schlangen und Ovalen und Quadraten, sie lädt uns geradezu zum Raten ein. War die Eule für die Ägypter ein Symbol für Weisheit, genau wie für uns? Im griechischen Text auf dem Stein von Rosetteist von Königen die Rede; wo steckt der König in den Hieroglyphen?
Hieroglyphen sind Bilder, und diese fundamentale Beobachtung weist in zwei verschiedene Richtungen zugleich. Die erste ist entmutigend – wir sehen uns mit einer Schriftform konfrontiert, die anders ist als praktisch alle, die in unserer Zeit in Gebrauch sind. Die zweite Richtung dagegen ist optimistischer und wichtiger – eben weil die Hieroglyphen Bilder sind, stellen sie eine Schriftform dar, die weniger abstrakt und eher zugänglich wirkt als alle anderen.
Unsere Aufgabe ist somit nicht ganz so beängstigend wie die Dechiffrierung von Enigma. Diesmal können wir uns auch als Amateure sehr wohl an der Suche nach Anhaltspunkten in den gleichen Puzzleteilen beteiligen, die Young und Champollion und alle ihre Nachfolger gleichermaßen anlockte und zum Narren hielt.
4:Stimmen aus dem Staub
Die Rätsel der Sprache und der Entschlüsselung sind lebende Mysterien – es gibt Texte in fremdartigen Schriften, die bis heute kein Mensch entziffert hat, darunter auch ein Text aus dem antiken Italien 1 und ein weiterer von den Osterinseln –, und sie sprechen grundlegende Aspekte der Zivilisation und Kultur an. Sprechen und Schreiben erscheinen uns als zwei Seiten derselben Medaille, doch das Schreiben ist wesentlich schwieriger. Jedes Baby lernt sprechen, ganz automatisch, es saugt die Laute in seiner Umgebung geradezu in sich auf. Kein Baby lernt dagegen automatisch lesen oder schreiben, obwohl es ebenso von gedruckten Wörtern umgeben ist wie von gesprochener Sprache.
Warum das so ist, kann niemand sagen. Vielleicht ergibt es einfach Sinn, dass das Lesen schwierig ist. Aber ist es nicht erstaunlich, dass Sprechen lernen eben nicht schwierig ist? Lassen Sie ein Baby in eine Quelle voller Wörtern hüpfen, und es wird sich von alleine darin zurechtfinden, gewissermaßen Schwimmen lernen. Der Schriftsteller Nicholson Baker beschreibt besser als jeder Sprachwissenschaftler, wie viel im Kopf dieses winzigen, brabbelnden Forschers vor sich geht. »Allmählich dämmert uns, dass diese ganzen Laute – mgu, merrp, plurk –, die wir erzeugen können und die wir vernehmen, sich ordnen lassen. Wir sind weiter nichts als ein neugeborenes Gehirn, wir sind gerade erst aus der Einzelhaft des Uterus entlassen, und doch mit einem Schlag Bletchley-Park-Kryptoanalytiker. Wir sichten bereits, gleichen ab, suchen Muster, suchen Anfang und Ende und die Spuren der Bedeutung.« 2
Was auf jeden Einzelnen zutrifft, trifft hier auch auf die gesamte Menschheit zu: Unsere Vorfahren begannen vor ungefähr 50000 Jahren zu sprechen, doch erst vor etwa vor 5000 Jahren – ließ sich irgendein unbekanntes Genie einfallen, wie sich die vielfältigen Klänge der Sprache in einer Handvoll Kritzeleien abbilden und festhalten ließen. Beziehungsweise waren es mehrere Genies nacheinander, und jedes einzelne trug neue Erkenntnisse oder Verbesserungen bei.
Das Entscheidende ist, dass sich das Sprechen auf ganz natürliche Weise entwickelt, das Schreiben hingegen musste erst erfunden werden. Die Sprache ist Teil unseres biologischen Erbes, wie das Krabbeln oder das Gehen. Schreiben ist ein Produkt menschlichen Einfallsreichtums, wie das Telefon oder das Flugzeug. (Die Geschichte dieses kolossalen Durchbruchs in der menschlichen Entwicklung ist für immer verloren. Ironischerweise hat sie niemand jemals aufgeschrieben.)
Lesen zu lernen ist demnach mit Arbeit verbunden. Und damit sind wir, jede und jeder Einzelne von uns, schon mitten in der Geschichte um den Stein von Rosette, denn wir alle haben fast genau die gleiche Art von Entschlüsselung durchgemacht, die am Ende auch den Code der Ägypter knackte – jeder neue Leser, der sich daran abgearbeitet hat, die Kringel in Der Kater mit Hut mit Leben und Sinn zu erfüllen, ist ein kleinformatiges Gegenstück zu den brillanten Ermittlern, die sich als Erste mit den Hieroglyphen herumschlugen. Lesen ist Entschlüsseln, und wir alle sind linguistische Detektive. Jeder von uns hat irgendwann einmal in Bletchley Park gearbeitet.
Der Lohn, den wir aus dieser Entzifferungstätigkeit beziehen, ist enorm. Der Autor Alberto Manguel erinnert sich an seinen eigenen Heureka-Moment, was das Lesen angeht. Er war etwa vier Jahre alt und kannte die Bezeichnung der Buchstaben, da sah er zufällig ein Plakat vom Autofenster aus. »Welches Wort ich da auf jener Plakatfläche entziffert hatte, weiß ich nicht mehr … aber das Erlebnis, plötzlich verstehen zu können, statt nur auf inhaltsleere Formen zu starren, ist mir heute noch so gegenwärtig wie damals.« 3
Manguel findet einen bemerkenswerten Vergleich: »Es war wie die plötzliche Entdeckung eines neuen Sinnesorgans.«
Die Erfindung der Schrift wird oft als größte aller geistigen Errungenschaften eingeordnet. »Ohne die Schrift«, bemerkte der Anthropologe Loren Eiseley einmal, »verkommen die Geschichten aus der Vergangenheit rasch zu einem Tasten durch Mythen und Fabeln. Das größte Epos der Menschheit, seine vier langen Kämpfe mit dem heranrückenden Eis der großen Kontinentalgletscher, ist spurlos aus dem Gedächtnis der Menschheit verschwunden. Ebenso verschwanden unsere des Lesens und Schreibens unkundigen Vorfahren, und innerhalb einiger weniger Generationen starb damit auch eine der großen Geschichten, die die Zeit zu erzählen gehabt hätte.« 4
Zahllose kleinere Geschichten verschwinden ebenfalls im Nichts, wenn sie niemand aufschreibt. »Wenn die Menschheit nur einen Tag alt wäre«, bemerkt der Linguist John McWhorter, »dann wäre das Schreiben etwa eine Stunde vor Mitternacht erfunden worden.« 5 Ob also vor 23 Uhr auf der Uhr der Geschichte Stämme ihre Kriege ausgefochten oder Liebende im Verborgenen ihre Schwüre geflüstert haben, wird nie jemand erfahren.
Die Erinnerungen, die wir im Kopf behalten, reichen vielleicht zwei, höchstens drei Generationen zurück. Mein Großvater wurde über neunzig Jahre alt. Als ich klein war, besuchten wir ihn oft, glaube ich. Aber heute, da niemand mehr da ist, der seine Geschichte erzählen könnte, keine Briefe oder Tagebücher, in denen man nachlesen könnte, sind für mich alle Geschehnisse aus diesen neun Jahrzehnten dahingeschmolzen. Alles, woran ich mich erinnere, sind die kratzigen, schlecht rasierten Wangen eines alten Mannes (ich mochte es überhaupt nicht, ihm zum Abschied einen Kuss zu geben) und die knochigen Handgelenke, die aus seinen langen, schlabbrigen Ärmeln herausragten.
Die Erinnerung an Kultur und Wissen vergangener Zeiten kann sich fast genauso schnell verflüchtigen. Der Dichter und Historiker Amadou Hampâté Bâ widmete eine Menge Zeit der Sammlung mündlicher Überlieferungen aus seiner Heimat Mali. »Wenn in Afrika ein alter Mann stirbt, verbrennt eine ganze Bibliothek«, beklagte er. 6
Und so ist die Geschichte des uralten Kampfs der Menschheit gegen das Vergessen in hohem Maße auch die Geschichte der Schrift. Das bedeutet, dass die Saga des Steins von Rosette denkbar weit entfernt ist von einer Erzählung über obskure Forschungen in muffigen Bibliotheken. Ganz im Gegenteil: unsere Forschungsreise wird uns in erstaunliche Täler und kreuz und quer über unbekanntes Terrain führen. Um nicht die Orientierung zu verlieren, werden wir dennoch versuchen, uns nicht allzu weit vom eigentlichen Forschungsobjekt, dem Stein von Rosette, zu entfernen. Aber wir sind hinter einer großen Beute her – Geschichten archäologischer Abenteurer, die durch uralte Grabstätten taumeln; wir werfen einen Blick auf die allerersten Versuche, Worte in Schriftform festzuhalten; wir begeben uns auf Exkursionen in große Themen wie den Kampf gegen Tod und Vergessen – und es wäre ein Fehler, auf diese Abenteuer zu verzichten und sich stattdessen ausschließlich an die Hieroglyphen zu halten.
Es wäre ein Fehler, denn wenn wir den Blick ausschließlich auf den Stein von Rosette gerichtet halten, entgeht uns die größere Geschichte, die ihn umgibt. Denn der Stein von Rosette ist ein denkbar unwahrscheinliches Objekt: ein Fenster aus massivem Stein. Und der Blick durch dieses Fenster verrät uns nicht nur etwas über die Details der Detektivarbeit und Schriftentschlüsselung, er erzählt auch etwas über das Wesen der Sprache, die Seitenpfade der Geschichte und die Evolution der menschlichen Kultur.
Einen entscheidenden Punkt verliert man leicht aus dem Blick – die Erfindung der Schrift war nicht nur eine der größten menschlichen Errungenschaften überhaupt, sondern auch eine der schwierigsten. Man denke nur, wie lange es dafür brauchte. Zehntausende von Jahren lang zeichneten unsere Vorfahren überaus gekonnt Bilder von verblüffender Detailgenauigkeit an Höhlenwände; sie fertigten Steinmesser, die so dünn sind, dass das Sonnenlicht durch die Klinge scheint, und so scharf, dass selbst moderne Skalpelle nicht mithalten können. 7 Niemand hat seinen Namenszug unter diese Meisterwerke gesetzt – wie denn auch? Über tausende von Generationen hatte niemand einen Weg gefunden, den Klang der Stimme in Symbole und Zeichen zu übersetzen.
Ausgehend von unserem heutigen Wissen ist es mitunter schwer, die Hürden zu erkennen, die unsere geistigen Vorfahren überwinden mussten. Ein gelöstes Rätsel erscheint uns oft so, als hätte es eigentlich gar nicht erst zum Mysterium werden müssen. Aber ein solcher zeitlich-historischer Provinzialismus ist ebenso unangebracht wie Provinzialismus im herkömmlichen Sinn. Auch die »simpelsten« Fragen können uns vor gewaltige Rätsel stellen, bis die Antworten wirklich gefunden sind.
Alle Geschichten der Entschlüsselung liegen in einem Dickicht solcher Fragen verborgen, die hinterher ganz simpel, aber zunächst vollkommen mysteriös sind. Das trifft ganz besonders auf den Stein von Rosette zu, da die auffällige Erscheinung der Hieroglyphen alle in die Irre führte. Allerdings erfordert jede Geschichte, die mit Entschlüsselung zu tun hat, ein tiefes Eintauchen in die Geheimnisse der Sprache, und Sprachen sind nun einmal enervierend vielfältig und endlos komplex. Zweifellos weisen Sprachen zahlreiche gemeinsame Merkmale auf, schließlich beschreiben sie alle unsere eine, gemeinsame Welt, mit Müttern und Brüdern und Sonne und Mond und rauschenden Flüssen und krabbelnden Babys. Aber in Aussehen und Klang unterscheiden sie sich eben erstaunlich stark.
Wer in Peking aus dem Flugzeug steigt oder einen Hörsaal in Gallaudet (eine Universität speziell für gehörlose und hörgeschädigte Studierende – Anm. d. Ü.) betritt, dem bleibt kaum etwas anderes als hilfloses Staunen. Kein Wunder, sind Sprachen doch konstruiert aus Luftstößen (oder Gesten), und eine Architektur aus Wörtern kann weitaus fantastischere Formen annehmen als jedes Gebäude aus Stein oder Holz.
Im Ergebnis ist die Aufgabe der Entschlüsselung einerseits enorm schwierig, andererseits aber auch enorm wichtig. Einmal niedergeschrieben, haben die kleinsten Begebenheiten und die gewaltigsten Sagen eine Chance auf Unsterblichkeit. Liebesbriefe sind nach tausenden Jahren wieder ans Licht gekommen, ebenso wie Quittungen über den Kauf von einem Dutzend Fußschemeln und epische Erzählungen von Helden und Ungeheuern im Kampf auf Leben und Tod.
Im Fall Ägyptens verlieh die Entschlüsselung der Hieroglyphen Pharaonen und Schuljungen ebenso eine Stimme wie Händlern und Reisenden, die seit dreitausend Jahren tot sind. In anderen, feuchteren Regionen der Welt wären derartige Botschaften längst verwittert, aber Ägyptens heißes, trockenes Klima dient als eine Art zufällige Zeitkapsel. Botschaften, die vor langer Zeit in Monumente geritzt oder auf Tempelmauern gezeichnet wurden, bleiben bis auf den heutigen Tag klar und deutlich sicht- und lesbar. Zahllose auf Papyrus geschriebene Texte sind erhalten, manche tragen den Abdruck des tintenverschmierten Fingers eines Schreibers oder gekritzelte Korrekturen eines Lehrers auf der Arbeit eines Schülers. 9
© Evren Kalinbacak / Alamy Stock Photo
Die Details und Farben an den Wänden von Ägyptens Grabstätten sind noch heute so lebendig wie vor vielen tausend Jahren, als diese Gräber versiegelt wurden.
Besucher aus regenreichen Klimazonen wundern sich immer wieder über die extreme Trockenheit Ägyptens. In der schillernden Stadt Luxor liegt der durchschnittliche jährliche Niederschlag bei null. So ist das schon seit jeher. »Die Zeichnungen an den Grabstätten zeigen weder Regen, noch auch nur das kleinste Anzeichen für Regen«, stellte der englische Archäologe Flinders Petrie vor einem Jahrhundert fest. »Keine breiten Hüte, keine Schirme, kein vom Regenwasser tropfendes Vieh, nichts dergleichen ist irgendwo abgebildet.« 10
In Ägypten kommt unser Wort »vergänglich« kaum jemals zur Geltung. Eine Blume aus einem Kranz, der vor dreitausend Jahren für ein Begräbnis geflochten wurde, könnte durchaus noch zu erkennen sein. Auf einem Laib Brot, der älter ist als das antike Griechenland oder Rom, sind vielleicht noch immer Abdrücke von der Hand des Bäckers zu erkennen. 11 Ägyptens Hitze und Trockenheit vermochten auch Leichname zu mumifizieren, ohne dass dafür zeitaufwendige und schwierige Prozeduren vonnöten wären. Der ganze komplizierte Prozess der Einbalsamierung, den wir so eng mit dem alten Ägypten verbinden, ist eigentlich in dieser Region unnötig.
Die Ägypter glaubten an ein Leben nach dem Tod. Die Mumifizierung war wichtig, weil man ja einen funktionstüchtigen Körper brauchte, um im Jenseits weiterleben zu können. Die Einbalsamierung war eine schwierige, zeitraubende Kunst. Man brauchte Haken, um das Gehirn des Verstorbenen durch die Nase aus dem Schädel zu ziehen, und spezielle Messer zum Aufschneiden des Bauchs, damit man die inneren Organe entfernen konnte, sowie spezielle Verfahren zum Trocknen menschlichen Gewebes. Und dennoch: Wenn ein Leichnam einfach in eine flache Grube im Sand gelegt wurde, was traditionell das Schicksal der Armen war, dann mumifizierten der heiße Sand und die sengende Sonne den Körper auf ganz natürliche Weise.
Die Reichen bestanden allerdings auf einer stilvolleren Reise ins Jenseits. Aber gerade der Akt, Leichname in Särgen in völliger Stille und Dunkelheit einzuschließen, machte eine ganze Bandbreite von Maßnahmen notwendig, um den Körper vor Verwesung und Verfall zu bewahren.
Im alten Ägypten war das Überdauern von Artefakten somit quasi die Regel. In einer Kultur, die geradezu besessen war von Kontinuität, war dies von entscheidender Bedeutung, und es war die Fähigkeit zur Überwindung der Zeit, die dem Schreiben gegenüber allen anderen Künsten eine so spezielle Bedeutung verlieh. Hieroglyphen waren die Handschrift der Götter, postulierten Texte aus alter Zeit, und die Götter hatten der Menschheit dieses wunderbare Geschenk zuteilwerden lassen. Von seinen frühesten Tagen an hatte Ägypten die Möglichkeiten erkannt, die darin lagen.
Eine Tempelinschrift aus etwa der gleichen Ära, auf die auch der Stein von Rosette zurückgeht, pries die Götter, die »die Schrift im Anfang erschufen« und damit »die Erinnerung beginnen ließen«. Dank dieser göttlichen Gabe »spricht der Erbe mit seinen Vorfahren« und »Freunde können kommunizieren, auch wenn ein ganzes Meer zwischen ihnen liegt, und ein Mensch kann einen anderen hören, ohne ihn zu sehen.« 12
In Stein gravierte Inschriften bezogen sich zumeist auf Könige und Götter, aber Botschaften auf Papyrus hatten tendenziell eher Profanes und Praktisches zum Gegenstand. »Bitte mach mir ein neues Paar Sandalen« lautete eine Mitteilung etwa aus dem Jahr 1200 v. Chr. 13 Ein weiterer Text aus der gleichen Zeit besagt: »Warum hast du nicht auf meine Nachricht geantwortet? Ich habe dir vor einer Woche geschrieben!«
Ein junger Schreiber beklagte sich bei seinem Aufseher etwa um das Jahr 1240 v. Chr., er wäre schlecht behandelt und ausgenutzt worden. »Ich bin wie ein Esel für euch. Wenn es Arbeit gibt, holt den Esel. …Wenn es Bier gibt, interessiert ihr euch nicht für mich, aber wenn es Arbeit gibt, sucht ihr nach mir.« 14
Eine betrübte Mutter schimpfte über ihre undankbaren Kinder, aus ihrer Klage spricht über die seitdem vergangenen Äonen unverhüllte Verbitterung zu uns. »Ich bin eine freie Frau im Land des Pharao«, erklärte sie in ihrem letzten Willen um das Jahr 1140 v. Chr. »Ich habe acht Kinder großgezogen und gab ihnen alles, was ihrem Stand gebührt. Aber ich bin alt geworden, und sie haben sich nicht um mich gekümmert. Denen, die mir geholfen haben, werde ich mein Eigentum hinterlassen. Aber denen, die mich vernachlässigten, werde auch ich nicht helfen.« 15
1897 kam es zum vielleicht größten Einzelfund antiker Schriftstücke, als zwei englische Archäologen in der Wüste südlich von Kairo mehrere fast zehn Meter hohe Hügel mit Papyrusfetzen unter dem Sand entdeckten (vermischt mit anderen zufälligen Bruchstücken). Die Fetzen stammten ursprünglich aus Abfallhaufen in der einst blühenden Stadt Oxyrhynchos. (Der Name bezeichnet heute eine in der Region vorkommende Fischart, deshalb ließe sich der Städtename auch übersetzen mit »Stadt des Spitznasennilhechts.«) Geschützt durch die Trockenheit der Wüste hatte die Tinte über 2000 Jahre kaum etwas von ihrer Schwärze verloren.
Eine halbe Million Fragmente sind erhalten geblieben, manche nicht größer als eine Briefmarke, andere groß wie ein Tischtuch. Die meisten geben uns Einblicke in das Alltagsleben. Ein wohlhabendes Paar schickte 1000 Rosen und 4000 Narzissen für die Hochzeit des Sohnes einer befreundeten Familie. 16 Ein Mann namens Juda fiel vom Pferd und brauchte die Hilfe zweier Pfleger, nur um sich umdrehen zu können. Bruchstücke von Eheverträgen, Horoskopen und schwülstigen Erzählungen tauchten auf, ebenso ein unbekanntes Stück von Sophokles und Teile von Gedichten von Sappho. 17
Viele alte ägyptische Texte sind von irgendwie verstörender Beschaffenheit: als wären einem die Umstände fast vertraut, aber eben doch nicht so ganz. Die Schreiber beschreiben Gefühle, die wir sofort erkennen, aber sie bringen ihre Inhalte in Form von Bildern vor, die uns schlagartig daran erinnern, dass wir hier, in diesen Schriftstücken, weit weg von daheim sind. Ein Gedicht aus der Ära des Königs Tut um 1300 v. Chr. beschrieb die Hindernisse, vor denen ein junges Liebespaar steht: »Die geliebte Schwester weilt auf der anderen Seite, / und breites Wasser trennt uns. / Ein Krokodil wartet auf der Sandbank.« 18
Bisweilen enthüllen uns die Schriften eine ganz und gar fremdartige Welt. Die Ägypter glaubten beispielsweise, wenn ein Mensch starb, legten die Götter das Herz des Verblichenen in eine Waagschale und eine Feder, die die Wahrheit symbolisiert, in die andere. Waren Herz und Feder im Gleichgewicht, hatte der Mensch ein ehrliches Leben geführt und damit die Chance, in eine Art Himmel zu kommen. Fiel der Test jedoch negativ aus, war das Ergebnis nicht etwa das Gegenstück zu Hölle und ewiger Verdammnis, die Person verschwand einfach! Das verräterische Herz wurde einer Kreatur, halb Nilpferd, halb Krokodil zum Fraß vorgeworfen, und Schwupp! – weg war er (oder sie).
© Smith Archive / Alamy Stock Photo
Die Zeremonie »Das Wiegen des Herzens«. Der ibisköpfige Gott des Schreibens, Toth, steht rechts bereit, die Ergebnisse des Tests festzuhalten.
Die eindringlichsten Stimmen wirken, als wären sie erst gestern erklungen. Ein ägyptischer Schreiber kritzelte sich seinen Ärger auf einem Stück Papyrus von der Seele, das erhalten blieb und seinen Weg ins British Museum fand. »Ach hätte ich doch Sätze, die niemand kennt«, schrieb er, »in einer neuen Sprache, die noch nie gesprochen wurde, keinen längst verbrauchten Ausdruck, gesprochen von Menschen in alter Zeit.« 19 Dieses Lamento wurde ca. 2000 v. Chr. verfasst, also rund tausend Jahre vor Homer.
Aber wie sieht es aus, wenn zwar die Schrift überlebt, nicht jedoch das Wissen, wie diese Schrift zu lesen ist?
5:So nah und doch so fern
Wenn man mit der Kamera weit genug Abstand hält, sehen alle Kulturen gleich aus. Menschen begegnen sich, verlieben sich; sie geben an, tun sich groß; sie verspotten ihre Rivalen; sie beten zu ihrem Gott, oder zu jeder Menge Göttern; sie haben Angst vor dem Tod. Die Details machen den Unterschied aus. Die Azteken rissen den Kriegern des Gegners, die sie in der Schlacht gefangen nahmen, das noch schlagende Herz aus der Brust, um ihre Götter zu besänftigen; die Jains in Indien kehren den Gehweg sauber, um Käfer zu retten, auf die sie sonst treten könnten.
© Wikimedia Commons
Zeichnung eines aztekischen Künstlers von einem Priester, der einem Menschen das Herz für eine Opferzeremonie herausschneidet.
Wir wissen eine Menge über die alten Ägypter, weil sie so viele Texte hinterlassen haben. Das führt allerdings zu der Versuchung zu glauben, wir wüssten viel mehr, als wir tatsächlich wissen. »Die Bier zechenden Handwerker, die peniblen Briefeschreiber, die eleganten Damen, die ehrgeizigen Bürokraten und die leidenschaftlichen Jäger – alle haben ihren Auftritt (machen wir uns jedenfalls vor) als die Sorte Leute, die wir kennen, und die wir auch selbst hätten getroffen haben können«, schreibt der britische Historiker Peter Green. 1
Dies jedoch war, wie sich Green selbst korrigiert, eine »exotische (um nicht zu sagen: sonderbare) Kultur.«
Allein dieser Zwiespalt – sie waren Menschen wie wir; sie waren bizarre Fremdlinge – erklärt schon eine ganze Menge über die Faszination des alten Ägypten. Ägypten stellt so etwas wie ein Ideal in unserer Vorstellung von der Geschichte dar: nahe genug, um uns hineinzuziehen, und doch weit genug weg, um Faszination auszuüben.
Wir können uns vorstellen, in die ägyptische Vergangenheit einzutauchen, und wenn wir es tun, dann schieben wir, wie alle Zeitreisenden auf der bequemen Couch, die düstere Wirklichkeit beiseite. Gefahr und Mühsal lassen wir als Erstes verschwinden. Niemand, der oder die sich tagträumerisch in die Anfänge der Zeit zurückversetzt, malt sich aus, hilflos zwischen den Zähnen eines Tyrannosaurus zu zappeln; niemand versetzt sich in seiner Vorstellung in das Leben eines sich zu Tode schuftenden Arbeiters im Bautrupp eines Pharaos, wie er Steinblöcke eine Rampe hochschleppt.
Wie sollte Ägyptens andauernde Faszination zu erklären sein, wenn wir sämtliche anderen antiken Kulturen als zu angestaubt und langweilig abtun, als dass sie der Rede wert wären? Wer sagt, Ägyptens berühmteste Bilder wären zu Ikonen geworden, argumentiert eigentlich bloß im Kreis.
Die Antwort hat vielleicht zum Teil schlicht mit dem Aspekt der Größe zu tun. Wir entwachsen niemals ganz unserem sechsjährigen Selbst, und schiere Größe verliert offenbar niemals ihre Faszination. Damit sind wir wieder bei den Dinosauriern. Jedes naturgeschichtliche Museum auf der Welt zieht die Massen an, die diese riesigen, den Saal füllenden und an die Decke stoßenden Skelette bestaunen. Bei den Pyramiden ist es genauso, ihre kolossale Größe (und das schlichte Design) sind der ganze Witz bei der Sache. Die Sphinx ist sogar noch besser, sie ist nicht bloß riesig (jede einzelne ihrer Löwenpranken ist größer als ein Schulbus), sondern auch noch mysteriös.