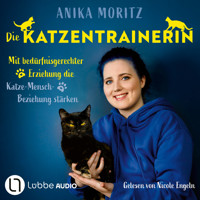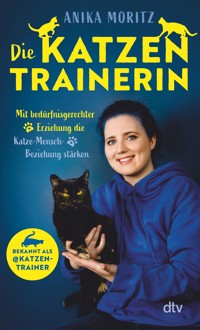
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dtv
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2023
Bye bye zerbrochene Blumentöpfe und zerkratzte Sofas Verschmust und unabhängig, sanftmütig und verspielt – wer kann einer Katze schon widerstehen? Mit bedürfnisgerechter Erziehung steht einer liebevollen Katze-Mensch-Beziehung nichts im Wege. Anika Moritz zählt zu den gefragtesten Verhaltensberaterinnen für Tiere. Die leidenschaftliche Katzentrainerin zeigt anschaulich, wie sich unangestrengt und katzengerecht ein ebenso katzen wie menschenverträgliches Sozialverhalten erzielen lässt. Dazu braucht es gar nicht viel: ein bisschen Zeit, Geduld und die Bereitschaft, sich mit den Grundlagen der Tierpsychologie und des Tiertrainings vertraut zu machen. Mit Anika gehören apathisches Herumliegen, zerfetze Couchbezüge oder verschmähte Katzentoiletten der Vergangenheit an. Gemeinsam mit ihr findet man den wahren Charakter der kätzischen Mitbewohner, die ja eigentlich verschmust, eigenwillig, selbstständig und spielverliebt sind – und so wird es eine Beziehung fürs Leben. - Anika Moritz (#anikatze) gehört zu den gefragtesten Verhaltensberaterinnen für Katzen - Bedürfnisorientierte Katzenerziehung: So liebt dich deine Katze wirklich
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 232
Ähnliche
Über das Buch
Eine Katze fürs Leben!
Verschmust und unabhängig, sanftmütig und verspielt – wer kann einer Katze schon widerstehen? Mit bedürfnisgerechter Erziehung steht einer liebevollen Katze-Mensch-Beziehung nichts im Wege. Anika Moritz ist eine der gefragtesten Verhaltsensberaterinnen für Katzen. Sie erklärt die Sprache und Bedürfnisse von Katzen, die Grundlagen der Katzenerziehung, und wie schon wenige Minuten Training am Tag deine Katze ausgeglichen und glücklich machen.
Mit vielen Schritt-für-Schritt-Anleitungen!
Anika Moritz
Die Katzentrainerin
Mit bedürfnisgerechter Erziehung die Katze-Mensch-Beziehung stärken
Mit Illustrationen von Ben Rennen
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Das 1x1 der Katzenhaltung
Was Katzen essen – das Futter
Sicherheit und Kontrolle – der Wohnraum
Beziehungen und Freundschaften
Gesundheitliche Vorsorge
Die Sprache der Katze
Die Sinne der Katze
Die Körpersprache
Die Gefühle der Katze
Hat deine Katze Stress?
Von Menschen und Katzen
Regel Nr. 1 – Positivität
Regel Nr. 2 – Respekt
Regel Nr. 3 – Erwartungssicherheit
Regel Nr. 4 – Gemeinsame Lösungsfindung
Regel Nr. 5 – Fairness
Die Mensch-Katze-Beziehung
Die Katze-Katze-Beziehung
Katzenbeziehungen fördern
Die Grundlagen der Katzenerziehung
So lernen Katzen
Was »muss« eine Katze können?
Verhalten muss sich lohnen
Umgang mit störenden Verhaltensweisen
Bestrafungen sind ein No-Go
Wie fördere ich erwünschtes Verhalten?
Spiele und Training
Start- und Endsignale
Struktur der einzelnen Einheiten
Stimmungszonen
Cats just want to have fun
Eure gemeinsame Morgenroutine
Eure gemeinsame Abendroutine
Verschiedene Beschäftigungsarten
Training: So klappt’s
Trainingssysteme
Gemeinsame Signale setzen
Training ganz konkret
Probleme verstehen und lösen
Alltagsprobleme im Fokus
Verhaltensauffälligkeiten im Fokus
Literaturverzeichnis
Vorwort
Seit ich denken kann, lebe ich mit Tieren zusammen. Aber die besondere Art von Katzen faszinierte mich von der ersten Sekunde an – nicht nur, weil ich fast täglich Katzen um mich hatte. Schon im Kindesalter verschlang ich fast alle Bücher über Katzen, um sie zu verstehen und ihnen ihr Leben bei mir so schön wie möglich zu machen.
Mit elf Jahren wurde mein Wunsch, selbst für eine Katze zu sorgen, erfüllt und meine erste Katze Alexis zog bei mir ein. Mit Alexis öffneten sich für mich die Tore des gewaltfreien, positiven und bedürfnisgerechten Tiertrainings. Alexis ist auch der Grund dafür, dass es dieses Buch und mich als Katzentrainerin gibt (Alexis seht ihr auch auf dem Cover). Sie und ihre Katzenpartner*innen Cassiel, Freddie, Balthazar und Emely waren meine besten Lehrer*innen. Durch sie lernte ich vor allem, wie wichtig es ist, sich individuell auf die jeweilige Katze einzustellen, und wie gut positives Training funktioniert.
Schon im Teenageralter war für mich klar, dass ich beruflich mit Tieren arbeiten möchte, und so nahm ich an zahlreichen Seminaren und Workshops zum Thema Katze und Hund teil. Für mein Matura schrieb ich eine vorwissenschaftliche Arbeit mit dem Titel »Untersuchung des Konzeptes für Clickertraining am Beispiel der Katze« und absolvierte danach den Fernlehrgang »Tierpsychologie mit Schwerpunkt Katze«, der den Grundstein meiner Ausbildung legte. Seither besuche ich regelmäßig internationale Fortbildungen und wurde an weiteren Instituten für Tierverhalten ausgebildet, um auf dem neuesten Stand der Wissenschaft zu bleiben und mein Wissen zu erweitern.
Je mehr Katzen und Katzenbesitzer*innen ich dadurch kennengelernt habe, desto klarer wurde mir, dass Katzen bei Problemen missverstanden werden. Katzen sind sehr feinfühlige Tiere, die unsere Stimmungen aufnehmen und spiegeln. Sie sind für mich aber auch ein Ausdruck der Selbstbestimmung und Freiheit. Sie haben zwar ihre eigenen Vorstellungen, wie ihr Leben aussehen soll, können zeitgleich aber sehr innige Beziehungen zu uns Menschen aufbauen.
Dieses Buch soll dabei helfen, die Beziehung zwischen dir und deiner Katze zu vertiefen. Dafür bilden wir mit dem 1×1 der Katzenhaltung eine gute Grundlage und erkunden die Vorlieben und Bedürfnisse unserer Katzen. Um unsere Haustiere zu verstehen, entschlüsseln wir ihre Körpersprache und ihre Laute. So können wir vielen Missverständnissen aus dem Weg gehen. Und da Katzen glücklich sind, wenn sie ausgelastet sind, gibt es die besten Tipps für gutes Spielen. Um eure Beziehung aktiv zu stärken, erlernen wir Schritt für Schritt, wie du aktiv mit deiner Katze trainieren kannst.
Und so steht einer innigen Katze-Mensch-Beziehung nichts mehr im Wege!
Das 1x1 der Katzenhaltung
Es ist endlich so weit: Deine Katze ist bei dir eingezogen. Dein wichtigstes Ziel ist jetzt natürlich, dass deine Katze glücklich, gesund und zufrieden ist. Den Bedürfnissen der Katze gerecht zu werden ist manchmal eine echte Herausforderung. Denn unter dem Wort »Bedürfnisbefriedigung« sind nicht nur frisches Wasser, Futtergabe oder die Organisation eines kuscheligen Schlafplatzes für die Katze zu verstehen. Die Wünsche und Must-haves unserer Katzen sind weitaus anspruchsvoller.
Und ganz kurz vorweg: Bedürfnis- und bindungsorientierte Erziehung bedeutet nicht, dass keine Grenzen gesetzt werden oder uns die Katze auf der Nase herumtanzen kann. Dieses Konzept bedeutet vielmehr, dass sowohl die Bedürfnisse der Katze als auch die des Menschen beachtet und insbesondere geachtet werden. Damit das frustfrei (für die Katze und dich) funktioniert, sind passende Managementmaßnahmen nötig, auf die ich in den weiteren Kapiteln eingehen werde.
Neben den individuellen Bedürfnissen deiner Katze sollten bestimmte grundlegende Ressourcen erfüllt sein. Dazu gehören Sicherheit und Kontrolle, was durch ein gutes Wohnraummanagement erreicht werden kann, eine ausgewogene und hochwertige Ernährung, mentale und körperliche Beschäftigung und gesundheitliche Check-ups. Auch Beziehungen spielen im Leben der Katze eine bedeutende Rolle. Eine innige Freundschaft von Mensch und Katze sowie Katze und Katze steigert die Lebensqualität. Eine gute Mensch-Katze-Beziehung hilft, in stressigen Situationen wie zum Beispiel in der Tiermedizinpraxis Sicherheit und Geborgenheit zu vermitteln. Katze-Katze-Freundschaften sind deshalb so wichtig, da Katzen sehr soziale Tiere sind und vom Zusammenleben mit anderen Katzen stark profitieren.
Verhaltens- oder Kommunikationsprobleme entstehen, weil ein oder mehrere Grundbedürfnisse der Katze nicht ausreichend berücksichtigt wurden. Vorstellen kannst du dir das wie einen Akku:
Werden alle Bedürfnisse der Katze befriedigt, ist der Akku voll und im grünen Bereich. Mit vollem Akku führt die Katze ein zufriedenes Leben und kann auf neue Situationen positiv und selbstbewusst reagieren. Wenn die Akkus der Katze nicht geladen, also im roten Bereich sind, und es so zu einem Defizit bei der Bedürfnisbefriedigung kommt, spiegelt sich das direkt im Verhalten wider. Katzen sind leider Meister im Verstecken von Unzufriedenheit oder Krankheiten. Oftmals drücken sie sich dahingehend sehr subtil aus, sodass wir die ersten Warnzeichen nicht wahrnehmen. Katzen tolerieren eine nicht katzengerechte Haltung sehr lange, so lange, bis ein weiterer der Katze zusetzender Stressfaktor hinzukommt und den Akku komplett entleert. Katzen wirken dann gereizter oder scheinen »desinteressiert« oder in manchen Fällen gar »gemein«. Das Verhalten unserer Katzen hat aber nichts mit diesen Gefühlen zu tun. Katzen verfügen über keinen moralischen Kompass und unterteilen ihr Verhalten nicht in »gut« und »böse«. Durch die erhöhte Reizbarkeit beurteilt das Katzengehirn Situationen, die bisher unproblematisch waren, als stark einschränkend oder gefährlich. Die Katze ist so stark gestresst, dass sie jede kleinste Veränderung als für sie negativ beurteilt. Wir als Besitzer*innen müssen hier mit positiven und gewaltfreien Maßnahmen gegensteuern. Passiert das nämlich nicht, dann kann es zu wiederholten aggressiven, ängstlichen oder gleichgültigen Verhaltensweisen kommen, die ohne passendes Training intensiver werden.
Du hattest einen harten Arbeitstag und kommst erschöpft nach Hause. Durch deinen Jobwechsel ist es heute nicht das erste Mal, dass du die morgendlichen und abendlichen Spiel- und Kuscheleinheiten mit deinen beiden Katzen auslässt. Als du deine Haustür aufsperrst, laufen dir dein Kater Koda und deine Kätzin Toni bereits in die Arme. Doch du bemerkst, dass sich Toni heute anders verhält. Auch in den letzten Tagen war es so, dass Toni dir gegenüber etwas zurückhaltender war als sonst. Koda hingegen wirkt präsent, er zwängt sich regelrecht zwischen dich und Toni. Du bemerkst außerdem, dass Koda Toni von ihren Lieblingsplätzen verdrängt und das Aufeinandertreffen der Katzen rauer geworden ist. Außenstehende würden das Verhalten von Koda vermutlich als »eifersüchtig« oder »dominant« bezeichnen. Dabei ist es so, dass durch das mehrfache Ausbleiben der Spieleinheiten Folgendes passiert ist:
Kater Koda ist frustriert. Er möchte nun jeden verfügbaren und kurzen Moment mit dir genießen. Er wünscht sich mehr Eins-zu-eins-Zeit mit dir ganz allein und lässt seinen Frust deshalb an Toni aus. Toni hingegen ist verunsichert. Die täglichen Rituale gaben ihr Struktur und das Gefühl der Kontrolle. Bei beiden sind die Bedürfnisse Kontrolle, Beschäftigung und Beziehungspflege unzureichend befriedigt worden. Das wirkt sich direkt auf die Akkus deiner Katzen aus, die aus diesem Grund im dunkelorangefarbenen Bereich sind. Damit die Akkus wieder aufgeladen werden können und man der Unsicherheit und Frustration aktiv entgegenwirkt, müssen regelmäßig viele positive Erlebnisse stattfinden. Das kann in Form von passiven Futterspielen wie Cat Activity Boards, auch »Fummelbretter« genannt, der Verbesserung des Wohnraummanagements (und somit auch mehr Beschäftigungsmöglichkeiten) und wöchentlichen festen Qualitätszeiten und Ritualen mit jeder Katze geschehen.
Es wäre übrigens nicht realistisch, zu behaupten, dass der Akkuladestand zu jedem Zeitpunkt bei 100 Prozent liegen muss. Das wird aufgrund unseres modernen Lebensstils, also bei einem Vierzig-Stunden-Job, anderen Freizeitaktivitäten und unvermeidbaren Stresssituationen (wie zum Beispiel akuter Krankheit), nicht funktionieren. Viel wichtiger ist es, Strategien zu finden, die das Zusammenleben von Katze-Katze und Katze-Mensch wieder harmonisch gestalten.
Wir als Besitzer*innen sind maßgeblich dafür verantwortlich, dass die Akkus unserer Katzen möglichst immer im grünen Bereich liegen. Deshalb solltest du dir vor der Anschaffung einer neuen kätzischen Mitbewohnerin wirklich klar sein, ob du die finanziellen, mentalen und zeitlichen Möglichkeiten hast, die Bedürfnisse der Katze zu erfüllen und sie glücklich zu machen.
Was Katzen essen – das Futter
Katzen sind Karnivoren, also Fleischfresser. Sie brauchen einen hohen Fleischanteil und eine hochwertige, detailreiche Zusammensetzung des Futters, um artgerecht ernährt zu werden. Gerade die Katzenernährung ist ein wichtiger Aspekt im bedürfnisorientierten Umgang mit Katzen. Eine falsche Ernährung birgt nicht nur gesundheitliche, sondern auch verhaltensbezogene Gefahren. Aus etlichen Studien ist bekannt, dass sich eine Mangel- oder falsche Ernährung der Mutterkatze schon direkt negativ auf die Kitten und deren Auffassungsvermögen und emotionale Stabilität auswirken kann. Beinhaltet das Katzenfutter Zucker und Getreide, kann das zu einem hyperaktiven und andauernd nervösen Verhalten bei Katzen führen.
Grundsätzlich gibt es folgende Möglichkeiten, die Katze zu füttern:
Rohfütterung oder Barfen (biologisch artgerechte Rohfütterung)
Nassfutter
Trockenfutter
Bei der Rohfütterung wird ein Gemisch aus hauptsächlich frischem Fleisch, Innereien und Knochen gefüttert. Zusätzlich wird das Menü durch ausgewählte Obst- und Gemüsesorten verfeinert. Um den Bedarf der Katze vollständig zu decken, werden Futterzusätze wie zum Beispiel Taurin, Kalzium oder Omega-3-Fettsäuren hinzugefügt. Dadurch hat der oder die Besitzer*in die Gewissheit darüber, was sich tatsächlich im Futter befindet. Obwohl der Umstieg von Nassfutter auf Barf für die meisten Katzen unproblematisch ist, muss man sich vorab gut in die Materie einlesen. Ein*e Barfernährungsberater*in hilft dir dabei, das Konzept »Barfen« richtig zu beherrschen. Beim Barfen sind regelmäßige medizinische Kontrollen in Form von Blutbildern und Kotproben wichtig, um sicherzustellen, dass deine Katze alle wichtigen Nährstoffe erhält.
Da das Barfen von Katzenbesitzer*innen anfänglich eher als schwierig empfunden wird, greifen viele zu Nass- oder Trockenfutter. Bei beiden Futterarten kann zusätzlich noch zwischen Allein- und Ergänzungsfuttermitteln unterschieden werden. Ersteres ist für den täglichen Bedarf konzipiert, Zweiteres als Snack oder als alternatives Futter für zwischendurch, da hier lebenswichtige Zusätze (wie z. B. Taurin) fehlen. Das Ergänzungsfutter kann/sollte also maximal 20 % der gesamten Futtermenge pro Woche ausmachen.
Ein gutes, hochwertiges Futter ist ganz klar beschrieben und die Inhaltsstoffe sind genau aufgelistet. Der reine Fleischanteil des Nassfutters sollte mindestens 60 % betragen. Zucker und Getreide haben in einem artgerechten Futtermittel nichts zu suchen, denn der Katzenmagen ist nicht darauf ausgelegt, diese Stoffe zu verdauen. Dadurch kann es zu akuten Beschwerden wie Bauchschmerzen oder Hyperaktivität, aber auch zu langfristigen gesundheitlichen Problematiken wie zum Beispiel einer Diabeteserkrankung kommen.
Folgende Nassfutterzusammensetzung gilt als hochwertig:
Huhn (72%, bestehend aus Muskelfleisch, Herz, Leber und Magen), Hühnerbrühe (21,6%), Cranberrys (3%), Karotte (2%), Mineralstoffe (1%), Katzenminze (0,2%), Lachsöl (0,2%)
Bei der Fütterung mit Trockenfutter wird die Katze mit getrockneten Pellets oder Kroketten gefüttert. Das Trockenfutter bringt zwar Vorteile wie lange Haltbarkeit mit sich, ist als Hauptnahrungsmittel allerdings nicht zu empfehlen. Denn einerseits ist der Feuchtigkeitsanteil bei Trockenfutter in der Regel unter 10 % (bei Nassfutter liegt der Wert bei 70–80 %) und andererseits ist der Kaloriengehalt drei- bis viermal höher als der von Nassfutter. Katzen decken ihren täglichen Flüssigkeitsbedarf hauptsächlich über die Nahrung. Bei einer reinen Trockenfütterung ist das Risiko einer Nierenerkrankung der Katze deutlich erhöht, da die Katze nicht automatisch mehr trinkt. Auch der hartnäckige Mythos, dass sich Trockenfutter positiv auf die Zahnhygiene auswirkt, ist falsch. Ganz im Gegenteil: Trockenfutter kann Zahnproblematiken verschlimmern, da sich kleine Stückchen abspalten und dann zwischen den kleinen Zähnen hängen bleiben können. So als würden wir Menschen durch Kekseessen unsere Zähne reinigen wollen. Trockenfutter ist als Leckerchen für zwischendurch oder als Trainingsleckerchen ideal, aber als tägliches Hauptnahrungsmittel nicht gut. Eine Umstellung von Trocken- auf Nassfutter gestaltet sich für viele Katzenbesitzer*innen kompliziert. Geduld und Durchhaltevermögen des Menschen sind bei einer Futterumstellung das Wichtigste. Es ist eigentlich genau wie bei uns: Eine nachhaltige Änderung unserer Ernährung fällt sicherlich dem einen oder der anderen schwer.
Tipps zur Futterumstellung von Trocken- auf Nassfutter:
einen flachen Teller benutzen, der leicht erwärmt wurde (z. B. in der Mikrowelle)
Trockenfutter mit sehr warmem Wasser aufweichen
nun in kleinen Schritten Nassfutter untermischen
Der Katzennapf wird bei jeder Fütterung mit etwas mehr neuem Futter gefüllt, sodass das neue Futter (hochwertiges Nassfutter) das alte Futter (Trockenfutter, Nassfutter) ersetzt. Katzen sind bekanntlich Gewohnheitstiere, je nachdem, wie lange die Katze schon minderwertiges Katzenfutter erhalten hat, kann dieser Prozess mehrere Wochen oder Monate dauern.
Schließlich haben Katzen Vorlieben, und es gibt unter Katzen regelrechte Trockenfutterjunkies. Diese Vorlieben betreffen auch die Häufigkeit, Form und Art von Fütterung, Futternapf oder Futterplatz. Gerade die Häufigkeit der Fütterung und ihre Form können die Lebensqualität der Katze erheblich steigern. Zu wenig Futter und ständiger Hunger können zu chronischem Stress und daraus resultierend zu einer schlechten Gruppendynamik im Mehrkatzenhaushalt, Spannungen in der Mensch-Katze-Beziehung und zu gesundheitlichen Problemen führen.
Es gibt drei Formen der Fütterung:
Ad-libitum-Fütterung (Sattfütterung)
restriktive Fütterung
Fütterung auf Verlangen
Unter Ad-libitum-Fütterung versteht man, dass ein permanenter Zugang zu (kleinen) Futterportionen sichergestellt wird. Das Futter wird regelmäßig ausgetauscht, bleibt somit frisch und attraktiv für deine Katze. Diese Form der Fütterung ist bei Katzen besonders beliebt, da die Ressource »Futter« immer verfügbar ist und dadurch ein möglicher Stressfaktor im Leben der Katze vermieden wird.
Die restriktive Fütterung ist die am häufigsten vorkommende Form der Fütterung. Hier wird das Futter begrenzt und zu bestimmten Uhrzeiten angeboten. Durch den modernen Lebensstil und Arbeitsalltag ist es für Besitzer*innen weitaus einfacher, zwei bis drei Mahlzeiten am Tag in Zeitfenstern anzubieten. Die Katze erhält zum Beispiel um 06:00 und um 18:00 Uhr ihre Futtereinheit. Diese Fütterung scheint zwar auf den ersten Blick praktisch, für die Katze hingegen ist eine restriktive Fütterung nicht angenehm. Katzen sind Häppchenfresser und keine Schlingfresser, sie bevorzugen mehrere kleinere Mahlzeiten am Tag. In freier Wildbahn jagen und fressen Katzen täglich zwischen zehn und zwanzig Beutetiere wie Mäuse, Ratten, kleinere Insekten und manchmal auch Vögel. Die restriktive Fütterung ist nicht auf dieses Verhalten ausgelegt und kann daher Stress verursachen. Zudem ist die Katze darauf angewiesen, alle vier bis fünf Stunden Futter zu Verfügung zu haben. Sind die Fütterungsabstände zu lang, kann das gesundheitliche Folgen haben. Nach fünf Stunden ohne Futteraufnahme sinkt der Säuregehalt des Katzenurins, und das kann auf Dauer die Wahrscheinlichkeit von Erkrankungen der Harnwege (z. B. Harnsteinen) erhöhen.
Tatsächlich »hungern« Katzen täglich, wenn sie keinen regelmäßigen Zugang zu Futter haben, denn ihr Stoffwechsel ist nicht darauf ausgelegt, zwei Mahlzeiten am Tag über eine lange Zeitspanne zu verarbeiten. Es wird also nicht nur die körperliche Gesundheit, sondern auch das psychische Wohlbefinden beeinträchtigt. Katzen, die restriktiv gefüttert werden, neigen zu Schlingverhalten, erhöhter Reizbarkeit und geringer Frustrationstoleranz. Das schlägt sich direkt in den Beziehungen (Mensch-Katze, Katze-Katze) nieder.
Die Sorge, dass eine Ad-libitum-Fütterung zu Übergewicht bei Katzen führt, ist verständlich, aber wissenschaftlich nicht belegt. Adipositas ist ein komplexes Thema und tritt bei Katzen normalerweise aufgrund von Krankheit, bisher schlechter Erfahrung mit Futter und zu wenig körperlicher Beschäftigung auf. Im Unterschied zu einer Ad-libitum-Fütterung kann eine restriktive Fütterung eher zu Übergewicht führen. Durch die Knappheit ist das Risiko von Schlingen erhöht, wodurch das Sättigungsgefühl gestört wird. Die Katze hat demnach fast immer ein Hungergefühl. Dadurch ist auch das Risiko, dass die Katze Unverdauliches frisst, gegeben.
Katzen aus dem Tierschutz neigen eher dazu, das Futter auf einmal zu verschlingen. Sie haben in vielen Fällen gelernt, dass Futter eine begrenze Ressource ist. Hier kann folgendes Training gestartet werden: Die Katze erhält eine Kombination aus allen Fütterungsformen. Einerseits ist immer Futter zur Verfügung (ad libitum), andererseits kommt ein zeitgesteuerter Futterautomat (restriktive Fütterung) zum Einsatz. Zudem erhält die Katze frisches Futter, wenn ihr deutlich anzusehen ist, dass sie hungrig ist. Dieser Lernprozess ist wichtig, um der Katze einen positiven Zugang zu Futter zu vermitteln. Dieses Training kann je nach Katze Wochen oder Monate dauern und dann z. B. durch eine Ad-libitum-Fütterung ersetzt werden. Eine rein restriktive Fütterung ist bei diesen Katzen nicht sinnvoll.
Wenn es nicht möglich ist, die Katze in regelmäßigen Abständen und öfter als fünf Mal am Tag zu füttern, stehen als Abhilfe die zeitgesteuerten Futterautomaten zur Verfügung. Sie können morgens und abends befüllt werden und öffnen sich je nach Einstellung alle paar Stunden. In Kombination mit chipgesteuerten Futterautomaten, aus denen nur die jeweils mit Chip registrierte Katze fressen kann, können das Futtermanagement optimiert und das Stressniveau gesenkt werden. Leider sind aktuell noch keine zugleich zeit- und chipgesteuerten Futterautomaten auf dem Markt.
Eine weitere Form des Fütterns ist das Füttern auf Verlangen. Die Katze ist direkt vom Menschen abhängig und macht deutlich, unter anderem mit lautstarkem Miauen oder Kratzen an Tapete oder Türen, wenn sie hungrig ist. Diese Form der Fütterung kann bei zu spätem Erkennen der individuellen Hungersignale zu Frust und Stress bei den Katzen führen.
Wie wichtig die Präsentation des Futters ist, ist vielen Katzenbesitzer*innen nicht wirklich bewusst. Die Wahl des Futterplatzes und des Napfes sowie das Zerteilen des Futters im Napf sind für die Katze von großer Bedeutung. Es sollte ein fester Futterplatz vorhanden sein, der geschützt ist. Freilebende Katzen fressen selten die gefangene Beute direkt an Ort und Stelle – außer sie haben wirklich sehr großen Hunger –, sie bringen das Tier nach Hause, um es dort in Ruhe zu verspeisen. Ein gleichbleibender Platz für die Hauptmahlzeiten gibt Struktur und das Gefühl von Kontrolle. Erwachsene Katzen jagen und fressen allein und nicht mit anderen Katzen gemeinsam. Deshalb ist eine Gruppenfütterung bei den Hauptmahlzeiten nicht zu empfehlen und stärkt die Beziehungen unter den Katzen nicht. Bei gemeinsamer Fütterung gibt es auch keinerlei Indizien dafür, wie gut oder schlecht die Gruppendynamik ist. Fressen ist lebensnotwendig, darum fressen Katzen auch zusammen, wenn sie sich nicht gut verstehen, da sie keine andere Wahl haben. Die Katze kann in einen inneren Konflikt mit sich selbst kommen, wenn ihr keine Alternative angeboten wird. Das stresst sie, und sie zeigt in Folge ein sehr hastiges Fressverhalten oder das Wegtragen von einzelnen größeren Futterstücken an einen anderen, für sie sicheren Ort. In der Praxis kann dieses Problem behoben werden, indem die Katzen räumlich getrennt gefüttert werden oder eine Sichtbarriere zwischen den Futternäpfen aufgestellt wird.
Futternäpfe gibt es heutzutage in verschiedenen Ausführungen. Katzen bevorzugen flache und große Näpfe, sodass die Vibrissen, also die Schnurrhaare, den (erhöhten) Rand des Napfes nicht berühren. Vibrissen sind dreimal tiefer in das Nervengewebe eingebettet als das übrige Fell der Katze, weshalb das Berühren bestimmter Gegenständen unangenehm sein kann. Man glaubt es kaum, aber neben dem Material des Napfes, wie zum Beispiel Keramik, Plastik oder Glas, ist auch die Farbe bedeutend. Sehr dunkle Farben können Katzen schwer einschätzen und auf sehr sensible Katzen erstmal gruselig wirken. Das Futter sollte nicht flach in den Napf gedrückt, sondern zu einem kleinen Türmchen gebaut werden. Für eine bessere Futteraufnahme kann ein Schuss heißes Wasser über das Katzenfutter sorgen.
Als Katzenbesitzer*in solltest du mit drei bis fünf Katzenfuttermarken (Alleinfutter und Ergänzungsfutter) rotieren, damit der Bedarf deiner Katze(n) in jedem Fall ausreichend gedeckt wird.
Für die perfekte Futtergabe wird das Futter auf einem hellen, flachen Dessertteller oder Teeuntersetzer aus Keramik mit Zimmertemperatur aufgetischt. Nassfutter direkt aus dem Kühlschrank finden Katzen nicht so toll, da kaltes Futter zu Verdauungsproblemen führen kann. Für etwas Abwechslung und mentale Stimulation kann das Futter in unregelmäßigen Abständen mit mehr/weniger Wasser gestreckt oder in kleine/große Stückchen zerteilt werden.
Bei jungen Katzen macht es aus erzieherischer Sicht Sinn, dass sie verschieden verarbeitete Nassfuttersorten (Texturen wie Paste, Sauce, Ragout …), Futternäpfe und -plätze kennenlernen. So ist der Grundstein für eine stressfreie Fütterung und eine spätere problemlose Umstellung gelegt. Katzen fressen hauptsächlich und am liebsten das, was sie während der Sozialisierungsphase kennengelernt haben. Bei Katzen aus dem Tierschutz kann das herausfordernd sein, aber Tierschutzkatzen können mit viel Geduld und kleinschrittigem Training an hochwertiges Futter gewöhnt werden.
Bei der Wassergabe ist darauf zu achten, dass das Wasser nicht direkt neben dem Futter steht, da der Geruch des Futters das geruchlose Wasser überdecken kann, zudem fressen Katzen in freier Wildbahn nicht dort, wo getrunken wird, um keine potenziellen Feinde anzulocken. Die Wasseraufnahmemöglichkeit sollte nicht auf einen Napf beschränkt werden, ein vielfältiges Angebot an verschiedenen Trinkmöglichkeiten steigert das natürliche Trinkverhalten. Mittlerweile gibt es strombetriebene Trinkbrunnen, die den herkömmlichen Wasserhahn, der für viele Katzen die ideale Trinkstelle ist, nahezu perfekt imitiert. Viele Katzen trinken gerne erhöht und mit Aussicht auf ihr Revier, in der Nähe einer Knabbermöglichkeit. Mehrere Katzengrassorten neben einer Trinkquelle nehmen Katzen sehr gerne an. Katzengras ist ein weiteres Must-have in einem Wohnungskatzenhaushalt. In manchen europäischen Ländern, wie zum Beispiel Österreich, sind die Gabe und der uneingeschränkte und ständige Zugang zu Katzengras sogar im Tierschutzgesetz verankert. Und das nicht nur, da es die wichtige Folsäure, die für das Wachstum der Katze und die Produktion von roten Blutkörperchen verantwortlich ist, enthält. Durch das Fressen von Katzengras, reinigen Katzen ihren Magen und können Haarballen besser Verdauen. Zudem befriedigt das Fressen von Katzengras das natürliche und manchmal sehr stark ausgeprägte Knabber- und Kaubedürfnis. Regelmäßiges Erbrechen nach dem Fressen von Katzengras ist kein katzentypisches Verhalten, sondern eine Verhaltensauffälligkeit, die tiermedizinisch untersucht werden sollte.
Sicherheit und Kontrolle – der Wohnraum
Katzen sind sehr stark an ihre Umgebung gebunden und fühlen sich in den eigenen vier Wänden am wohlsten. Das Wohnraummanagement deckt Bedürfnisse wie Sicherheitsgefühl, stressfreie Kommunikationsmöglichkeit oder die körperliche und mentale Stimulation ab. Ein sicheres und katzenfreundliches Lebensumfeld dient der Stressreduktion und macht die Katze mutig. Zudem beinhaltet ein gutes Wohnraummanagement strategisch gut platzierte Markierstellen, die die Katze zur Kommunikation mit anderen Tieren nutzen kann. Je besser das Wohnraummanagement ist, umso besser und deutlicher kann sich die Katze uns gegenüber äußern. Verschiedene Markierstellen (Kratzstellen, Möglichkeiten, den Kopf an Gegenständen zu reiben) sind im Wohnraum hilfreich, um Informationen mit anderen Lebewesen auszutauschen. Diese klare Kommunikationsart kann die Gruppendynamik im Mehrkatzenhaushalt unterstützen und Gruppenstress verringern.
Es darf nicht vergessen werden, dass heutzutage viele Katzen in Wohnungshaltung leben. In freier Wildbahn jagen Katzen im Durchschnitt mehr als vier Stunden am Tag. Diese Zeit muss bei Katzen, die in reiner Wohnungshaltung leben, durch uns oder unser Wohnraummanagement ausgefüllt werden. Die Vorstellung, dass eine glückliche Katze nur auf dem Sofa döst und sich über gemeinsame Kuscheleinheiten freut, ist falsch. Katzen wollen beschäftigt werden. Ein artgerechter Lebensraum ist die beste Prävention, um das Risiko von Verhaltensproblematiken zu verringern. Die reine Wohnraumfläche ist für Katzen übrigens zweitranging, viel wichtiger ist die Gestaltung. Eine Katze, die auf 100 qm lebt, aber keine katzengerechten Ausblickmöglichkeiten, Futterspiele oder Ähnliches hat, wird ein weniger zufriedenes Leben führen als eine Katze, die zwar auf 50 qm lebt, dafür aber in einem an die Katze angepassten Lebensraum. Da die Katze die Gestaltung des Wohnraumes leider nicht mitbestimmen kann, zeigt sie mitunter katzentypische Verhaltensweisen, die wir manchmal als störend wahrnehmen. Das Kratzen, um die Krallen zu schärfen, ist hier ein gutes Beispiel.
Du kommst etwas später als sonst nach Hause, deine Katze begrüßt dich und kratzt anschließend an deinem neu gekauften Sisalteppich im Vorzimmer. Deine Katze zeigt dieses Verhalten nicht, weil sie nachtragend ist, sondern aus zwei Gründen. Der erste ist die Geruchsüberdeckung durch die Duftdrüsen und der zweite ist ein Ausdruck der Freude, weil du gerade nach Hause gekommen bist.
Das Kratzen an Gegenständen ist ein oft unterschätztes Bedürfnis, damit drückt sich die Katze gerne aus. Denn das Kratzen ist zwar in erster Linie für das Schärfen der Krallen und das Abstreifen der Krallenhüllen nützlich, spielt aber auch bei der Kommunikation mit anderen Tieren oder uns Menschen eine sehr bedeutende Rolle. Durch die Duftdrüsen, die direkt unter den Pfoten sitzen und Pheromone absondern, hinterlassen Katzen Botschaften für andere Tiere wie zum Beispiel »Hier wohnt Emely und ist zufrieden«. Da diese speziellen Kratzpheromone nicht besonders intensiv riechen, setzen Katzen durch das Zerkratzen zusätzlich eine optische Markierung.
Vielen Katzen wird unterstellt, dass sie bestimmte Dinge durch ihr Kratzverhalten gerne und bewusst zerstören. Diese Behauptung trifft insoweit zu, als das optische Markieren frustsenkend wirkt und zum Sicherheitsbedürfnis und Wohlbefinden der Katze beiträgt. Kratzstellen sollten sich daher nicht nur auf Sisalkratzstämme beschränken. DIY-Kratzzonen wie Korkplatten, Gymnastikmatten oder Kratzpappen nehmen die meisten Katzen dankbar an. Der Vorteil hier ist, dass die Katze bei diesen Materialien sehr schnell ihren eigenen Erfolg sieht.
Auch wenn es in unserem Wohnraum nicht ganz so ästhetisch und schön wirkt, sollten fast kaputt gekratzte, aber noch intakte Kratzstellen nicht sofort ersetzt werden. Stell dir vor, du malst über Wochen hinweg ein Gemälde. Du schenkst es deinen*r Freund*in und diese*r hängt das Bild in der Wohnung auf. Bei deinem nächsten Besuch findest du das Bild nicht mehr, da dein*e Freund*in es in die Mülltonne entsorgt hat. Das löst bei dir Frust, Vertrauensschwund und Unsicherheit aus. Deiner Katze ergeht es genauso, wenn du ihre Lieblingskratzstellen wegnimmst.
Ob die Katze die bereitgestellten Kratzmöglichkeiten nutzt oder nicht, hängt nicht nur von Material oder Vorliebe, sondern vielmehr von der Positionierung ab. Kratzmöglichkeiten müssen aus Katzensicht logisch platziert sein. Steht der einzig verfügbare Kratzbaum in einem Zimmer, das von den Halter*innen selten benutzt wird, wird die Katze wohl lieber am Sofa kratzen, da dieser Raum täglich und gerne vom Menschen benutzt wird. Aus Sicht der Katze macht es hier Sinn, eine Markierstelle zu setzen. Durch die Anpassung der Kratzmöglichkeiten kann man Kratzen an unerwünschten Stellen gut entgegenwirken. Zum Beispiel sind Kratzmöglichkeiten in der Nähe oder oberhalb von Schlafplätzen sehr empfehlenswert. Nach dem Schlafen strecken sich Katzen gerne, ein Kratzbrett schafft Abhilfe, da dieses Strecken häufig in ein kurzes, aber intensives Kratzverhalten übergeht. Katzen bevorzugen übrigens auch Kratzbäume, an denen sie sich problemlos hochstrecken können. Daher sollten zwischen der sich streckenden Katze und dem nächsten Kratzbrett mindestens 30 cm Abstand liegen.
Ein guter Kratzbaum sieht folgendermaßen aus:
kein Plüsch, aber dicke und stabile Kratzstämme
nicht zu verschachtelt, aber freie Stämme und verschieden ausgerichtete Ebenen
kein hängendes Spielzeug, das kann zu Verletzungen führen
Katzen kratzen gerne:
Durch das Kratzen kann die Katze eine Vielzahl an Gefühlen wie Freude, Ärger oder Frust ausdrücken.
Katzen kratzen gerne auf dem Weg zwischen Schlafplatz und Futterplatz.
Katzen kratzen nicht nur in die Höhe, sondern gerne auch am Boden, daher sollten sowohl vertikale als auch horizontale Möglichkeiten in den Wohnraum integriert werden.
Manche Katzen ziehen Textilien und verschiedene Holzelemente als Lieblingskratzstellen vor.
Erhöhte Kratzstellen sind ideal, um der Katze Überblick über den gesamten Raum oder auch Ausblick aus dem Fenster zu gestatten. Der Weg auf das Fensterbrett sollte einfach gestaltet werden, sodass auch ältere und sehr junge Katzen problemlos hinausschauen können. Der Ausbau der sogenannten dritten Ebene mithilfe von Catwalks vermittelt nicht nur Sicherheit, sondern eine Menge Spaß. Mit wenigen Regalbrettern an der Wand in Kombination mit gesicherten Schränken und deckenhohen Kratzbäumen entsteht ein Kletterparadies für Katzen in der Höhe. Dabei ist immer zu beachten, dass die Sprung- und Landeflächen mit Antirutschmatten beklebt sind. Auch sollte es mehr als einen Ausweg in nur eine Richtung geben. Katzen sollten allgemein im Wohnraum mehrere Fluchtwege in die Höhe haben, das ist vor allem im Zusammenleben mit anderen Tieren wie zum Beispiel Hunden vorteilhaft. So können sich Katzen bei Gefahren oder bei Unsicherheit in eine für sie sichere Zone begeben.