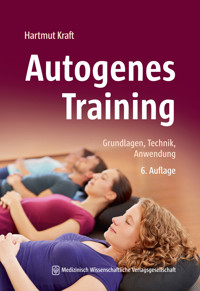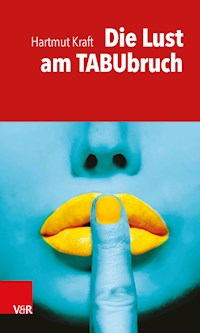
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Vandenhoeck & Ruprecht
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2015
Tabus haben Konjunktur. Sie sind aktuelle Phänomene in unserer Gesellschaft. So sind zum Beispiel in Folge der Political Correctness die "Negerküsse" und "Mohrenköpfe" aus unseren Cafés verschwunden. Während manche Tabus und deren Übertretungen nur Befremden hervorrufen, führen andere Tabubrüche zum Ausschluss aus der Bezugsgruppe, für die diese Tabus Geltung haben. So befindet sich ein Politiker, der in Deutschland das Antisemitismus-Tabu bricht, schnell am Ende seiner Karriere.Doch besteht immer auch eine Lust am Tabubruch, das Bedürfnis, überholte und verkrustete Denk- und Handlungsmuster abzustreifen. Von der sexuellen Revolution in den Sechzigerjahren bis zu den Auseinandersetzungen um die Ehe zwischen gleichgeschlechtlichen Partnern und deren Adoptionsrecht zieht sich ein roter Faden des gesellschaftlichen Wandels. Auf diesem Weg mussten zahlreiche Tabus in Frage gestellt, gebrochen und neue Normen und Gesetze aufgestellt werden.Um Tabus im eigenen sozialen Umfeld zu identifizieren, lässt sich eine "Tabu-Suchfrage" verwenden: Was müsste ich tun oder sagen – ohne ein Gesetz zu brechen –, um in meiner Ehe, Familie, Firma, Partei etc. ausgeschlossen, zumindest aber geschnitten zu werden? Sie werden unweigerlich auf die Tabus ihrer jeweiligen Bezugsgruppe stoßen.Mit seinem weiten beruflichen Erfahrungsspektrum untersucht der Psychoanalytiker, Arzt und Kunstsammler Hartmut Kraft das Phänomen von Tabus und dessen Brüchen in spannender Vielfalt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 349
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Hartmut Kraft
Die Lust am TABUbruch
Vandenhoeck & Ruprecht
Mit 15 Abbildungen
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
ISBN 978-3-647-99733-9
Umschlagabbildung: art photo finger on yellow lips close up/Little Moon/shutterstock.com
© 2015, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen /Vandenhoeck & Ruprecht LLC, Bristol, CT, U.S.A.www.v-r.deAlle Rechte vorbehalten. Das Werk und seine Teile sind urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung in anderen als den gesetzlich zugelassenen Fällen bedarf der vorherigen schriftlichen Einwilligung des Verlages.
Inhalt
Vorwort
1. Zehn Thesen zum Tabu – eine Einführung
2. Konkret Nigger und Judensau – oder: Was ist Political Correctness?
3. Von der Magie bis zur sozialen Strategie – eine Kulturgeschichte der Tabus und ihrer Definitionen
4. Konkret Suche Niere, biete Geld! Tabus in der Transplantationsmedizin
5. Vom Inzest- bis zum Nahrungstabu: Die verschiedenen Erscheinungsformen der Tabus
6. Konkret Warum gilt der Untergang der Titanic als die größte Schiffskatastrophe? Oder: Die Tabus der Vertriebenen des Zweiten Weltkriegs
7. Hier irrte Freud aus gutem Grund – jenseits von »Totem und Tabu«
8. Konkret Das Inzesttabu – ein gut gehütetes Familiengeheimnis
9. Tabus sichern Identität – die Funktionen der Tabus
10. Konkret Theo, »Attolf Hitler« und das Bildtabu
11. »Du glaubst wohl, was Besseres zu sein?« Oder: Die vielfältigen Methoden des Tabuisierens
12. Konkret Holt uns der Tod – oder wir ihn: Totentanz oder Euthanasie?
13. Keine Hunde in Alangouan: Mana und Tabu
14. Konkret Der 20. Juli 1944 – Widerstand und Tabu
15. Es begann mit Adam und Eva: Tabubrüche ermöglichen Entwicklung
16. Konkret Tabus und ihre Witze
17. Warum wir uns heute einem Tabu unterwerfen, es brechen oder ein neues errichten – Zusammenfassung und Ausblick
Anmerkungen
Literatur
Vorwort
Die Lust am Tabubruch – stimmt diese Aussage? Können wir wirklich Lust verspüren, ein Tabu zu brechen oder gebrochen zu haben? Ja, wir können. Die Studenten der 68er-Generation vertrieben »unter den Talaren den Muff von tausend Jahren«. Zusammen mit vielen anderen in der Gesellschaft setzten sie einen Veränderungsprozess in Gang, der bis heute fortwirkt. Es wurde mehr Demokratie gewagt, die Aufarbeitung der nationalsozialistischen Vergangenheit schritt voran, und eine verkrustete Sexualprüderie wich Schritt um Schritt einer Vielfalt sexueller Lebensformen. Ohne Tabubruch keine Zukunft.
Aber es gibt auch Ängste angesichts der Meidungsgebote von Tabus, erst recht gibt es berechtigte Ängste, ein Tabu zu brechen. Dabei geht es nicht nur um fehlgeleitete Fanatiker, die feige Mordanschläge auf Journalisten und Karikaturisten wegen einiger Mohammed-Karikaturen verüben. Es geht längst vorher schon um allgemeine Ängste vor sozialer Ausgrenzung. Die Political Correctness als modernes Sprachtabu hat ihre Verbotsschilder quer durch die Gesellschaft errichtet. Aber auch jedes Liebespaar, jede Familie, jeder Verein und jede Partei legt über Tabus fest, »was zu uns gehört – und was auf jeden Fall zu meiden ist«. Der angedrohte Ausschluss aus der jeweiligen sozialen Gemeinschaft ist schmerzlich – und das Charakteristikum der Tabus.
Die Angst vor dem Tabubruch – auch so hätte der Titel des Buches lauten können. Er wäre ebenso berechtigt wie die Rede von der Lust. Aber es ist ja kein Tabu, bei einem spannungsvollen, hoch ambivalenten Geschehen den positiven Aspekt in den Vordergrund zu rücken.
Meine intensive Beschäftigung mit den Tabus hier und heute geht zurück auf eine Anfrage von Wolfgang Mertens aus dem Jahre 1997. Für ein »Handbuch psychoanalytischer Grundbegriffe« sollte ich das Stichwort »Tabu« bearbeiten. Ausgehend von Freuds Arbeit über »Totem und Tabu« (1912/1913) sollten Ergänzungen, konkurrierende Vorstellungen sowie geistesgeschichtliche Hintergründe dargestellt werden.
Diese umfassende Beschäftigung mit dem Thema Tabu veranlasste mich nicht nur zu intensiver Fachlektüre, sondern ebenso zur Zeitschriftenlektüre: Wie wird der Begriff Tabu hier und heute in unserer Gesellschaft, in unserer Kultur, in unserem Alltag verwendet? Welche Tabus haben wir, wie gehen wir damit um, wie reagieren wir auf Tabubrüche?
Das gesammelte Material mit seinen vielen, oft widersprüchlichen Aspekten veranlasste mich, auf den Psychotherapietagungen in Lindau, Lübeck, Langeoog und Aachen Kurse anzubieten zum Thema »Tabu – warum wir uns ihm unterwerfen, es brechen oder ein neues errichten«. Zwischen 1999 und 2003 fanden 16 Kurse in Kleingruppen mit insgesamt mehr als 200 Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten statt. Neben der Sichtung der Literatur und vielen Gesprächen mit Freunden und Kollegen verdanke ich vor allem den Diskussionen in diesen Gruppen die wesentlichen Anregungen zur Klärung des Tabubegriffs hier und heute. Ich danke den Kursteilnehmenden für ihre engagierte Mitarbeit und ihre Anregungen, die an vielen Stellen in die Gestaltung dieses Buches eingeflossen sind.
Für die zahlreichen Ermutigungen, an dieser oft schwierigen Thematik nicht zu verzweifeln, danke ich vor allem auch meiner Frau, Dr. Maria Kraft. Von ihr stammt der Vorschlag, das »unmögliche Thema« überhaupt zur Grundlage von Tabu-Kursen zu machen, also über das miteinander zu sprechen, worüber man so oft vermeiden möchte zu sprechen.
So sind es nun schon nahezu zwei Jahrzehnte, in denen ich mich mit den Tabus in unserer Gesellschaft beschäftige (Kraft, 2000, 2004, 2006, 2008a, 2011, 2012).
Das Ergebnis dieser Recherchen und Auseinandersetzungen findet sich in diesem Buch. Gegenüber früheren Publikationen zu diesem Thema lassen sich nach dieser langen Zeit inzwischen Entwicklungen erkennen. Tabus befinden sich in einem steten Wandel:
– Der sehr lange Zeit verschwiegene und geleugnete Missbrauch von Kindern in Familien und verschiedenen Institutionen, wie z. B. der katholischen Kirche, ist offengelegt.
– Auf der anderen Seite sind Versuche pädophiler Gruppen gescheitert, die unter dem Deckmantel einer zunehmenden Vielfalt sexueller Lebensformen eine Entkriminalisierung ihrer sexuellen Vorlieben durchsetzen wollten.
– Eines der weltweit am ehesten akzeptierten, geradezu als unumstößlich gelten Tabus, das Inzesttabu, steht inzwischen auf dem juristischen und gesellschaftlichen Prüfstand. So hat der Deutsche Ethikrat in seinem Mehrheitsvotum 2014 die Straffreiheit für inzestuöse Sexualität unter erwachsenen Geschwistern zur Diskussion gestellt.
– Zum Ende unseres Lebens geht es um die Frage, ob der Tod uns holt – oder wir ihn. Vor dem Hintergrund der nationalsozialistischen Vergangenheit mit ihrer Pervertierung des Begriffes »Euthanasie« werden Diskussionen um die Sterbehilfe in Deutschland intensiver und noch kontroverser geführt als in unseren Nachbarländern.
Wie diese Schlaglichter zeigen, ist die Auseinandersetzung mit Tabus ein Prozess, der nie zur Ruhe kommt. Ihn darzustellen, ist das Anliegen dieses Buches. Es ist so aufgebaut, dass die Kapitel mit den ungeraden Zahlen theoretische Aspekte darstellen und diese an möglichst vielen Einzelbeispielen nachvollziehbar machen. Die mit geraden Nummern versehenen Kapitel »Konkret …« vertiefen die Ausführungen, indem sie sich auf ein reales Beispiel konzentrieren.
Als Psychoanalytiker komme ich natürlich nicht umhin, mich selbst zu fragen, was mich über Jahre hinweg an diesem Thema festgehalten hat. Die Tatsache, dass unsere Tabus hier und heute noch nicht genügend bearbeitet worden sind – was zweifellos zutrifft –, reicht als Begründung nicht aus. Im Verlauf meiner Arbeit habe ich erstaunt festgestellt, dass mir die einzelnen Tabuthemen immer wieder zu entfallen drohten. Wenn ich im Gespräch Beispiele geben wollte, hatte ich häufig kein konkretes Beispiel zur Hand! So merkte ich am eigenen Leibe die Wirksamkeit der Tabus. Ich ärgerte mich und beschloss, dieses Buch als Gegenwehr gegen das Vergessen und Verdrängen zu schreiben. Das systematische Umkreisen des Tabuthemas von immer neuen Standpunkten aus (Definitionen, Erscheinungsformen, Funktionen, Tabubrüche etc.) hat mir dabei geholfen. Die Auswahl der Beispiele hätte anders ausfallen können – aber das ist der subjektive Faktor dieses Buches, der nicht nur meinen ethnologischen und vor allem künstlerischen Interessen geschuldet ist, sondern auch meiner familiären Herkunft mit der Notwendigkeit, die untergründigen Auswirkungen des Naziregimes in meiner Kindheit und Jugend aufzuarbeiten. Eingebettet in dieses spezifisch deutsche Thema war ich trotz allen Wissens immer wieder emotional berührt durch die Häufigkeit, mit der ich auf die fernen Manifestationen der deutschen Geschichte zwischen 1933 und 1945 stieß, sei es z. B. bei der Euthanasiedebatte, der Tabuisierung des Leids der Vertriebenen oder bei unserem sehr unterschiedlichen Gedenken an die Hitler-Attentäter.
Nicht alle Kapitel ließen sich mit einem vergleichbaren Aufwand schreiben. Manch ein Thema schien sich immer wieder der Formulierung zu entziehen, forderte neue Entwürfe, Einschübe, Ergänzungen und Anmerkungen. So konnte ich beim Schreiben miterleben, an welchen Stellen ich mit mehr oder weniger hartnäckigen Tabus in mir selbst konfrontiert wurde – eine Konfrontation, die auch nach Abschluss des Manuskripts keineswegs beendet ist. Die Auseinandersetzung mit den Tabus in uns und in unserer Gesellschaft ist ein niemals endender, fließender Prozess.
1. Zehn Thesen zum Tabu – eine Einführung
Am Tabu scheiden sich die Geister. Für manche Zeitgenossen sind Tabus geradezu ein rotes Tuch, das sie anfeuert, gegen das Verbotene anzugehen und reale oder vermeintlich gesetzte Grenzen zu überschreiten. So wurden z. B. in einem oft lustvollen Sturmlauf viele Sexualtabus der Nachkriegsära hinweggefegt. Aber wer erinnert sich heute noch an die Entrüstung und die Boykottaufrufe der Kirchen, als es um den Film »Das Schweigen« (1962) von Ingmar Bergman ging? Und wer wüsste noch zu sagen, woran sich die Aufregung seinerzeit entzündete?1
Dass wir aufgrund der zahlreichen aufgehobenen Tabus in einer tabufreien Zeit und Gesellschaft leben, dürfte allerdings kaum jemand ernsthaft behaupten wollen. Bereits ein Blick in die Tageszeitungen führt uns vor Augen, welch weiter Verbreitung und welch regen Gebrauchs sich der Begriff Tabu in den Medien und in der Umgangssprache erfreut. Auf diese umgangssprachliche Verwendung des Tabubegriffs in unserer Kultur hier und heute wird deshalb auch immer wieder Bezug genommen. Eine erste, leicht zu belegende These lautet:
Tabus haben Konjunktur! Tabuisierungen und Tabus sind aktuelle Phänomene in unserer Gesellschaft.
So konnten wir in den 1980er, vor allem aber 1990er Jahren das Aufblühen eines Sprachtabus unter dem Sammelbegriff »Political Correctness« miterleben: »Negerküsse« und »Mohrenköpfe« sind aus unseren Cafés und Bäckereien verschwunden, aus den »armen Negerkindern«, für die einst ein »Nickneger« in katholischen Kirchen mit artigem Kopfnicken für die Opfergroschen dankte, sind Schwarzafrikaner geworden. Im nachfolgenden Kapitel 2 »Nigger und Judensau – oder: Was ist Political Correctness?« werden wir ausführlich darauf zu sprechen kommen.
Was aber verstehen wir überhaupt unter einem Tabu? Es gibt in unserer Sprache kein Wort, das dem Tabubegriff entsprechen würde. »Unsere Zusammensetzung ›heilige Scheu‹ würde sich oft mit dem Sinn des Tabu decken«, hat Sigmund Freud (1912/1913, S. 311) in seiner berühmten Arbeit zu »Totem und Tabu« ausgeführt. Allgemeiner gefasst könnten wir von Meidungsgeboten sprechen. Das Besondere des Tabus liegt jedoch nicht im Meidungsgebot allein, sondern in der spezifischen Reaktion auf die Verletzung dieses Gebots. Dies führt uns zur zweiten These, zu einer ersten Definition des Tabus:
Tabus sind Meidungsgebote, deren Übertretung mit Ausschluss aus der Gemeinschaft bedroht ist.
Welche Veränderungen der Tabubegriff und seine theoretischen Einordnungen durchlaufen haben, ist das Thema des 3. Kapitels »Von der Magie bis zur sozialen Strategie: Eine Kulturgeschichte der Tabus und ihrer Definitionen«. Das jeweils Umkämpfte, Tabuisierte oder soeben Enttabuisierte gibt uns Einblick in aktuelle psychosoziale Problemzonen. Die emotional geführte Debatte im Zusammenhang mit der Verabschiedung der Euthanasiegesetze in den Niederlanden und in Belgien (siehe Kapitel 12 »Totentanz oder Euthanasie?«) zeigt dies ebenso deutlich wie die Auseinandersetzungen um Vergütungen bei Organtransplantationen (siehe Kapitel 4 »Suche Niere – biete Geld!«) oder die von Günter Grass u. a. angestoßene breite Auseinandersetzung um das Leid der Vertriebenen zum Ende des Zweiten Weltkriegs (siehe Kapitel 6 »Warum gilt der Untergang der Titanic als die größte Schiffskatastrophe?«). Die dritte These lautet also:
Eine »Tabuologie« wäre eine höchst spannungsvolle Wissenschaft von den in einer Gesellschaft aktuell gültigen Grenzen des Denkens, Redens und Handelns.
Gesellschaftliche Veränderungen führen zu Veränderungen der Tabus dieser Gesellschaft, so wie umgekehrt Tabubrüche zu einer Änderung der Gesellschaft führen können. Eine amüsante Randzone, in der Grenzen ausgetestet und spielerisch übertreten werden, stellen Witze dar (Kapitel 16 »Tabus und ihre Witze«). Dass man in einem totalitären Regime aber bereits für das Weitererzählen eines Witzes verhaftet werden kann, sollte nicht übersehen werden.
Unser Reden und Handeln mag Einschränkungen unterliegen, aber – so mag ein Einwand lauten – was wir denken und fühlen, das geht niemanden etwas an: »Die Gedanken sind frei!« Hier lauert ein oft unerkanntes Problem. Unsere eigenen Tabus und die unserer Gesellschaft können wir in vielen Fällen gar nicht erkennen. Unsere Gedanken sind bei Weitem nicht so frei, wie wir es uns oft wünschen mögen. So lautet die vierte These:
Bei den Tabus gibt es ein Spektrum von Erscheinungsformen, das von bewusst und öffentlich diskutierten Tabus über nonverbal vermittelte bis hin zu unbewussten Tabus reicht.
Das Spektrum der Tabus ist durch die Gegensatzpaare verbal – nonverbal, bewusst – unbewusst sowie öffentlich – heimlich gekennzeichnet. Die bereits genannte Political Correctness oder der Antisemitismus gehören zu den öffentlich diskutierten Tabus. Zahlreiche Familientabus, die sich um schamhaft verschwiegene Familienereignisse wie z. B. eine uneheliche Geburt oder den Alkoholismus des Vaters ranken, werden eher nonverbal vermittelt. Darüber spricht man nicht, und Personen, die dies doch tun wollen, werden gemieden.
Über die uns unbewussten Tabus können wir naturgemäß zunächst keine Aussage machen. Aber wir können uns zumindest eine Zeit lang an Tabus erinnern, die in den letzten Jahren erst aufgedeckt und in unser Bewusstsein gelangt sind. So ist z. B. das Inzesttabu stets akzeptiert und propagiert, sogar gesetzlich verankert worden – tabuisiert wurde jedoch die Häufigkeit des Bruchs dieses Inzesttabus! Sexueller Missbrauch innerhalb der Familien galt noch in den 1960er Jahren als ein sehr seltenes Phänomen, zudem eines, das nur in der sozialen Unterschicht zu beobachten sei. Sigmund Freud als Aufklärer über die kindliche Sexualität beteiligte sich an dieser Tabuisierung. Seine ursprüngliche Erkenntnis, dass ein realer sexueller Missbrauch am Anfang vieler neurotischer Entwicklungen stehe, wurde von ihm zurückgenommen und als Fantasietätigkeit der Kinder umgedeutet. Dies trifft zwar auch einen wesentlichen Aspekt, wie es – nach Freud – im sogenannten Ödipuskomplex als dem Kernkomplex der Neurosen ausgearbeitet wurde, verschleiert nun aber die ursprüngliche Erkenntnis von der Häufigkeit des Bruchs des Inzesttabus. Diesem Phänomen sind Kapitel 7 »Hier irrte Freud aus gutem Grund« und Kapitel 8 »Das Inzesttabu – ein gut gehütetes Familiengeheimnis« gewidmet. Generationen von Psychoanalytikern wurden blind für die Häufigkeit realen sexuellen Missbrauchs und für die Unterschiede, die zwischen erlittener Realität und intrapsychischen Konflikten, Wünschen und Ängsten bestehen. Dabei hatten gerade die Psychoanalytiker in ihrer Betonung der Bedeutung von kindlicher Sexualität zu ihrer beruflichen Identität gefunden. Diese kritisch zu würdigende Feststellung lässt sich als fünfte These verallgemeinern:
Tabus dienen der Herausbildung und Sicherung von Identität.
Identität sowie Sicherheits- und Selbstwertgefühl bedürfen einer Vorstellung von dem, was zu mir/uns gehört – und was nicht. Tabus definieren, wie bereits ausgeführt wurde, Meidungsgebote, deren Übertretung mit Ausschluss aus der Gemeinschaft bedroht ist. Sie kennzeichnen eine Grenzlinie – eine stets umstrittene Grenzlinie. Diesem Thema ist Kapitel 9 »Tabus sichern Identität« gewidmet, Kapitel 10 »Theo, ›Attolf Hitler‹ und das Bildtabu« gibt ein ungewöhnliches Beispiel hierzu.
Was jenseits der von den Tabus gezogenen Grenzlinie liegt, ist nun aber keineswegs für alle Menschen aller Zeiten und Kulturen verbotenes Terrain. In Kapitel 14 »Der 20. Juli 1944« wird hierzu ein konkretes Beispiel angeführt. Jedes Ehepaar, jede Familie, jede Berufsgruppe und jede Gesellschaft hat ihre spezifischen und oft höchst unterschiedlichen Tabus. Was z. B. für Partei A aus ihrem Selbstverständnis heraus vollkommen tabu ist, muss für Partei B keineswegs ein Meidungsgebot darstellen. So können wir eine sechste These aufstellen:
Tabus sind immer kontextabhängig – jede Gruppe, jeder Ort und jede Zeit haben ihre oft sehr unterschiedlichen Tabus.
Ohne die Benennung der Gruppe, für die ein bestimmtes Tabu Gültigkeit hat, geraten wir bei einer Diskussion rasch in heillose Verwirrung. In Kapitel 5 »Vom Inzest bis zum Nahrungstabu« sind die sehr unterschiedlichen Erscheinungsformen im Einzelnen dargestellt, in Kapitel 6 »Warum gilt der Untergang der Titanic als die größte Schiffskatastrophe?« wird ein konkretes Beispiel analysiert.
Tabus ändern sich aber nicht nur von Bezugsgruppe zu Bezugsgruppe, sie ändern sich auch mit der Zeit und gegebenenfalls sogar mit einem Ortswechsel. Was z. B. innerhalb einer ärztlichen Praxis als Berührung möglich ist, bleibt außerhalb der Praxisräume ein Berührungstabu. Noch deutlicher wird die Kontextabhängigkeit von Tabus bei ihren spielerisch und probeweise vorgenommenen Übertretungen, den in Kapitel 16 behandelten Witzen.
Wenn wir Tabus als derartig funktional und wandlungsfähig verstehen, sie stets in ihrer Kontextabhängigkeit und in ihrer Funktion für die Herausbildung und Aufrechterhaltung der Identität einer Gruppe begreifen, wird eine Herleitung von einem wie auch immer gearteten »Ur-Tabu« immer unwahrscheinlicher. Vor allem macht es keinerlei Sinn, das Tabu einzugrenzen auf die Tabuvorstellungen der Südseevölker. Nicht das Tabu kam Ende des 18. Jahrhunderts von dort zu uns, sondern lediglich der Begriff »Tabu«. Tabus kannten und kennen alle Kulturen, es fehlte uns und ihnen aber ein prägnanter Begriff. So fiel der Begriff »Tabu« in eine »Wortschatzlücke« nahezu aller Sprachen der Welt und fand seine Anwendung auf die jeweils dort herrschenden Phänomene.
Wie die konkreten Beispiele dieses Buches zeigen, können wir das Tabu auch nicht als ein »uraltes Verbot, von außen (von einer Autorität) aufgedrängt« verstehen, wie Freud (1912/1913, S. 326) es formulierte. Noch weniger lässt es sich gar generell auf das »Menstruationstabu« zurückführen, wie Erich Neumann (1988, S. 274) es getan hat. Die siebte These zu den Tabus lautet:
Es gibt keine Herleitung der Tabus von einem »Ur-Tabu«.
Da die Inhalte der Tabus nahezu beliebig austauschbar sein können, wie im Kapitel 13 »Keine Hunde in Alangouan« ausgeführt wird, sind sie auch keineswegs immer gegen »die stärksten Gelüste des Menschen gerichtet« (Freud, 1912/1913, S. 326), andererseits auch nicht nur einfach nach dem Gesetz der Ähnlichkeit im Rahmen magischer Vorstellungen zu verstehen, auch wenn James Frazer (1989, S. 27ff.) hierzu zahlreiche Beispiele aus den Kulturen der Welt geliefert hat. Im Kapitel 11 »Du glaubst wohl, was Besseres zu sein?« wird dieses Thema näher erörtert. Die achte These lautet dementsprechend:
Tabuisieren ist ein in uns angelegter, sowohl intrapsychisch als auch interpersonell wirkender psychosozialer Mechanismus, der sich in immer neuen Tabus manifestieren kann.
Das Tabuisieren steht dabei zum Tabu wie das Verdrängen zum Verdrängten oder das Verleugnen zum Verleugneten. Im Unterschied zu den individuellen, intrapsychischen, also in unserer Psyche ablaufenden Abwehr- und Bewältigungsmechanismen, wie Verdrängen, Verleugnen, Isolieren, Verkehren ins Gegenteil etc.2, ist das Tabuisieren stärker interpersonell, also auf eine jeweils zu definierende Gruppe hin ausgerichtet. Es kann als eine interpersonale und institutionalisierte Abwehr verstanden werden. In diesem Sinne können wir Tabus als eine Bewältigung oder auch Abwehr von Identitätsdiffusion oder sogar Identitätsverwirrung (Desintegration) auffassen (Mentzos, 1988, v. a. S. 91–93).
Wer das Tabu der Gruppe übertritt, wird ausgeschlossen, weil er das System infrage stellt, die Identität der Gruppe zu untergraben droht. Der Ausschluss trifft auf frühkindlich geformte Ängste vor einem Verlassenwerden, einem Ausgesetztwerden. Auf dieser Entwicklungsstufe geht es um existenzielle Ängste, es geht um Tod oder Leben. Insofern liegt es nahe, das Tabuisieren, vor allem den angedrohten Ausschluss aus der Gemeinschaft, mit präödipalen Ängsten in Verbindung zu bringen. Unter dem Begriff »präödipal« fassen Psychoanalytiker die frühen Entwicklungsschritte vor dem ca. vierten Lebensjahr eines Kindes zusammen, also all das, was vor der mit ca. vier bis sechs Jahren zu durchlebenden ödipalen Phase liegt. Das führt uns zur neunten These:
Die Wirksamkeit der Tabus ist präödipal verankert. Der angedrohte Ausschluss aus der Gemeinschaft rührt an existenzielle Ängste (Todesangst).
In Abhängigkeit von unseren ganz persönlichen wie auch gesellschaftlich tradierten Erfahrungen, die wir in unserer frühen Kindheit gemacht haben, werden wir mehr oder weniger ängstlich auf einen drohenden Ausschluss reagieren, dementsprechend Tabus mehr oder weniger ängstlich befolgen. Im Rahmen hirnphysiologischer Forschungen gibt es inzwischen Hinweise, dass eine soziale Ausgrenzung oder auch nur Missachtung ähnliche Areale im Gehirn aktiviert, wie dies bei körperlichem Schmerz geschieht (Eisenberger, Liebermann u. Kipling, 2003).
Um die Macht der Tabus zu würdigen und auch theoretisch fassbar zu machen, eignet sich der Blick auf die Herkunft des Tabubegriffs von den Kulturen der Südsee. Hier war das Tabu eng verknüpft mit dem Begriff »Mana«. Mana meint das »außerordentlich Wirkungsvolle«, eine übernatürliche Kraft, die sich im Tabu manifestiert. Je mehr Mana ein Objekt oder eine Person hat bzw. ihr zugeschrieben wird, desto größer ist seine/ihre Tabuzone. Heute können wir das Mana vom Himmel und aus dem Bereich des Numinosen herunter auf die Erde holen. Es ist die Frage nach der irdischen Macht, ihrer Verteilung, den offenen und verborgenen Machtstrukturen. Bei jedem Tabu, das wir in unserer Umgebung entdecken, lohnt es sich, nach dem Mana dieses Tabus zu fragen. Was würde, vertreten durch welche Personen, passieren, wenn ich dieses oder jenes jetzt tue oder sage?! Was davon entspricht wirklich der Macht eines »Tabuwächters« – und was schreibe ich ihm möglicherweise lediglich zu?! Sind es vielleicht nur die in mir vorhandenen Bilder (Introjekte), die mir Angst einjagen und die ich auf andere Menschen zu projizieren bereit bin? Das führt uns zur zehnten und letzten These:
»Mana« entsteht interaktionell in Gruppen und eignet sich als konzeptueller Begriff zur Beschreibung der Wirkungsweise, Macht und Ausstrahlung von Tabus.
In den Kapiteln 13 und 15, »Keine Hunde in Alangouan« und »Es begann mit Adam und Eva«, werden Erwerb, Zuschreibung und Gebrauch von Mana ausführlich diskutiert.
In den vorgestellten zehn Thesen zum Tabu sind sehr unterschiedliche Aspekte thematisiert worden. Immer wieder aber geht es um den zentralen Punkt, den angedrohten Ausschluss aus der Gemeinschaft. Ein Tabubruch konnte in Stammesgesellschaften ohne äußere Gewaltanwendung zu einem psychogenen Tod führen (Schmid, 2000), vor allem aber drohte der Ausschluss aus dem Dorf, sofern nicht Reinigungsrituale das Unglück oder die Strafe abwendeten. Wer aber aus der sozialen Gemeinschaft eines Dorfes oder Stammes ausgesondert wurde, der war existenziell gefährdet. Da viele kleine Gemeinschaften das Böse und Feindselige, welche das Zusammenleben störten, nach draußen projizieren, leben außerhalb des Dorfes nicht nur die realen wilden Tiere, sondern auch die verschlingenden Dämonen als die Projektionen dieser eigenen Fantasien.
Wenn wir heutzutage ein Tabu brechen, droht die Familie, die Berufsgruppe, die gesellschaftliche Schicht etc. mit Ausschluss, mit Scheidung, Karriereknick, letztlich mit sozialer Isolierung. Ein solcher Ausschluss ist zumeist nicht mehr existenziell gefährdend für Leib und Leben, wird aber wegen der sozialen Auswirkungen doch gefürchtet. Tabus lassen sich auf diese Weise im eigenen Umfeld vergleichsweise leicht aufspüren. Vielleicht stellen Sie sich – bevor Sie weiterlesen – selbst die Tabu-Suchfrage: »Was müsste ich tun oder sagen – ohne ein Gesetz zu brechen –, um in meiner Ehe, Familie, Firma etc. ausgeschlossen, zumindest geschnitten zu werden?« Sie werden unweigerlich auf die Tabus Ihrer jeweiligen Bezugsgruppe stoßen.
2. Konkret Nigger und Judensau – oder: Was ist Political Correctness?
Wir können offen über alles sprechen. Es besteht Rede- und Diskussionsfreiheit. Bei strittigen Fragen kein Blatt vor den Mund zu nehmen, gilt sogar als Zeichen von Aufrichtigkeit und gegebenenfalls auch Führungsqualität.
Aber ist es wirklich so? Dürfen wir sagen, was wir wollen? Können wir es überall und zu jeder Zeit wagen, jeden beliebigen Begriff zu verwenden?
In den USA wird z. B. vom »N-word« gesprochen. Wer zum ersten Mal davon hört, wird allenfalls aus dem Zusammenhang folgern können, wofür hier mit allen Anzeichen bereitliegender Entrüstung eine Abkürzung verwendet wird. Es geht um den Begriff »Nigger«, der zum Unwort gestempelt und nicht ausgesprochen werden soll. Er gilt als entwertend, beleidigend, diskriminierend, rassistisch, kurzum: Er ist politisch nicht korrekt.
Der aus den USA stammende Begriff der »Political Correctness« hat uns ein zeitgenössisches Sprachtabu beschert, das neben Sprachreglementierungen auch Handlungsanweisungen umfasst. Was die einen als Sprachkosmetik schmähen, gilt anderen als wesentlicher Bestandteil für ein gelingendes Zusammenleben in unseren multikulturellen Gesellschaften. Unabhängig von der jeweils persönlichen Einstellung zur Political Correctness kann nicht bezweifelt werden, dass die Verletzung dieses modernen Sprachtabus zu sehr weitreichenden Folgen führen kann. Eine eindrucksvolle literarische Darstellung hierzu gibt der amerikanische Schriftsteller Philip Roth in seinem Roman »Der menschliche Makel«. Weit entfernt von einer rigiden Anwendung der Sprachregelungen an amerikanischen Universitäten schreibt er über Coleman Silk, Professor für Altphilologie an einer noblen Ostküsten-Universität und Hauptfigur seines Romans: »Gegen Ende des Zweiten Weltkriegs hatte Coleman Silk als Matrose in der Marinebasis Norfolk in Virginia gedient. Sein Name verriet nicht, dass er Jude war – es hätte genauso gut ein Negername sein können, und tatsächlich hatte man ihn einmal, in einem Bordell, für einen Nigger gehalten, der sich als Weißer ausgab, und in hohem Bogen hinausgeworfen. ›Aus einem Puff in Norfolk haben sie mich als Schwarzen rausgeschmissen, und aus dem Athena College haben sie mich als Weißen rausgeschmissen […] Man hat mich in Athena rausgeschmissen […], weil ich ein weißer Jude von der Sorte bin, die diese strohdummen Arschlöcher als Feind bezeichnen. Ich bin der, der an ihrem amerikanischen Elend Schuld ist. Der sie aus dem Paradies herausgeschafft hat. Und der sie die ganze Zeit unterdrückt hat. Wer trägt die meiste Verantwortung dafür, dass Schwarze auf diesem Planeten leiden? Sie wissen es, ohne ein einziges Mal an einem Seminar teilgenommen zu haben. Sie wissen es, ohne je ein Buch aufgeschlagen zu haben. Sie wissen, ohne zu lesen – sie wissen, ohne zu denken. Wer ist schuld? Dieselben bösen Monster aus dem Alten Testament, unter denen schon die Deutschen so zu leiden hatten« (Roth, 2002a, S. 25 f.).
Unterschiedliche Identitäts- und Schuldzuschreibungen sind ein zentrales Thema des Bestsellers, der seinen Ausgang von der unbedachten Verwendung eines einzelnen Wortes nimmt. In seinem Seminar mit vierzehn Teilnehmern verliest Professor Silk jeweils zu Beginn der Sitzung die Namen der Angemeldeten, um sich die Gesichter seiner Studenten einzuprägen. Fünf Wochen lang bekommt er auf zwei Namen keine bestätigende Antwort, so dass er zu Beginn der sechsten Seminarstunde die Frage stellt: »Kennt jemand diese Leute? Hat sie schon mal jemand im College gesehen, oder sind es dunkle Gestalten, die das Seminarlicht scheuen?« (S. 15).3
Noch am selben Tag wird Coleman Silk in das Büro des Dekans gebeten und mit dem Vorwurf des Rassismus konfrontiert: Bei den abwesenden Studenten hatte es sich um Schwarze gehandelt.
In der amerikanischen Originalausgabe des Romans wird nicht von »dunklen Gestalten« gesprochen, sondern von »Spooks«. Wie der Übersetzer Dirk van Gunsteren schreibt, bedeutet Spook: »1. Gespenst, 2. (im amerikanischen Slang) Spion, besonders CIA-Agent. Bis in die fünfziger Jahre war es jedoch darüber hinaus eine abfällige Bezeichnung für einen Schwarzen (und übrigens, von einem Schwarzen gebraucht, auch eine abfällige Bezeichnung für einen Weißen). Da es im Deutschen kein Wort gibt, dass etwas Abwesendes, Unsichtbares bezeichnet und zugleich eine untergründige, vom Sprecher womöglich gar nicht intendierte Herabsetzung eines Schwarzen beinhaltet, habe ich Spooks, um wenigstens das Moment der unbeabsichtigten, rassistischen Verunglimpfung zu bewahren, mit ›dunkle Gestalten, die das Seminarlicht scheuen‹ übersetzt.«4
Die »Spooks« geraten für Coleman Silk zum veritablen Spuk. Er verliert seine Stellung und seine Reputation. Dabei hat der Autor des Romans seinem Protagonisten noch nicht einmal das in den USA kaum aussprechbare »N-word« in den Mund gelegt: »Jeder mit Ambitionen auf einen hohen öffentlichen Posten sollte sich von jeglicher Verwendung des Begriffs ›Nigger‹ zurückhalten, egal in welcher seiner unterschiedlichen Bedeutungen er es gebraucht, denn das ›N-Wort‹ verletzt viele Menschen tief. Politische Klugheit rät uns zu strikter Vermeidung. Wir wissen heute, dass ein Mann Präsident der Vereinigten Staaten werden kann, selbst wenn man gehört hat, dass er jemanden als ein Arschloch beschimpft, aber derselbe Mann kann sich eines Mitarbeiters nicht sicher sein, der einen anderen als Nigger beschimpft: Zu viele Wähler betrachten solch ein Verhalten als äußerst disqualifizierend.« So schreibt Randall Kennedy in seinem in den USA kontrovers diskutierten Buch »Nigger – The Strange Career of a Troublesome Word« (2002, S. 172 f.). Am Beispiel der Verwendung – oder besser gesagt: Vermeidung – eines einzigen, historisch durch Sklaverei und Diskriminierungen belasteten Wortes zeigt Kennedy die verschiedenen Facetten der Political Correctness. Ohne Zweifel handelt es sich bei der Political Correctness um das moderne Sprachtabu schlechthin. Einzelne Worte werden aus dem Sprachgebrauch ausgeklammert (Meidungsgebot). Werden sie trotzdem verwendet, droht dem Sprecher der Ausschluss aus seiner beruflichen und/oder sozialen Gruppe. Dass dies keinesfalls nur ein Romanthema, sondern ein höchst aktuelles gesellschaftspolitisches Thema ist, lässt sich fast täglich an neuen Beispielen feststellen.
Auch in Deutschland sind die Auswirkungen dieser Auseinandersetzungen in einer abgeschwächten Form festzustellen. Kein »Nickneger« sammelt mehr Cents für arme Negerkinder in katholischen Kirchen, »Mohrenköpfe« und »Negerküsse« sind aus den Cafés verschwunden. Es besteht eine erhöhte Sensibilität für Diskriminierungen von Schwarzafrikanern, wie sie nicht nur in Worten, sondern auch in unzähligen Objekten zum Ausdruck kam (Abb. 1). Das Spektrum der Darstellungen reicht vom allseits bekannten, eher liebenswert porträtierten Sarotti-Mohren über Aschenbecher in Form eines Mohrenkopfes, »Onkel Tom« als Salzstreuer bis zu Korkenziehern mit unzweideutigen sexuellen Anspielungen (Abb. 2). Flohmärkte sind eine Fundgrube für diese keineswegs von allen als witzig betrachteten Objekte. Ihnen allen ist gemeinsam, dass sie Schwarze in dienender Funktion, z. B. als Nickneger und Salzstreuer, zeigen. Oft aber wird eine darüber hinausgehende offen diskriminierende und entwertende Absicht verfolgt. Wie anders sollte man z. B. den immer wieder anzutreffenden gutmütig grinsenden Gesichtsausdruck dieser Figuren werten, der weit eher als dümmlich denn etwa als freundlich zu bezeichnen ist?
Abbildung 1: Zwei »Negerbüsten« als Aschenbecher (Mitte des 20. Jahrhunderts)
Abbildung 2: »Neger« als Korkenzieher (Mitte des 20. Jahrhunderts)
Das Besondere der Darstellung von Sarotti-Mohren, Nicknegern, Aschenbechern etc. lässt sich durch eine Gegenüberstellung herausarbeiten. Es gibt nämlich nicht nur eine breite Palette von Darstellungen Schwarzer durch Weiße (vgl. Levinthal, 1999), es gibt ebenso die Darstellung von Weißen durch schwarzafrikanische Schnitzer. Keineswegs selten wurden Kolonialbeamte und andere Weiße von den einheimischen Künstlern im jeweiligen Stammesstil dargestellt. Unter Sammlern afrikanischer Kunst bilden diese sogenannten »Colon-Figuren« (Jahn, 1983) als ein fremder Blick auf uns Weiße ein eigenes Sammelgebiet. Vergleichen wir diese Colon-Figuren untereinander, so können wir recht bald auffällige Gemeinsamkeiten feststellen, die sie von unseren Darstellungen der Angehörigen der fremden Kultur deutlich unterscheiden. Sehr häufig sind die geschnitzten Personen mit Waffen oder anderen Insignien der Macht und des Wohlstands ausgezeichnet. Sie tragen Helme, Polizeiuniformen und Armbanduhren. Trotz ihrer oft nur geringen Größe stellen sie offensichtlich machtvolle, geachtete und gefürchtete Personen dar – karikierende Darstellungen sind nicht unbekannt, aber selten.
Political Correctness
Wie kam es zur Etablierung dieses Tabus in den Vereinigten Staaten und von dort aus in der gesamten westlichen Welt? (gute Übersicht bei Schenz, 1994; Ravitch, 2003). Während über den Ursprung dieses Begriffs Unklarheit herrscht, stimmen die meisten Autoren darin überein, dass er in den sechziger Jahren im Zuge der Reform- und Bürgerrechtsbewegung in den USA entstanden ist. Seine Wurzeln reichen aber sehr viel weiter zurück und werden letztlich mit dem Weltverbesserungsdrang und dem Perfektionismus der puritanischen Einwanderer in Verbindung gebracht. Für manche Autoren führt ein gerader Weg vom Puritanismus über die großen Erweckungsbewegungen, die Prohibition und die Anti-Raucher-Kampagnen bis hin zur Political Correctness.
Der Begriff umfasst nicht nur eine Sprachreglementierung wie die Vermeidung rassistischer und sexistischer Ausdrücke. Es geht auch um die Förderung von Multikulturalismus, um Quotenregelungen sowie um die Diskussion des literarischen Canons von Schul- und Universitätscurricula. Im Kern dreht es sich um einen Kampf gegen Vorurteile und Diskriminierungen durch die Entwicklung einer »richtigen« Einstellung. Es wird der Anspruch erhoben, das Kränkungspotenzial zu vermeiden, das in vielen Begriffen enthalten ist. Deshalb sollen alle Handlungen und Ausdrucksweisen gemieden werden, welche Personen aufgrund ihrer Rasse, ihres Geschlechts, ihrer Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Schicht, ihrer körperlichen oder geistigen Behinderung oder ihrer sexuellen Neigungen diskriminieren. In diesem Zusammenhang wird auch der Eurozentrismus mit seinen fest gefügten Bewertungsmaßstäben kultureller und wirtschaftlicher Leistungen kritisiert und eine Erweiterung von Lehrinhalten um nichtwestliche Themen gefordert. Ist z. B. das von den westlichen Industrienationen herausgestellte Bruttosozialprodukt wirklich ein Gradmesser für die Wirtschaftskraft eines Landes, wenn – bei ähnlichen Zahlenwerten – in dem einen Entwicklungsland Unterernährung der Bevölkerung zur Tagesordnung gehört, im anderen Land jedoch nicht?
Während die einen in der Political Correctness die einzige Möglichkeit für eine friedliche Koexistenz in unseren zunehmend multikulturellen Gesellschaften sehen, meinen andere darin eine verlogene Ideologie zu erkennen, die durch eine unerträgliche dogmatische Bevormundung den Menschen und sein Denken einengt. Die Political Correctness sei, so heißt es, auf dem Weg zur multikulturellen Toleranz Eiferern und Fanatikern in die Hände gefallen. Eine ebenso amüsante wie doch auch erschreckende Übersicht hierzu gibt Diane Ravitch am Beispiel von Schulbüchern in ihrem Buch »The Language Police« (2003; vgl. Arnim, 1994; Schenz, 1994, S. 136ff.). Als frühere Mitarbeiterin der US-Schulbehörde beschreibt sie den Druck verschiedener politischer und gesellschaftlicher Gruppen auf den Inhalt der Schulbücher in den USA und macht darüber hinaus auch konkrete Gegenvorschläge. Dieser Druck führt zur Selbstzensur der Schulbuchverlage, die ihre Bücher nicht dem Vorwurf der Diskriminierung bestimmter Gruppen aussetzen wollen. So verschwinden hilflose alte Menschen aus den Schulbüchern und werden zu joggenden und Dachrinnen reparierenden fitten Senioren. Geschichten aus den Bergen verschwinden, weil sie Kinder, die weder dort leben noch im Urlaub dorthin reisen, diskriminieren könnten. Eulen dürfen in den Kindergeschichten nicht vorkommen, weil sie für die Navajos, die keine »Indianer«, sondern »native Americans« sind, heilige Tiere darstellen. Harry Potter schließlich ist selbst als Romanheld für die US-Schulbuchfabrikanten vollends des Teufels – nicht nur wegen seiner Vorliebe für Eulen, sondern vor allem wegen seiner Zauberkünste, die die Gefühle gläubiger Christen verletzen könnten.
Die Political Correctness hat tatsächlich nicht nur Konsequenzen für politische Debatten, sondern sie hat ganz konkret – wie im Roman »Der menschliche Makel« zutreffend beschrieben wird – an manchen Hochschulen zum Rücktritt von Professoren und zum Absetzen von Lehrveranstaltungen geführt. Kritiker sprechen von Zensur und Einschüchterung. Nicht die freie, ungezügelte Debatte, in deren Zentrum das Argument und seine Verteidigung stehe, sondern die Mobilisierung und Macht bestimmter sozialer und ethnischer Gruppen beherrschten das Feld. Diese Gruppen würden sich zu Opfern (»Victim Groups«) stilisieren, denen von vornherein Glaubwürdigkeit zuerkannt werde. Charles F. Sykes, der diesem Kampf um den Opferstatus ein ganzes Buch gewidmet hat (1992), bemerkt süffisant, dass die Konkurrenz um den Opferstatus groß sei und alle Gruppen, die sich für unterdrückte Minderheiten hielten, zusammen 374 % der Bevölkerung ausmachen würden.
Inzwischen hat die Political Correctness in vielen Bereichen eine breite Akzeptanz gefunden. Statt eines als abwertend empfundenen – und oft so gemeinten – Begriffes wie »Krüppel« werden Ausdrücke wie »Mensch mit Behinderung« verwendet. Darüber hinaus werden manche Begriffe in ein positives Assoziationsfeld verschoben, indem z. B. von »anders begabten Menschen« oder »mental herausgeforderten Menschen« gesprochen wird. Nicht nur in der englischen Sprache hat sich der Begriff »challenged« (herausgefordert) für »handicapped« (behindert) inzwischen durchgesetzt. Aus »Lernbehinderten« wurden in Deutschland inzwischen »Lernhilfeschüler« oder »Förderschüler«, aus »Behinderteneingängen« wurden »barrierefreie Zufahrten«.
Kritisch wird angemerkt, dass eine reine »Sprachkosmetik« wenig bis gar nichts nutzt, wenn den schönen Worten nicht Taten folgen. Eine Vermeidung des Schimpfwortes »Nigger« ist noch längst nicht gleichzusetzen mit der Integration und Wertschätzung schwarzer Mitbürger. Das Ersetzen des »N-Wortes« durch immer neue Begriffe von »negro« über »black people« und »coloured people« bis zu »Afro-Americans« zeigt eher das anhaltende Problem als den Lösungsweg.5
Für das »N-word« besteht auch in Deutschland schon eine größere Sensibilität. Neger, Schwarzer, Farbiger sind Begriffe, die oft mit einem Zweifel in der Stimme, ob man wohl die richtige Bezeichnung gewählt habe, ausgesprochen werden. Ein wirklich tiefgreifendes Gefühl für die Brisanz des Begriffs »Spook« oder gar »Nigger« wird sich bei einem deutschen Leser jedoch kaum einstellen, und der oft sehr freie Umgang von Philip Roth mit den verschiedenen Begriffen in seinem Roman wird einen deutschen Leser nicht so sehr berühren wie einen Leser in den USA. Und kaum ein deutscher Kritiker käme auf die Idee, nachzuzählen, wie oft Mark Twain in seinem berühmten Buch »Huckleberry Finn« das Wort »Nigger« verwendet hat: Es sind 215 Mal (Kennedy, 2002, S. 137 f.). Tabus sind, so lehrt uns dieses Beispiel, stets und vor allem auf eine bestimmte gesellschaftliche oder ethnische Gruppe bezogen.
Judensau
Welchem Begriff aber käme in Deutschland eine ähnliche gesellschaftspolitische Brisanz zu wie dem »N-word« in den USA?
Seit der Zeit der Weimarer Republik ist der Begriff »Judensau« im öffentlichen Bewusstsein präsent. Die antisemitische Hetzparole »Knallt ab den Walther Rathenau – die gottverfluchte Judensau« (vgl. z. B. Blumenthal, 2002, S. 142 f.) wurde am 24. Juni 1922 mit dem Mord an dem Politiker traurige Wirklichkeit. Der 1867 geborene Walther Rathenau war einer der offiziellen Repräsentanten der Weimarer Republik. Als Außenminister und Wirtschaftsexperte war Rathenau ein von der nationalistischen und antisemitischen Propaganda lautstark geschmähter Politiker. Zwar erreichte er im Jahre 1922 eine Herabsetzung der Reparationszahlungen an die Siegermächte des Ersten Weltkriegs, galt aber trotzdem als »Erfüllungspolitiker« dieser politisch umkämpften Zahlungen.
Antisemitische Karikaturen, Hetz- und Diffamierungskampagnen erfuhren bis hin zum Holocaust eine stete Steigerung. Weniger oder sogar kaum bekannt hingegen ist die christliche Vorgeschichte der Judensau. Ab dem 13. Jahrhundert finden sich in christlichen Kirchen vor allem in Deutschland (z. B. Brandenburger Dom, Marienkirche in Lemgo, Xantener Dom, Magdeburger Dom), vereinzelt aber auch in Polen, Belgien, Frankreich und Schweden Darstellungen von Schweinen, an denen Juden saugen6 (Abb. 3 und 4). In seiner Schrift »Vom Schem Hamphoras« schreibt Martin Luther über die Judensau zu Wittenberg: »Es ist hier zu Wittenberg an unserer Pfarrkirche eine Sau in Stein gehauen, da liegen junge Ferkel und Juden unter, die saugen. Hinter der Sau steht ein Rabbiner, der hebt der Sau das rechte Bein empor, und mit seiner linken Hand zeucht er den Pirtzel über sich, bückt und kuckt mit großem Fleiß der Sau unter den Pirtzel in den Talmud hinein, als wollt er etwas Scharfes und Sonderliches lesen und ersehen.«7 Die Tradition, dass Juden gemäß der Kaschrut (Speisegesetze) die Berührung mit dem Schwein als unreinem Tier und gar den Genuss von Schweinefleisch als Gräuel und Sakrileg empfinden, wurde zynisch ausgebeutet. So wurden z. B. Juden im Mittelalter immer wieder einmal gezwungen, Schweinefleisch zu essen oder barfuß auf der blutigen Haut eines Schweines stehend, einen Eid zu leisten (sog. »Judeneid«). In diesen diskriminierenden, entehrenden Zusammenhang ist auch das Sc 9783525717523_Umschlag_Litora_Begleitgrammatik handbild der »Judensau« und später das entsprechende Schimpf- und Schmähwort einzureihen (vgl. hierzu Lenzen, 2002, S. 88ff.).
Abbildung 3: Darstellung einer »Judensau« an der Stadtkirche St. Marien in Wittenberg
Abbildung 4: Bodenplatte als Mahnmal unterhalb der sog. »Judensau« in Wittenberg
Von Darstellungen an Säulenkapitellen (z. B. in Wittenberg) über Schnitzwerke am Chorgestühl (z. B. Kölner Dom) bis zu Flugblättern und Buchillustrationen (Abb. 5) reichen die Darstellungen von Juden, die das Schwein küssen, an seinen Zitzen saugen, es umarmen, sich am Gesäß und an den Geschlechtsteilen zu schaffen machen und schließlich auch seinen Kot essen und seinen Urin trinken (Shachar, 1974, S. 66). Erst gegen Ende des 18. Jahrhunderts/Anfang des 19. Jahrhunderts verschwinden die bildlichen Darstellungen. Mitte des 19. Jahrhunderts tauchen nur noch vereinzelte Karikaturen auf. Die spätmittelalterliche, bildhaft-drastische Schmähung der Juden, die zutreffend als »christliche Sauerei« bezeichnet werden kann, dürfte ab Mitte des 19. Jahrhunderts doch zu direkt, zu plakativ und für ein aufgeklärtes Bürgertum letztlich schlichtweg unglaubwürdig geworden sein. Damit verschwand die »Judensau« aber nicht, sondern fand als Schimpfwort (auch als »Saujud«) Verwendung, wie das auf Walther Rathenau bezogene Zitat ausweist. In der Zeit des Nationalsozialismus wurde der Begriff zusätzlich auf Deutsche ausgedehnt, die eine Liebesbeziehung zu einem jüdischen Mitbürger eingingen. Als »Rassenschänderin« wurde z. B. eine Frau bloßgestellt mit einem Schild um den Hals: »Ich bin am Ort das größte Schwein und lass mich nur mit Juden ein« (Abb. in Hirsch u. Schuder, 1999, S. 619).
Abbildung 5: »Judensau«, Kupferstich aus Johann Wolf: Lectiones Memorabiles et Reconditae (Frankfurt 1672)
Was aber macht die Brisanz dieses Begriffs heute aus? Anders gefragt: Hat der Begriff »Judensau« oder »Saujud« überhaupt noch eine Brisanz?
Weder als bildnerische Darstellung noch als Schimpfwort kann die Judensau heute Aktualität für sich beanspruchen. Dies ist ein Verdienst der politischen Entwicklung in Deutschland nach dem Ende des Naziregimes. Auch ohne den Begriff der Political Correctness haben sich eine hohe Sensibilität und ein Meidungsgebot für diesen und andere antisemitische Äußerungen ausgebildet. Antisemitismus selbst ist zu einem Tabu geworden. Wer sich in der Öffentlichkeit antisemitischer Äußerungen oder auch nur antisemitischer Absichten verdächtig macht, muss mit massiven öffentlichen Reaktionen rechnen.8 Für die positive Wirkung einer politisch korrekten Einstellung stehen das Antisemitismustabu im Allgemeinen und die Judensau im Speziellen. An diesen Beispielen wird deutlich, dass Tabus nicht statisch, festgefügt und unveränderbar sind. Sofern ein Tabu wirksam bleiben soll, bedarf es einer hohen gesellschaftlichen Wachsamkeit und Gegenwehr bei Tabuverletzungen.
Aus psychologischer Sicht kann man Rassismus allgemein und Antisemitismus im Besonderen als massenpsychologischen Mechanismus der »Selbstentgiftung« begreifen: Das eigene Schlechte wird auf die anderen, die Fremden, projiziert, ebenso aber auch das, was man selbst nicht hat und neidvoll nun den anderen zuschreibt (z. B. sexuelle Potenz, Macht). Diese Tendenz besteht – mehr oder weniger stark ausgeprägt – in allen Menschen und allen Gesellschaften. Sie kann nicht zum Verschwinden gebracht werden. Somit geht es um einen stets wachsamen und politisch verantwortungsvollen Umgang mit dieser Tendenz.
Recherche, Widerstand und Wandel
Die vielfältigen, oft subtilen Verflechtungen und Auswirkungen einer Tabuisierung sollen abschließend nicht theoretisch, sondern ganz konkret am Gang der Recherche zu diesem Kapitel beleuchtet werden. Nachdem ich mich entschieden hatte, Political Correctness als modernes Sprachtabu zu analysieren, stand mir zunächst »Nigger« als Schimpfwort vor Augen. Erst durch einen Hinweis im Kölner Stadt-Anzeiger zur Darstellung einer »Judensau« im Chorgestühl des Kölner Doms (o. A. d. V., 2002c) stieß ich im Jahre 2002 auf die mir zuvor unbekannte bildnerische Darstellung. Als ich dieses Bildthema seinerzeit mit dem Besitzer einer großen, breit angelegten privaten Bibliothek diskutierte, sagte er mir zu, nach entsprechender Literatur zu forschen. Das Gleiche versprachen ein von mir häufig um Rat und Hilfe gefragter kenntnisreicher Antiquar und eine Kunstwissenschaftlerin. Bis auf ein paar knappe Hinweise im »Lexikon christlicher Ikonographie« und einen Ausspruch (»Bin kein Jud’, leck’ keine Sau«) im deutschen Sprichwörter-Lexikon9 blieb das Ergebnis dieser ersten Recherche ungewöhnlich karg. Einer der Gefragten behauptete nun sogar, dass es sich ausschließlich um ein Schimpfwort handele.
Die Recherche im Internet im Jahre 2003 (!) war auf Anhieb erfolgreicher und ergab, je nach Suchmaschine, zwischen 213 und 720 Eintragungen. Dabei bot die Suchmaschine Google bei jeder meiner Durchforstungen des umfassenden Angebots an: »Meinten Sie: Judenau?« Trotz baldiger Ermüdungserscheinungen bei der Durchsicht endlos langer Listen stieß ich schnell auf den eindrucksvollen Kupferstich aus Johann Jacob Schudts »Jüdischen Merkwürdigkeiten« (Frankfurt 1714), der über die Homepage des Jüdischen Museums in Frankfurt ins Internet gestellt worden war. Sollte ich im Jüdischen Museum anrufen und um weitere Auskünfte bitten? Wie würde man reagieren? Sollte ich lieber einen Brief schreiben und mein Anliegen ausführlich darlegen? Ich verspürte ein deutliches Unbehagen bei diesen Überlegungen und verschob die Anfrage auf ein späteres Datum.
Ich wurde mir immer mehr bewusst, dass ich mich in einem tabuisierten Bereich bewegte. In Gesprächen in Buchläden und Antiquariaten wurde von meinen Gesprächspartnern der Begriff entweder gemieden, oder es wurde zumindest die Stimme gesenkt. Die Mitarbeiterin eines Antiquariats, das ich mit der Besorgung von Literatur und Drucken zu diesem Thema beauftragt hatte, empfing mich in den Geschäftsräumen im Beisein anderer Kunden mit dem Satz: »Zu Ihren kleinen Tierchen haben wir übrigens noch nichts gefunden.« Sie fand auch später nichts.