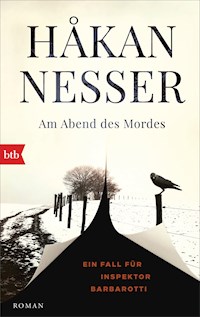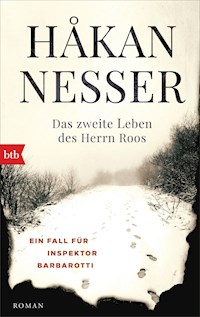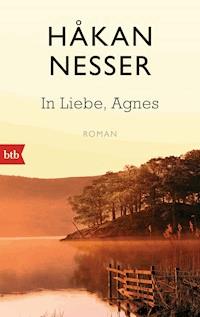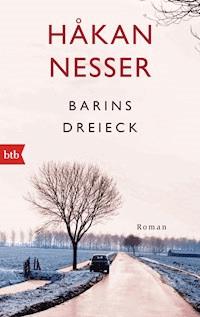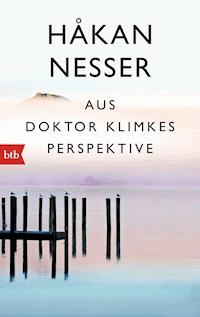9,99 €
Mehr erfahren.
Ist Viktor Vinblad tatsächlich ein Mörder? Oder hat man ihm vor Jahren Unrecht getan, als seine Jugendliebe ermordet wurde und er selbst danach spurlos verschwand? Ist er etwa selbst einem Verbrechen zum Opfer gefallen? Nach Jahrzehnten des Schweigens und der Verdrängung versucht sein Pflegebruder David, dem Geheimnis auf die Spur zu kommen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 510
Ähnliche
Håkan Nesser
Die Schatten und der Regen
Roman
Aus dem Schwedischen von Christel Hildebrandt
Copyright
Die schwedische Originalausgabe erschien 2004 unter dem Titel »Skuggorna och regnet« bei Albert Bonniers Förlag, Stockholm.
PeP eBooks erscheinen in der Verlagsgruppe Random House
Copyright © 2004 by Håkan Nesser
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2005 by btb Verlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH
Umschlaggestaltung: semper smile, München Umschlagmotiv: © plainpicture/mia takahara
ISBN 978-3-89480-888-4
www.pep-ebooks.de
Inhaltsverzeichnis
DAVID123 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 JOHN SORROW 1 2 DAVID 1 2 Über das Buch Über den Autor Copyright
DAVID
1
Ich verließ Uppsala und meine Familie gegen halb vier an einem Nachmittag im September. Ich hätte es vielleicht nicht getan, wenn da nicht der Brief meiner Schwester gewesen wäre. Aber zwei billige Gründe wiegen mindestens doppelt so schwer wie einer.
Es war ein sonniger Tag nach einem der schönsten Sommer seit Menschengedenken; als ich mit meiner Reisetasche über den Markt ging, sah ich, dass die Leute immer noch in kurzen Hosen herumliefen.
Der 15. September. Ein Montag. Ich war gerade dreiundfünfzig Jahre alt geworden, auf dem Weg zum Bahnhof machte ich einen kurzen Abstecher in den Systembolaget und kaufte mir eine kleine Flasche Grant’s. Es gehört nicht zu meinen Gewohnheiten, Whisky zu trinken, aber es gab eine Stimme in mir, die sagte, dass ich eine Art Sicherheitsnetz bräuchte.
Ich habe schon immer auf meine innere Stimme gehört.
Draußen auf dem Bürgersteig stieß ich auf Henry Unger.
»Herzlichen Glückwunsch«, sagte er. »Ich habe gehört, dass du unterrichtsfreie Zeit bewilligt bekommen hast.«
»Schönes Wetter«, erwiderte ich. »Sicher an die fünfundzwanzig Grad, oder was meinst du?«
»Ich verstehe«, sagte Henry. »Du willst nicht darüber reden. Gehst du auf Reisen?«
Er deutete auf meine Tasche. Ich nickte. Registrierte, dass er ein Pflaster am Hals hatte, schräg unter dem rechten Ohr, und fragte mich, ob er vielleicht wieder mit irgendeinem Liebhaber Streit gehabt hatte. Henry war auf seine alten Tage homosexuell geworden, hatte aber bis jetzt noch nicht die richtige Harmonie und Sicherheit in seinem Liebesleben gefunden.
Aber vielleicht ist es auch gar nicht das, was er will, dachte ich, als ich ihn in den Bus steigen sah, der in die Vororte fuhr. Lieber ein wenig Blut und Feuer und die Erinnerung daran, dass man immer noch am Leben ist. Ich kann nicht leugnen, dass ich ihn in dieser Hinsicht verstehe.
Ansonsten trafen seine Vermutungen ins Schwarze. Sowohl, dass ich unterrichtsfreie Zeit bewilligt bekommen hatte, als auch, dass ich nicht darüber sprechen wollte.
Das lag natürlich in der Natur der Sache. Die zehn so genannten Freistellungen waren von unseren vorausschauenden Kommunalpolitikern vor einigen Jahren eingerichtet worden, doch ihre genaue Zielrichtung lag ein wenig im Dunkeln. Aus pädagogischen, aber auch praktischen Gründen. Die Formulierungen waren alles in allem vage gehalten – aller Wahrscheinlichkeit nach, um den geschätzten Betroffenen die Möglichkeit zu geben, von Fall zu Fall zu entscheiden.
Sich zu bewerben, war auf jeden Fall allen freigestellt, die seit mindestens zehn Jahren als Lehrer in der Kommune arbeiteten, man behielt sein Gehalt und brauchte nicht zu unterrichten oder auch nur an irgendeiner Form von schulischer Arbeit teilzunehmen. Aber höchstens ein Jahr lang, so lautete die Abmachung. Das Ganze konnte sowohl als eine Art Belohnung nach langen treuen Diensten gesehen werden – ein freies Jahr in der Mitte des Lebens – als auch als eine Möglichkeit, einem müden, ausgebrannten Pädagogen die Möglichkeit zu geben, wieder zu Kräften zu kommen. Nach Ansicht einiger Leute gab die Freistellung Schulleitern auch die Möglichkeit – zumindest zeitweise –, hoffnungslose Lehrer loszuwerden. Solche, von denen es immer dreizehn in jedem Dutzend gibt und die mehr Schaden anrichten als Nutzen bringen.
Aus welchem Grund genau ich meinen Antrag im März eingereicht hatte – und aus welchem Grund ich einer der Auserwählten unter Hunderten von Bewerbern wurde: das war nichts, worüber ich weiter nachzudenken gedachte. Nicht einmal abwägen wollte ich es, jedenfalls nicht an so einem Tag, aber auf jeden Fall kannte ich Henry Unger lange genug, um zu wissen, dass er es nicht böse meinte.
Sicher hatte er auch sein Päckchen zu tragen. Pflaster am Hals und was es da sonst noch so gab. Das war kein Tag, um sich tiefer in diese Dinge zu vergraben.
Ich schaute auf die Uhr. Mein Zug sollte in zwanzig Minuten fahren. Ich packte meine Tasche und ging weiter in Richtung Bahnhof.
Meine Ehefrau heißt Liv.
Sie ist vierzehn Jahre jünger als ich, wir leben seit acht Jahren zusammen und haben insgesamt drei Kinder. Ich bin für zwei zuständig, einen Sohn und eine Tochter, die ich während meiner ersten Ehe mit einer Frau namens Lois bekam. Alle drei sind aus meinem Leben verschwunden. Liv hat eine Tochter von vierzehn Jahren, die jede zweite Woche bei uns wohnt.
Wohnte. Ich vergesse bereits, dass ich sie verlassen habe. Liv und Linnea. Ich schreibe das hier im Zug, vermutlich haben sie noch gar nicht gemerkt, dass ich fortgegangen bin. Linnea ist bei ihrem Vater, da es eine gerade Woche ist, und ihre Mutter hat Abendschicht in der Bibliothek, wie an jedem Montag.
Nun ja, zur rechten Zeit wird es allen Beteiligten klar werden. Ich gehe auf die Toilette, pinkele und trinke einen Schluck Whisky. Setze meinen Weg fort zum Speisewagen. Wie immer bin ich voller Unruhe, aber sie hat schärfere Konturen heute, was natürlich nicht besonders verwunderlich ist.
Obwohl natürlich auch die Umgebung irgendwie frischer und schärfer wird, wenn man eine entscheidende Veränderung dieser Art beschlossen hat. Ich spüre es an den Menschen um mich herum. An den Gesprächen, denen ich mit halbem Ohr lausche, und an den Überschriften der Zeitungen. Ich merke, dass ich bereit bin, mich auf die Welt und ihre Aktionen einzulassen, plötzlich sind Dinge und Sachen wieder wichtig, und der vorsichtige Blick, den mir die große, blonde Frau schenkt, die mir direkt gegenüber sitzt, könnte sicherlich eine Öffnung hin zu ganz neuen Spielplänen bedeuten, das ist deutlich zu spüren.
Aber mir ist klar, dass ich langsam vorgehen muss. Natürlich ist es Marias Brief, der die nächste Zeit, die nächsten Tage bestimmen wird. Ich weiß nicht, was mit ihr los ist. Ich war seit Vaters Beerdigung vor dreizehn Jahren nicht mehr zu Hause, und wenn das wirklich stimmt, was sie behauptet, so will ich mich nicht ablenken lassen. Von nichts, es wird Zeit und Kraft kosten, sie hat mir zugesagt, dass ich in meinem alten Zimmer unterm Dach wohnen kann, genau wie früher, und mit einem pervertierten Teil meines unterstimulierten Gehirns freue ich mich direkt darauf.
Ich trinke meinen Kaffee aus und kehre an meinen Platz zurück. Lese einige nicht besonders interessante Seiten in Klimkes Betrachtungen und falle bald in den Schlaf.
Ich träume von meiner Geliebten Sofia. Das habe ich seit Juni immer mal wieder getan, seit sie mir erklärt hat, dass sie schwanger ist, und ich Schluss mit ihr machte.
Ich träume davon, wie wir ab und zu miteinander schliefen, von ihrem Klammergriff um meine Hüften und ihrem Muttermal unter dem linken Schulterblatt. Es ist ungefähr so groß wie eine Handfläche und zeigt detailliert eine Karte von Island. Natürlich ohne Orte, Straßen und Wasserläufe, aber mit so deutlich gezeichneter Küstenlinie, inklusive Buchten und Landzungen, dass einem klar wird, dass Gott tatsächlich mit Landkarte und Millimeterpapier dagesessen haben muss, als er Maß nahm für Sofia und ihre Details. Ich habe es mit Paulsson-Forsbergs Schulatlas verglichen, ich weiß, wovon ich rede.
Sofia Ilmari Jonsson. Wir begegneten uns vor drei Jahren in einer Kneipe in München, stellten fest, dass wir im gleichen Land und gleichen Ort lebten, und betranken uns nach und nach. Wir beschlossen ziemlich schnell, dass wir einander nur zur Freude und zum Zeitvertreib dienen wollten, niemals zusammen leben und keine Kinder in die Welt setzen wollten.
Folglich habe ich Sofias Existenz meiner Ehefrau gegenüber mit keinem Wort erwähnt. Es hat keinen Anlass dazu gegeben, und als Sofia mich dann im Juni in Ofvandahls Café treffen wollte, ahnte ich bereits Böses, wie ich sie da mit einem ganz neuen Ernst im Blick sitzen sah.
Ich bekomme ein Kind, sagte sie und löffelte den Schaum von ihrem Cappuccino, wie sie es immer tat.
Die meisten Frauen hören auf, Kaffee zu trinken, wenn es so um sie steht, erwiderte ich.
Ich nicht, erklärte Sofia. Ich bin nicht wie die anderen Frauen.
Wie weit bist du?, fragte ich.
In der achten Woche, antwortete sie.
Ich dachte eine Weile nach, dann erklärte ich, dass sie unsere Vereinbarung gebrochen habe und dass es mir in Anbetracht dessen nicht möglich sei, unsere Beziehung weiter fortzuführen.
Sie saß da, rührte einige Sekunden lang mit dem Löffel in ihrem Kaffee herum, dann schaute sie mich mit funkelnden Augen an und bat mich, zur Hölle zu fahren.
Ich spürte, dass wir uns nichts weiter zu sagen hatten, betrachtete meinen unberührten Kaffee und verließ sie.
Genau von dieser Episode träume ich, sowohl jetzt im Zug als auch schon früher im Laufe des Sommers, hin und wieder, und im Traum stolpere ich jedes Mal in der Tür auf dem Weg hinaus. Ich trete schräg auf die Türschwelle, falle kopfüber die kurze Treppe hinunter, die es in Ofvandahls realer Welt nicht gibt, nur in der des Traumes, und lande auf dem Bürgersteig. Der ist nass und schmutzig und voll mit Hundescheiße und einer Art kurzer, fetter Würmer, die vielleicht Leichenmaden sind, wobei ich nie Leichenmaden gesehen habe und mir nicht sicher bin, ob man eigentlich einen Gegenstand träumen kann, auf den man im wachen Zustand noch nie gestoßen ist. Doch, das kann man natürlich. Aber sind es nicht eigentlich Larven, Fliegenlarven?
In Wirklichkeit bin ich niemals gefallen. Ich trat problemlos hinaus in den Regen, spannte meinen Regenschirm auf und schaute nicht zurück.
Irgendwo hinter Gävle halten wir. Über Lautsprecher wird mitgeteilt, dass an der Lok ein technischer Defekt eingetreten ist, wir aber weiterfahren werden, sobald der Fehler behoben sein wird.
Ich schaue aus dem Fenster. Eine frühe Dämmerung will sich über das Land legen. Rechts haben wir Nadelwald mit Birkeneinschlag, links haben wir Nadelwald mit Birkeneinschlag. Nach einer halben Stunde kommt ein Schaffner vorbei, und ich frage ihn, wie es steht. Er erklärt mir, dass es wohl noch so fünfundvierzig Minuten dauern wird, allerhöchstens eine Stunde.
Ich frage, wie es mit meinem Anschlussbus in Y. aussieht. Er zieht einen Block aus der Brusttasche und studiert ihn eine ganze Weile. Blättert hin und her, wobei er schwer atmet und besorgt blickt. Er ist ein wenig übergewichtig und hat offensichtlich zu hohen Blutdruck, eine Einschätzung, die ich auf Grund seiner Gesichtsfarbe und seiner leicht hervorstehenden Augen treffe. Dann stopft er seinen Block wieder in die Tasche und sagt, dass es nicht klappen wird, leider, leider. Es sind verschiedene Gesellschaften, die die unterschiedlichen Linien betreiben, und man stehe nicht in der Pflicht, auf verspätete Züge zu warten.
Ich bedanke mich für die Information und lege den Klimke weg. Denke, dass es dann wohl ein Hotel in Y. werden wird, und versuche Maria mit dem Handy zu erreichen, aber wir befinden uns in einer Gegend, in der es keine Verbindung gibt, so dass ich es aufgebe. Ich gehe auf die Toilette und nehme einen Schluck Whisky sowie ein paar Halstabletten. Kehre zu meinem Platz und meinen Betrachtungen zurück.
Einen kurzen Moment lang stelle ich fest, dass ich mich nicht an meine Personenkennziffer erinnern kann, aber als ich die Augen schließe und ein paar Mal tief durchatme, taucht sie wieder vor meinem inneren Auge auf.
Sicherheitshalber gehe ich in meinem Kopf noch einige weitere Ziffernkombinationen durch, an die zwanzig europäische Flüsse und die Nobelpreisträger für Literatur von 1950 bis heute. Nirgends kann ich eine Lücke feststellen. Ich schüttle die Unruhe ab. Gleichzeitig bemerke ich, dass da etwas ist. Eine Bedrohung. Oder etwas, das mir demnächst zustoßen wird, ich weiß nur nicht recht, was.
Während ich dasitze und der Nadelwald rund um den still stehenden Zug immer dunkler wird, versuche ich zu verstehen, was es bedeutet, dass Viktor zurückgekommen ist.
Und ob es tatsächlich stimmen kann.
Er »war zu sehen«, schreibt Maria, aber auch wenn sie diese vage Formulierung benutzt, erscheint es, als wäre sie felsenfest überzeugt von der Sache.
Viktor soll also am Leben sein.
Er ist es die ganze Zeit gewesen, die ganzen dreißig Jahre, und jetzt ist er zurückgekehrt.
Er war zu sehen?
Es geht nicht daraus hervor, wo, und nicht, wer ihn gesehen haben soll.
Es geht überhaupt nicht besonders viel aus Marias Brief hervor, denke ich. Obwohl er über vier Seiten lang ist. Größtenteils handelt er von Rune und Skröppel. Rune ist jetzt seit fast vier Jahren arbeitslos, was ihm ganz offensichtlich auf die Nerven geht. Skröppel hat etwas mit den Nieren. Vielleicht muss man ihn einschläfern lassen, er ist ja mittlerweile auch schon elf Jahre alt, wie Maria schreibt. Eine Operation ist teuer, und wenn es nicht klappt, bekommt man das Geld nicht zurück. Außerdem sind elf Jahre ein stolzes Alter für einen Hund.
Ich denke, dass ich am liebsten vorschlagen würde, Rune statt des armen Hundes einschläfern zu lassen. Rune hat Marias Leben zerstört, und es ist ihm noch nicht einmal gelungen, sie zu schwängern. Sie hätte ein Kind gebraucht, Maria, das hätte alles andere ausgeglichen, und da sie es nun einmal auf natürlichem Wege nicht geschafft haben, hätten sie zumindest eines adoptieren können. Es gibt Menschen, für die ich mehr Mitleid habe als für Rune.
Aber jetzt ist mir Rune scheißegal. Es geht um Viktor.
Ich versuche die Fragen um ihn herum zu formulieren, aber es will mir nicht gelingen. Sobald ich sie stelle, muss ich erkennen, dass sie bereits eine Antwort enthalten, die ich nicht akzeptieren kann. Unangebrachte Antworten, in gewisser Weise dem gesunden Menschenverstand widersprechend.
Ich habe Schwierigkeiten zu verstehen, was Maria wirklich mit dem meint, was sie im Brief schreibt. Ich versuche in den Nadelwald zu schauen, aber jetzt ist das Licht im Abteil eingeschaltet, und ich sehe nur die Spiegelung der Einrichtung und mein eigenes Gesicht. Die wenigen Menschen, die vereinzelt im Wagen sitzen, sind bis zur Unbeweglichkeit erstarrt. Einem jungen Mann mit rasiertem Schädel ist sein Kinn so weit heruntergefallen, dass ich sein Gaumenzäpfchen sehen kann, nur sein rasselnder Atem verrät, dass er noch am Leben ist. Eine ältere, große, krumm gewachsene Frau liegt über den kleinen ausklappbaren Tisch gebeugt, ihr Kopf ruht auf den nackten Armen. Ein halb gelöstes Kreuzworträtsel lugt unter ihrer Wange hervor.
Nichts geschieht, nichts außer dass die kleine Menge Alkohol, die ich zu mir genommen habe, in meinem Körper verbrennt und dass wir alle in stetem Takt altern. Das bilde ich mir zumindest ein. Ich schließe die Augen und beschließe, dass der Zug sicher gleich weiterfahren wird, wenn ich nur langsam und unbemerkt bis achtundzwanzig zähle.
Es klappt nicht. Ich versuche es noch einmal.
Und noch einmal.
Als ich bei meinem vierundzwanzigsten Versuch bei sechzehn angekommen bin, kommt der Schaffner erneut vorbei. Ich begegne seinem Blick, und er nickt ernsthaft.
Es ist jetzt geklärt, sagt er. Wir werden in wenigen Minuten weiterfahren.
Ich bedanke mich bei ihm. Ich habe das Gefühl, als hätte ich nicht mehr sehr lange ausgehalten. Wenn es mir nicht schon vorher klar gewesen wäre, würde ich jetzt endgültig begreifen, dass es ein durch und durch besonderer Tag ist. Eine besondere Dämmerung. Die inneren Bruchflächen, die wir im hellen Tageslicht freilegen, kommen in der nachfolgenden Dunkelheit am besten zu Tage, so ist es immer gewesen, so wird es immer sein. Das wahre Gewicht einer Bewegung und ihre Bedeutung kommen erst im Stillstand zum Ausdruck.
Und es fällt mir schwer, das mit Viktor zu glauben.
Außer mir steigt nur noch ein weiterer Fahrgast in Y. aus. Es gibt irgendwelche Probleme mit den Lampen auf dem Bahnsteig, sie brummen laut und verbreiten nur so viel Licht, dass man mit Mühe und Not in den Tunnel findet, der unter dem Bahngleis hindurchführt, hinaus zu dem geschlossenen Bahnhofsgebäude. Mein Mitreisender, ein hochgeschossener Jüngling mit Lederjacke und Pferdeschwanz, verschwindet in die andere Richtung, quer über das Bahnhofsgelände, ich gelange mit meiner Tasche auf den ebenso spärlich erleuchteten Bahnhofsvorplatz. Es ist Viertel nach zehn, insgesamt hat die Verspätung also genau zweieinhalb Stunden gedauert. Ich sehe nirgends einen Bus stehen und auch keine Taxis.
Überhaupt keinen Menschen. Aber auf der anderen Straßenseite – die parallel zu den Schienen verläuft und wo es noch vereinzelt ein erleuchtetes Schaufenster gibt und hier und da ein Auto parkt – entdecke ich ein Hotelschild. Zwei der fünf vertikalen Neonbuchstaben sind zwar außer Funktion, aber es erscheint doch ziemlich wahrscheinlich, dass sich hinter H-TE- nichts anderes verbirgt als eben eine Herberge für gestrandete Zugreisende.
Ich schlage meinen Jackenkragen hoch und lenke meine Schritte auf den Eingang zu. Hier ist die Luft kälter, offensichtlich ist vor kurzem ein Herbstregen niedergegangen, und als ich die hellgrüne, schwach erleuchtete Nachtklingel drücke, denke ich, dass es ebenso gut schon November sein könnte.
Ich werde von einer Frau um die fünfundzwanzig hereingelassen. Sie hat sich ein dickes Buch unter den Arm geklemmt und die Brille auf die Nasenspitze heruntergeschoben; vielleicht verbringt sie die Nachtstunden in der Portierloge damit zu studieren, das würde ich jedenfalls tun. Sich eine Berufsausbildung beschaffen, die es einem ermöglicht, diese Gegend zu verlassen und in die Welt hinaus zu kommen. Sie fragt mich, ob ich mit dem Zug gekommen bin, erklärt, dass neunzehn von zwanzig Zimmern frei seien, und bittet mich, mir eine Nummer auszusuchen.
»Nummer acht«, sage ich.
Sie lacht auf. Legt ihr Buch hin und nimmt die Brille ab. Sieht plötzlich richtig niedlich aus. Warme, nussbraune Augen und diese sanften Schatten unter den Wangenknochen, die ich einen langen Zeitraum meines Lebens mehr oder weniger unwiderstehlich fand.
»Wie konnten Sie das wissen?«, fragt sie. »Das ist das einzige Zimmer, das belegt ist. Vor einer Stunde ist eine Frau angekommen, die unbedingt die Nummer acht haben wollte. Sie hat mit ihrem Mann dort gewohnt, vor vierzig Jahren, hat sie behauptet.«
»In Nummer acht?«
»Ja. Deshalb seien Sie doch so gut und suchen Sie sich ein anderes Zimmer aus.«
»Sechs?«, schlage ich vorsichtig vor.
Sie überreicht mir einen Schlüssel mit einem schweren, herzförmigen Metallklumpen, erklärt, dass das Frühstück zwischen sieben und neun Uhr serviert wird, und wünscht mir eine gute Nacht.
Das Zimmer ist grau und voller Wehmut. Ein Doppelbett, ein kleiner Tisch, ein Stuhl, ein Fernseher. Ein freistehender schiefer Schrank, Toilette, Dusche.
Ein Wandbild mit dem Foto eines Treckers, der über ein offenes Feld fährt. Eine deutlich südlichere Landschaft, wie ich annehme, die Erde ist rötlich.
Ich stelle meine Tasche ab. Hole die Whiskyflasche hervor und nehme einen ordentlichen Schluck.
Ziehe mir die Kleider aus. Pinkele und bürste mir die Zähne.
Gehe zu Bett.
Bevor ich einschlafe, lese ich noch einmal Marias Brief. Den letzten Abschnitt zweimal.
Doch das Wichtigste zum Schluss, David. Viktor war hier in der Gegend zu sehen. Ich begreife nicht, wie das möglich ist oder was es bedeutet, aber ich fühle mich unruhig und aufgewühlt. Ich kann diese Sache natürlich nicht mit Rune diskutieren, der Einzige, mit dem ich darüber reden könnte, wärst du. Bitte, kannst du nicht herkommen, ich habe das Gefühl, dass etwas Schreckliches passieren wird. Manchmal des Nachts bekomme ich fast keine Luft mehr.
Mit freundlichen Grüßen
Maria
Ich lege den Brief auf den Nachttisch. Plötzlich taucht Kommissar Malander in meinen Gedanken auf.
Seine lange, magere Gestalt und seine traurigen Augen.
Gibt es ihn noch?
Natürlich muss er inzwischen pensioniert sein, aber lebt er noch? Wäre es möglich, ein Gespräch mit ihm zu führen?
Ich versuche mich daran zu erinnern, wie alt er wohl zum Zeitpunkt des Mordes gewesen sein kann, doch es scheint, als wollte er sich dieser Einschätzung entziehen.
Vielleicht so um die fünfzig. Aber es könnten gut und gerne auch zehn Jahre mehr oder weniger gewesen sein. Ein merkwürdiger Mann, dieser Kommissar Malander, der Meinung waren damals alle.
Alle, mit denen ich gesprochen habe. Ich selbst war ja nicht vor Ort, als es passierte.
Ich lasse Klimke liegen. Lösche stattdessen das Licht und rolle mich zusammen, die Hände zwischen den Knien. Es ist kalt im Raum. Das blaulila Hotelschild schimmert schwach durch die Gardinen. H-TE-.
Ich erwache mit einem Ruck. Ein schiefes, Schwindel erregendes Gefühl im Körper, ich muss geträumt haben, dass ich falle. Die Zunge klebt am Gaumen, ich bin in kalten Schweiß gebadet und spüre einen kräftigen Druck von innen auf die Schläfen.
Ich öffne die Augen und sehe nur Dunkelheit. Irgendwo läuft die Wasserspülung, es singt in einem Rohr.
Wo bin ich?
Was ist das hier?
Es dauert einige Sekunden, bevor ich diese Fragen zufriedenstellend beantworten kann.
3
Der Tag ist der Fötus der Nacht.
An diesem tot geborenen Morgen frühstücke ich in einem engen, grün tapezierten Speisezimmer, in dem sich die Gerüche und Gegenstände die Waage halten. Alter, erkalteter Zigarettenrauch, Putzmittel älteren Datums. Ein düsterer Elchkopf und eine Standuhr, die auf Viertel vor fünf stehen geblieben ist. Drei Tische sind gedeckt, ich sitze allein an dem hintersten. Mit dem Rücken zur Wand. Kaffee, ein hart gekochtes Ei, Saft und ein Käsebrot. Ich blättere in der Länstidningen, die ich nicht mehr gelesen habe, seit ich erwachsen bin. Sie scheint sich nicht verändert zu haben.
Ein asiatisches Mädchen deckt auf und fragt, ob alles in Ordnung ist. Ich erkläre, dass alles in Ordnung ist. Sie füllt meine Kaffeetasse und verschwindet. Ich frage mich, wo sie wohl geboren wurde und wie sie in diesem abgelegenen Winkel gelandet sein mag. Aus einem verborgenen Lautsprecher ertönt ein klassisches Musikstück, das ich wiedererkenne, doch es gelingt mir nicht, es zu identifizieren. Nur Klavier, Cello und Geige. Vielleicht ist es Pärt.
Die Frau an der Rezeption ist gegen einen jungen Mann ausgetauscht worden. Er hat einen Schnurrbart, so groß wie der Schmutzrand unter einem Daumennagel, und scheint aus irgendeinem Grund nervös zu sein. Er teilt mir mit, dass der erste Bus nach K. bereits um sieben Uhr abgefahren ist. Der nächste fährt um Viertel nach elf.
Das täte ihm Leid, wie er sagt.
Ich lege mich noch für eine Weile aufs Bett in meinem Zimmer und ruhe mich nach dem Frühstück aus. Mein Körper prickelt, die Nerven liegen bloß, vielleicht ist es der gestrige Whisky, der sich bemerkbar macht und raus will. Ich fühle, dass ich gut noch ein paar Stunden Schlaf vertragen könnte, aber ich will nicht noch einen Bus verpassen. Überlege, dass ich mein Handy einschalten sollte, um nachzusehen, ob meine Frau von sich hat hören lassen. Ich hatte es für eine kurze Zeit an, bevor ich gestern ins Bett ging, nachdem ich Maria angerufen hatte, aber da war keine Mitteilung eingegangen.
Maria klang müde. Doch sie sagte, sie sei dankbar, dass ich herkommen würde. Wir sprachen nicht einmal eine Minute miteinander, sie sehe sich gerade zusammen mit Rune eine amerikanische Komödie an, hat sie behauptet.
Ich verzichte dann doch darauf, mein Handy an diesem Morgen anzustellen. Ich habe keine Lust.
Den Busfahrer, mit dem ich fahre, kenne ich tatsächlich. Er heißt Lindberg oder Lundborg oder so, ich habe ein Bild von ihm, wie er vor fünfunddreißig Jahren aussah. Er fuhr bereits damals Bus, ein fescher Jüngling, der mit allen weiblichen Fahrgästen im richtigen Alter und mit dem richtigen Körperbau flirtete. Jetzt flirtet er nicht mehr, er sitzt wie eine große, etwas wässrige Birne hinter dem Steuer, es kann nicht mehr viel bis zur Pensionierung fehlen. Trotzdem sieht er sich immer noch so weit ähnlich, dass ich ihn wiedererkenne. Ich meine mich zu erinnern, dass er sich mit einer älteren Schwester eines Mädchens aus meiner Klasse verheiratet hat, sie wurde auf Grund ihres Körperbaus Busen-Inga genannt, meine Klassenkameradin, meine ich, das aber ist ein wie aus dem Nichts aufblitzendes Erinnerungsbild, das mich ein wenig beunruhigt.
Wie wenig wir doch unsere Gedanken und Empfindungen steuern können; was da alles nach Aufmerksamkeit schreit, sobald man seine eingefahrenen Wege verlässt. Sicher wird jede Menge altes Gerümpel in den nächsten Tagen auftauchen, das schon lange entsorgt sein sollte. Solche Dinge, die man tatsächlich gern los wäre. Ich habe den Verdacht, dass es sich hier um so eine Reise handelt.
Ich setze mich in dem halb leeren Bus auf die vorletzte Bank – vermeide natürlich die Plätze über dem Rad, daran erinnere ich mich noch. Da poltert es so schrecklich, wie mein Vater immer zu sagen pflegte, da sitzen nur Idioten und Leute, die eine Darmverschlingung heilen wollen.
Ich schaue durch das unerwartet schmutzige Fenster hinaus, auf das jetzt auch noch der Regen prasselt, und versuche die Fragen zu formulieren, die mir wirklich am Herzen liegen, aber es gelingt mir nicht viel besser als gestern. Es gelingt mir überhaupt nicht. Ich beschließe, es aufzuschieben, bis ich angekommen bin. Bis ich ein vernünftiges Gespräch mit Maria geführt habe, sind das alles doch reine Spekulationen.
Stattdessen denke ich über die acht Jahre mit Liv nach – ein Zeitraum, der jetzt, in Nullkommanichts, zu einem Nichts zusammenzuschrumpfen scheint. Und das führt mich logischerweise zu der fast traurigen Einsicht, dass mein ganzes Leben so aussehen wird, wenn ich eines Tages mit einem Fuß im Grab stehen und nachdenklich zurückschauen werde.
Eine leere Hülse in der Ewigkeit.
Aber so ist nun einmal die Lage, und wenn man durch einen verregneten Nadelwald rutscht, in dem der Sommer seinen letzten Seufzer macht, dann lohnt es sich nicht, dazusitzen und zu prahlen. Man ist einfach der, der man ist.
Wir haben uns zufällig kennen gelernt, Liv und ich. Das tun vielleicht acht von zehn Menschen, aber in unserem Fall pflegten die Leute zu sagen, dass es doch etwas ganz Besonderes war.
Ich hatte beschlossen, mir einen besseren Fernseher zu kaufen, und das tat ich auch. Ich fand in dem Laden in der Bangårdsgatan einen Apparat, der mir gefiel, und danach setzte ich eine Anzeige in die Zeitung, um meinen alten loszuwerden.
An dem Samstagvormittag, als die Anzeige erschien, erhielt ich einige Anrufe, und zur Mittagszeit kam eine Frau und kaufte den Fernseher. Sie bezahlte wie verabredet fünfhundert Kronen dafür, und ich half ihr, das Gerät die Treppen hinunterzutragen und es auf dem Rücksitz ihres Autos zu verstauen. Ich versicherte ihr, wie bereits mehrmals zuvor, dass er in all den Jahren, in denen er in meinem Besitz gewesen war, perfekt funktioniert hatte, aber dass sie sich natürlich sofort bei mir melden sollte, wenn irgendein Problem auftauchte.
Ein paar Stunden später klingelte das Telefon, und eine wütende Frauenstimme sagte: »Der Mist funktioniert nicht. Kommen Sie sofort her und regeln Sie das oder geben Sie mir mein Geld zurück.«
Ich nahm an, dass sie technisch ein Idiot war, deshalb erschien es mir sinnlos zu versuchen, sie per Telefon zu instruieren und fragte also nach ihrer Adresse. Bekam sie und versprach ihr, innerhalb einer Stunde bei ihr zu sein.
Fünfundvierzig Minuten später parkte ich meinen Wagen vor einem Reihenhaus in der Nypongatan draußen in Årsta. Ich läutete an der Tür und wurde von einer Frau um die dreißig hereingelassen, die ich nie gesehen hatte. Sie entschuldigte sich, erklärte, dass sie im Nachbarhaus wohne und schnell herbeigerufen worden sei, um mich zu empfangen. Wanda, die Tochter der Frau, die mich angerufen hatte, habe sich beim Eiskunstlaufen den Arm gebrochen und sei jetzt mit ihrer Mutter auf dem Weg ins Krankenhaus.
»Aber kommen Sie doch herein und sehen zu, ob Sie den Apparat in Ordnung kriegen.«
Sie führte mich ins Haus hinein in ein Zimmer, das offensichtlich ein Arbeitsraum war. Schreibtisch, Bücherregale mit Ordnern und Büchern, ein hoher Ablageschrank. Dünne, rote Gardinen vor dem Fenster. Ich sah keinen Fernsehapparat und schon gar nicht meinen alten Sony.
»Bitte schön«, sagte die Frau. »Ich nehme an, dass es das Beste ist, wenn ich Sie in Ruhe lasse.«
Ich schaute mich erneut im Zimmer um.
»Entschuldigung«, sagte ich. »Wo ist der Apparat?«
»Da natürlich«, sagte die Frau und zeigte auf einen Computer, der nicht angeschlossen auf dem Schreibtisch stand.
»Das ist ein Computer«, sagte ich.
»Äh… ja«, sagte die Frau.
»Aber es ging doch um einen Fernsehapparat«, sagte ich.
»Nein«, widersprach die Frau. »Es geht um einen Computer. Um den hier.«
Ich sah sie verwirrt an.
»Das stimmt nicht«, erklärte ich. »Ich bin hierher gekommen, um einen Fernseher zum Laufen zu bringen. Nicht einen Computer.«
Sie versuchte zu lächeln, aber ihr Lächeln wurde zu einer Art Grimasse, die zwischen Beunruhigung und Wut hin und her pendelte.
»Denken Sie… denken Sie, ich bin ein Idiot? Glauben Sie, ich könnte nicht den Unterschied zwischen einem Fernseher und einem Computer erkennen?«
»Das können Sie sicher«, warf ich freundlich ein.
»Meine Freundin hat mir erklärt, dass ein Typ kommen soll, um einen Computer in Ordnung zu bringen, den sie gerade von ihm gekauft hat. Sie glauben bestimmt, wir Frauen wären zu blöd, um den Unterschied zwischen…«
Die Situation wurde langsam absurd, und ich unterbrach sie.
»Einen Moment mal«, sagte ich. »Wir sind ja beide der Meinung, dass das hier ein Computer ist, aber ich kann mich nun einmal ausgezeichnet daran erinnern, dass ich Ihrer Freundin einen Fernsehapparat verkauft habe. Einen Sony. Ich bin auch kein Idiot.«