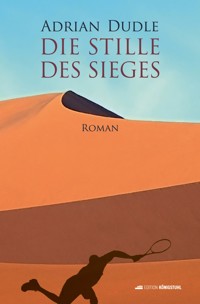
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Edition Königstuhl
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2022
Aly ist ein autistischer Junge, der nicht sprechen kann. Geschützt hinter dicken Mauern eines herrschaftlichen Anwesens in Oman entwickelt er sich dank seines fürsorglichen Vaters Mahmoud klammheimlich zum Spitzentennisspieler. Durch Vermittlung des Erzählers, welcher als Tenniscoach den egozentrischen Portugiesen Jorge an die Weltranglistenspitze führt, kommt es zwischen den beiden Spielern zur schicksalshaften Begegnung. Diese wird für die scheinbar so unterschiedlichen Protagonisten zum Wendepunkt in ihrem Leben.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 234
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Adrian Dudle
Die Stilledes Sieges
Roman
Webseite Autor:
www.adriandudle.com
Impressum
© 2021 Edition Königstuhl
Alle Rechte vorbehalten.
Kein Teil dieses Buches darf ohne schriftliche Genehmigung des Verlags reproduziert werden, insbesondere nicht als Nachdruck in Zeitschriften oder Zeitungen, im öffentlichen Vortrag, für Verfilmungen oder Dramatisierungen, als Übertragung durch Rundfunk oder Fernsehen oder in anderen elektronischen Formaten. Dies gilt auch für einzelne Bilder oder Textteile.
Bild Umschlag:
Boaz Meiri (Wüste), canva.com
Gestaltung und Satz:
Stephan Cuber, diaphan gestaltung, Bern
Lektorat:
Manu Gehriger
CPI books GmbH, Ulm
Verwendete Schriften:
Adobe Garamond, Trajan Pro
ISBN 978-3-907339-04-6
eISBN 978-3-907339-18-3
www.editionkoenigstuhl.com
Inhalt
Vorwort
ERSTER TEIL
Der Anruf
Die Anfänge
Ich, Max Ander
Der Palast
ZWEITER TEIL
Jorge De Sousa
Aly Bin Lussa
Die Lehrjahre
Der Seitenwechsel
Der Aufstieg
DRITTER TEIL
Der Besuch
Die Bestätigung
Das Treffen
Die Krönung
Die Worte
Das Zweite Treffen
Die Trennung
Die Vorbereitung
Die Reise
Das Match
VIERTER TEIL
Der Rückzug
Derweil
Der Fall
Die Erkenntnis
Der Abschied
Noch ein Fall
FÜNFTER TEIL
Die Folgejahre
Jetzt
Nachtrag
«Es hat nichts Edles, sich seinen Mitmenschen überlegen zu fühlen.Wahrhaft edel ist, wer sich seinem früheren Ich überlegen fühlt.»
Ernest Hemingway,US-amerikanischer Schriftsteller
«Kein Sportler redet so viel mit sich selbst wie ein Tennisspieler.Warum?Weil Tennis ein so verdammt einsamer Sport ist.»
André Agassi,ehemaliger Tennisprofi
Vorwort
Lange zweifelte ich, ob ich die Geschichte erzählen soll. Würde mir überhaupt jemand Glauben schenken?
Es ist die Geschichte zweier aussergewöhnlicher Menschen, die auf ihre ganz unterschiedliche Art Einzigartiges geleistet haben. So dankbar ich dafür bin, dass ich diesen beiden Personen begegnen durfte, so schwer lastet die Tatsache auf mir, dass sie allein durch mein Wirken zusammengefunden haben, was letztlich erst zum Drama führte.
Oder war es bloss die Fügung des Schicksals, welches der Geschichte ihre Wendung gab? Dieser Gedanke reichte lange Zeit nicht aus, um mich vom Gefühl des Versagens zu lösen, welches mich bislang dazu bewogen hatte, das Geschehene zu verschweigen.
Aber auch das Schicksal scheint beeinflussbar zu sein. Gerade die besagten Geschehnisse, über die ich nun berichten werde, haben mich in dieser Hoffnung bestärkt. Was uns Mutter Natur in die Wiege legt, bestimmt zwar unser aller Ausgangspunkt, gibt indes nicht das spätere Leben schlechterdings vor. Mancherlei hängt davon ab, ob man sein Leben in die Hand nimmt. Oder es aus der Hand gibt.
Letztlich habe ich diese Geschichte niedergeschrieben, weil es galt, ein Versprechen einzulösen.
ERSTER TEIL
Der Anruf
Alles begann mit einem Anruf vor rund vier Jahren.
Er erreichte mich, nachdem ich Bea soeben «Shadows in the Rain!» zugerufen hatte. Ich war mir mittlerweile sicher, wartete aber dennoch jedes Mal mit Spannung darauf, dass sie die richtige Musik spielen würde. Bea war meine virtuelle, sprachgesteuerte Alltagshilfe in Form einer schwarzen Box aus Kunststoff. Und tatsächlich, es erklang nicht die Originalaufnahme von Police, sondern die gleichnamige Cover Version von Sting. Meine smarte Assistentin hatte mein Hörverhalten brav gespeichert. The Dream of the Blue Turtles war eines der Lieblingsalben meines Vaters, einem Musiknarr durch und durch, der sich nicht nur der Rock- und Jazzmusik zugetan fühlte, sondern auch ein profunder Kenner der klassischen Musik war. So war es nicht erstaunlich, dass ihm das erste Soloalbum von Sting besonders gefiel – er brachte dieses heraus, noch bevor sich seine Band Police offiziell aufgelöst hatte. Diese Langspielplatte erhob die Rockmusik via Jazz zur ernsten Kunst, wie das Fachblatt Rolling Stone einst festhielt. Während mein Vater vor allem von Russians angetan war – kein Wunder, der Song verwendet eine Passage von Prokofjew –, war mein Lieblingssong eben Shadows in the Rain und somit dasjenige Lied, das meistens übergangen wird, das aber ein schlagender Beweis dafür ist, dass eine Kopie zuweilen besser ist als das Original. Jedenfalls konnte ich damals nicht erahnen, dass dieser Song wenige Jahre später bei ganz anderer Gelegenheit abgespielt werden würde.
Ob der gehobenen Lautstärke wäre der eingehende Anruf um ein Haar in den «Schatten im Regen» untergegangen. Zufällig jedoch leuchtete das Display meines Mobiltelefons just in dem Moment auf, als ich aus der Dusche stieg. Ich nahm den Anruf eiligst entgegen, noch bevor ich Bea ein schroffes «Stop!» entgegenrufen konnte.
«Herr Ander?»
Ohne zu fragen, wer sich am anderen Ende der Leitung befand, entschuldigte ich mich mit einem geschämten «Sorry» für den befehlenden Ton, der ja nicht dem Anrufer galt, was dieser wiederum nicht wissen konnte.
«Komme ich ungelegen, Herr Ander? Bitte lassen Sie mich ruhig wissen, wenn ich später anrufen soll.» Die unbekannte Stimme war von einer angenehmen Wärme und Tiefe, aus welcher ein orientalischer Akzent auszumachen war.
«Sie stören überhaupt nicht, Mister», erwiderte ich. «Ich musste bloss zunächst die Musik zum Verstummen bringen.»
«Max, ich darf Sie doch sicher so nennen, Sie kennen mich mit Bestimmtheit nicht, aber ich kenne Sie, zwar nicht persönlich, aber ich habe viel von Ihnen gehört und gelesen.»
«Das glaube ich Ihnen gerne, Sir, aber darf ich Sie nach dem Grund Ihres Anrufes fragen?»
«Selbstverständlich, und verzeihen Sie mir, dass ich mich noch gar nicht vorgestellt habe. Mein Name ist Mahmoud Bin Lussa, ich rufe aus der Nähe von Maskat in Oman an. Ich möchte, dass Sie meinen Sohn trainieren, ich meine, ihm Tennisunterricht erteilen.»
Hätte ich den eingehenden Anruf aus purer Unlust nicht entgegengenommen oder den Klingelton schon gar nicht erst gehört, würde ich jetzt zum Synkopen-Gewitter von Marsalis, Hakim und Kirkland einen Smoothie zubereiten und, meinem täglichen Morgenritual folgend, ein paar Minuten auf der Couch vor dem raumhohen Fenster sitzen und beobachten, wie die Stadt aus ihrem Schlaf erwachte. Ich hätte dabei feststellen können, dass von Westen anziehende Wolken erahnen liessen, dass ein eher trüber Herbsttag bevorstand. Nun aber war ich in eine Diskussion geraten, die, wenn es nach mir ginge, gar nie hätte beginnen dürfen. Zum einen kannte ich den Anrufer nicht, zum anderen wusste ich nicht, was diese merkwürdige Anfrage bedeutete, und schliesslich hatte ich ohnehin keine Zeit für, aber mit Bestimmtheit keine Lust auf ein solches Gespräch, geschweige denn Tennisunterricht für Klein Mahmoud, wer immer das auch sein mochte.
«Lieber Mister Mahmoud, Ihr Anruf kommt etwas überraschend, und ich muss gestehen, dass ich Ihren Wunsch beim besten Willen nicht deuten kann. Wie dem auch sei, ich muss Ihnen leider absagen, da ich bis auf Weiteres keine neuen Spieler in mein Coaching aufnehme.»
«Lieber Max, ich habe mit dieser Antwort gerechnet. Bevor Sie jedoch das Gespräch beenden, möchte ich Ihnen noch mitgeben, dass Sie für Ihre Arbeit gut bezahlt werden. Auch könnten Sie von etwas besonderen Bedingungen profitieren, die Ihnen Ruhe und allen Komfort verschaffen werden, den Sie sich wünschen.»
«Das ist sehr grosszügig von Ihnen», erwiderte ich. «Aber zum Glück bin ich jedenfalls auf absehbare Zeit finanziell unabhängig und auch sonst mit meinen jetzigen Lebensumständen sehr zufrieden.» Obwohl mir noch beim Reden klar wurde, dass Letzteres nur ansatzweise der Wahrheit entsprach, wollte ich mir gegenüber diesem Fremden nichts anmerken lassen.
«Ich habe vermutet, dass es Ihnen materiell an nichts fehlt und Sie aufgrund Ihrer erfolgreichen Tätigkeit gewiss auch grosse berufliche Genugtuung verspüren. Ich wollte einfach klarstellen, dass ich mich jedenfalls grosszügig gegenüber Ihnen zeigen werde, weil mir Ihr Engagement sehr wichtig ist. Vielleicht aber könnte Sie die Aufgabe aufgrund einer weiteren Begebenheit interessieren, welche ich Ihnen noch gar nicht erläutert habe.»
Erst einige Wochen später sollte ich erfahren, was Mahmoud Bin Lussa damit wirklich meinte.
Die Anfänge
Die Hintergründe des Anrufs und mithin die Anfänge dieser Geschichte reichen viele Jahrzehnte zurück ins Sultanat von Oman zur Familie Bin Lussa.
Der Vater von Mahmoud, Scheich Ahmed Bin Lussa, war ein kultivierter, ruhiger Mann von eher kleiner Statur, mit dichtem Bart und glatter Haut in braunem Teint. Seine dunklen Augen strahlten eine angenehme Wärme aus, gerieten aber in ein feuriges Funkeln, sobald ihn die Leidenschaft packte. Ahmed wurde in eine Familie hineingeboren, der sämtliche Privilegien des Landes zur Verfügung standen. Als entfernter Verwandter des Sultans genoss sein Stamm hohes Ansehen. Auch ohne sonderlich viel Begabung und Engagement standen den Mitgliedern der obersten Schicht im Oman praktisch alle Möglichkeiten in beruflicher und privater Hinsicht offen. Nicht selten aber sind die übermittelten Fälle von Angehörigen, die mit grossem Fleiss und überdurchschnittlichem Verstand ganz Grossartiges geleistet haben.
Ahmed war ein weit über die Landesgrenzen geachteter Professor der Universität Maskat, an welcher er Mathematik und Physik lehrte. So eindrücklich er durch fachliche Exzellenz bestach, so befremdend war seine überaus verschlossene, unnahbare Art. Dieses Verhalten bekamen die Studenten deutlich zu spüren, denn der Professor liess kaum je einen Dialog zu. Solange man seinen Ausführungen jedoch konzentriert folgte und eifrig die damals noch gebräuchlichen Notizhefte füllte, konnte man sich ein beachtliches, weit über dem Durchschnitt anderer, auch westlicher Universitäten liegendes Wissen aneignen. Für Rückfragen oder einen Diskurs mit dem Professor blieb jedoch kein Raum.
Auch in seiner Familie nahm Scheich Ahmed zwar die Rolle eines verlässlichen Ehegatten und Vaters wahr. Er behandelte seine Nächsten wie auch andere Mitmenschen mit Respekt, schien ihnen gegenüber aber sonst kein besonderes Interesse entgegenzubringen. Sein vordergründig abweisendes Verhalten wurde fälschlicherweise oft als Ausfluss purer Arroganz gedeutet. Nicht nur deswegen mied Ahmed die Öffentlichkeit, so gut es ging.
Eine Art von echter Zuneigung verspürte Ahmed einzig zu seinem ältesten Sohn, Mahmoud. Der Dekan der Universität, mit dem ihn ein intellektueller Draht verband, lud Ahmed als offiziellen Gast zur ersten öffentlichen Filmvorstellung im Lande ein, denn es war ihm gelungen, eine Kopie dieses Films zu beschaffen. Dabei erschien Ahmed mit seinem damals zehnjährigen Sohn Mahmoud, er wollte ihn, und nur ihn, bei diesem für das Land wichtigen kulturellen Ereignis zur Seite haben. Ahmed ignorierte sichtlich gleichgültig die ob seiner überraschenden Begleitung erstaunten Blicke der übrigen Anwesenden – Mitglieder der Sultan-Familie, ranghohe Vertreter aus Regierung und Verwaltung, Minister und wohlhabende Geschäftsleute. Er betrat mit seinem Sohn, ohne die übrigen Gäste eines Blickes zu würdigen, in seiner stillen Art den Vorführraum. Dieser war eigens für den Anlass im grossen Auditorium der Universität eingerichtet worden.
Mahmoud hatte sich seit Wochen auf dieses Ereignis gefreut, waren doch Ausflüge aus der gewohnten Umgebung, und dazu noch allein mit seinem Vater, von Seltenheit. Bereits beim Betreten des halb abgedunkelten «Kinos» begannen seine Augen zu leuchten, und er war unglaublich gespannt auf das, was ihn erwartete. Die Aufregung war ihm anzusehen an seinen erröteten Backen, welche zum Glück bald in der gänzlichen Dunkelheit des Saales verschwanden. Sein Vater hatte ihm in seiner knappen Art vorgängig einzig angedeutet, dass es um einen historischen, aufwendig gedrehten Film eines Engländers ginge, welcher von der «grossen Geschichte der Wüste» handle. Der Vorspann kündigte Lawrence of Arabia an. Dies war das Letzte, was Mahmoud mit einigermassen klarem Kopf wahrnehmen konnte. Dann sank er in eine Art Trance, aus der er erst allmählich wieder erwachte, als er mit seinem Vater nach Hause zurückkehrte.
Seit diesem Abend war Mahmoud von der Welt der bewegten Bilder in den Bann gezogen. Nur etwas anderes sollte bald zu einer noch grösseren Leidenschaft heranwachsen. Dies konnte ihm nur recht sein, da es leider bei diesem einen grossartigen Kinoerlebnis blieb. Denn Filme waren ihm fortan verwehrt, da sein Vater kein Bedürfnis verspürte, sich mit unzähligen anderen Menschen in Reih und Glied zu ordnen, nur um gemeinsam während Stunden auf eine Leinwand zu starren.
Daran änderte sich erst etwas, als der Vater beschloss, ein Fernsehgerät anzuschaffen. Ahmed hatte davon gehört, dass Sendungen neuerdings auch in Farbe ausgestrahlt wurden. Vormals waren bloss Schwarz-Weiss-Bilder zu empfangen, und darauf hatte Ahmed schlicht keine Lust. Er konnte gerade so gut die Tageszeitung Muscat News lesen, um sich auf dem Laufenden zu halten, zumal dieses Blatt von recht guter Qualität war; einzig wissenschaftliche Themen kamen für seinen Geschmack viel zu kurz. Was hätte es also zuvor für einen Unterschied gemacht, sich die Information, obgleich «bewegend», über einen so merkwürdigen Kasten vermitteln zu lassen? Abgesehen vom Wegfall der lästigen Druckerschwärze, die nach dem Lesen der Zeitung an den Fingern haftete? Aber Sehen in Farbe, wie im richtigen Leben, das war jetzt wirklich etwas Neues! Und es ermöglichte Ahmed, sich mitten im Geschehen zu fühlen, ohne dabei mit anderen Leuten allzu nahe in Kontakt zu treten.
Ab nun wurde im Haus jeweils eine Stunde pro Tag gemeinsam ferngeschaut. Die ganze Familie versammelte sich pünktlich um acht Uhr abends vor dem würfelförmigen Gerät, um sich die Nachrichten des Tages anzuschauen. Ahmed liess den sperrigen Kasten auf eine hübsch dekorierte Kommode stellen, die bereits in vierter Generation an ihn weitergereicht worden war. Das Holz des Fernsehgehäuses passte prima zum Mahagoni der Kommode.
Mahmoud freute sich jeweils schon den ganzen Tag auf diesen Augenblick. Er konnte von den bewegten Bildern nicht genug kriegen. Die tägliche Fernsehstunde genügte ihm bei Weitem nicht. Wenn immer es ihm gelang, unbeobachtet in den abgedunkelten Raum zu schleichen, sass er vors Gerät und schaute sich die zufällig laufenden Sendungen an. Alles konnte ihm recht sein. Fast ausschliesslich ging es um lokale Informationssendungen. Eines Tages aber wurde ein amerikanischer Film ausgestrahlt. Obwohl in dieser Zeit im Oman nur ganz wenige Leute der englischen Sprache mächtig waren, lief der Film in englischer Originalsprache und natürlich ohne Untertitel, sodass Mahmoud das Gesprochene nicht verstehen konnte. Dennoch war er in der Lage, die erzählte Geschichte grob zu erahnen. Diese war aber ohnehin eher sekundär, weil er im Grunde allein von der blossen Erscheinung des Hauptdarstellers gefesselt war. Dieser Gentleman zeugte, ähnlich wie Peter O‘Toole alias Lawrence Monate zuvor, von ganz grosser Klasse. Einer Ausgabe der Muscat News, die sein Vater auf dem Tisch liegengelassen hatte, entnahm er tags darauf, dass es sich um Gary Grant handelte.
Ein paar Wochen später, an einem lauen Spätsommerabend, konnte Mahmoud wiederum unbemerkt vor die Kommode schleichen. Auf dem Sender – es gab nur einen – wurde angekündigt, dass als erste Direktübertragung im Lande überhaupt das Finale von Wimbledon, des angeblich wichtigsten Tennisturniers der Welt, ausgestrahlt würde. Mahmoud wusste zwar weder, was mit «Tennis» gemeint war, noch wo sich das Land Wimbledon befand. Jedenfalls hörte es sich spannend an. Offenbar ging es um eine Sportveranstaltung, und dies liess ihn aufhorchen. Sein Vater hatte ihn schon des Öfteren zu Kamel- und Pferderennen mitgenommen; auch durfte er ihn gar einmal auf eine Falkenjagd begleiten. Aber diese Art von Betätigungen interessierten Mahmoud nicht, zumal er keinen besonderen Zugang zu Tieren hatte. Mahmoud war daher gespannt darauf, was nun diese Sportart bringen würde.
Die Direktübertragung begann, und Mahmoud war zunächst verwundert darüber, dass das Bild noch volles Tageslicht zeigte, wo doch ein Blick aus dem Fenster ergab, dass die Dämmerung schon längstens angebrochen war. Er hatte aber von seinem Vater gelernt, dass die Erde eine Kugel ist, die sich einmal täglich um die eigene Achse dreht. Die Aufnahmen müssten also von einem weit entfernten Ort stammen, der schon – oder noch? – im vollen Radius der Sonne stand. Richtig verblüfft war er aber erst, als «Tennis» begann. Er sah zwei ganz in weiss gekleidete Männer, welche sich auf einem von Rasen bedeckten und in der Mitte durch ein engmaschiges Netz getrennten Feld die Bälle mittels eines im oberen Teil kugelförmig ausgebuchteten Holzobjekts hin- und her spielten. Bevor er sich auf die Handlungen der beiden Weissbekleideten konzentrieren konnte, fragte sich Mahmoud noch, wie intensiv denn dieser Rasen bewässert worden sein musste, war das ansonsten satte Grün doch nur an den Stellen, wo die beiden Herren meistens standen, durch bräunliche Flecken durchbrochen. Aber dies sollte ihn in der Folge nicht weiter kümmern. Vielmehr tauchte er nun ganz ein in die Welt der beiden Akteure. Von Beginn an war er in den Bann gezogen, fasziniert von der Eleganz und Grazie dieses Ballsports. Die Szenerie kam ihm so majestätisch vor: Ob Kleider, Schuhe oder Bälle – alles erstrahlte in blendendem Weiss. Vor allem den Athleten mit dem dunklen, am Scheitel seitwärts gekämmten Haar bewunderte er auf Anhieb. Wie er später erfahren sollte, handelte es sich um einen Spieler aus einem fernen Kontinent, der offenbar schon seit vielen Jahren zu den Besten dieser Sportart gehörte. Das braungebrannte Gesicht und die perfekt sitzende Frisur von Ken Rosewall – so hiess er – liessen ihn an Gary Grant denken. Noch fast mehr aber erinnerte ihn Rosewalls Erscheinung an Peter O‘Toole, den heldenhaften Lawrence aus dem Film, zwar nicht wegen der Haar- und Augenfarbe, dafür aber umso mehr aufgrund seiner ruhigen, überlegten Art. Diese Ähnlichkeit wurde noch unterstrichen durch die helle Tennisbekleidung, die Mahmoud an das weisse Beduinengewand von Lawrence denken liess.
Mahmouds Faszination für das, was sich ihm soeben erschloss, war vergleichbar mit seinen Empfindungen vor ein paar Monaten im Kino. Allein, dieses Mal war die Begeisterung noch etwas grösser, weil ihn nun wirklich die Lust befiel, das, was hier gemacht wurde, auch selbst zu tun. Dies erschien ihm realistisch, bedurfte es doch zu Beginn offensichtlich bloss eines derartigen Holzgerätes und eines Balls. Nicht jeder konnte hingegen so einfach Lawrence sein und quasi im Alleingang ein ganzes Volk in die Unabhängigkeit führen, sei es auch bloss auf der Leinwand. Filme machen, das war wohl ohnehin etwas, was nur dort möglich war, wo die Sonne früher oder später als hier schien, dachte sich Mahmoud.
So trat Mahmoud noch am gleichen Abend vor Ahmed und bat ihn, Tennis spielen zu dürfen. Holzgerät und Ball würden es notfalls auch tun, fügte er noch schüchtern bei. Sein Vater reagierte verwundert: Woher zum Teufel hatte sein Junge auch nur diese Idee, und warum war Tennis für ihn überhaupt ein Begriff, während er, Ahmed selbst keine Ahnung hatte, worum es bei diesem Sport denn ging? Mahmoud hoffte, dass der Vater sich wie üblich auch dieses Mal nicht auf längere Diskussionen einlassen möge. Und so verhielt es sich zum Glück auch jetzt. Er würde schauen, was sich machen liesse, murmelte Ahmed, bevor er in seinem Arbeitszimmer verschwand.
Zwei Tage später brachte der Chauffeur Mahmoud in das Quartier Ras Al Hamra. Nun stand Mahmoud vor einem etwas verwahrlosten Tennisplatz. Eine leise Enttäuschung stellte sich ein, als er bemerkte, dass der Platz wohl nicht genügend bewässert worden war: Anstelle eines dichten Rasens, den er aus dem Fernsehen kannte, lag rötlich-braune Erde auf dem Feld. Mahmoud wurde von Moustafa, der sich als sein Tennislehrer vorstellte, in Empfang genommen. Was Mahmoud in den folgenden zwei Stunden vollbrachte, hatte mit der Eleganz, die er kürzlich im Fernsehen beobachten konnte, nichts, aber auch gar nichts zu tun. Er war sich sogleich bewusst, dass es ein langer Weg sein würde, bis er den Ball auch nur halbwegs so gut wie diese Gentlemen am Fernsehen treffen sollte. Er wusste aber auch, dass er nicht lockerlassen würde.
Ab diesem Tag fuhr Mahmoud einmal wöchentlich zum Training, was sich erst änderte, als er die Ausbildung abschloss und ins Berufsleben einstieg. Das bereits sehr früh erklommene Amt als nationaler Bildungsminister nahm ihn fortan derart stark in Anspruch, dass er kaum mehr Zeit hatte, sich seinem geliebten Hobby zu widmen. Hatte er am Abend einmal keine berufliche oder gesellschaftliche Verpflichtung, so war der Weg nach Ras Al Hamra doch zu weit, um noch rechtzeitig, das heisst vor Sonnenuntergang, für das Training anzukommen. Mahmouds Frustration wurde immer grösser; zugleich wusste er aber, dass er dieser Situation schon bald einmal würde Abhilfe schaffen wollen.
Ich, Max Ander
Ich hätte das Gespräch mit Mahmoud Bin Lussa ein paar Wochen zuvor nicht so abrupt beenden dürfen. Ich schämte mich im Nachhinein für die Arroganz meines Verhaltens gegenüber diesem Mann, der mir doch höchst anständig begegnet und sich ohne Zweifel gute Manieren gewöhnt war. Doch immerhin hatte ich damals die Konversation noch mit einem gespielt netten «Vielen Dank und auf Wiederhören» zum Verstummen gebracht. Und mehr war ich diesem Unbekannten auch nicht schuldig gewesen, redete ich mir nun ein. Woher bloss hatte diese Person denn überhaupt meine private Nummer? Glaubte der gute Mann, dass ich aus dem Stand zusagen würde und ihm jeden Wunsch, so eigenartig dieser auch töne, mir nichts dir nichts erfülle? War er einer dieser Menschen, die der festen Überzeugung sind, alles zu kriegen, solange sie nur mit dem Geldbeutel schwingen? Und was in aller Welt suchte diese Person denn im abgelegenen Maskat? Hielt er sich dort als reisender Geschäftsmann auf, oder doch eher als Tourist? Fiel ihm beim Sonnenbaden am Indischen Ozean schlicht nichts Besseres ein, als eine sinnvolle Beschäftigung für seinen verwöhnten, womöglich an jugendlicher Fettleibigkeit leidenden Sohn zu organisieren? Wohl, so vermutete ich, labte er sich im Moment des Anrufs mit seiner Familie gerade am reichhaltigen Buffet des Luxusresorts.
Doch war da nicht ein leichter Akzent in seiner Stimme auszumachen, der auf arabische Herkunft hinwies?
Allein schon der Umstand, dass ich mir all diese Fragen stellte, machte mich missmutig. Zur Verbesserung der Stimmung vermochte auch der Blick aus dem Fenster nichts beizutragen. Starke Regenfälle hatten soeben von Westen her eingesetzt.
Und doch ging mir eines nicht aus dem Kopf: Was meinte dieser Mahmoud damals, als er von einer «weiteren Begebenheit» sprach? Hatte es etwas mit ihm, Mahmoud, zu tun? Oder war die Bemerkung auf sein zu coachendes Kind gerichtet?
Ich konnte mir keinen Reim daraus machen, strengte mich aber auch nicht sonderlich an. Ich war schlicht nicht in der Stimmung, weitere Mutmassungen anzustellen. Vielmehr wurden die Gedanken daran überlagert von meinen mit dem Gespräch erst wieder ins Bewusstsein gerufenen Zweifeln an meinen «jetzigen Lebensumständen.» Mit diesen konnte ich, anders als ich gegenüber dem unbekannten Anrufer zu erkennen gegeben hatte, nicht zufrieden sein. Zwar plagten mich in der Tat keine Geldsorgen. Nebst der finanziellen Unterstützung meiner Eltern hatten auch meine beruflichen Erfolge als Tennisspieler, vor allem aber als Tenniscoach, dazu beigetragen, dass ich über ein genügend grosses Budget verfügte, um meinen Lebensunterhalt zu bestreiten und einen durchaus komfortablen Lebensstil zu führen. Die Mietwohnung mitten in der Stadt war zwar nicht sonderlich gross, bestach aber durch ihre einzigartige, erhöhte Lage mit fantastischem Blick über Stadt, See und Berge; der Himmel, dessen Farben sich je nach Saison, Tageszeit und Witterung änderten, lag mir quasi zu Füssen.
Doch fragte ich mich in den letzten Wochen und Monaten immer öfter, wohin denn die Reise gehen sollte. Mit meinen 37 Jahren hatte ich viele Bälle in der Luft, aber keinen in der Hand.
Mich bedrückte der Gedanke, dass bei mir noch vieles im Umbruch stand. Mein endgültiger Rücktritt vom Spitzentennis als Spieler lag mittlerweile vier Jahre zurück. Während meiner Karriere hatte ich zwar ein paar beachtliche Erfolge feiern können, doch etwas Bleibendes für die Nachwelt war damit beileibe nicht geschaffen. Beim Studium der Kunstgeschichte, das ich nach meiner aktiven Tenniskarriere vor zwei Jahren schon in Angriff genommen hatte, lief es immer noch schleppend; ich kam nicht vom Fleck. Nicht dass es mir an Interesse gefehlt hätte, aber irgendwie kriegte ich es mit dem Timing nicht hin, vor allem seit ich mich nebenbei zum Tennislehrer ausbilden liess und fortan regelmässig als Coach auf der Tour unterwegs war. Obgleich ich zu diesem Zeitpunkt immerhin drei Spieler, allen voran Vlado, in die Top 100 führen konnte, so war doch meinen Schützlingen, und mithin auch mir, der ganz grosse Durchbruch bislang nicht gelungen. Entsprechende Hoffnung machte mir zwar der vor ein paar Wochen neu unter Vertrag genommene iberische Hitzkopf Jorge De Sousa. Doch die Zusammenarbeit mit ihm schien schon aufgrund seines etwas unsteten Charakters auf wackligen Füssen zu stehen.
Und wie stand es eigentlich um mein privates Leben? Wo blieb eine Beziehung, die dieser Bezeichnung einigermassen hätte gerecht werden können? Die Zeiten, in denen ich mein ungebundenes Leben als Junggeselle genossen hatte, waren längst vorbei. So froh ich vor Jahren noch gewesen war, eine Bettbekanntschaft ohne Brimborium wieder beenden zu können, so sehnlichst wünschte ich mir nun, dass mich eine Frau, zu der ich mich hingezogen fühlte, nicht einfach fallen liess. Ich war in einem Alter, in welchem die meisten Leute in meinem Umfeld schon längst eine Familie gegründet hatten. Ich jedoch war immer noch auf der Suche.
Dabei hatte es mit Charlotte letztes Jahr an sich gut begonnen. Unsere Beziehung war von Vertrautheit, Zuneigung und gemeinsamen Interessen geprägt. Sie hatte zwar mit Tennis nichts am Hut, teilte aber meine Leidenschaft für Kunst und Musik. Auch konnten wir stundenlang ihre rechtlichen Fragestellungen diskutieren, die sie von der Anwaltskanzlei, bei der sie angestellt war, am Feierabend mit nach Hause brachte. Oft attestierte sie mir dabei ein «gutes juristisches Gefühl» und fügte in sarkastischem Ton an, dass mir mein Vater doch noch etwas Nützliches mit auf den Weg gegeben hätte. Tatsächlich hatte ich früher viel von der Arbeit meines Vaters mitgekriegt, der sich in der Musikbranche einen Namen als Anwalt gemacht hatte. Wie man mit minutiös formulierten Klauseln junge Musiker unbemerkt ihrer Rechte entledigen könne, sie dabei jedoch im Glauben liesse, sie hätten gerade das Geschäft ihres Lebens gemacht und den Sprung zu Rockstars soeben geschafft, fand ich faszinierend, wenngleich aus Sicht der Künstler ziemlich uncool. Ich selbst verstand meine Beiträge in den Gesprächen mit Charlotte eher als blossen Ausfluss gesunden Menschenverstandes denn als Zeugnis juristischer Sachkenntnis.
Auch bei Meinungsverschiedenheiten zollten wir uns genügend Respekt. Keiner von uns hatte das Bedürfnis, à tout prix das letzte Wort für sich in Anspruch zu nehmen. Und Charlotte konnte über sich selbst herzhaft lachen, eine Eigenschaft, die für meinen Geschmack viel zu selten anzutreffen ist. Doch all diese Verbundenheit sollte nicht genügen, um unsere Beziehung in ein nächstes Stadium zu führen. Eines Tages im letzten August, als ich soeben zurück aus New York kam, wo ich Vlado am US Open bis in den Viertelfinal begleitet hatte, gab mir Charlotte unverhofft den Laufpass. Sie fing mich noch an der Tür zu ihrer Wohnung ab und verkündete nach knapper Begründung – Benito hiess er, ausgerechnet Benito! – das bereits rechtskräftige Urteil. Ich musste rechtsum kehren. In diesem Moment bestand meine einzige Sorge darin, dass sie die Marshmallows nicht bemerken würde, welche ich für sie vor dem Abflug am JFK gekauft und nun für die Übergabe an sie hinter meinem Rücken versteckt gehalten hatte.
Alles war da, aber nichts wirklich hier.
Ich musste meinem Leben eine neue Richtung geben. Bloss wie? Und wohin?
Mein Interesse an der Kunst wurde Jahre zuvor geweckt, als ich mit meinen Eltern über ein Osterwochenende für ein paar Ferientage nach München fuhr. Ich war sechszehn Jahre alt und hatte soeben mein erstes internationales Tennis-Juniorenturnier gewonnen. Die Reise kam gelegen, zumal mir eine Sehnenentzündung am Schlagarm zu schaffen machte und mithin an Tennisspielen für eine gewisse Zeit nicht zu denken war. Mir gefiel München auf Anhieb, obwohl – oder gerade weil – sich ihr Flair nicht gross von dem meiner Stadt unterschied. Ich fand besonders die Radtouren entlang breiter Alleen und durch Biergärten gleichermassen unterhaltsam und entspannend. So war ich zunächst nicht sonderlich angetan von der Idee meines Vaters, einen Zwischenhalt in einem, wie er sagte, «einzigartigen Kunsttempel» einzulegen. Das Lenbachhaus stammte aus dem späten Neunzehnten Jahrhundert. Der hübschen Villa vorgelagert war ein prächtiger Garten. Die gesamte Museumsanlage der Villa mit Freitreppe, Loggien, Säulen, geschwungenen Bogenformen und aufgesetzten Terrakottagefässen machte auf mich einen malerischen Eindruck. Vor allem aber das, was sich mir im Innern des Gebäudes offenbarte, zog mich sogleich in den Bann. Es waren ausdruckstarke Bilder in kräftigen Farben, denen ich mich nicht entziehen konnte. Franz Marc stand unter einem Werk geschrieben, und die Künstlerbewegung, der er angehörte, hiess «Der Blaue Reiter», bezugnehmend auf ein Bild seines Malerkollegen Kandinsky. Dessen Impressionen, Improvisationen und Kompositionen beeindruckten mich besonders. Welche Symphonie an Farben und Formen, mit denen der Künstler die Gestaltung von Vorstellungen und Fantasien zum Bildgegenstand erhob!
Als auf dem Programm des nächsten Tages – nun war die Reihe an meiner Mutter – ein Besuch der Neuen Pinakothek anstand, hatte ich dem nichts entgegenzusetzen, im Gegenteil, ich freute mich darauf, neuerlich in diese mir vorher so gut wie unbekannte Welt einzutauchen.





























