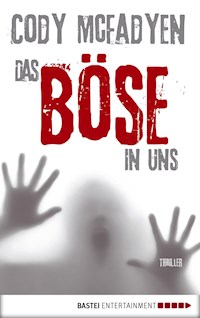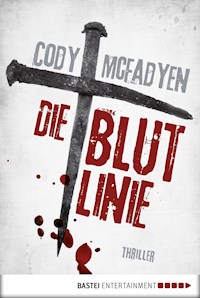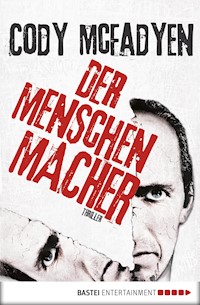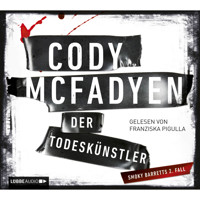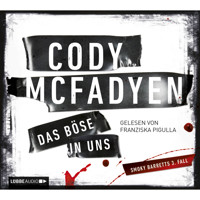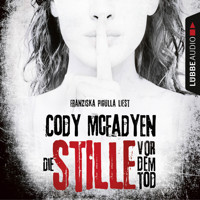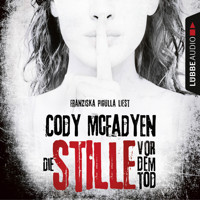
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Lübbe Audio
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Smoky Barrett
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2016
Smoky Barrett ist zurück!
An einem kalten Oktobertag werden Smoky Barrett und ihr Team nach Denver, Colorado, gerufen. Im Haus der Familie Wilton ist Schreckliches geschehen: Die gesamte fünfköpfige Familie wurde ermordet, und der Täter hat durch eine mit Blut geschriebene Botschaft Smoky mit der Lösung des Falles beauftragt. Doch das Unheil ist weit größer, denn die Wiltons sind nicht die einzigen Opfer. Insgesamt drei Familien wurden in der gleichen Nacht und in unmittelbarer Nähe voneinander getötet. "Komm und lerne", lautet die Botschaft an Smoky. Es wird ein grausamer Lernprozess, das Böse in seiner reinsten Form, in seiner tiefsten Abgründigkeit zu spüren. Smoky gelangt an die Grenzen ihrer Belastbarkeit. Und weit darüber hinaus.
Der fünfte Psychothriller aus der Smoky Barrett-Reihe von Cody Mcfadyen - Hochspannung mit Gänsehaut-Potenzial!
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Zeit:7 Std. 19 min
Sprecher:
Ähnliche
Inhalt
Über den Autor
Cody Mcfadyen wurde 1968 in Fort Worth, Texas (USA) geboren. Er wuchs in mehr als einfachen Verhältnissen auf, fühlte sich in der Schule unterfordert und interessierte sich bereits in seiner Kindheit für das Schreiben.
Mit 16 Jahren brach Cody McFadyen seine High-School-Ausbildung ab und widmete sich sozialer Arbeit für Drogenabhängige und unterstützte Selbsthilfegruppen.
Er unternahm als junger Mann mehrere Weltreisen und arbeitete danach in den unterschiedlichsten Branchen z.B. als Webdesigner, bis er sich mit 35 vollständig dem Schreiben hingab. Mit 37 Jahre erfand er die Protagonistin seiner sensationell erfolgreichen Thriller-Reihe – Smoky Barrett.
»Die Blutlinie« war sein erster Thriller, mit dem er direkt weltweit für großes Aufsehen sorgte, was sein Leben über Nacht komplett veränderte. Mit den Bestsellern »Der Todeskünstler«, »Das Böse in uns« und »Ausgelöscht« hat er die außergewöhnliche Thriller-Reihe um Smoky Barrett fortgesetzt. Seine Protagonistin jagt brutale Mörder und psychopathische Serienkiller, wird jedoch auch selbst nicht vom Schicksal verschont und verliert geliebte, ihr nahestehende Menschen.
Im Jahr 2011 erschien – außerhalb der Smoky-Barrett-Reihe – der Thriller »Der Menschenmacher«, in dem Opfer Selbstjustiz üben, um den Täter zu beseitigen. Cody McFadyens Thriller sind nichts für schwache Nerven, denn was er dem Leser serviert ist hart, zuweilen brutal und immer atemlos spannend.
Seine Bücher sind im deutschsprachigen Raum sehr beliebt und seine Fan-Gemeinde hierzulande ist rasant gewachsen.
Cody McFadyen lebt zurückgezogen und schreibt seine Bücher gern in einer privaten und häuslichen Umgebung. Er ist zum zweiten Mal verheiratet, Vater einer Tochter und lebt mit seiner Familie in Südkalifornien.
Cody Mcfadyen
Thriller
Übersetzung aus dem amerikanischen Englischvon Axel Merz
BASTEI ENTERTAINMENT
Vollständige E-Book-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG
Dieser Titel ist auch als Hörbuch erschienen
Titel der amerikanischen Originalausgabe: »The Truth Factory«
Für die Originalausgabe:
Copyright © 2016 by Cody Mcfadyen
Für die deutschsprachige Ausgabe:
Copyright © 2016 by Bastei Lübbe AG, Köln
Textredaktion: Wolfgang Neuhaus, Oberhausen
Umschlaggestaltung: Manuela Städele-Monverde
Einband-/Umschlagmotiv: © getty-images/Pando Hall; © shutterstock/Ensuper
E-Book-Produktion: Dörlemann Satz, Lemförde
ISBN 978-3-7325-3169-1
www.bastei-entertainment.de
www.lesejury.de
Für meine Freunde aus alten Zeiten –
ich werde eure Gesichter nie vergessen.
ICH GLAUBE
Wir werden geboren,
laufen über Blumenwiesen,
voll Freude und Erwartung,
und dann sterben wir.
CWM
KAPITEL 1
Es war einmal, geht es mir durch den Kopf, da wohnte hier eine Familie. Und wenn sie nicht gestorben ist …
Ich rümpfe die Nase, so scheußlich sind die Verwesungsgerüche. Sie sättigen die Luft, dick und schwer, und ich spüre (wie immer sehr lebhaft), dass ich mit jedem Atemzug den Tod inhaliere.
Es ist ein sinnloser Gedanke, aber wie üblich kann ich ihn nicht loswerden. So war es schon bei meiner allerersten Begegnung mit den Gerüchen des Todes gewesen; der abscheuliche Gestank hatte mir so zugesetzt, dass ich Hals über Kopf aus der Haustür in den Vorgarten geflüchtet war, die Hand vor dem Mund.
Ich hatte es gerade noch bis auf den Rasen geschafft, als mir die Kotze auch schon zwischen den gespreizten Fingern hindurchspritzte. Damit hatte ich zwar den Tatort unversehrt gelassen, war aber in die Fänge der Außenwelt geraten: Eine Gruppe von Cops und FBI-Leuten schaute zu, wie ich auf die Knie fiel und drei Viertel eines Cheeseburgers mit einer großen Portion Pommes herauswürgte. Von diesem Moment an hatte ich für ein paar Monate den Spitznamen »Kotzbrocken« weg.
Beim Schlucken habe ich das Gefühl, dass mir etwas Pelziges, Schleimiges durch die Kehle kriecht. Unwillkürlich schüttle ich mich. Der »Kotzbrocken« ist zwar Vergangenheit, aber die Erinnerungen sind noch wach, und sie sind so widerwärtig wie eh und je.
»Stinkt ganz schön«, meint Alan, der meine Gedanken gelesen hat. Er hat die Augen leicht zusammengekniffen, und seine Nasenflügel sind gebläht. Er schüttelt den Kopf. »Leichen sind eine verdammte Plage.«
»Sie sind lästig«, bestätige ich ihm.
Am lästigsten sind zweifellos die Mordopfer.
Ich stehe regungslos im Flur und sammle mich für das, was jetzt kommt. Es ist eine Sache, den Schauplatz eines Mordes zu betreten, eine ganz andere, der Realität des Todes zu begegnen, wenn man nicht richtig darauf vorbereitet ist. Dann möchte man am liebsten irgendwo anders sein; man wünscht es sich nicht nur, man sehnt es sich geradezu herbei.
Die Erinnerungen an den Anblick meines ersten Mordopfers sind frei von Regungen, welcher Art auch immer, und wenngleich es Erinnerungen an etwas sehr Reales sind, kommen sie mir jedes Mal unwirklich vor. Die Eindrücke, die ich mit dem Anblick der Leiche verbinde, sind Kompositionen aus verwaschenen Farben, völliger Stille und Tunnelblick. Ich weiß nicht mehr, welche Farbe der Teppich hatte, aber die Frauenleiche mit ihren unerträglichen Details steht mir noch heute deutlich vor Augen. Ich kann noch immer die Poren auf ihrer Nase sehen; ich erinnere mich an die Farbe ihres Nagellacks auf den Zehennägeln. Wenn ich die Augen schließe, kann ich sogar die Knoten in dem dünnen Hanfseil zählen, das straff um ihren Hals lag und sich tief ins Fleisch gegraben hatte.
Deshalb weiß ich heute, dass es besser ist, wenn man eine Zeit lang wartet und sich wappnet, um auf den Angriff der Verleugnung vorbereitet zu sein. Auf diese Weise kann man die Wirklichkeit leichter ertragen, wenn es an der Zeit ist, sich ihr zu stellen.
»Okay«, sage ich zu Alan, vor allem aber zu mir selbst. »Gehen wir.«
Ich verlasse den kleinen Flur, in den die Haustür mich geführt hat, und gehe los, ohne einen Blick zurückzuwerfen. In der Mitte des Zimmers, in das ich komme, bleibe ich stehen. Ich kann die Leichen jetzt aus den Augenwinkeln sehen. Ich rühre mich nicht vom Fleck, schließe die Augen und tauche ein in das überwältigende Gefühl des Lebendigseins; ich zähle meine Herzschläge, meine Atemzüge und sage stumm ein Mantra auf: Ihr Tod ist nicht dein Tod. Du bist die Lebende. Du lebst.
Dann nehme ich einen tiefen Atemzug, mache die Augen auf und wende mich den Leichen zu. Ich höre das Pling!, das den Beginn jener kurzen Zeitspanne markiert, während der mein Verstand nicht wahrhaben will, was meine Augen mir zeigen. Dieser Moment ist wie das Blitzlicht einer Kamera, ein grelles weißes Nichts.
Letzte Chance, warnt mich mein Verstand. Wenn du das nicht sehen willst, schau weg. Letzte Chance!
Dann wieder das Pling!, und das grellweiße Licht ist verschwunden. Mein Blick schärft sich, ebenso mein Verstand, und ich bin am Ziel. Keine verwaschenen Farben, kein Tunnelblick. Nur die Leichen in ihrer ungeschminkten Wahrheit und ich.
Die Gesichter der Toten starren mich an. In ihren lautlosen Schreien liegt endloses Entsetzen. Worte, die ich vor langer Zeit gelesen habe, kommen mir in den Sinn: Manche Dinge kann man nicht begreifen, nur beschreiben.
Ich zucke zusammen, als ich mir die Sauciere neben der Hand der toten Mutter genauer anschaue. »Ist das Blut?«
Alan beugt sich vor, schaut ebenfalls genauer hin. Er verzieht das Gesicht, nickt. »Sieht so aus.«
Wir sind in Colorado, im Norden von Denver. Es ist die erste Oktoberwoche und ein lausiges Stück kälter als in Südkalifornien. Und trockener. Die Leichen verfärben sich bereits, aber der Geruch ist längst nicht so schlimm, wie es im feuchtwarmen Kalifornien der Fall wäre.
Ich lese die Worte an der gegenüberliegenden Wand, geschrieben mit Blut. Zweifler müssen büßen, steht da. Hilf uns, Gerechtigkeit zu finden. Komm und lerne, Smoky Barrett.
Ein Frösteln durchläuft mich; kleine Füße aus Eis trippeln mein Rückgrat hinunter. Es muss mir anzusehen sein, denn Alan beobachtet mich aufmerksam. »Macht einen unruhig, den eigenen Namen in Blut geschrieben zu sehen«, sagt er.
»Halb so wild.« Mein Lächeln ist verkrampft. »Keine Bange, Mister Schwarzseher, mir fehlt nichts. Konzentrieren wir uns darauf, den Täter zu fassen.«
Er mustert mich, sucht nach Rissen in meiner Fassade. Als er keine findet, hebt er eine Braue. »Mister Schwarzseher?«
»Genau. Pessimist.«
»Hmmm. Schätze, es stimmt, was man so sagt.«
»Was sagt man denn?«
»Die Schwangerschaft macht eine Frau nicht gerade lustiger.«
»Sie sieht nur lustiger aus.«
»Kein Kommentar«, sagt er. »So dumm bin ich nun auch nicht.« Er zieht das kleine zerfledderte Notizbuch hervor, das er stets bei sich trägt, und blättert es durch. »Es ist das einzige von den drei Häusern mit einer Botschaft an der Wand, sagt Ned.«
Alan nennt sein Notizbuch »Ned«, weil er ein Notizbuch für den besten Freund eines Ermittlers hält, und ein bester Freund müsse nun mal einen Namen haben. Mir ist es egal, wie er das Ding nennt. Ich weiß nur, dass Alan jeder Kleinigkeit nachgeht, die in Ned festgehalten wird, und Ned vergisst nichts.
»Ich muss dieses Wort nachschlagen«, sagt er, mehr zu sich selbst. »Zweifler. Irgendwie kommt es mir bekannt vor.«
Ich schaue auf die Wand, auf das Wort, sorgfältig ausgeschrieben in sechzig Zentimeter hohem, klebrigem Rotbraun. »Ich habe es auch schon irgendwo gehört.« Ich krame in meinem Gedächtnis, jedoch vergebens. »Bin mir allerdings nicht sicher. Nur so ein Gefühl.«
»Nein, mehr als nur ein Gefühl«, meint Alan, wobei er sich Notizen macht. Er sieht mich an, lächelt und wedelt mit Ned. »Ned zufolge – und allen Neds vor ihm – hast du ein ziemlich gutes Gedächtnis.«
»Tatsache?«
»Klar. Ned lügt nicht.« Alan reckt sich, dass es knackt und knirscht. Dabei stöhnt er leise. Es ist, als würde man einen Berg dabei beobachten, wie er es sich bequem macht. Er ist ein großer Mann, mein Freund und Kollege. Nicht fett, nicht athletisch, sondern massig, respekteinflößend. Mir ist vor langer Zeit klar geworden, dass seine schiere Größe meine Wahrnehmung von allem, was er tut, beeinflusst. Alan denkt nicht, Alan grübelt. Er geht nicht, er stampft. Er steht nicht vor einem, er ragt vor einem auf. Wäre Alan Profi-Footballer gewesen, hätte er garantiert einen dieser typischen Spitznamen wie »Rammbock« oder etwas in der Art.
Er ist Afroamerikaner. »Groß und schwarz zu sein, ist keine Garantie, einen guten Vernehmungsbeamten abzugeben«, hat er mal zu mir gesagt, »aber schaden kann es auch nicht.« Da ist was dran, aber es ist bei Weitem nicht die ganze Wahrheit. Alans Größe ist trügerisch. Seine schärfste Waffe ist sein Verstand. Er war bereits zehn Jahre Mordermittler, bevor das FBI ihn sich an Land zog, und bekannt für seine Fähigkeit, Geständnisse erwirken zu können, die vor Gericht Bestand haben. Wir arbeiten seit mehr als zehn Jahren zusammen, und ich vertraue ihm blind.
Alan steht kurz vor dem FBI-Ruhestandsalter. Sein Gesicht sieht im Profil immer noch jung aus, trotz der ergrauenden Haare, aber in seinen Augen zeigt sich in letzter Zeit eine Müdigkeit, die ich zuvor nicht gesehen habe. Ich muss mich an den Gedanken gewöhnen, dass Alan sich bald verabschieden und das ruhige Leben führen wird, das er sich verdient hat.
Doch im Moment bin ich heilfroh, dass er hier ist. Ich bin das erste Mal in meiner neuen Rolle, in diesem neuen Scheinwerferlicht, und ich bin nervös. Ich reite ein neues Pferd, kaum anders als mein altes, aber größer, stärker und gefährlicher.
Ich habe den größten Teil meiner FBI-Laufbahn im Los Angeles Field Office des NCAVC verbracht, dem Bundesamt für die Analyse von Gewaltverbrechen. Die NCAVC-Zentrale befindet sich in Quantico, aber in jedem FBI-Büro gibt es einen Agenten, der für die Aktivitäten des NCAVC in seinem Bereich zuständig ist. In L.A. hatten wir genug zu tun, um ein Vier-Mann-Team zu beschäftigen. Wir jagen Serienkiller, Vergewaltiger und ganz allgemein Personen, die Dinge tun, über die Sie garantiert nichts erfahren wollen.
Vor zwei Monaten aber änderte sich alles. Samuel Rathbun, seines Zeichens FBI-Direktor, richtete auf Druck von oben eine Art Spezialkommando ein – eine Einheit, die mit den gleichen Aufgaben betraut war wie unser Team in L.A., allerdings auf nationaler Ebene. Es ging darum, die Doppelfunktionen des NCAVC abzubauen und die Größe der Zentrale zu verringern.
»Gewisse Entscheidungsträger sind zu dem Schluss gelangt, dass das NCAVC zu viele Ressourcen verschwendet«, meinte Rathbun kopfschüttelnd, als er mir offiziell den Job als Chefin des Spezialkommandos anbot. »Ungeachtet der Tatsache, dass unser Budget im Vergleich zu den Aufwendungen für die Terrorbekämpfung wie eine Hütte neben einem Wolkenkratzer aussieht.« Er bedachte mich mit einem skeptischen Blick. »Ich habe nicht die Absicht, als der Direktor in die Geschichte einzugehen, der dem FBI die Fähigkeit genommen hat, den staatlichen Behörden Hilfestellung bei der Verfolgung von Psychopathen und Serienkillern zu leisten.« Er schüttelte heftig den Kopf. »Die Verderbtheit dieser Monster ist für normale Menschen schwer vorstellbar und wird deshalb gern infrage gestellt. Aber wir wissen Bescheid, nicht wahr?«
»Oh ja, Sir.«
»Und deshalb zweifeln wir nicht daran.« Er trommelte mit den Fingern auf die Schreibtischplatte. »Wir sind dafür verantwortlich, solche Bestien aus dem Verkehr zu ziehen. Und dabei interessiert es mich einen Scheiß, ob irgendein hochrangiger Schreibtischhengst sich dabei übergangen fühlt.«
Dann bat er mich, die Leitung der neuen Einheit zu übernehmen und mein eigenes Team mit einzubringen. Ich war einverstanden – vorerst.
Und dies hier ist nun unser erster richtiger Fall. Und die ganze Nation schaut zu, und das nicht nur im übertragenen Sinne.
Drei Familien sind abgeschlachtet worden, alle im gleichen Häuserblock, alle in der gleichen Nacht. Einer der örtlichen Cops hatte meinen Namen in der blutigen Inschrift an der Wand gelesen und sich sofort mit dem FBI in Verbindung gesetzt. Die Behörden in Denver haben uns um Hilfe ersucht, was ich als gutes Zeichen werte. Denn es bedeutet, dass sie mehr daran interessiert sind, den Fall zu lösen, als an der Frage, wem später die Lorbeeren zukommen. Es bedeutet außerdem, dass sie sich überfordert fühlen. Was sie unbestreitbar auch sind.
Innerhalb einer Stunde saßen wir in einem Privatjet, und keine drei Stunden später landeten wir auf dem Denver International Airport.
Ich betrachte die blutige Schaubühne, die der Killer für uns hergerichtet hat. Die Wiltons waren eine intakte fünfköpfige Familie gewesen: Mutter, Vater und drei Kinder, zwei Mädchen und ein Junge. Das ältere Mädchen war vierzehn, das jüngere zwölf, der Junge fünf. Der Esstisch ist mittelgroß und aus dunklem, glattem Holz. Der Killer hat die Leichen der Mutter und des Vaters an die Schmalseiten des Tisches gesetzt. Die abgetrennten Köpfe sitzen wieder auf ihren Hälsen. Der Killer hatte allerdings keine Lust, die Köpfe genau auszurichten, oder sie sind ein wenig verrutscht, was den Toten ein fremdartiges, unwirkliches Aussehen verleiht. Ein Anblick, der einen verfolgt, wenn man das Zimmer verlässt.
Der Vater und die Töchter waren brünett, die Mutter blond. Der Tisch war für zwei gedeckt worden. Mr. und Mrs. Wilton haben jeder einen weißen Porzellanteller vor sich stehen. Der Killer hat ihnen Gabeln in die Hände gedrückt.
»Silberbesteck.« Ich zeige auf die Gabeln. »Für besondere Anlässe.«
»Woher willst du das wissen?«
»Meine Mutter hatte so ein Besteck von meiner Großmutter geerbt. Sie hat es nie in den Geschirrspüler getan, sondern jedes Stück mit Silberpolitur von Hand geputzt. Silber reflektiert das Licht anders. Es hat mehr … ich weiß nicht, der Glanz hat irgendwie mehr Tiefe.«
»Wow. Ein vornehmes Besteck«, zieht Alan mich auf. »Ich wusste bis jetzt noch gar nichts von deinen aristokratischen Wurzeln.«
Ich schnaube abfällig. »Nach dem frühen Tod meines Urgroßvaters hat meine Uroma fünf Jahre lang als Prostituierte gearbeitet. Das Silber war die Bezahlung für ein Wochenende der Lust.«
»Du willst mich verarschen.«
»Nein, die Geschichte ist wahr. Zu dem Tafelsilber gehörte ein Brief, in dem Urgroßmutter erzählt, wie es dazu gekommen war, dass sie anschaffen musste. Außerdem verlangte sie, das Silber nur von der ältesten Tochter zur ältesten Tochter weiterzugeben, und wenn es keine gibt, an den ältesten Sohn.« Ich hebe den Finger. »Und man durfte das Erbe nur unter der Bedingung annehmen, es niemals zu verkaufen, es sei denn, man will verhindern, dass man sich selbst verkaufen muss.«
»Wow« ist Alans Kommentar.
»Meine Mom hat mir das Besteck nie offiziell übergeben. Dad gab es mir erst, nachdem sie gestorben war, zusammen mit dem Brief.«
Ich weiß noch, wie ich den Brief las, der mir wie ein Licht in dunkler Nacht erschienen war. Ich war ein Teenager, allein auf der Welt, mit nichts als dem Brief und dem Silber, das mich mit jener Frau verband, die sich vor langer Zeit hatte verkaufen müssen, um den Unbilden einer Existenz in einer Welt voller Gleichgültigkeit zu trotzen. Urgroßmutter hatte einen Teil dieses Blutgelds mitsamt ihrer Geschichte in die Zukunft geschickt, in der Hoffnung, dass kein weiblicher Nachfahre das Gleiche tun müsse wie sie.
»Starke Frau«, sagt Alan.
»Der Gedanke, was mit den Kindern geschieht, wenn man nicht mehr da ist, lässt einen nie in Ruhe. Ganz gleich, wie alt sie werden.«
»Ja, wahrscheinlich«, sagt Alan, und sein Blick schweift zurück zu den Wiltons.
Die Kinder sind nicht verstümmelt worden. Der Killer hat die Leichen der Töchter entkleidet und der Länge nach auf den Tisch gelegt.
»Sie müssen sehr hübsch gewesen sein.« Meine Stimme ist ganz leise.
»Ja«, sagt Alan. Mehr nicht.
Die Mädchen haben eine Haut wie Sahne, makellos, rein und unschuldig, doch nun spannt sich diese Haut unnatürlich über den hervorstehenden Knochen. Die ständigen, nahezu unmerklichen Bewegungen, die ein Lebender vollführt, um den Körper auszubalancieren, sind nicht mehr notwendig, und so wirken die Leichen seltsam schwer. Sie erinnern mich an zwei auf dem Rücken liegende Statuen, gemeißelt aus weißem Alabaster und zu kalter Perfektion poliert. Bei beiden Mädchen liegt der Hinterkopf auf einem Essteller. Ihre Augen, die bereits trüb werden und in den Höhlen schrumpfen, sind auf die Eltern gerichtet.
Beide Mädchen haben das Gesicht ihrer Mutter, jedoch in unterschiedlichen Altersstufen. Diese Unterschiede sind so krass wie die Ähnlichkeiten, erst recht angesichts ihrer nackten Körper, und es schmerzt, wenn ich daran denke, was für wunderschöne Frauen diese Mädchen geworden wären.
»Sie haben Male am Hals«, stelle ich das Offensichtliche fest. »Und petechiale Blutungen in den Augen.«
Alan nickt bloß.
»Wo ist der Leichnam des Jungen?«
»In seinem Bett«, sagt Alan.
»Auf die gleiche Weise ermordet? Ebenfalls nackt?«
Alan konsultiert Ned, sein Notizbuch. »Er wurde mit einem Kissen erstickt. Und nein, der Killer hat ihn nicht nackt ausgezogen.«
Mir kommt der gleiche Gedanke wie zu Anfang, beim ersten Blick auf diesen Tatort. Der Killer war kein Amateur.
»Also, wir haben hier unten vier Tote, ein fünfter liegt oben im Haus«, ziehe ich eine Zwischenbilanz. »Und es gibt zwei weitere ermordete Familien hier im Wohnblock.« Ich zwicke mich in die Nasenwurzel und schließe die Augen. »Das sind verdammt viele Tote, selbst für die Art von Verrückten, mit denen wir es normalerweise zu tun haben. Außerdem wurden die Morde ohne erkennbares Zögern verübt, und der Tatort wurde bemerkenswert sauber zurückgelassen.«
»Es sind nicht seine ersten Morde«, sagt Alan und schreibt etwas in Ned.
Wir schweigen eine Zeit lang, leisten den Toten stumme Gesellschaft und denken über Alans Worte nach, dass es nicht die ersten Morde dieses Täters sind. Es wäre schlimm, wenn er recht hätte.
Wieder schaue ich auf die Botschaft, die der Mörder für mich hinterlassen hat. Worte in Blut, geht es mir durch den Kopf.
Ich stelle ihn mir vor, den Killer, hier, im Dunkel, wie er den Finger in die mit Blut gefüllte Sauciere taucht und seine düstere Nachricht, deren Bedeutung sich mir noch immer verschließt, an die Wand malt.
Du hast es bestimmt genossen, geht es mir beim Anblick der getöteten Wiltons durch den Kopf. Dir kam es nicht darauf an, wer oder was diese Leute waren. Dir ging es nur um das, was sie für dich sein sollten. Das hier ist deine Vorstellung von alldem, die du mit hierher gebracht und deinen Opfern aufgezwungen hast.
»Drei Familien«, überlege ich laut. »Das bedeutet intensive Überwachung. Er musste die Verhaltensmuster der Nachbarn herausfinden. Zum Beispiel, wann sie zu Hause sind und wann nicht. Wenn er besonders gründlich war, hat er vielleicht sogar Persönlichkeitsprofile erstellt, damit er im Vorhinein weiß, wie seine Opfer sich verhalten.« Ich verstumme, wäge alles ab. »Er brauchte etwas, um sie zu überzeugen. Ein starkes Argument, das augenblicklich jeden Gedanken an Widerstand bricht.«
Alan denkt kurz nach, dann nickt er. »Macht Sinn. An was denkst du?«
Ich überlege, während ich den Blick über die Szenerie schweifen lasse, von einem blinden Gesicht zum nächsten. »Er hat drei Familien in einer Nacht ermordet und die Tatorte sauber zurückgelassen. Wir können mit ziemlicher Sicherheit davon ausgehen, dass es kein Glück war, sondern Routine. Die beste Strategie ist ein brutaler, lähmender Schlag, der allen zeigt, wer Herr der Lage ist. Der keinen Zweifel daran lässt, dass man es todernst meint.«
»Dann wäre der Vater das naheliegende Ziel«, sagt Alan. »Unterwirf den Vater als Ersten. Mach es schnell und vor allem brutal, und der Rest der Familie fügt sich in sein Schicksal.«
Väter sind im Allgemeinen das Symbol der Stärke und des Schutzes für ihre Kinder. Das Symbol schlechthin. Deshalb ist es für die meisten Kinder ein traumatisches Erlebnis, einen Vater schluchzen zu sehen. Und zusehen zu müssen, wie ein Vater zerbrochen wird, ist geradezu vernichtend.
»Also gut.« Ich gehe langsam um den Tisch herum, Alan im Schlepptau, um die Leichen noch einmal sorgfältig zu betrachten. »Da.« Ich zeige auf das, was ich meine. »Der Arm, siehst du?« Tatsächlich hängt der linke Arm des Vaters schlaff herab, ein Detail, das uns bisher entgangen ist.
Alan geht in die Hocke, um einen genaueren Blick daraufzuwerfen, und stößt einen leisen Pfiff aus. »Der Killer hat ihm den Daumen abgeschnitten. Und es sieht so aus, als hätte er ihm jeden Finger einzeln gebrochen.«
Ich höre die Schreie der Opfer in meinem Kopf. Hätten die Nachbarn nicht etwas hören müssen?
Ich löse mich von diesem Gedanken, konzentriere mich auf die anderen Toten, kann aber keine weiteren Hinweise auf Folter entdecken.
»Ich glaube, das alles hier hat eher mit Zweckmäßigkeit zu tun als mit Lust oder Vergnügen«, sage ich schließlich zu Alan. »Es ging ihm um Kontrolle, nicht um Genuss.«
Alan nickt. »So sehe ich das auch.«
»Man sieht immer noch das Entsetzen in ihren Gesichtern. Wie hat er sie umgebracht?«
»Enthauptung, meint der Gerichtsmediziner. Mit einer langen scharfen Klinge.« Alan schaut mich an.
Verwundert erwidere ich seinen Blick. »Er glaubt, der Killer hat sie mit einem Schwert geköpft?«
»Die Schnitte sind sauber. Das spricht dafür, dass die Köpfe mit einem einzigen wuchtigen Schlag abgetrennt wurden.« Alan zuckt die Schultern. »Ist natürlich nur eine Arbeitshypothese.«
»Jedenfalls könnte es erklären, weshalb der Ausdruck auf ihren Gesichtern erhalten blieb, als sie starben.« Ich atme tief durch. »Ein Schwert als Mordwerkzeug ist allerdings neu für mich.«
»Für mich nicht. Es gab da mal den Killer einer Latino-Bande, der seinen Opfern den Kopf abschlug, falls er sie nicht in einen Stapel alter Autoreifen steckte, die er dann mit Benzin übergoss und anzündete.« Alan verdreht die Augen. »Die Presse nannte ihn den Michelin-Mann.«
Der Gedanke lässt mich schaudern, obwohl ich in den mehr als zehn Jahren, die ich im Dienst des FBI die perversesten Irren jage, Schlimmeres gesehen habe. Warum ich diesen Beruf ausübe? Weil ich es am besten kann. Vielleicht bin ich dafür geboren. Ich habe die Gabe, in die Köpfe dieser Täter schauen zu können, mich in ihren kranken Verstand hineinzuversetzen, jedenfalls ein Stück weit, und mich gemütlich einzurichten neben dem schwarzen verpesteten Pfuhl, in dem sie lauern, unter dem gleichen sternenlosen Nachthimmel, unter dem sie auf Beutezug gehen.
Die meisten Menschen sind nicht imstande, das Böse zu begreifen, weil sie sich weigern, dessen Schlichtheit zu akzeptieren. Gute Menschen sind komplexe Wesen, die gegen die primitiven Triebe ankämpfen, die jeder von uns hat. Schlechte Menschen dagegen sind meist einfach gestrickt und geradeaus; sie werden nicht behindert von Gewissensbissen, sondern steuern stur und voll unerschütterlicher Gewissheit ihr Ziel an. Sie hinterfragen ihre Bedürfnisse nicht. Sie kriechen dicht am Rande unserer Wahrnehmung um uns herum, unsichtbar und unerkannt, und beobachten uns, während wir unsere Träume träumen, unsere Kinder großziehen und unser Leben lieben (oder hassen). Sie behalten uns im Auge, wachsam, lauernd, und singen dabei leise ihre Lieder, die nur sie selbst hören können und andere von ihrer Sorte. Es sind Lieder über den Tod, den Schmerz und die Angst. Lieder über Blut, leuchtend rot auf weißem Porzellan, und von gebräunter Haut, die grau und nass an einem dunklen Ort verwest. Sie singen. Und manchmal kommen sie aus den Schatten, treten hinaus in unser Licht und singen für uns. Es ist stets ein Klagelied, ein Trauergesang, der vom Jüngsten Gericht kündet wie das Horn des Erzengels Gabriel. Jedes dieser Lieder ist einzigartig. Kann sein, dass sie sich ähnlich anhören, aber sie sind niemals gleich.
Ich lausche diesen Sängern der Finsternis und sammle ihre Lieder. Ich bin keiner von ihnen, aber ich kann sie verstehen. Ich fühle mich von ihren Liedern angezogen, von ihrer Musik, wie ein Schiff von den Felsen. Ich höre, wo andere nichts hören, weil ich die Wahrheit gesehen habe.
Diese gespenstischen Sänger sind um uns herum, immerzu und überall, und sie sehen aus wie wir. Sie sind Väter, Brüder, Onkel, Tanten. Sie sind die netten Lehrer, die kleinen Mädchen beim Sportunterricht in den Schritt fassen, nachdem sie sich deren Vertrauen erschlichen haben. Sie sind der Ehemann, der eine Straßenhure erwürgt, bevor er nach Hause geht und seine Frau vögelt. Sie sind die Frau, die ihr Baby mit einem Kissen erstickt hat, weil es zu laut schrie, und die man jeden Sonntag in der Kirche sieht.
Ja, ich habe den Gesang dieser Kreaturen gehört. Die Fähigkeit, ihre Lieder hören zu können, ist eine Gabe, aber man zahlt einen hohen Preis dafür – den, zu erkennen. Der Unterschied zwischen dem nüchternen Wissen und dem emotionalen Erkennen liegt im Sehen. Solange man das Monströse nicht gesehen hat, kann man es anzweifeln. Der Verstand will nicht glauben, dass es solche Abgründe gibt, bevor die eigenen Augen sie nicht erblickt und der Verstand sie nicht erfasst hat. Aber glauben Sie mir – dieses Erfassen ist zerstörerisch. Es verändert einen, grenzt einen ab vom Rest der Menschheit.
Ich schaue in die toten Augen des Ehemannes, dann in die Augen seiner Frau.
»Was wart ihr für ihn?«, frage ich die beiden leise. »Wer wart ihr für ihn?«
Meine Blicke schweifen durchs Zimmer, suchen nach etwas, das wir vielleicht übersehen haben und das uns Antworten geben könnte. Aber da ist nichts.
Ich schaue wieder auf die tote Familie.
Wer wart ihr?, frage ich stumm. Die Toten geben keine Antwort, also beantworte ich meine Frage mit einem Versprechen an sie und mich selbst: Ich werde es herausfinden. Das Gute, das Schlechte und alles andere. Ich finde es heraus, und ich werde es nie vergessen.
Das ist kein leeres Versprechen. Ich kann mich an die Gesichter aller meiner Toten erinnern.
»Es fühlt sich irgendwie … persönlich an«, sage ich. »Merkwürdig.«
»Inwiefern?«, fragt Alan.
Ich schüttle den Kopf. »Ich weiß nicht … Es ist so steril, so leidenschaftslos. Als wäre die Botschaft wichtiger als das Töten an sich.«
Und auch das ist bizarr, überlege ich. Warum die Beute erlegen, wenn sie nicht das ist, was du fressen willst?
»Und was ist die Botschaft?«
»Keine Ahnung.« Ein Tritt gegen die Innenseite meiner Bauchdecke lässt mich zusammenzucken. »Autsch! Kleiner Mistkerl!«
Alan hebt eine Augenbraue. »Alles in Ordnung?«
»Ja. Das Alien in mir ist wach, weiter nichts.«
Er sieht mich finster an. »Du solltest ihn nicht mehr so nennen. Das ist nicht richtig.«
Alan scheint es ernst zu meinen, also lächle ich ihn an, ungeachtet unserer grausigen Umgebung. »Ich könnte ihn Klumpen nennen … oder kleines Ding.«
»Sehr witzig!«
Ich bin knapp eins fünfzig, und meine Schwangerschaften sind sehr deutlich zu sehen. Bei meiner Tochter Alexa war mein Bauch so groß, dass ich nicht mehr Auto fahren konnte. Diesmal bin ich nicht ganz so dick (was mich manchmal nervös werden lässt, wenn ich den Fehler mache, darüber nachzudenken), aber niemand käme auf den Gedanken, meinen Bauch als klein zu bezeichnen. Er eilt vor mir her durch Türen und Gänge und betritt jedes Zimmer ein kleines bisschen eher als ich.
Ich schaue an mir hinunter und muss mir ein Grinsen verkneifen. Deine Titten sind auch größer geworden. Normalerweise habe ich Körbchengröße B, aber jetzt reicht C kaum noch, und wahrscheinlich ist demnächst Größe D an der Reihe. Mein Hintern ist eine andere Geschichte. Ich hatte schon immer einen großen Hintern. Ich bin athletisch gebaut, sodass das eigentlich ein Aktivposten ist, aber die Schwangerschaft ist keine sonderlich sportliche Zeit, und so hat sich der große Hintern in einen dicken Hintern verwandelt.
Ich bin seit siebeneinhalb Monaten schwanger, und mein Sohn ist inzwischen ziemlich rege. Manchmal frage ich mich, ob er mich mit seinen Tritten ermahnen will, ihn nicht an solche Orte des Todes mitzunehmen. Als ich mich ein weiteres Mal im Zimmer umschaue, spüre ich, wie er sich schon wieder bewegt. Es macht mich unruhig. Spürt er das Grauen, die Gewalt? Werden diese Schrecken ihn irgendwie beeinflussen?
Er rührt sich ein weiteres Mal, als wollte er Ja sagen, und mich überläuft eine Gänsehaut.
»Jesses.« Ich flüstere es beinahe. »Du hast vielleicht eine Art, einem Angst zu machen.«
»Wer?«, fragt Alan.
»Fred. Nennen wir ihn für den Augenblick Fred. Okay?«
Er zuckt die Schultern. »Ziemlich fad, aber jeder Name ist besser als ›Alien‹.«
Ich streichle mit der Hand über meinen Leib, rede mit dem Leben darin. Worte braucht es nicht, da mein ungeborener Sohn und ich auf andere Weise verbunden sind. Manchmal habe ich Angst, weil mein Sohn mir so viel Glück schenkt. Es ist ein Leuchten in mir, ein Versprechen, gegeben in beide Richtungen, auf eine Zukunft voller Licht und Wärme.
Meine Gedanken werden unterbrochen, als die Eingangstür sich öffnet, gefolgt vom Geräusch klappernder Absätze auf den Fliesen im Flur. Dann kommen die beiden anderen Mitglieder meines Teams ins Esszimmer. Sie schweigen ein paar Sekunden, während sie den Anblick der Wiltons in sich aufnehmen.
»Das ist ja grässlich«, sagt Callie dann.
James mustert sie verärgert. »Die Komposition ist die gleiche wie in den anderen Häusern«, erklärt er. »Mutter und Vater enthauptet und an den Kopfenden des Tisches positioniert. Die Töchter erdrosselt, nackt ausgezogen und auf dem Tisch drapiert.« Ich sehe, wie er das Besteck in Augenschein nimmt. Er nickt. »Er hat auch in den anderen Häusern das Tafelsilber benutzt.«
»Gab es in einer der anderen Familien einen Sohn?«, frage ich.
»Die Aymans hatten einen zwölfjährigen Jungen. Er wurde im Bett ermordet. Der Täter hat ihn nicht mit an den Tisch gesetzt. Und hier?«
»Ein kleiner Junge«, antworte ich. »Oben im Bett. Noch angezogen.«
»Eigenartig.« James runzelt die Stirn. »Hast du nicht auch das Gefühl, das alles hier ist gestellt? Ich meine nicht die Opfer oder die Morde, sondern alles.« Er deutet auf die Szenerie.
Ich bin nicht überrascht, dass er meine eigenen Gedanken wiederholt. James Giron ist der Jüngste von uns, ein Misanthrop ohne jeden Hauch gesellschaftlicher Umgangsformen, aber ein Genie. Sein Verstand arbeitet doppelt so schnell wie bei uns anderen, und er ist scharfsinniger als wir alle zusammen. Außerdem teilt er meine Gabe. Er ist ein Liedersammler wie ich. Als er zwölf war, wurde seine ältere Schwester ermordet. Von einem Serienmörder. Mit einer Lötlampe. Bei ihrem Begräbnis schwor er sich, zum FBI zu gehen. Er schloss mit sechzehn die Highschool ab und studierte Kriminologie. Mit einundzwanzig hatte er seinen Doktor.
Callie beobachtet uns, die Stirn gefurcht. »Die Tatorte sind ungewöhnlich sauber«, stellt sie fest. »Erst recht, wenn man bedenkt, dass die Opfer enthauptet wurden.« Sie umrundet den Tisch, schnüffelt. »Ich rieche weder Pipi noch Kaka. Sehr ungewöhnlich.«
Ich schaue sie verdutzt an. »Pipi? Kaka?«
»Ich arbeite an meiner Ausdrucksweise, Süße, als Vorbereitung auf die Geburt meines Neffen.«
»Die Mühe kannst du dir sparen.« Ich seufze. »Ich kriege es nicht mal hin, auf ›verdammt‹ und ›verflucht‹ zu verzichten. Ich glaube, das liegt an den verdammten Hormonen.«
»Ich muss doch sehr bitten.« Callie reckt die Nase in die Höhe. »Mein Neffe jedenfalls wird niemals fluchen wie ein beschissener Bierkutscher.«
Alan lacht leise.
Callie hat einen Master in Forensik und Kriminologie. Sie spricht von meinem ungeborenen Sohn als »Neffe«, aber wir sind nicht verwandt; es liegt daran, dass wir einander so nahestehen. Respektlosigkeit ist sozusagen ihr Hobby, vielleicht sogar ihre Religion. Wir sind ungefähr im gleichen Alter, und sie war für mich da in der schlimmsten Zeit meines Lebens. Sie kannte meinen ersten Mann, und sie liebte meine erste Tochter.
Dieses Jahr hat sie geheiratet und damit die lüsternen Träume vieler Männer zunichtegemacht. Denn sie sieht verdammt gut aus, unsere Callie. Sie ist ein großer, schlanker, langbeiniger Rotschopf mit dem Körper eines Models. Ihre Heirat hat uns alle überrascht – bis zu diesem Moment hatte niemand gewusst, dass Callie einem Mann überhaupt so nahe kommen könnte. Ich freue mich unheimlich für sie, weil ich immer schon die Wahrheit kannte: Callie war genauso allein wie wir anderen, und wie wir hatte sie ihre Gründe dafür. Ich kenne diese Gründe, und ich habe Callie leiden sehen. Ich habe erlebt, wie sie beinahe zerbrochen wäre, und ich kam mir dabei klein und schäbig vor. Callie weinen zu sehen ist so, als würde Wasser nach oben fließen, oder als wäre der Polarstern plötzlich vom Himmel verschwunden. Doch ihre Heirat lässt hoffen, dass sie darüber hinweg ist.
»Wirklich seltsam, diese aberwitzige Sauberkeit«, sagt sie nun und betrachtet wieder die Leichen der Wiltons. »Folter ist blutig. Verstümmelungen ebenso. Wahrscheinlich hat der Täter das Blut im Badezimmer weggespült. Warum, wollt ihr wissen?« Sie breitet die Arme aus und lächelt uns glückselig an, uns kleine ahnungslose Zwerge. »Weil es ihm mehr um die Botschaft geht als um die Tat.«
»So weit waren wir auch schon«, sagt James gähnend.
»Kommt, Leute, Spaß beiseite«, mahnt Alan. »Wie lautet die Botschaft?«
»Er hat die Töchter nackt auf den Tisch gelegt«, sagt James. »Wie Opfer. Beinahe wie eine Speise. Was will er damit sagen? Dass die Eltern ihre Kinder fressen?«
Callie verzieht das Gesicht. »Falls es tatsächlich so gemeint ist, heißt es dann: Diese Eltern fressen ihre Kinder? Oder alle Eltern fressen ihre Kinder?«
Ein Flugzeug fliegt über uns hinweg. Der Boden knarrt ohne erkennbaren Grund.
»Es könnte eine Metapher sein«, überlege ich laut und reibe mir die Stelle, wo einst mein kleiner Finger war. »Sexueller Missbrauch? Misshandlung? Vernachlässigung?«
»Und wieso liegen die Jungen in ihren Betten?«, fragt Alan.
»Gute Frage«, muss ich zugeben.
»Ich glaube nicht, dass es mit den Dingen zu tun hat, die du eben genannt hast, Smoky«, sagt James.
Ich schaue ihn an. »Warum nicht?«
Er hebt drei Finger. »Drei Familien im gleichen Wohnblock. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie das gleiche dunkle Geheimnis teilen? Sehr gering. Wie stehen die Chancen, dass die drei Familien überhaupt ein Geheimnis haben? Ein bisschen besser, aber immer noch sehr dürftig. Ich glaube eher, der Killer hat sich für diese Straße entschieden, weil er hier genau den Pool an Opfern vorgefunden hat, den er brauchte.«
»Und das muss irgendeine Botschaft sein«, bemerkt Alan. »Wichtig genug, dass er dafür in einer einzigen Nacht drei Familien in ein und derselben Wohngegend abschlachtet.«
Und das wiederum könnte bedeuten, dass es dem Täter wichtig genug ist, um es noch einmal zu tun, geht es mir durch den Kopf. Na fabelhaft.
Ein paar Haarsträhnen bewegen sich geisterhaft an Mr. Wiltons Hinterkopf, als James langsam an ihm vorbeigeht. Mich überläuft eine Gänsehaut, auch wenn ich weiß, dass es an der Trockenheit und der statischen Elektrizität liegt, erzeugt von der Bewegung.
Wie lange weißt du schon, was du bist?, frage ich den gesichtslosen Killer. Wie lange hast du dir Zeit gelassen, um alles für diesen einen Augenblick vorzubereiten?
Es gibt eine Gemeinsamkeit, die sich bei Verhören von Serientätern häufig herausschält. Es ist die Vorstellung, immer schon gewusst zu haben, dass sie eines Tages morden werden. Es ist eine Art der Selbstwahrnehmung, die sie dazu bringt, die Schwächen anderer zu studieren und möglichst viel daraus zu lernen. Sie wissen, dass sie sich vom Rest der menschlichen Spezies unterscheiden, weil sie aus purem Vergnügen morden, aus Lust, und dass es für sie kein Zurück gibt. Als ich in der Ausbildung in Quantico war, habe ich ein Zitat von einem Serienkiller namens David Gore gelesen. Ich habe es auswendig gelernt.
»Plötzlich, wie aus heiterem Himmel wurde mir klar, dass ich soeben etwas getan hatte, was mich von der menschlichen Rasse trennt. Etwas, das ich nie wiedergutmachen konnte. Mir wurde klar, dass ich von diesem Moment an nie mehr wie ein normaler Mensch sein würde. Ich habe sicher zwanzig Minuten in diesem Zustand dagestanden. Nie zuvor hatte ich eine solche Leere in mir gespürt. Ich werde dieses Gefühl niemals vergessen. Es war, als wäre ich in ein Reich eingetreten, aus dem es kein Zurück gab.«
Ich habe mir dieses Zitat gemerkt, weil es eine grundlegende Wahrheit zeigt: Dieser Mann war durchaus imstande, die Tragweite seines Handelns zu begreifen. Er mordete trotzdem, weil er süchtig danach war. Wer imstande ist, diese Hölle in sich selbst zu erkennen, weiß sehr genau, was auf dem Spiel steht.
Organisierte Serienkiller lernen aus ihrem Tun und variieren ihre Methoden, um nicht gefasst zu werden. Das dürfte mit ein Grund dafür sein, weshalb es bei Serienmorden oft keine Zusammenhänge zu geben scheint. Deshalb suchen wir im Leben ihrer Opfer nach Verbindungen, wie klein und unbedeutend sie auch sein mögen. Vielleicht sind sie alle in das gleiche Fitnessstudio gegangen, und ihr späterer Mörder war damals ihr Trainer. Vielleicht haben sie zehn Jahre zuvor auf dem gleichen College ihren Abschluss gemacht, und der Mörder ist ein ehemaliger Lehrer.
Wenn James recht hat, und der Killer hat diese Straße nur deshalb ausgewählt, weil er hier genau die Opfer fand, die er brauchte, macht es unsere Arbeit schwieriger. Dann nämlich wären sämtliche Verbindungen zufällig.
James betrachtet die Botschaft an der Wand. »Das Blut muss noch warm gewesen sein«, meint er. »Seht ihr, wie ein paar Buchstaben verlaufen sind?«
Es war mir vorher gar nicht aufgefallen, aber jetzt sehe ich es ebenfalls. Dünne rote Rinnsale ziehen sich die weiß schimmernde Wand hinunter, einige bis zur Fußleiste.
»Eine interessante Wortwahl«, fährt James fort. »›Komm und lerne‹, nicht ›Komm und sieh‹. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das Zufall ist.«
»Komm wohin?«, murmelt Alan. »Lerne was?«
Im Zimmer wird es plötzlich heller, obwohl die Vorhänge zugezogen sind, und das unterbricht unser Gespräch. Die bestialischen Morde an den drei Familien haben Scharen von Reportern angezogen wie Motten das Licht. Draußen auf der Straße ist es hell wie bei einem nächtlichen Karneval, und die Lightshow wird immer spektakulärer.
»Ein echtes Irrenhaus da draußen«, bemerkt Callie abfällig.
»Gott sei Dank sind es bis jetzt nur die örtlichen Medien.« Ich schaue auf die Uhr. »Aber das wird sich bald ändern. Bis zum Morgen ist das ganze Land hier.«
»Wen kümmert das?«, sagt James verächtlich. »Ich schaue mir keine Nachrichten an. Mich würde viel mehr interessieren, wie wir jetzt weiter vorgehen. Alles andere ist ja wohl scheißegal.«
Ich stoße einen resignierten Seufzer aus. Ich nehme einen James Classic, überlege ich. Mit einer kleinen Portion Arschgesicht. Zum Mitnehmen. Aber ich bin zu müde und zu schwanger, um mich über James zu ärgern. Ich bin allerdings nicht zu müde, um das kleine neue Nugget an persönlichen Informationen zu speichern: James schaut sich keine Nachrichten an. Ich füge dieses Detail den anderen auf meiner James-Liste hinzu, einer sehr kurzen Liste, denn James ist die Personifizierung des Begriffs »Privatsphäre«. Wir haben nur durch Zufall erfahren, dass er schwul ist, aber wir haben nie jemanden kennengelernt, mit dem er sich trifft. Und seiner Mutter bin ich nur ein einziges Mal begegnet. Sie scheint eine nette Frau zu sein. Ich würde sie trotzdem nur mit »Mrs. Giron« ansprechen. Ich weiß nicht viel über die Familie. Eigentlich gar nichts. Ach ja, James habe ich mal einen Dylan-Song summen hören, aber er hat sofort aufgehört, als er bemerkt hat, dass ich zuhöre. Der Rest ist ein Mysterium.
»James«, sage ich.
Sein Kopf ruckt zu mir herum. »Ja?«
»Wir gehen jeden der drei Tatorte gemeinsam durch, jetzt sofort. Du, Callie, nimmst mit den örtlichen Forensikern Verbindung auf. Sieh zu, dass sie ihre Sache ordentlich machen. Sollte das nicht der Fall sein, hilfst du ihnen.«
Sie nickt mir zu. »Schon dabei. Und keine Bange, diese Provinzler haben ein vernünftiges Team hier vor Ort.«
»Ich möchte trotzdem, dass du denen über die Schulter schaust. Wenn sie deswegen sauer sind, haben sie eben Pech gehabt. Alan, ich brauche dich in deiner Funktion als ehemaligen Cop. Bring die Einheimischen dazu, dass sie uns mögen.«
»Und dann?«
»Holst du an Informationen aus ihnen raus, so viel du kannst.«
»Ich soll mal wieder das Vertrauen der Leute erschleichen, damit wir sie anschließend umso besser ausquetschen können?«, sagt er in gespieltem Unmut. »Gott, ich hasse diese Rolle.«
»Aber keiner spielt sie so gut wie du.« Callie klimpert kokett mit den Wimpern. »Du betörst uns alle mit deinem vertrauenerweckenden Äußeren, du süßer schwarzer Bär.«
Alan schaut sie an. »Spricht da mal wieder die Weisheit des Alters aus dir?«
Callie richtet sich zu voller Größe auf und schürzt die Lippen. »Ich denke, ich bin hier fertig«, sagt sie naserümpfend und wendet sich ab. »Wenn das so weitergeht, werde ich meine Versetzung beantragen.«
»Ach, Callie, lass diese leeren Versprechungen«, entgegnet Alan.
Amüsiert verfolge ich ihr Spielchen. Ein Außenstehender würde es als respektlos gegenüber den Wiltons empfinden, aber das wäre ein Irrtum. Das Geplänkel ist ein Selbstschutz, um ein bisschen besser mit dem Grauen fertigzuwerden.
»Machen wir die Nacht durch?«, fragt Alan.
»Sei bloß still.« Ich verdrehe die Augen. »Siebeneinhalb Monate Schwangerschaft sind die Hölle, wenn man jenseits der vierzig ist. Ich brauche meine acht Stunden Schlaf, ohne gottverdammtes Wenn und Aber.«
»Du kannst wirklich ordinär sein, Süße«, sagt Callie. »Verdammt beschissen ordinär.«
KAPITEL 2
Als ich nach draußen komme, ist die Nacht zum Tag geworden.
Ich lasse den Blick über die Straße schweifen. Sie ist u-förmig. Beide Enden des »U« münden in die Hauptstraße, die mitten durch dieses Wohnviertel führt. Die Häuser der drei ermordeten Familien stehen ziemlich weit voneinander entfernt, sodass die Polizei die Straße nicht vollständig abriegeln kann. Stattdessen steht ein Streifenwagen vor jeder Straßeneinmündung, und die Uniformierten gestatten nur Anwohnern die Durchfahrt. Führerscheine müssen vorgezeigt werden, Personalien werden notiert. Die Cops sind außerdem angewiesen, die Videokameras in ihren Streifenwagen laufen zu lassen und alles aufzuzeichnen.
Jedem der Tatorte sind zwei zusätzliche Streifenwagen zugeordnet. Einer steht direkt vor dem Eingang am Straßenrand, mit flackernden Signallichtern, die Scheinwerfer auf die vordere Veranda gerichtet; der andere Wagen parkt hinter dem Gebäude in einer Gasse und beleuchtet die Rückfront. Zusätzlich steht an jedem Haus ein drittes, ziviles Fahrzeug der Mordermittler in der Auffahrt. Schwere Sägeböcke, Flatterbänder und Uniformierte sorgen dafür, dass die Tatorte nicht kontaminiert werden.
Wetterfeste Halogenscheinwerfer stehen auf dem Rasen vor den Häusern. Zwischen ihnen verlaufen Verlängerungskabel, die wie orangefarbene Schlangen aussehen. In jedem Haus an der Straße brennt Licht, und bei den meisten ist die Eingangsbeleuchtung eingeschaltet. Die Bewohner drängen sich an den Panoramafenstern, auf dem Rasen oder den Veranden und verfolgen das Geschehen, neugierig oder ängstlich oder beides zugleich.
Da sämtliche Häuser an dieser Straße nach hinten an freies Feld grenzen, an das sich ein Waldstück anschließt, wurde der gesamte Bereich abgeriegelt, mit Scheinwerfern ausgeleuchtet und in ein virtuelles Schachbrett aufgeteilt. Ein Team aus erfahrenen Polizeibeamten und Spurentechnikern sucht dieses Gebiet langsam und methodisch ab, die Blicke unverwandt auf den Boden gerichtet, auf der Suche nach jedem noch so unscheinbaren Indiz.
Wie nicht anders zu erwarten, sind die regionalen Medien zahlreich erschienen, konnten bis jetzt aber von den Häusern ferngehalten werden – was sie jedoch nicht daran hindert, ihre Anwesenheit auf verschiedenste Weise kundzutun. Sie haben ihre Scheinwerfer im Einsatz, und ihre Kameras laufen. Die Reporter sind selbst auf die Entfernung hin nicht zu überhören und zu übersehen.
»Was machen die Hubschrauber hier?« Ich schirme die Augen ab und beobachte die beiden Helikopter, die in sicherer Entfernung hinter den Häusern schweben. Ihre Suchscheinwerfer sind nach unten gerichtet, auf das Feld und den Wald dahinter.
»Möglicherweise hat jemand denen erzählt, dass wir da hinten wichtige Beweise zu finden glauben«, erklärt Callie augenzwinkernd. »Tja, und jetzt sind sie auf der Suche.«
»Und spenden den Suchmannschaften extra Licht.« Alan lacht auf. »Warst du das, Callie?«
»Nun ja, ich verkörpere nun mal das seltene Aufeinandertreffen von blendendem Aussehen und überragender Intelligenz. Frag meinen Göttergatten.«
James verdreht die Augen. »Lass die dummen Scherze, du nachgemachtes Model, und mach dich an die Arbeit.«
»Du aber auch, Süßer«, sagt Callie. »Sonst kommst du zu spät zum Christopher Street Day.«
James lächelt. Es ist kaum zu glauben, er lächelt. »Nicht schlecht für eine ältere Dame. Ich sehe dich in Haus Nummer zwei«, sagt er zu mir und macht sich auf den Weg.
»War das ein Lächeln?« Ich schüttle fassungslos den Kopf.
»So was in der Art.« Alan nickt. »Dass ich das noch erleben darf.«
*
Ich bemerke die Videokamera, die mich verfolgt, als ich die Straße in Richtung Haus Nummer zwei überquere. Ich beobachte, wie der Kameramann das Objektiv justiert, und ich weiß, dass er aufblicken wird, sobald er meine Narben scharf gestellt hat, und das tut er schließlich auch. Er kann mich auf diese Entfernung ohne Optik nicht deutlich sehen, doch es ist der Instinkt, der uns so reagieren lässt, wenn wir unseren Augen nicht trauen. Ich kann es ihm nicht verdenken.
An den meisten Tagen ist es mir gleichgültig. Ich habe mich an die Blicke der Menschen gewöhnt. Daran, dass manche mich anstarren, während andere erschrecken und wieder andere verlegen reagieren und so tun, als würden sie woandershin schauen. Anfangs habe ich mich im Haus versteckt und stundenlang in den Spiegel geblickt, ohne mich zu erkennen. Als ich mich endlich wieder nach draußen wagte, trug ich mein langes braunes Haar offen, sodass es mein Gesicht umrahmte. Ich war hässlich, fühlte mich nackt und entblößt und war sicher, dass jeder, der mich sah, Alpträume bekam. Doch mit der Zeit wuchs mein Selbstvertrauen, und meine Schmerzen ließen nach. Ich gewöhnte mir an, das Haar nach hinten zu bürsten und zu einem Pferdeschwanz zu binden, der mir inzwischen fast bis zur Taille reicht. Ursprünglich war es eine Botschaft an Gott und die Welt: Seht her, ich habe keine Angst, mich so vor euch zu zeigen. Inzwischen geht es mir nur darum, dass ein Pferdeschwanz einfach praktischer ist. Heute bin ich die Frau, die ich mir damals nie hätte träumen lassen. »Es ist einfacher so« wurde zu einem viel besseren Argument als das ewige »Ich muss für die ganze Welt da draußen so gut aussehen, wie es nur geht«.
Ich gehe hinter dem Streifenwagen vorbei, der am Straßenrand parkt, noch ganz in diese Gedanken versunken, als es geschieht.
Der Kofferraumdeckel fliegt auf. Ein Mädchen springt heraus, ein Teenager. Sie bewegt sich unglaublich schnell und geschmeidig. Bevor ich reagieren kann, drückt sie mir die Mündung einer Schrotflinte gegen den Bauch.
»Ganz ruhig«, sagt sie, »oder ich schieße ein Loch in Sie rein.«
Ich erstarre. Die Zeit bleibt stehen. Mein Inneres ist plötzlich eiskalt.
»Ihnen passiert nichts, solange Sie stillhalten und zuhören.« Das Mädchen spricht mit unnatürlich ruhiger Stimme. »Eine falsche Bewegung, und Sie und Ihr Kind sind tot.«
Sie meint es ernst, ich sehe es in ihren Augen. Das Mädchen wird keine Millisekunde zögern. Sie strahlt eine erschreckende Kaltblütigkeit aus.
»Die Waffe runter!« Ich höre Alans Ruf wie aus weiter Ferne und nehme verschwommen wahr, wie um mich herum ein Pandämonium losbricht. Rufe, Schreie, Stimmengewirr, das Klirren von Waffen. Doch nichts von alledem ist von Bedeutung für mich, denn meine Angst erstickt alles. Meine Sinne sind geschärft bis zum Zerreißen, und das Adrenalin, das durch meine Adern jagt, lässt die Haare in meinem Nacken aufrecht stehen. Der Tod ist mit einem Mal keine Verabredung in der Zukunft mehr, er ist da, steht mitten unter uns, in der Maske einer wunderschönen, sehr jungen Frau, fast noch ein Mädchen.
Ich schaue in die Augen des Mädchens, furchtlose Augen von einem unglaublich tiefen Blau, und ich rieche das frische Waffenöl auf den Doppelläufen der Schrotflinte. Meine Blase fühlt sich heiß und pochend an, und irgendwo im Hinterkopf weiß ich, dass ich mich vollpinkeln werde.
Warum sagt sie nichts mehr?, frage ich mich, bevor mir bewusst wird, dass ich meinen Herzschlag nicht mehr spüre. Die Zeit dehnt sich, verwandelt eine Sekunde in eine endlose Spanne. Mir ist klar, ich habe keine Chance. Und wenn meine Leute noch so schnell sind – sie könnten niemals verhindern, dass die junge Frau abdrückt, selbst wenn sie bereits getroffen ist. Ich weiß, dass ich etwas zu ihr sagen müsste, aber mir fällt nur ein leises »Bitte« ein, auf das sie gar nicht reagiert.
Eine Stimme in meinem Kopf meldet sich: Bekämpfe die Angst. Beruhige dich. Atme tief ein, zähle dabei bis drei. Die Luft anhalten, wieder bis drei. Ausatmen, noch mal bis drei.
In meinem Innern hat sich Druck aufgestaut wie bei einem Ballon, der im nächsten Moment platzen wird. Die Zeit verlangsamt sich noch mehr, bis hinunter auf atomare Ebene. Dann spüre ich mein Herz wieder schlagen und peng!, der Ballon platzt. Die Zeit schießt mit Lichtgeschwindigkeit davon, fegt um eine Haarnadelkurve und verfängt sich, dehnt sich, biegt sich bis zum Zerreißen, während sie vibrierend im Raum schwebt, und dann explodiert sie zurück in ihren normalen Ablauf. Ich atme ein, zähle bis drei, halte die Luft an, zähle bis drei, atme aus, zähle bis drei. Die Angst bleibt.
Sag nichts. Warte. Hör ihr zu.
Dem Gesicht nach ist das Mädchen nicht älter als sechzehn, siebzehn. Doch ihren Augen nach zu urteilen, diesen unfassbar schönen blauen Augen, ist sie ein gutes Stück älter. Ihre Haare sind so blond, dass sie beinahe weiß erscheinen, und zu einem langen Zopf geflochten, der bis über die Mitte ihres Rückens reicht. Sie ist außergewöhnlich hübsch und in bester körperlicher Verfassung. Wie eine Profisportlerin. Oder eine professionelle Killerin. Sie trägt einen schwarzen hautengen Body mit dazu passenden schwarzen Turnschuhen.
Für einen winzigen Augenblick wird mir bewusst, dass ich die Grenze zwischen Angst und Panik überquere. Die Stimme in meinem Kopf schreit mich an, ich solle mich dagegen wehren. Sie heult, kreischt und zetert: Schau sie an! Sieh deiner Angst ins Auge!
Also schaue ich in die Augen des Mädchens, und allmählich klärt sich mein Tunnelblick. Langsam dämmert es mir wieder, dass wir von Cops umgeben sind, von denen jeder eine Waffe gezogen hat. Ich sehe Pistolen, Schrotflinten, ein automatisches Gewehr. Die Luft ist aufgeladen mit Gewaltbereitschaft, die sich jede Sekunde explosionsartig lösen kann. Die Cops bleiben in sicherem Abstand, doch alle Waffen zeigen auf das Mädchen, und ich kann die Finger an den Abzügen spüren.
Die beiden Mündungen der Schrotflinte fühlen sich durch den Stoff meiner Bluse hindurch wie ein heißes Brandeisen an. Der Wind trägt den Duft von frisch gemähtem Gras heran, und er vermischt sich mit dem säuerlichen Geruch meines Angstschweißes. Der Asphalt unter meinen Schuhen ist auf seltsam vertraute Weise rau und uneben, und ich denke an die Straße vor meinem Haus.
Alan steht zwei Meter hinter dem Mädchen, die Waffe auf ihren Rücken gerichtet. Sein Gesicht ist wie aus Stein gemeißelt. Er sieht mich an und nickt unmerklich. Wenn du stirbst, sagt sein Blick, folgt sie dir in der nächsten Sekunde. Ich habe Alan selten so erschrocken gesehen, und noch nie so entschlossen.
»Was willst du von mir?« Meine Stimme zittert leicht, aber es ist meine Stimme, und ich habe sie unter Kontrolle.
Das Mädchen bleibt völlig unbeeindruckt von dem Tod, der aus Dutzenden Waffen auf es zielt, oder es registriert es gar nicht, denn es ist vollständig auf mich konzentriert. »Ich will, dass Sie zuhören. Ich möchte Ihnen erzählen, weshalb ich die Leute in den Häusern umgebracht habe.« Sie sagt es gleichmütig, weder stolz noch reuig.
Ich starre sie an. »Du hast diese Familien umgebracht.« Meine Fassungslosigkeit bewirkt, dass es sich wie eine Feststellung anhört, nicht wie eine Frage. »Aber … warum?«
»Sie waren nicht, was sie zu sein schienen. Sie waren böse Menschen, die Schlimmsten der Schlimmen. Finden Sie den Bunker unter dem Rasen, dann werden Sie sehen.«
Bunker? »Ich weiß nicht, was du meinst. Wo …«
»Dafür ist keine Zeit. Ich bin in wenigen Augenblicken tot, deshalb müssen Sie mir zuhören.«
»Tot?«, frage ich – diesmal laut, weil es mir Angst macht, dieses Wort zu hören. Ich schaue auf die Cops um uns herum. »Die Polizei schießt nur, wenn du abdrückst.«
Sie verzieht ungeduldig das Gesicht. »Wir haben keine Zeit für Fragen. Sie müssen mir zuhören. Ich bin gleich tot.«
Aber wieso?, geht es mir durch den Kopf, während sich eine Ameisenkolonie in meinem Magen in Bewegung setzt und sich ein Wettrennen mit ihrer Mahlzeit liefert, einer Heuschrecke, um für den Winter gewappnet zu sein. Ich zwinge mich, die Gedanken auf meinen Sohn zu richten, der in meinem Leib schlummert. Wenn wir das hier überleben, gebe ich dir einen Namen. Dann ist Schluss mit Alien und Fred, ich versprech’s.
»Dürfen wir das aufzeichnen?«, fragt Callie. Ihre Stimme kommt von links hinter mir.
»Das wäre ideal«, sagt das Mädchen. »Aber ich warne Sie. Mein Finger ist am Abzug, und ich bin fest entschlossen.«
»Das glaube ich dir aufs Wort«, erwidert Callie. »Ich lege zuerst meine Waffe weg. Dann nehme ich eine kleine Videokamera aus der Tasche, die über meiner Schulter hängt, okay?«
»Okay. Dann machen Sie mal.«
Die Ruhe dieses Mädchens ist vollkommen unnatürlich. Eine solche Ruhe erwartet man allenfalls von Profikillern oder bestens ausgebildeten Söldnern, aber nicht bei einer Sechzehnjährigen. Der Griff um den Schaft der Flinte ist entspannt, aber fest.
Sie wurde ausgebildet, überlege ich. Und nicht von einem Amateur.
»Ich bin so weit«, sagt Callie einen Moment später.
Das Mädchen beginnt ohne Umschweife. »Es gibt zwei Männer. Sie existieren im Schatten, länger, als manche von Ihnen leben. Diese Männer sind das absolute Böse. Sie begehen Grausamkeiten und Bluttaten nur zu ihrem Vergnügen, und sie weiden sich an Hoffnungslosigkeit und Resignation. Sie glauben, dass man eine Gesellschaft, sogar die ganze Welt in den Abgrund stürzen kann, wenn man sie in Blut und Verzweiflung ertränkt.
Vor langer Zeit wurde der Plan dieser beiden Männer einer Person bekannt, die einer strengen Kirche angehörte, der Kirche des Fundamentalen Ich. Nach innerem Kampf beschloss diese Person, ihr Geheimnis zu offenbaren, und gab den Plan an eine Handvoll Vertraute weiter. Die Gruppe trat aus der Kirche aus, bereitete sich vor und wartete, bis die beiden Männer mit der Umsetzung ihres Plans begonnen hatten, um ihn über die ganze Welt zu verbreiten.
Weitere Leute schlossen sich der Gruppe an, darunter auch ich. Dass ich jetzt das Schweigen der Erwählten breche, um ihr Geheimnis einer Gesetzeshüterin anzuvertrauen, verletzt meine heiligsten Glaubensregeln. Ich bin wie ein katholischer Priester, der seine Kirche niederbrennt, indem er den Beichtstuhl anzündet. Ich werde mit meinen Überzeugungen sterben und sie mitnehmen in mein nächstes Leben.« Sie zuckt die Schultern. »Aber das ist in Ordnung. Schließlich ist es meine Seele. Ich werde sterben, weil ich dafür sorge, dass es weniger sicher ist für die Welt, ehrlich zu sein.«
Ihr Lächeln ist wunderschön, voller Gewissheit und Freude. Es lässt mich frösteln. Ich denke an die toten Familien und daran, dass wir von Anfang an die Vermutung hatten, es ginge mehr um die Botschaft als um die Tat als solche. Diese unnatürliche, glückselige Gelassenheit …
Das mit dem Profikiller war der falsche Vergleich. Meilenweit daneben. Bei diesem Mädchen hier ist es etwas ganz anderes. Es ist das Frohlocken des Märtyrers.
Ich habe mal ein Foto gesehen, das Standbild eines Selbstmordattentäters aus dem Mitschnitt einer Überwachungskamera. Die Kamera war genau auf den Attentäter gerichtet. Die Aufnahme zeigte das Gesicht des jungen Mannes, unmittelbar bevor er auf den Knopf drückt. Ich hatte nie zuvor eine solche Gewissheit gesehen, einen solchen Frieden, eine so überwältigende Glückseligkeit. Erst recht nicht im Gesicht eines neunzehnjährigen Jungen, der im Begriff steht, sich in die Luft zu sprengen und Dutzende unschuldiger Menschen mit in den Tod zu reißen.
Deshalb bist du, wie du bist, nicht wahr? Deshalb ist eine junge Frau wie du so abgeklärt. Deshalb bist du so wild entschlossen, deine Fähigkeiten einzusetzen …
Mit einem Mal sehe ich sie mit anderen Augen. Ich habe immer noch Angst, aber ich sehe keine Bosheit mehr in dem Mädchen, nicht einmal Wahnsinn. Ihre Kraft ist die des fanatischen Glaubens. Nicht Prostitution ist das älteste Gewerbe der Welt, sondern die Ausübung von Macht über andere.
»Was ist mit diesen beiden Männern?«, frage ich.
»Alles deutet darauf hin, dass sie bald aus dem Schatten treten. Man hat uns die Möglichkeit gegeben, es Ihnen zu beweisen.« Sie blickt mich eindringlich an. »Es tut mir ehrlich leid, Agent Barrett, Sie und Ihr Baby bedrohen zu müssen. Es geschieht nur, um diese Begegnung zwischen uns beiden zu ermöglichen, das müssen Sie mir glauben. Um dafür zu sorgen, dass ich zu Ihnen sprechen kann und dass Sie mir zuhören.«
»Ich höre dir zu«, versichere ich ihr. »Ich verspreche es.«
»Danke, Agent Barrett, danke sehr. Also, man hat uns zwei Hinweise gegeben. Der erste war der Name eines Mannes. Wir fanden rasch heraus, dass er zu den Bösen gehört, zu den Zweiflern – ein Begriff, mit dem wir jene bezeichnen, die ihr Gesicht wissentlich und aus eigenem Entschluss von dem Guten abwenden. Weitere Nachforschungen ergaben, dass der Mann Bauunternehmer ist. Er hat den Bunker gebaut, den Sie unter dem Rasen finden werden. Er hat mich hierher geführt, zu diesem Nest von Zweiflern, auf deren Leichen Sie und Ihre Leute gestoßen sind. Ich habe diese Familie als Erste vernichtet, im Namen des Guten. Dann habe ich dem Mann seine Geheimnisse entrissen und mich anschließend auf die gleiche Weise um ihn gekümmert wie um diese Familie.«
»Du hast ihn getötet, willst du damit sagen.«
Sie blickt mich verwundert an. »Natürlich. Was denn sonst?«
Ich stoße einen Seufzer aus. »Und der zweite Hinweis?«
»Der kam ebenfalls von diesem Mann. Ich werde seine Worte genau wiederholen, auch wenn sie verwirrend sind.« Sie räuspert sich und beginnt in einer solch perfekten Imitation einer Männerstimme, dass mir die Haare zu Berge stehen. »Das Milgram-Experiment. Seine Erklärung war die Wahrheit, nicht die Lüge. Es ist wirklich passiert, und er war nicht verrückt. Er hat nicht gelogen. Nein! Nein!« Sie holt tief Luft. »Bitte, das ist alles, was ich weiß. Ich kenne seinen Namen nicht. Nur das. Nur das! Nur das!«
Die Stimme klingt jetzt angsterfüllt, voller Entsetzen und körperlichem Schmerz. Das letzte »Nein« kommt als schriller Schrei, der sich am Ende überschlägt. Dann verstummt das Mädchen so abrupt, als hätte jemand einen Schalter umgelegt. Sie schaut mich an und fügt hinzu, nun wieder mit der eigenen Stimme: »Mehr hat er nicht gewusst, das kann ich Ihnen versichern.«
Meine Kehle fühlt sich trocken an. »Habt ihr ihn gefoltert?«
»Nur ganz zu Anfang«, sagt das Mädchen, »um seinen Widerstand zu brechen. Mit Elektroden. Im Anus, an den Genitalien und an den Füßen. Wir haben ihm ausschließlich Fragen gestellt, die er mit Ja oder Nein beantworten konnte. Er hat schnell begriffen, dass er keine Chance hat, uns zu belügen. Wenn er gezögert hat, mussten wir nur die Elektroden auf den Tisch legen.«
Sie lächelt. Es ist dieses »Ist das nicht cool?«-Lächeln, wie ich es häufig bei meiner Adoptivtochter sehe.
Ich unterdrücke ein Seufzen. »Wie heißt du?«
»Maya.«
»Und weiter?«
»Ich habe keinen Nachnamen, weil ich keinen brauche.« Ihr Gesicht wird wieder ernst. »Die Zeit wird knapp. Wir haben lange auf diese Gelegenheit gewartet. Auf einen Beweis, der nicht widerlegt werden kann. Auf das Erscheinen eines Kriegers, dem wir vertrauen konnten.« Sie schenkt mir ein sanftes, trauriges Lächeln. »Dieser Krieger sind Sie, Smoky Barrett. Wenn Sie wegen Ihrer Narben jemals wieder traurig sind, dann denken Sie daran, dass diese Narben der Grund dafür sind, dass wir an Sie glauben können.«
Was für ein wirres Gerede. Ich kann gerade noch verhindern, dass ich tadelnd den Kopf schüttle.
»Wenn du mir vertraust, Maya, leg die Flinte zur Seite und lass dir von mir helfen.«