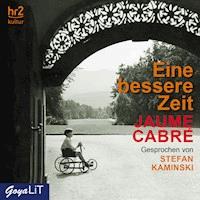11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2010
Ein großer, dramatischer Roman über das engverflochtene Schicksal einer Handvoll Menschen, die der Spanische Bürgerkrieg zu Gegnern und zu Liebenden macht. Seit Carlos Ruiz Zafóns Der Schatten des Windes hat es keinen Roman aus Spanien gegeben, der seine Leser so in den Sog einer faszinierenden Geschichte zieht wie dieser. Was geschah wirklich am 18. Oktober 1944 in dem Pyrenäenort Torena? Als Tina Bros sechs Jahrzehnte später in der alten Dorfschule ein hinter der Schiefertafel verborgenes Tagebuch entdeckt, ahnt sie nicht, daß sie an Dinge rührt, die in ihrer Verquickung aus Schuld und Scham, aus Leidenschaft und Fanatismus das ganze Drama einer schlimmen Zeit spiegeln. Noch weniger ahnt sie, daß der Schatten von damals bis in ihre eigene Gegenwart ragt. In den Händen hat sie die Lebensgeschichte des Dorfschullehrers Oriol Fontelles – einen langen Brief an seine Tochter, der diese nie erreicht hat, die Bitte, von ihr und der Nachwelt nicht verurteilt zu werden. Tina, deren eigenes Leben in Unordnung geraten ist, setzt alles daran, herauszufinden, was damals tatsächlich geschah. Sie erfährt von Oriols tragischer Liebesbeziehung zu der schönen und mächtigen Elisenda Vilabrú, deren Vater und Bruder zu Beginn des Bürgerkriegs von Anarchisten ermordet wurden, davon, wie Elisenda in ihrem Bedürfnis nach Rache alle Fäden zieht und wie ihr Geliebter Oriol Fontelles als heimlicher Widerständler ein gefährliches Doppelspiel beginnt, das in der Dorfkirche von Torena sein schicksalhaftes Ende findet. Für Tina Bros jedoch ist die Geschichte nicht beendet, denn alter Haß und alte Leidenschaften gären weiter, die Vergangenheit ist nicht vergangen. Jaume Cabré ist ein Meister der Dramatik: Wie im Film wechseln die Szenen in raschem Schnitt, die Stimmen der Protagonisten lösen einander ab, und das ungeheuerliche Geschehen erschließt sich dem Leser, als wäre er selbst dabei. Er liest die bewegende Geschichte von kleinlicher Bosheit und heimlicher Größe, von mörderischem Ha
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 864
Ähnliche
Jaume Cabré
Die Stimmen des Flusses
Roman
Aus dem Katalanischen von Kirsten Brandt
Suhrkamp
Die Originalausgabe erschien 2004 unter dem Titel
Les veus del Pamano
im Verlag Proa, Barcelona.
© Jaume Cabré, 2004
(für die deutsche Ausgabe vertreten durch
UnderCover Literary Agents)
Umschlagfoto: © Pagès Editors & Arxiu Comarcal de Sort
Die Übersetzung wurde gefördert aus Mitteln
des Institut Ramon Llull.
ebook Suhrkamp Verlag Berlin 2010
© der deutschen Ausgabe
Insel Verlag Frankfurt am Main 2007
Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das
der Übersetzung, des öffentlichen Vortrags sowie der Übertragung
durch Rundfunk und Fernsehen, auch einzelner Teile.
Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form
(durch Fotografie, Mikrofilm oder andere Verfahren)
ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert
oder unter Verwendung elektronischer Systeme
verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
www.suhrkamp.de
Umschlag: Göllner, Michels, Zegarzewski
eISBN 978-3-518-73320-2
Für Margarida
Vater, vergib ihnen nicht, denn sie wissen, was sie tun.
Vladimir Jankélévitch
0
Ein kaum merkliches Geräusch an der Tür, eine sachte Berührung. Lautlos schwang sie auf, und eine behandschuhte Hand griff nach dem Knauf an der Innenseite, um ihn am Zurückschnappen zu hindern. Die Tür schloß mit einem leisen Ächzen. Eine dunkle Gestalt schlich durch die dunkle Wohnung, schweigend verfolgt von Juris an die Finsternis gewöhnten Augen. Der Eindringling betrat das Arbeitszimmer und fluchte leise, als er die hochgezogene Jalousie sah. Der plötzliche Kälteeinbruch hatte die Landschaft in ein eisiges Grab verwandelt. Das Schneegestöber vor dem Fenster ließ die Nacht noch stiller erscheinen, nicht einmal das Rauschen des Flusses war zu hören. Er beschloß, die Jalousie nicht herunterzulassen, denn niemand durfte jemals erfahren, daß er in dieser Nacht in dieser Wohnung gewesen war.
Mit einem verdrossenen Seufzer setzte er sich an den Computer, stellte seine Mappe neben dem Stuhl ab und schaltete das Gerät ein. Er bemerkte, daß der Tisch ordentlich aufgeräumt war. Das würde seine Arbeit erleichtern. Juri war ihm still zum Arbeitszimmer gefolgt und beobachtete ihn nun, noch stiller, von der Tür aus. Das bläuliche Licht des Bildschirms erfüllte das Zimmer, und der Eindringling hoffte, daß der schwache Schein weder von der verlassenen Straße noch vom anderen Ende der Wohnung aus zu sehen sein würde. Am Rand des Bildschirms klebte ein Post-it, auf dem stand: »Guten Morgen! Das Futter steht im Schrank über dem Kühlschrank. Danke für alles!« Er sah die Dateiordner durch, zog die Schachtel mit den Disketten aus der Tasche seines Parkas und begann, geduldig eine Datei nach der anderen zu kopieren. Irgendwo im Haus hustete jemand. Er stellte sich vor, daß es die Nachbarn von unten waren, die müde und angetrunken von einer Party nach Hause kamen und vor sich hin murrten, daß sie dafür eigentlich zu alt seien. Das Geräusch eines Wagens durchbrach die nächtliche Stille. Er fuhr langsam, wohl wegen des Schnees. Warum brauchen Computer so lange, wenn man es eilig hat? Warum summen sie so laut, wenn sie doch angeblich geräuschlos sind? Plötzlich klingelte das Telefon, und der Eindringling erstarrte. Er schaltete den Computer aus, obwohl er mitten in der Arbeit war, und blieb reglos sitzen, wie versteinert. Ein Schweißtropfen rann ihm über die Nase, aber er wischte ihn nicht ab, denn eigentlich war er ja gar nicht da. Am anderen Ende der Wohnung rührte sich nichts.
»Im Augenblick bin ich nicht erreichbar. Sie können aber nach dem Piepton eine Nachricht hinterlassen.«
»Hör mal, ich kann morgen früh nicht kommen, wir haben eine weitere Ladung Steine für Tremp bekommen, und meine Tochter besteht darauf, daß ich fahre. Mach dir keine Sorgen, ich komme gegen Mittag vorbei, vor dem Essen. Tschüß. Viel Glück und einen Kuß. Ich besuche dich bald. Ach, und noch was: Du hast recht, man hört tatsächlich den Pamano rauschen.«
Ein zweimaliges Piepen. Eine Männerstimme, rauh vom Tabak und vom Kaffee mit Schuß, jemand, der unüberhörbar aus dieser Gegend kam und vertrauensvoll von morgen sprach. Der Eindringling wartete einige Minuten lang, ob sich eine Tür öffnete. Nichts. Niemand. Zu seinem Glück hatte Juri beschlossen, keinen Laut von sich zu geben und weiter bewegungslos im Verborgenen zu bleiben. Erst als die Erinnerung an das Schrillen des Telefons verklungen war, als er wieder die Schneeflocken hören konnte, die alles sanft verhüllten, atmete der Eindringling auf und schaltete den Computer wieder ein.
Juri wußte nicht, was er tun sollte, und so verließ er vorerst seinen Posten und versteckte sich im Wohnzimmer, lauschte aber auf jedes Geräusch, das aus dem Arbeitszimmer drang.
Der Eindringling machte sich wieder an die Arbeit. Rasch füllte er fünf Disketten mit allen Dateien, die in den Ordnern mit den Initialen O. F. gespeichert waren, und mit einigen anderen, um ganz sicherzugehen. Als er damit fertig war, verschob er all diese Dateien in den Papierkorb des Computers, leerte ihn und vergewisserte sich, daß wirklich alle betreffenden Dateien gelöscht waren. Dann legte er eine neue Diskette mit dem Virus ein, lud sie hoch, nahm sie wieder heraus und machte den Computer aus.
Er schaltete die Taschenlampe ein und klemmte sie sich in den Mund, um die Hände frei zu haben. Mühelos fand er im Aktenfach des Schreibtischs die drei Ordner, die ihn interessierten, und nahm sie heraus. Sie enthielten Papiere, Fotos und Dossiers. Er ließ alles in seiner Mappe verschwinden und schloß das Fach. An der Wand stand ein kleiner roter Koffer. Er öffnete ihn. Reiseutensilien. Vorsichtig durchwühlte er ihn: nichts Interessantes. Er machte ihn zu und stellte ihn an dieselbe Stelle zurück. Bevor er ging, durchsuchte er sicherheitshalber noch alle Schubladen. Leere Blätter, Notizblöcke, Schulhefte. Und eine Schachtel. Er öffnete sie und fühlte, wie ihm plötzlich der Schweiß auf die Stirn trat. Vom anderen Ende der Wohnung her glaubte er ein schmerzliches Stöhnen zu hören.
Als er die Wohnungstür hinter sich zuzog, war er sicher, keinerlei Spuren hinterlassen zu haben. Er wußte, daß er gut fünfzehn Minuten gebraucht hatte, um seinen Job zu erledigen, und daß er bei Tagesanbruch möglichst weit weg sein sollte.
Sobald er allein war, schlich Juri ins dunkle Arbeitszimmer. Alles sah aus wie immer, aber er war beunruhigt. Er hatte das unbestimmte Gefühl, versagt zu haben.
Erster Teil Der Flug des Grünfinken
Namen, hingestreckt und mit Blumen bedecktJoan Vinyoli
Am Ostersonntag, dem 31. März Anno Domini 2002 um neun Uhr morgens, an diesem so lange ersehnten Tag, sind die Augen der zahlreichen auf dem Petersplatz versammelten Gläubigen aus aller Herren Ländern erwartungsvoll auf das damastgeschmückte Fenster gerichtet, von dem aus der Heilige Vater den Segen »urbi et orbi« erteilen wird. Obwohl es schon Frühling ist, ist es bitter kalt, denn vom Tiber dringt durch die Via della Conciliazione ein tückischer Luftzug herauf und fegt übermütig über den Platz, entschlossen, die Hingabe derer zu schmälern, die auf den Auftritt des Pontifex maximus warten. Rührung und Schnupfen sorgen für gezückte Taschentücher. Da geht das Balkonfenster auf, die Scheiben blitzen im Sonnenlicht. Ein beflissener Priester stellt das Mikrophon auf die richtige Höhe, und der gekrümmte, in makelloses Weiß gekleidete Johannes Paul II. spricht ein paar Worte, die unverständlich bleiben, obwohl die Leute aufgehört haben, sich zu schneuzen. Dann erfolgt der Segen. Sechs Nonnen aus Guinea, die auf dem feuchten Pflaster des Platzes knien, vergießen Freudentränen. Die von Hochwürden Rella angeführte Gruppe, die einen guten Platz direkt vor dem Fenster des Papstes ergattert hat, schweigt ein wenig unbehaglich angesichts einiger Gläubiger, die Rosenkränze schwenken, Papstbildchen küssen oder diesen Augenblick auf einem Foto verewigen. Sind diese Gefühlsausbrüche nicht doch etwas abergläubisch? Hochwürden Rella winkt ab, wie um zu sagen, was soll’s, und sieht auf die Uhr. Wenn sie in einer halben Stunde auf der Piazza del Sant’Uffizio sein wollen, müssen sie sich sputen. Also hebt Hochwürden Rella, kaum daß der Papst nach Erteilung des Segens von seinen Ärzten vom Fenster fortgezogen wurde, den Arm, um die Richtung vorzugeben, und schickt sich an, sich mit Schlägen seines roten Regenschirms einen Weg durch die dichte Menge auf dem Platz vor dem Vatikan zu bahnen. In geschlossener Formation folgt die Gruppe von gut dreißig Frauen und Männern dem Regenschirm. Auch die anderen Leute setzen sich in Bewegung, langsam, als zögerten sie noch, diesen Ort zu verlassen, der ihnen so viel bedeutet.
Durch die Via di Porta Angelica gleitet eine Limousine mit getönten Scheiben, biegt rechts ab und hält an dem Kontrollposten der Via del Belvedere. Zwei Männer mit Knopf im Ohr, Sonnenbrille und ausrasiertem Nacken beugen sich auf jeder Seite des Wagens zu den Fenstern hinunter, die mit der Eleganz eines berechnenden Augenaufschlags herabgelassen werden. Dann richten sich die beiden gleichzeitig wieder auf und winken den Wagen durch. Allerdings begleitet einer von ihnen die Limousine im Laufschritt noch bis zur Via della Posta und zeigt an, wo genau sie parken soll. Ein Bediensteter des Vatikans, der wie aus dem Nichts aufgetaucht ist, öffnet die rechte Wagentür. Vor dem Portal des Palazzo Apostolico steht ein bunt gekleideter Schweizergardist, der seine Umgebung mit betonter Gleichgültigkeit ignoriert. Statt dessen starrt er geradeaus, zum Wachgebäude hinüber, als gäbe es dort etwas Interessantes zu entdecken. In der Tür der Limousine erscheinen zwei zierliche Füße in tiefschwarzen Schuhen mit silbernen Schnallen und werden vorsichtig auf den Boden gesetzt.
Wie es dem Protokoll und der Bedeutung dieses Tages entspricht, wird im Petersdom in Anwesenheit der gesamten Kongregation für die Seligund Heiligsprechung eine Messe zelebriert werden. Vorsorglich sind alle Ehrengäste für drei Stunden vor Beginn der Veranstaltung zitiert worden, um jedes auch noch so kleine Mißgeschick auszuschließen, denn wenn die Heilige Römisch-Katholische Kirche im Laufe der Jahrhunderte eines gelernt hat, ist es, Feierlichkeiten aller Art mit dem entsprechenden Pomp zu ersinnen, zu organisieren und durchzuführen.
Die alte Dame ist ganz in Schwarz gekleidet und trägt einen dezenten, aber hocheleganten Hut. Schmal und trotz ihrer siebenundachtzig Jahre kerzengerade wartet sie, bis ihr Sohn Marcel und ihre ehemalige Schwiegertochter Mertxe neben ihr stehen. Mit einer gewissen müden Herablassung überhört sie den Lärm, der von der zusammengedrängten Menschenmasse auf dem Platz herüberdringt. Rechtsanwalt Gasull bespricht mit dem Korporal, der hinter dem Bediensteten aufgetaucht ist, das weitere Vorgehen.
»Wo ist Sergi.« Die alte Dame macht sich nicht die Mühe, fragend die Stimme zu heben. Sie blickt mit strenger Miene geradeaus.
»Er ist hier, Mamà«, erwidert Marcel. »Wo soll er denn sonst sein?«
Sergi ist ein paar Schritte beiseite getreten und hat sich eine Zigarette angezündet, denn er ahnt, daß er da drinnen eine Ewigkeit lang nicht wird rauchen dürfen.
»Ich kann ihn nicht hören.«
Weil du dir nicht die Mühe machst, deinen Enkel direkt anzusprechen, denkt Mertxe, die schon seit den frühen Morgenstunden mit unübersehbar sauertöpfischer Miene herumläuft. Aber du würdest natürlich niemals jemanden irgend etwas fragen und niemals den Kopf nach jemandem wenden, denn davon könnte dein Hals ja Falten bekommen, und außerdem haben sich die anderen gefälligst vor dir zu präsentieren.
»Und?« wendet sich die Dame an Gasull.
»Alles erledigt.«
Drei Stunden vor Beginn der Zeremonie durchschreitet die fünfköpfige Gruppe mit der Kontrollnummer 35Z das Portal des Papstpalastes.
Der Santa-Clara-Saal ist geräumig und von einem matten Licht erfüllt, das durch drei Balkontüren dringt, die auf einen großen Innenhof hinausgehen. Soeben durchquert ihn raschen Schrittes ein Mann mit einer auffälligen gelben Schärpe; ihm eilt ein Mann in Alltagskleidung voraus, der mit halb erhobenem Arm auf eine Tür weist. Gegenüber den Balkontüren zeigt eine gewaltige dunkle Halbkugel, wie die Menschen des 17. Jahrhunderts sich die Erde vorstellten. Daneben steht ein Flügel, der in diesem Raum fehl am Platz wirkt, ein wenig befremdlich, wie alle stummen Musikinstrumente.
Der Zeremonienmeister, ein spindeldürrer Mann, der genau wie die Dame ganz in Schwarz gekleidet ist, sicher ein Priester, murmelt, wohl wissend, daß sie sowieso kein Italienisch verstehen, sie dürften sich setzen, sie sollten sich wie zu Hause fühlen, er bitte nur um ein wenig Geduld und die Toilette befinde sich hinter der Tür neben dem Flügel. Noch während sie Platz nehmen, schiebt eine Nonne mittleren Alters einen Wagen mit Antipasti und nichtalkoholischen Getränken herein, und der Spindeldürre murmelt Gasull zu, eine Stunde vor der Feier wird der Wagen wieder abgeholt, Sie wissen schon warum.
Die Dame nimmt in einem breiten Sessel Platz, die Beine dicht nebeneinander, den Blick auf das andere Ende des Saals gerichtet, als könnte sie sehen. Sie wartet darauf, daß die anderen es ihr gleichtun. Ihre innere Anspannung ist fast zuviel für ihren schwachen Körper, aber vor ihrem Sohn und ihrer Ex-Schwiegertochter, ihrem gleichgültigen Enkel, der durch die Balkontüren nach draußen starrt, und Rechtsanwalt Gasull läßt sie sich nicht anmerken, wie nervös, ja ängstlich sie ist in ihrem bequemen Sessel in dem geräumigen Santa-Clara-Saal im Palazzo Apostolico des Vatikans. Die Dame weiß, daß sie, wenn dieser Tag vorüber ist, in Frieden sterben kann. Sie legt ihre Hand an die Brust und tastet nach dem kleinen Kreuz, das sie um den Hals trägt. Sie weiß, daß heute der Gram der letzten sechzig Jahre ein Ende finden wird, und kann sich nicht eingestehen, daß sie in ihrem Leben vieles anders und besser hätte machen können.
1
An dem Tag, an dem sein Name dem Vergessen anheimgegeben wurde, waren nur wenige Menschen auf der Straße. Es wären auch nicht mehr gewesen, wenn es nicht geregnet hätte, denn die meisten taten so, als ginge sie das Ganze nichts an, beobachteten das Geschehen heimlich vom Fenster oder vom Gartenzaun aus und dachten an das vergangene Leid. Der Bürgermeister hatte beschlossen, den Festakt durchzuziehen, selbst wenn es wie aus Kübeln goß, wobei er den wahren Grund für seinen Anfall politischer Entschlossenheit verschwieg: Er war um zwei mit einem Kunden im Restaurant Rendé in Sort auf eine Paella verabredet, und allein bei dem Gedanken daran lief ihm schon jetzt das Wasser im Munde zusammen. Aber er war auch ein Bringué und wollte dem ganzen Dorf, einschließlich Casa Gravat, beweisen, daß diese Feier stattfinden würde, und wenn die Sintflut hereinbräche. So hatten sich zum Austausch der Straßenschilder der Bürgermeister, der Gemeinderat und der Sekretär eingefunden; zu ihnen hatten sich unaufgefordert zwei verirrte Touristen in leuchtend bunten Regenmänteln gesellt, die keine Ahnung hatten, worum es ging, aber unermüdlich die merkwürdigen Gebräuche der Gebirgler fotografierten, außerdem der unabkömmliche Steinmetz Serrallac und die Báscones vom Tabakladen, auch wenn niemand verstand, was um Himmels willen ausgerechnet sie bei diesem Festakt verloren hatte. Phrenokolopexie. Jaume Serrallac hatte die vier prächtigen Marmorplatten angefertigt, deren elegante Schriftzüge – schwarz auf hellgrauem Grund – vornehmere Straßen, besser erhaltene Wände und ein gepflegteres Dorf verdient hätten. Die Platte mit der Aufschrift Carrer President Francesc Macià ersetzte die Calle Generalísimo Franco, aus Calle José Antonio wurde Carrer Major, die Plaza de España hieß von nun an Plaça Major, und die Calle Falangista Fontelles wurde in Carrer del Mig umgetauft. Alles war vorbereitet, die Löcher waren schon gebohrt, und da Serrallac geübt war – seit mit dem Ende der Diktatur sämtliche Straßen umbenannt wurden, konnte er sich vor Aufträgen kaum retten –, lief alles wie am Schnürchen. Die Tafel des Falangisten Fontelles hielt so hartnäckig, daß Serrallac sie mit Hammerschlägen gegen die Wand zertrümmern mußte. Dann warf er die traurigen Überreste in die Mülltonne vor dem Haus der Familie Batalla. Der reglosen Gestalt unter dem Vordach von Casa Gravat war es, als stießen die Trümmer einen ohnmächtigen Schrei aus, und sie umklammerte das Geländer und stöhnte leise. Nur die Katzen bemerkten sie. Am oberen Ende der Straße standen, in ihre Mäntel gehüllt, zwei alte Frauen, eine von ihnen eine Greisin, und beobachteten den Festakt. Als sie sicher waren, daß Serrallac die alte Tafel zerschlagen hatte, gingen sie langsam, Arm in Arm, die Straße hinunter, die jetzt wieder Carrer del Mig hieß, betrachteten alle Fassaden, die Fenster, die Türen, und ließen ab und zu eine leise Bemerkung fallen, vielleicht um ihr Unbehagen darüber zu verhehlen, daß sie sich von zahlreichen Augen aus dem Inneren der Häuser verfolgt wußten, die die beiden alten Frauen ebenso ungestraft musterten, wie diese zuvor den Austausch des Straßenschildes überwacht hatten. Bei der Mülltonne angekommen, beugten sie sich darüber, als wollten sie sich vergewissern. Die Stadtväter waren schon im Aufbruch, gingen durch die Francesc Macià zur Plaça Major hinüber, wo der Austausch der letzten Tafel stattfinden und der Bürgermeister ein paar Worte über den Geist der Versöhnung sagen sollte, der in der Wiedereinführung der alten Straßennamen zum Ausdruck kam. In die kurze Straße kehrte wieder die gewohnte Ruhe ein, und von diesem Augenblick an war Oriol vergessen. Jedermann war froh darüber, daß nun endlich eines der Symbole der Zwietracht verschwunden war. Und außer der dunklen Gestalt, die sich unter dem Vordach von Casa Gravat die Brille abwischte und dachte, ihr werdet schon sehen, wer zuletzt lacht, erinnerte sich niemand mehr an Oriol Fontelles, bis vierundzwanzig Jahre später das verlassene, nutzlose Schulgebäude abgerissen wurde, weil es nicht in das Dorfbild des 21. Jahrhunderts paßte.
Wie zu erwarten, beauftragte Maite, die Direktorin der Schule von Sort, Tina Bros damit, nach Torena hinaufzufahren und ganz offiziell in dem Gerümpel im alten Schulgebäude zu stöbern. Sie planten eine Ausstellung über den Wandel der Lehrmittel im Laufe der Zeit, und in diesem kleinen Gebäude gab es sicher einiges an antiquierten Unterrichtsmaterialien zu entdecken. Und da Tina an einem Fotoband über die Gegend arbeitete, wurde sie im Namen der Schule mit den Nachforschungen betraut. So kam es, daß Tina, die ganz andere Sorgen hatte, zum zweiten Mal innerhalb einer Woche mit ihrem auffälligen roten 2CV widerwillig nach Torena hinauffuhr. Sie konnte nicht ahnen, daß sie unterhalb der Marmorplatte parkte, mit der vierundzwanzig Jahre zuvor die Straße ihren ursprünglichen Namen Carrer del Mig wiedererhalten hatte. Im Rathaus fragte sie nach den Schlüsseln für die Schule, und man sagte ihr, sie seien nicht mehr da, die Bauarbeiter seien schon an der Arbeit, und als sie vor dem Gebäude hielt, dem letzten des Dorfes, dort, wo der Weg zum Triador hinaufführte, sah sie, daß die Arbeiter bereits dabei waren, das Schieferdach Platte für Platte abzudecken. Spontan griff sie nach ihrer kleinen Kamera, der mit dem lichtempfindlichen Film, und machte im diffusen Licht des Nachmittags drei Aufnahmen, wobei sie darauf achtete, daß die auf dem Dach beschäftigten Bauarbeiter nicht ins Bild kamen. Vielleicht konnte sie eines der Fotos für das Buch verwenden. Zum Glück hatten die Arbeiter auf der Seite angefangen, wo die Toiletten lagen. So hatte sie Zeit, die beiden Schränke im Klassenzimmer zu durchstöbern, machte sich die Hände an dem schmierigen schwarzen Staub vieler Jahre schmutzig, sortierte Stapel von nutzlosen Papieren aus, rettete ein Dutzend Bücher, die in pädagogischer Hinsicht vorsintflutlich waren, aber für die Ausstellung durchaus ihren Reiz hatten, und lauschte dem dröhnenden Hämmern der Bauarbeiter, die drauf und dran waren, das Gebäude dem Erdboden gleichzumachen. Was sie an brauchbarem Material fand, paßte problemlos in den Pappkarton, den sie aus Sort mitgebracht hatte. Eine ganze Weile stand sie am Fenster, sah in die Ferne und überlegte sich, ob das, was sie anschließend vorhatte, nicht eigentlich unter ihrer Würde lag. Wahrscheinlich schon, aber Jordi ließ ihr keine Wahl. Sie starrte gedankenverloren vor sich hin: Nein, sie hatte keine andere Wahl. Weil Jordi nun mal war, wie er war, und Arnau ebenfalls. Weil weder ihr Mann noch ihr Sohn zu Hause etwas erzählten, weil sie so verschlossen waren, weil Arnau ihr von Tag zu Tag fremder wurde, nächtelang wegblieb und sich nur sehr vage darüber ausließ, mit wem er sich herumgetrieben hatte. Lange hing sie ihren düsteren Gedanken nach, und schließlich blickte sie sich um und fand sich in der verlassenen Schule von Torena wieder. Sie bemühte sich, die beiden vorerst aus ihren Gedanken zu verbannen, vor allem Jordi. So kam sie auf die Idee, die Schubladen des Lehrerpults zu durchwühlen. In der ersten fanden sich außer einem Schwall unsichtbarer Erinnerungen, die sich verflüchtigten, sobald sie die Schublade öffnete, nur die Späne eines vor langer Zeit gespitzten Bleistifts. In den anderen beiden war gar nichts, nicht einmal Erinnerungen. Hinter den schmutzigen Scheiben ging langsam der Tag zur Neige, und plötzlich wurde ihr bewußt, daß die Hammerschläge schon lange verstummt waren.
An der Tafel lag ein angefangenes Stück Kreide. Sie nahm es in die Hand und konnte der Versuchung nicht widerstehen, es zu benutzen; mit ihrer klaren Lehrerinnenhandschrift schrieb sie das Datum an die Tafel: Mittwoch, 12. Dezember 2001. Dann wandte sie sich um, als säßen Schüler an den wurmstichigen Pulten, denen sie den Lehrstoff des heutigen Tages erklären sollte, erstarrte jedoch mit offenem Mund, als sie ganz hinten in der Tür einen unrasierten Bauarbeiter mit einer Zigarette im Mundwinkel gewahrte. Er hielt eine Zigarrenkiste in der einen Hand und eine Campinggaslampe in der anderen und war ebenfalls verblüfft stehengeblieben, fing sich aber als erster und ging auf sie zu:
»Fräulein … wir machen Feierabend, es wird zu dunkel. Bringen Sie den Schlüssel zurück?«
An seinen weiß bestaubten Jeans baumelte ein Schlüsselbund, und Tina erschien er wie ein Schüler, der ihr sein Aufgabenheft brachte. Es kam ihr vor, als wäre sie ihr ganzes Leben lang Lehrerin an dieser Schule gewesen. Der Bauarbeiter stellte die Zigarrenkiste auf das Pult.
»Die haben wir hinter der Tafel gefunden.«
»Hinter dieser Tafel?«
Der Bauarbeiter trat an die Tafel. Sie sah aus, als wäre sie in die Wand eingelassen, ließ sich aber verschieben. Kreischend rückte sie etwa zwei Handbreit zur Seite und gab eine kleine dunkle Höhlung frei. Der Bauarbeiter hob die Lampe.
»Hier drin.«
»Wie ein Piratenschatz.«
Der Bauarbeiter schob die Tafel an ihren Platz zurück.
»Es sind Schulhefte«, sagte er und klopfte zweimal auf die gut erhaltene Zigarrenkiste, die mit einer schwarzen Kordel verschnürt war.
»Darf ich sie behalten?«
»Eigentlich wollte ich sie wegwerfen.«
»Und könnten Sie mir die Gaslampe dalassen?«
»Passen Sie auf, wenn Sie hierbleiben, frieren Sie sich zu Tode.« Er gab ihr die Lampe.
»Ich bin warm genug angezogen. Danke für die Lampe.«
»Wenn Sie gehen, schließen Sie bitte ab und lassen Sie die Gaslampe an der Tür stehen. Wir finden sie morgen dann schon.«
»Wie lange werden Sie denn brauchen, um das alles hier abzureißen?«
»Morgen sind wir fertig. Das heute waren nur die Vorarbeiten. Das Gebäude ist schnell abgerissen.«
Er tippte sich nach Soldatenart nachlässig mit dem Finger an die Schläfe. Dann schlug er die Tür hinter sich zu, und das Gespräch zwischen ihm und seinen beiden Kollegen hinter den schmutzigen Fensterscheiben verklang allmählich. Tina sah sich um. Das Licht der Campinggaslampe warf neue, fremde Schatten. Das Gebäude ist schnell abgerissen, dachte sie. Wie viele Generationen von Kindern hatten hier wohl lesen und schreiben gelernt? Und an einem Tag war alles weg.
Als sie an das Pult zurückkehrte, stellte sie fest, daß der Bauarbeiter recht gehabt hatte: Dieses Klassenzimmer war ein Eisschrank. Und das Tageslicht schwand immer rascher. Sie stellte die Lampe auf den Tisch und dachte an den Piratenschatz. Stell dir vor, sie hätten die Schule abgerissen und die Juwelen wären noch darin gewesen, dachte sie. Sie löste die schwarze Schnur und schlug den Deckel auf: ein paar verblichene Schulhefte, blaßblau oder hellgrün, über die in schwarzen Druckbuchstaben quer das Wort Cuaderno gedruckt war. Kinderschulhefte. Zwei, drei, vier. Jammerschade, daß es keine Juwelen sind. Und prompt überkam sie wieder der stechende Schmerz.
Sie schlug eines der Hefte auf. Sogleich fiel ihr die saubere, gleichmäßige, gut leserliche Schrift auf, die alle Seiten von oben bis unten bedeckte. Dazwischen in allen vier Heften immer mal wieder eine Zeichnung. Im ersten Heft war es ein Gesicht, ein bekümmert dreinblickender Mann. Darunter stand: ›Ich, Oriol Fontelles‹. Im zweiten Heft die Zeichnung eines Hauses, unter dem ›Casa Gravat‹ stand. Im dritten, mal sehen … eine Kirche. Die Kirche von Sant Pere de Torena. Und ein Cockerspaniel mit unendlich traurigen Augen, der der Unterschrift zufolge Aquil·les hieß. Und schließlich im letzten Heft die unfertige Skizze einer Frau, unzählige Male korrigiert und doch unvollständig, ohne Lippen und mit leeren Augenhöhlen, wie eine marmorne Friedhofsstatue. Sie setzte sich, ohne zu bemerken, daß in der Kälte ihr Atem zu weißem Nebel wurde. Oriol Fontelles. Wo hatte sie diesen Namen bloß schon mal gehört oder gesehen?
Neugierig fing Tina Bros an zu lesen. Sie begann mit der ersten Seite des ersten Hefts, mit dem Satz: Geliebte Tochter, ich kenne nicht einmal Deinen Namen, aber ich weiß, daß es Dich gibt. Ich hoffe, daß jemand Dir diese Zeilen zukommen läßt, wenn Du groß bist, denn ich möchte, daß Du sie liest … Ich habe Angst vor dem, was sie Dir über mich erzählen könnten, vor allem Deine Mutter.
Um halb neun abends, als das Licht der Gaslampe langsam schwächer wurde, hob sie plötzlich den Kopf und kehrte in die Gegenwart zurück. Sie fröstelte. Es war eine Dummheit, so lange in diesem eiskalten Klassenraum sitzen zu bleiben. Sie klappte das letzte Heft zu und atmete langsam aus, als hätte sie während der gesamten Lektüre den Atem angehalten. Diese Hefte, beschloß sie, waren nichts für Maites Ausstellung. Sie legte sie in die Zigarrenkiste zurück, steckte diese in ihre große Anoraktasche und verließ die Schule, in der sie, wie ihr schien, Jahre verbracht hatte.
Sie hinterließ die Lampe an der mit dem Bauarbeiter vereinbarten Stelle, gab den Schlüssel im Rathaus ab und ging zu der Marmorplatte mit der Aufschrift Carrer del Mig hinüber, wo ihr Citroën auf sie wartete, von einer feinen Schicht Neuschnee bedeckt.
Die Straße nach Sort hinunter war kalt und einsam. Sie hatte sich nicht mit dem Anlegen der Schneeketten aufhalten wollen, und so fuhr sie langsam, in Gedanken versunken und wie erstarrt von der Kälte, von dem, was sie gelesen hatte, und von der Aussicht auf das, was ihr an diesem Abend noch bevorstand. Hinter der Kehre von Pendís, wo der Gemeindebezirk Torena endete, war auf die alte Rückhaltemauer ein Protest gegen die Abholzung weiterer Bäume zur Vergrößerung der Skipiste von Tuca Negra gesprüht. In der Schule war niemand mehr, und so stellte sie den Pappkarton in Maites Büro ab, legte eine kurze Notiz dazu und ergriff die Flucht, denn die dunklen, einsamen Korridore hatten ihr schon immer Angst eingejagt, und die Kälte ließ sie noch unheimlicher erscheinen. Der 2CV brachte sie klaglos zu der abgelegenen Pension. Obwohl sie weiter im Norden lag, hatte es hier noch nicht geschneit. Auf dem Beifahrersitz lag die Zigarrenkiste mit den vier Heften. Sie hielt es für sicherer, den Wagen nicht auf dem Parkplatz der Pension abzustellen, also parkte sie ihn am Rand der verlassenen Landstraße, schaltete Motor und Lichter aus und blieb reglos sitzen, den Blick auf den erleuchteten Eingang der Pension geheftet. In diesem Augenblick begann es zu schneien, sanft und still, und sie tastete nach der Zigarrenkiste auf dem Beifahrersitz, um sich zu vergewissern, daß sie noch da war.
Es war kalt, und sie war schon ein paarmal ausgestiegen, um die Windschutzscheibe abzuwischen, ohne dabei die Eingangstür der Pension aus den Augen zu lassen. Trotzdem wollte sie die Autoheizung nicht einschalten, denn in der verzauberten Stille dieser Nacht war nicht einmal das Rauschen des Flusses zu vernehmen, und das Dröhnen des Motors hätte Jordi auf sie aufmerksam gemacht.
Als sie das nächste Mal aus dem Wagen stieg, um sich die Füße warmzustampfen und die Windschutzscheibe freizukratzen, bedeckte sie ihr Nummernschild mit Neuschnee vom Wegrand. Es war eine Sache, zu wissen, daß ihre Anwesenheit hier unter ihrer Würde lag, und eine andere, daß andere davon erfuhren. Ihre Nase war eiskalt.
Sie stieg wieder ein, ohne den Blick von der erleuchteten Tür zu wenden, durch die während der ganzen Zeit nur zwei Unbekannte auf die Straße getreten waren. Mit ihrer behandschuhten Hand strich sie sacht über die Zigarrenkiste.
»Was hast du gesagt?«
»Du hast mich sehr wohl verstanden.«
Rosa blieb vor Überraschung und Schreck der Mund offen stehen, und sie spürte, wie ihr Herz zu rasen begann. Ihr schwindelte, und sie ließ sich in den Schaukelstuhl fallen. Sie flüsterte: »Warum?«
»Hier ist jeder in Gefahr.«
»Nein. Hier ist nur einer in Gefahr, und das ist dieses Kind.«
»Ich tue, was ich kann.«
»Den Teufel tust du. Geh doch zu deiner Senyora Elisenda.«
»Wieso?«
»Du gehst doch sonst so gern zu ihr. Oder bist du etwa nicht völlig hin und weg, wenn du sie nur ansiehst? Wo sie ein so ausdrucksvolles Gesicht hat, so schwierige Augen …«
»Was willst du denn damit andeuten?«
Rosa blickte aus dem Fenster, als habe sie gar nichts andeuten wollen, und sagte dann mit müder Stimme: »Du bist der einzige im Dorf, auf den sie hört.«
»Senyora Elisenda kann auch nichts ausrichten.«
»In diesem Dorf geschieht nichts, was sie nicht will.«
»Schön wär’s.«
Rosa sah zu Oriol hinüber, sah ihm tief in die Augen, hoffte zu ergründen, welche Blicke ihr Mann mit Senyora Elisenda tauschte, wenn sie zusammen waren. Als Oriol zu einer Erklärung ansetzte, begannen draußen die Kirchenglocken das Angelus zu läuten. Sie schwiegen, doch noch bevor die Glocken verstummt waren, brach es aus Rosa heraus: »Wenn du nicht etwas dagegen unternimmst, kehre ich nach Barcelona zurück.«
»Du kannst mich doch nicht verlassen.«
»Du bist ein Feigling.«
»Ja, ich bin ein Feigling.«
Instinktiv legte Rosa die Hand auf ihren Bauch und sagte erschöpft: »Ich will nicht, daß unsere Tochter erfährt, daß ihr Vater ein Feigling und Faschist ist.«
»Ich bin kein Faschist.«
»Was unterscheidet dich denn vom Bürgermeister, diesem Schweinehund?«
»Nicht so laut, man hört dich ja überall!«
»Er macht, was er will, und du machst mit.«
»Hör mal, ich bin schließlich nur der Dorfschullehrer.«
»Du könntest den Bürgermeister dazu bringen, zu tun, was du willst.«
»Ausgeschlossen. Außerdem habe ich Angst. Dieser Mann macht mir angst.«
»Du mußt das mit Ventureta verhindern.«
»Das kann ich nicht. Ich schwöre dir, er hört einfach nicht auf mich.«
Rosa sah ihm ein letztes Mal in die Augen, dann wandte sie sich ab, wiegte sich sacht im Schaukelstuhl vor und zurück und blickte wieder aus dem Fenster. Es war ihre Art, Abschied von ihm zu nehmen. Wie hatte es nur so weit kommen können? Sie verfluchte den Tag, an dem er diese Arbeit angenommen hatte, eine Lehrerstelle in einem wunderhübschen kleinen Dorf, das laut Lexikon von der Rinder- und Schafzucht lebte, was glaubst du, wie glücklich wir dort sein werden, wir werden Zeit zum Lesen haben und Zeit füreinander, das ist genau das, was wir brauchen. Und nach langem Hin und Her hatte sie schließlich gesagt: Weißt du was, Oriol, laß uns einfach nach Torena gehen. Und nun wurde die Füllung für die Cannelloni, die sie zu Weihnachten hatte machen wollen, allmählich kalt. Unmöglich, sich vorzustellen, daß in vier Tagen Weihnachten war, unmöglich, heute Cannelloni zu machen, denn beim Gedanken an diesen armen Jungen blieb einem jeder Bissen im Halse stecken.
Oriol betrachtete einen Moment lang Rosas Nacken, dann schnitt er wütend das Brot in Scheiben und ging türenknallend hinaus, kam jedoch gleich darauf zurück, als habe er etwas vergessen. Er blieb reglos stehen, den Türgriff noch in der Hand, und bemühte sich, seinen Zorn zu bändigen. Rosa starrte weiter auf die Straße hinaus, ohne etwas zu sehen, weil das eindrucksvolle Panorama des Vall d’Àssua hinter ihren Tränen verschwamm. Oriol nahm seinen pelzgefütterten Mantel und die Mütze und ging wieder hinaus.
Seit einem halben Jahr war Oriol jetzt Lehrer in Torena, und seither war er nicht wiederzuerkennen. Dabei waren sie bei ihrer Ankunft so glücklich gewesen! Sie hatte gerade erst festgestellt, daß sie schwanger war, und beide waren noch ganz überrascht, daß er, der wegen eines Magenleidens keinen Militärdienst geleistet hatte und nicht an der Front gewesen war, eine Stelle bekommen hatte. Sie hatten gedacht, alle Posten würden an Lehrer aus anderen Regionen Spaniens vergeben, an solche, die das Mitgliedsbuch der Falange vorweisen konnten oder sich dadurch auszeichneten, daß sie an der Seite des Mannes mit dem dünnen Oberlippenbart gegen die Republik gekämpft hatten. In ihrer Einfalt hatten sie nicht verstanden, daß niemand an die Schule von Torena wollte, nicht einmal Gott, der zwar in einem Stall geboren, aber immerhin in Nazareth zur Schule gegangen war, wo nicht nur Bauernkinder, sondern auch Söhne von Zimmerleuten unter den Schülern waren.
Rosa starrte aus dem Fenster, ohne den Platz zu sehen. Es war Valentí Targa, der ihren Mann so verändert hatte, vom ersten Tag an, als er ihn mit Beschlag belegt und für sich gewonnen hatte. Vom ersten Augenblick an, als er auf dem Platz stand, die Arme in die Hüften gestemmt, und sie herausfordernd musterte, wie sie mit leuchtenden Augen aus dem Taxi stiegen, im Gepäck den großen Korb mit dem Geschirr und das sorgfältig verpackte Bild, das Oriol von ihr gemalt hatte. Sie hatte die Gefahr nicht kommen sehen, und nun wurde in Torena seit über vier Monaten Tag für Tag geschwiegen, darüber, daß von Zeit zu Zeit schwarze Wagen vorfuhren und weinende Männer zum Hang von Sebastià brachten, wo sie aussteigen mußten, und daß diese Männer anschließend auf Viehwagen abtransportiert wurden, zum Schweigen gebracht, ihre Tränen für immer versiegt. Und Valentí Targa hatte erreicht, daß auch Rosa den Mund hielt. Zu lange hatte sie geschwiegen, bis heute, als Oriol vom Rathaus zurückkehrte, wohin ihn dieser verdammte Targa zitiert hatte, und ohne ihr in die Augen zu sehen sagte, es wäre besser, wenn er in die Falange einträte. Sie stand am Herd, starrte ihn sprachlos an, mit offenem Mund, und dachte erst, sie habe ihn vielleicht falsch verstanden oder er mache Scherze. Aber nein: Er wich auch weiterhin ihrem Blick aus und schwieg, wartete auf ihre Reaktion. Sie stellte die Cannelloni auf dem Untersetzer ab, ging mit ihrem schweren Bauch mühsam zum Schaukelstuhl hinüber, als wolle sie möglichst viel Abstand zwischen ihr Kind und ihren Mann legen, und fragte: »Was hast du gesagt?«
»Du hast mich sehr wohl verstanden.«
José Oriol Fontelles Grau. Er starb den Heldentod für Gott und Vaterland. Jetzt fiel Tina ein, wo sie den Namen schon einmal gesehen hatte. Vor einer Woche, als sie noch glücklich gewesen war, hatte sie die Friedhöfe von Vall d’Àssua fotografiert, denn ein Kapitel ihres Buches sollte von den Gräbern handeln. Im Vergleich zu den Friedhöfen anderer Dörfer hatte der Friedhof von Torena fünf Sterne verdient. Anstatt das Weitwinkelobjektiv zu benutzen, das alles verzerrte, trat sie zurück, um einen Gesamteindruck zu bekommen. Für die Mitte des Fotos wählte sie ein verfallenes Mahnmal, rechts und links gesäumt von Erdgräbern, von denen die meisten verrostete Eisenkreuze trugen, einige auch ein Marmorkreuz. Im Hintergrund, halb von dem Mahnmal verdeckt, eine weitere Gräberreihe vor der Mauer Richtung Norden, woher der Feind und der eisige Wind kamen. Das blitzblanke, gepflegte Mausoleum der Herrenfamilie lag zur Linken.
Sie drückte auf den Auslöser. Ein Grünfink, der gerade zum Flug angesetzt hatte, blieb im Bild gefangen, mitten in der Luft, rechts von dem verfallenen Mahnmal. Sie hatte ihn nicht bemerkt. Oder hatte sie ihn unbewußt wahrgenommen, wie es vielen Fotografen ergeht, die zwar intuitiv alles erfassen, was sich im Bildausschnitt abspielt, aber beim Entwickeln der Fotos doch immer wieder überrascht sind?
Im schwülroten Licht begannen sich auf dem weißen Papier seltsame Formen abzuzeichnen, zunächst blaß, dann immer kräftiger. Sie schob das Papier mit einer Pinzette in der Flüssigkeit hin und her, und nach und nach wurde das Bild deutlicher. Sehr gut getroffen, war ihr erster Gedanke. Sie zog das Papier aus der Wanne, fixierte es und hängte es auf die Leine, neben die zwanzig anderen Aufnahmen der Filmrolle Nr. 3 vom 5. Dezember 2001, Friedhof von Torena. Ja, sehr gut getroffen.
Beim näheren Betrachten ihrer fotografischen Ausbeute fand sich zunächst nichts Überraschendes. Doch dann bemerkte sie den Grünfinken, der zum Flug ansetzte, festgebannt auf dem letzten Bild mit dem verfallenen Mahnmal. Sie konnte sich nicht mehr daran erinnern. Er verlieh dem Bild etwas Poetisches, fand sie. Sie betrachtete den Vogel unter der Lupe. Ja, ein Grünfink, die Flügel gesenkt im mühevollen Abheben. Hatte er einen Wurm im Schnabel, oder war das ein Fussel auf dem Abzug? Nein: Es war eine Zeichnung auf dem Grab im Hintergrund des Fotos, vor dem der Vogel vorbeiflog, eine optische Täuschung. Zum ersten Mal beachtete sie den Grabstein. Die Belichtungszeit war so kurz gewesen, daß sowohl der Grünfink als auch der Grabstein klar und deutlich zu erkennen waren. Auf dem Grabstein stand: José Oriol Fontelles Grau (1915-1944) – Er starb den Heldentod für Gott und Vaterland. Darunter das Joch und das faschistische Pfeilbündel. Eine der Pfeilspitzen sah aus wie ein kleiner Wurm, den der Grünfink in sein Nest trug.
Tina legte die Lupe beiseite und rieb sich die Augen. Dieses Foto, das letzte auf der Filmrolle, würde sich gut am Anfang des Buches machen, in Schwarzweiß, als Symbol der Vergänglichkeit oder etwas in der Art.
Ihre behandschuhte Hand lag noch immer auf der Zigarrenkiste, die Oriol Fontelles’ Hefte enthielt, und einen Augenblick lang ließ der Gedanke an ihren Inhalt sie vergessen, warum sie vor der erleuchteten Eingangstür der Pension von Ainet Wache hielt, während der Schnee wieder die Windschutzscheibe bedeckte. Die Schneeflocken erschienen ihr wie Sterne, die vom Himmel fielen, weil sie es müde waren, nutzlos dort oben zu hängen, weil sie enttäuscht waren von der Vorstellung, daß ihr Licht Jahrhunderte brauchte, um die Augen geliebter Menschen zu erreichen. Warum läßt Arnau sich nicht lieben? Immer ist er so schweigsam und verschlossen, mir scheint, er will die Sterne gar nicht sehen, genau wie Jordi. Meine Männer wollen die Sterne nicht sehen. Als sie gerade aussteigen wollte, um wieder einmal die Windschutzscheibe freizuwischen, sah sie, wie sich am Eingang der Pension etwas regte. Jemand kam heraus. Jordi. Ihr Jordi verließ die Pension von Ainet, weit weg von zu Hause, und spähte nach allen Seiten, während er sich die Mütze aufsetzte. Er bemerkte den roten Citroën nicht, der an der dunklen Landstraße parkte, wandte sich um und streckte den Arm durch die Tür. Diese Geste weckte ihre Eifersucht viel mehr als die Frau, die nun heraustrat. Sie war fast ebenso groß wie Jordi und so in ihren Anorak eingemummt, daß man sie nicht erkennen konnte. Es war eine Geste, mit der Jordi nicht nur die Frau willkommen hieß, sondern vielmehr das Dasein dieser Frau, es war ein Willkommensgruß und zugleich eine Ohrfeige für sie, die in der Kälte im Auto saß, nur um ihre Befürchtungen bestätigt zu sehen.
Jetzt reagierte sie. Sie griff zur Kamera, stützte sich auf das Lenkrad, um während der langen Belichtungszeit eine ruhige Hand zu haben, und drückte ab. Zwei, drei Fotos. Vier, fünf. Und jetzt mit dem Teleobjektiv: eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs … Sie ließ die Kamera sinken und fühlte sich wie eine gewöhnliche Paparazza.
2
Seine Exzellenz Don Nazario Prats, Zivilgouverneur und Provinzchef des Movimiento, war kahl, schnauzbärtig, verschwitzt und nervös. Wer war nicht nervös, wenn er Senyora Elisenda gegenüberstand? Allein ihre persönliche Duftnote versetzte ihn in Alarmbereitschaft, erinnerte sie ihn doch daran, wie Senyora Elisenda ihm während der Beerdigung ihres Mannes Santiago mit samtweicher Stimme Befehle zugeraunt hatte, als wüßte sie nicht, daß er Zivilgouverneur war, und wie sie ihn erpreßt hatte, als wäre ihr unbekannt, daß er als Provinzchef des Movimiento gewisse Vorrechte genoß. Aber ihr waren seine Vorrechte völlig egal, sie brachte ihn um seine rechtmäßigen Einkünfte, und das mit einer Kaltschnäuzigkeit, die eines Stalin würdig gewesen wäre. Eines Stalin, jawohl. Für die Kameras setzte er eine freundliche Miene auf, während er zusah, wie Marcel, der Sprößling des seligen Kameraden Santiago Vilabrú, elegant den Hang hinunterglitt bis zu der Stelle, wo er, drei Subdelegierte, sechs Bürgermeister und die verfluchte Witwe gemeinsam mit drei Autobussen voller Claqueure aus Vall d’Àssua, Caregue und Batlliu der Eröffnung der Skipiste von Tuca beiwohnten, die eine Innovation war, eine mutige Initiative und ein Ansporn für die Zukunft. Die Autobusinsassen klatschten eifrig, denn sie hatten kein Wort verstanden, und so handelte es sich wohl um etwas Bedeutendes. Marcel Vilabrú Vilabrú, ein ausgezeichneter Skifahrer, war in zweitausenddreihundert Meter Höhe gestartet; auf seinem Rücken knatterte die rot-goldene spanische Fahne im Wind, und seine Skier rauschten leise durch den Schnee, als er hangabwärts sauste, in Schwüngen, die er zuvor mit Quique abgesprochen und an die dreißigmal geübt hatte, damit er nicht etwa durch einen Patzer im Neuschnee landete, den er mit dieser grandiosen Abfahrt einweihte, und dabei die Fahne ruinierte und das Schauspiel verdarb.
Don Nazario Prats verfolgte Marcels Abfahrt mit aufgesetztem Lächeln und warf von Zeit zu Zeit einen verstohlenen Blick auf seine Widersacherin, um sicherzugehen, daß sie keinerlei Anzeichen von Langeweile, Mißmut oder sonst eine Gemütsregung erkennen ließ, die sie dazu bewogen hätte, das Ganze einem Minister zu erzählen, bloß um ihn anzuschwärzen. Einem Minister oder den Kameraden von der Falange. Aber nein, die Witwe sah ihrem geliebten Sohn zu und betrachtete voller Stolz die lautlos flatternde zweifarbige Fahne (das Knattern drang nicht bis zu den Würdenträgern herüber), während die Kameras der Wochenschau die Szene in Schwarzweiß festhielten.
»Erst dreizehn Jahre alt und schon ein so begnadeter Skiläufer«, sagte er aufs Geratewohl, für die Ohren der Allgemeinheit, besonders aber für ihre Ohren bestimmt. Niemand entgegnete etwas, und er spürte, wie seine Hände schweißnaß wurden, wie immer, wenn er die Fassung verlor. Nicht einmal sie hatte geantwortet, dabei hätte sie sich doch ein klein wenig entgegenkommend zeigen können. Aber nein, sie will mich fertigmachen.
Der Gouverneur sah nach links: Hochwürden August Vilabrú, dieser stille alte Kanoniker (oder was auch immer er sein mochte), beobachtete Marcel Vilabrús Abfahrt so stolz, als wäre er der Vater des Jungen. Der Gouverneur wußte nicht, daß August Vilabrú sich mit Fug und Recht zumindest als der Vater der Mutter des Jungen fühlen konnte; schließlich hatte er, als Elisenda fünf Jahre alt war, ihren Eltern gesagt: »Anselm, Pilar, dieses Mädchen ist etwas ganz Besonderes.« »Und Josep?« »Josep«, hatte er geantwortet (der arme Josep, er ruhe in Frieden), »Josep ist durchschnittlich, aber Elisenda ist außergewöhnlich intelligent, sie sieht die Dinge im Zusammenhang und …« »Schade nur, daß sie ein Mädchen ist.« »Galant wie immer.« »Anselm, Pilar, jetzt streitet euch doch um Himmels willen nicht meinetwegen! Eure Tochter ist ein Diamant, und es wäre mir eine Ehre, ihn zu schleifen, bis er funkelt.« Aber Anselm Vilabrú war ein Hansdampf in allen Gassen, und Pilar machte, auch wenn er das damals nicht wissen konnte, anderen Männern schöne Augen, und so schenkten sie Augusts Bemerkungen keine Beachtung. Sie nahmen ihn sowieso nicht ernst: Sowohl sein Bruder als auch seine Schwägerin waren der Ansicht, Mathematiker seien schlechte Menschenkenner, noch dazu, wenn sie Priester waren. Also ergriff Hochwürden August die Initiative und brachte das Mädchen im Internat der Theresianerinnen von Barcelona unter, weil er sich der Spiritualität ihres seligen Gründervaters Enric d’Ossó, der seiner Meinung nach heiliggesprochen gehörte, stets verbunden gefühlt hatte. Er sprach mit Mutter Venància und gewann sie als Verbündete: Das arme Kind brauchte eine anständige Erziehung, denn obwohl sie aus einer der besten Familien kam, kümmerte sich dort niemand richtig um sie. Mutter Venància verstand. Sie wußte, daß Hochwürden August Vilabrú sich an sie gewandt hatte, weil sie als die Anspruchsvollste unter den Theresianerinnen galt. Ein kurzer, aber fruchtbarer Aufenthalt im Kloster von Ràpita zu Zeiten der Äbtissin Dorotea hatte ihr eisernes Pflichtgefühl geschärft und ihr die Devise eingeprägt, daß man stets das tun mußte, was man für richtig hielt. »Eine Eins in Rechnen, eine Eins in Grammatik, eine Eins in Latein, eine Eins in Naturwissenschaften, eine Eins in Religion, Diamant ist gar kein Ausdruck für dieses Kind, Hochwürden August.«
Unten angekommen, nahm Marcel die Fahne ab und rammte die Stange an der mit Quique und dem nervtötenden Protokollchef des Gouverneurs vereinbarten Stelle in den jungfräulichen Schnee, als hätte er soeben den Nordpol erobert, eine männliche Geste, die von Würdenträgern wie Claqueuren beklatscht wurde. Nun setzten sich oben dreißig Skiläufer in Bewegung und zogen slalomfahrend ein zierliches Geflecht von Spuren in den Schnee, was mit erneutem Beifall quittiert wurde. Don Nazario Prats drehte sich halb um, und man präsentierte ihm ein Silbertablett mit einem roten Kissen, auf dem die Einweihungsschere ruhte. Er packte sie heftig, als wollte er eine Dummheit begehen. Onésimo Redondo höchstpersönlich, der Führer der Nationalsyndikalistischen Initiative, hatte ihm eines Abends verraten, daß ein Einfall, um genial zu sein, intuitiv und spontan sein müsse. Jetzt hatte er einen solchen genialen Einfall und reichte, ohne nachzudenken, die Schere an die Witwe Vilabrú weiter.
Da, du Miststück, am liebsten würde ich sie dir in den Hals rammen.
»Wer wäre geeigneter als Sie, Senyora Elisenda, mir bei der Einweihung der Skipiste von Tuca Negra zur Hand zu gehen?«
Senyora Elisenda ließ sich nicht lang bitten. Sie kannte ihre Rechte, und so ging sie ihm nicht nur zur Hand, sondern zerschnitt selbst das zweifarbige Band, das die Würdenträger bisher daran gehindert hatte, zum Sessellift und dem pittoresken Schweizerhaus hinüberzugehen, wo man ihnen einen schönen heißen Kaffee mit Schuß versprochen hatte. Würdenträger und Autobusinsassen beklatschten auch das Zerschneiden des Bands und sahen dann zu, wie Senyora Elisenda von Casa Gravat die Schere wieder auf das Kissen legte und sich in Begleitung des Gouverneurs auf den Weg zum Chalet machte, dem zukünftigen Vereinslokal von Tuca Negra. Nur die Honoratioren übertraten die nicht länger sichtbare Einweihungslinie, denn die Leute aus den Bussen hatten noch nie Skier unter ihren Füßen gehabt, obwohl sie mit dem Schnee vertraut waren. Sie hatten im Winter genug damit zu tun, ihre Geräte auszubessern und instand zu setzen, Sensen zu dengeln, Gewehre und Karrenräder zu reparieren, Maschinen zu ölen, Risse zu stopfen, schadhafte Dachziegel auszutauschen, wenn nicht ganz so viel Schnee lag, ihr Vieh zu versorgen und in die Ferne zu blicken und von einem anderen, unerreichbaren Leben zu träumen. Nur die Honoratioren übertraten also die Linie – und, ungebeten, Senyora Elisendas Chauffeur Jacinto Mas, der seiner Herrin nie von der Seite wich, weniger, weil er fürchtete, jemand könne ihr etwas zuleide tun, sondern vielmehr, weil er fühlte, daß sein Leben, die Narbe in seinem Gesicht und seine Zukunft nur dann einen Sinn hatten, wenn Senyora Elisenda ihn ansah und ihr Blick sagte, sehr gut, Jacinto, du machst das ausgezeichnet.
Hochwürden August Vilabrú segnete das Vereinslokal (Wände aus lasiertem Holz, imitierte Pokale, große Fenster, die auf die Piste hinausgingen), versprengte Weihwasser gegen das Böse und nuschelte »Asperges me« und daß von diesem Ort stets nur Gutes ausgehen möge. Doch schon wenige Jahre später würde sich hier zwischen Quique und Marcel die Szene unter der Dusche abspielen, der Haß, der sich in Quique angestaut hatte, würde sich in Flüchen und Gotteslästerungen entladen, im Vereinslokal von Tuca Negra würde in jeder Skisaison etwa dreißigmal Ehebruch begangen, bei guten Schneeverhältnissen sogar bis zu vierzigmal, und viele der Stammgäste waren zwar äußerst kultiviert, aber völlig skrupellos. Aber wie sollte Hochwürden August Vilabrú das ahnen? Im Gegensatz zu Bibiana kannte er die Zukunft der Dinge und Menschen nicht, und so erteilte er mit der Seelenruhe des Unwissenden großzügig seinen Segen.
Durch die Fenster des Vereinslokals bot sich den Honoratioren ein großartiger Ausblick auf die dreißig Skifahrer, junge, athletische Männer und Frauen mit gebräunter Haut und weißen Zähnen, die betont sorglos plauderten und nur von Zeit zu Zeit zur Kamera der Wochenschau hinüberschielten, in die sie nicht direkt hineinblicken sollten, während sie auf den Sessellift warteten. Die neu eröffneten Anlagen waren wie geschaffen für die distinguierte Klientel, die bald in Massen über die frisch asphaltierte Zufahrtsstraße herbeiströmen würde. Und all das, beendete der Reporter seinen Bericht mit näselnder Stimme, war der Entschlußkraft einiger einheimischer Unternehmer und der entschiedenen Unterstützung durch die örtlichen Behörden zu verdanken, die aus diesem idyllischen Fleckchen Erde einen Anziehungspunkt für die vornehmsten Freunde des aufkommenden Wintersports machen wollten. Der Sprecher verschwieg, daß die Bezeichnung »einheimische Unternehmer« ein Euphemismus war, weil siebzig Prozent des Kapitals aus Schweden kamen, obwohl die Schweden die Diktatur verabscheuten. Die anderen dreißig Prozent stammten von Senyora Elisenda Vilabrú, verwitwete Vilabrú, der letzten Hinterbliebenen der Vilabrús von Casa Gravat, Universalerbin des dreihundert Jahre alten Familienbesitzes sowie Erbin des nicht unbeträchtlichen persönlichen Vermögens des seligen Santiago Vilabrú. Bei den einheimischen Unternehmern handelte es sich allein um sie, denn alle anderen potentiellen Investoren hatten die Nase gerümpft und gesagt, die Piste von La Molina sei schon mehr als genug und Tuca Negra habe keinerlei Zukunft. Die darauffolgende Reportage zeigte Franco bei der Einweihung des dritten Stausees im Jahr 1957, dem neunzehnten Jahr nach dem Sieg.
Der Gouverneur trank Kaffee mit einem Schuß Cognac und hatte sich eine mächtige Zigarre angesteckt. Er lächelt unter seinem Schnurrbart und tat so, als sähe er durch das Fenster hinaus in den Schnee, während er in Wirklichkeit mit quälerischer Lust die sich in den Scheiben spiegelnde Silhouette der Witwe musterte. Die Witwe Vilabrú, der dieser begehrliche Blick keineswegs entging und die sah, wie er sich nervös den Schweiß von Stirn und Händen wischte, blieb völlig ungerührt. Wortlos bedeutete sie dem Dienstmädchen, dem Gouverneur und allen anderen, die eine Militär- oder Falangeuniform trugen, immer reichlich Cognac nachzuschenken. Ein schmaler, schüchtern wirkender Mann hob sein Weinglas wie zu einem Toast. Seit mehr als zwei Jahren beriet Rechtsanwalt Gasull Senyora Elisenda nicht nur in rechtlichen Fragen, sondern dachte auch sonst Tag und Nacht nur an sie, an ihre Augen, ihr Konto, ihre riskanten geschäftlichen und politischen Schachzüge, ihre Haut und ihre schneidende Gleichgültigkeit ihm gegenüber. Gasull wollte ihr über die Entfernung hinweg lächelnd zuprosten, aber Senyora Elisenda nahm die Geste ihres Rechtsanwalts gar nicht zur Kenntnis; soeben hatte Quique, der Skilehrer von Tuca Negra, den Raum betreten, gefolgt von einem Schwall kalter Luft, Marcel und ein paar auserwählten Skifahrern, und sie trat zu ihm, übermittelte ihm die Glückwünsche des Gouverneurs für die gelungene Abfahrt der Gruppe und sagte dann: »Heute abend fahre ich nicht nach Barcelona zurück, ich bleibe in Torena«, was weniger eine Information war als vielmehr ein Befehl. »So, und nun geh mit Marcel zum Gouverneur und begrüße ihn.« Quique unterdrückte ein zufriedenes Lächeln auf seinem schneegebräunten Gesicht und ging mit Marcel Vilabrú zum Gouverneur hinüber. Don Nazario Prats ignorierte den Schönling geflissentlich, legte statt dessen seine Hände auf die Schultern des Sprößlings der Familie Vilabrú – ein stämmigerer Bursche als sein Schwachkopf von Vater – und sagte: »Marcelo, Marcelo, wenn dein Vater heute hier wäre, er wäre sehr stolz auf dich. Armer Santiago, daß er das nicht mehr erleben darf …« Dabei dachte er, ich weiß, wovon ich rede, denn deinen Vater und mich verband eine tiefe, echte Freundschaft. Wir waren uns so nah, daß er sozusagen in meinen Armen gestorben ist, der arme Santiago. Marcel Vilabrú lächelte unverbindlich und dachte daran, daß sein Vater für ihn nicht mehr war als ein kaltes Gesicht auf dem einzigen Foto unter all den zahlreichen Familienfotos im Wohnzimmer von Casa Gravat. »Es ist ein Jammer, daß Papà heute nicht dabeisein kann«, entgegnete er dem Gouverneur für alle Fälle. Sehr gut, Jacinto, du machst das ausgezeichnet.
3
Sie hörte nicht, was der Junge sie fragte, der ungeduldig an ihrem Ärmel zupfte, denn obwohl sie die Karte mit dem asiatischen Kontinent vor sich hatte, waren ihre erstarrten Gedanken noch immer vor dem Eingang der Pension von Ainet. Sie war davon besessen, herauszufinden, wer zum Teufel noch mal diese Frau war.
»Ich kann Hongkong nirgendwo finden.«
Zu Hause angekommen, hatte sie ihre Tasche und ihre Schlüssel in die Ecke geworfen und sich in den Sessel fallen lassen, wo sie schweigend vor sich hin starrte, wie Doktor Schiwago, und grübelte: Und ich dachte, ich wäre nicht eifersüchtig. Und ich dachte, wir wollten immer ehrlich zueinander sein. Und ich dachte … Nein: Das Demütigendste daran ist, daß er mich so geringschätzt, daß er mich hintergeht und belügt, daß er es heimlich tut.
»Hätte er es etwa in aller Öffentlichkeit machen sollen?« mischte sich Doktor Schiwago ein und gähnte. »Das wäre erst recht demütigend gewesen.«
»Dich hat niemand um deine Meinung gebeten, Juri Andrejewitsch.«
Doktor Schiwago hörte auf zu gähnen, streckte sich, sprang geschmeidig von seinem Sessel auf Tinas Knie, ohne jedoch seine würdevolle Haltung zu verlieren, und rollte sich dort zusammen. Tina kraulte ihn hinter den Ohren, an seiner Lieblingsstelle, und dachte nach. Sie hatte sich vorgenommen, Jordi zur Rede zu stellen, sobald er nach Hause kam:Wer ist sie, wie lange läuft das jetzt schon mit euch beiden, was hat sie, was ich nicht habe, warum tust du mir das an, liebst du mich denn nicht mehr, weißt du nicht, daß ich dich noch liebe, warum betrügst du mich, hast du vielleicht auch mal an unseren Sohn gedacht, ich will die Scheidung, ich will dich umbringen, du Mistkerl, du hast mir doch Treue geschworen, weißt du überhaupt, was Treue bedeutet? Sie bedeutet, daß man an den anderen glaubt, daß man zu ihm steht, und du stehst nicht mehr zu mir, weil du nicht an mich glaubst, weil du mir nicht erzählst, was los ist, und wenn du dazu zu feige bist, warum schreibst du mir dann nicht einfach einen Brief, Briefe sind wie das Licht der Sterne, Jordi, wußtest du das? Ich glaube, du verdienst es gar nicht zu wissen. Was ist anders zwischen uns beiden, wann genau hat das angefangen, wer ist schuld daran, was habe ich falsch gemacht, Jordi, daß du dich heimlich mit Maite triffst, falls es Maite ist, oder mit Bego oder Joana oder irgendeiner Frau, die ich nicht kenne. Wer ist die Frau, die meinen Platz einnimmt, Jordi? Eine Schulkollegin? Und Jordi würde sie mit offenem Mund anstarren, entsetzt darüber, daß sie alles wußte, denn das paßte nicht in seinen miesen Plan. Und dann würde er in Tränen ausbrechen und sie um Verzeihung bitten, und sie würde versuchen, diese schlimme Zeit zu vergessen. Es würde nicht leicht werden, aber zum Glück war es nur eine Episode, und sie wollte positiv denken und stets nach vorn blicken. Und die Strafe? Wie konnte sie ihn bestrafen?
Tina überlegte, ob sie das Abendessen machen oder lieber auf Jordi warten sollte, der in einer Lehrerkonferenz saß. Jordi und Maite, der Intellektuelle und die Schulleiterin, ein hübsches Paar verlogener Ehebrecher, die nach der Konferenz herumtrödeln würden, bis sie alleine im dunklen Gebäude zurückblieben. Wenn sie bei Jordis Rückkehr mit Kochen beschäftigt wäre, würde sie nicht den Mut finden, ihm all das ins Gesicht zu sagen, was sie sich vorgenommen hatte, denn über so etwas konnte man in der Küche nicht reden, das war ein Gespräch fürs Wohnzimmer. Sie würden sich setzen, und dann würde sie sagen, Jordi, ich weiß alles, du belügst mich, du betrügst mich mit einer anderen, ihr trefft euch jede Woche in der Pension von Ainet, du hast mich enttäuscht, ich bin so traurig, daß ich heulen könnte; dabei bin ich doch noch eine attraktive Frau, na gut, ich habe drei Kilo zuviel auf den Hüften, aber sonst habe ich mich doch gut gehalten, siehst du das nicht? Du bist derjenige, der langsam Fett ansetzt, aber mir gefällst du auch mit Bauch; warum tust du mir das an, warum betrügst du mich, hatten wir nicht ausgemacht, immer ehrlich zueinander zu sein, Jordi? Ja, ein solches Gespräch führte man besser im Wohnzimmer als in der Küche, und sie fuhr fort, Doktor Schiwagos Kopf zu kraulen, und dachte unwillkürlich, jetzt sind die beiden sicher schon allein in der Schule; alle anderen wollen so schnell wie möglich nach Hause. Warum ist er sonst noch nicht zurück? Bestimmt ist es Maite. Mit wem betrügst du mich, Jordi? Kenne ich sie? Wenn es Maite ist, kann sie sich auf was gefaßt machen.
Nach einer Viertelstunde bekam sie Hunger, aber sie wollte nicht aufstehen, sie wollte an dieser Stelle auf Jordi warten, um die dunklen Punkte in ihrem Leben zu klären. Ihr Blick fiel auf die Zigarrenkiste, die sie auf dem Tischchen abgestellt hatte. Sie öffnete sie: Die vier Hefte von Oriol Fontelles. Inmitten ihres Kummers erinnerte sich Tina an Oriols Worte: Geliebte Tochter, mein Brief ist wie das Licht eines Sterns, der vielleicht längst erloschen ist, wenn Dich sein Strahl erreicht. Es ist so wichtig, gegen den Tod anzuschreiben; es ist so grausam, zu schreiben, wenn der Tod Dir keine Hoffnung läßt. Während sie auf Jordi wartete, verstand sie, daß Oriol Fontelles so verzweifelt geschrieben hatte, damit der Tod nicht das letzte Wort behielt.
Doktor Schiwago horchte auf, er hörte Jordi immer schon lange, bevor dieser auf dem Treppenabsatz ankam. Er sprang von Tinas Schoß und lief zur Tür. Schuldbewußt schielte er mit aufgerichtetem Schwanz zu Tina hinüber, wie um zu sagen, Jordi kommt nach Hause, was soll ich machen, und setzte sich an die Tür. Tina dachte, wenn wir uns nur so lieben würden, wie Juri Andrejewitsch uns liebt!
»Hallo Juri«, sagte Jordi, als er hereinkam, und Doktor Schiwago rieb sich schweigend an seinen Hosenbeinen. Dann erblickte Jordi Tina im Sessel und bemerkte ihren seltsamen Gesichtsausdruck. »Was gibt’s zum Essen?«
»Ich habe nichts gemacht. Wie war’s?«
»Gut.« Er seufzte. »Ich bin erledigt.«
Er hängte seine Jacke an die Garderobe, ging zu seiner Frau und strich ihr übers Haar. Seine Liebkosung ließ Tina schaudern. Jordi setzte sich in Doktor Schiwagos Sessel, und dieser ließ sich auf seinen Knien nieder.
Jordi, ich habe herausgefunden, daß du mich betrügst; dienstags triffst du dich nicht etwa mit einer Gruppe von Kollegen, sondern mit einer Frau in der Pension von Ainet, ich weiß alles, du brauchst mir nicht länger etwas vorzumachen, wer ist diese Frau? Warum belügst du mich?
»Ich mache uns was zu essen. Es ist noch Suppe von heute mittag übrig.«
»Wunderbar«, sagte Jordi, streichelte Doktor Schiwagos weichen Rücken und schloß entspannt die Augen. Als er bemerkte, daß Tina nicht aufstand, öffnete er sie wieder und schlug vor: »Wenn du willst, mache ich uns ein paar Spiegeleier.«
»In Ordnung.«
Immer war alles in Ordnung gewesen zwischen Tina und Jordi. Sie wartete, bis Jordi in der Küche beschäftigt war, blieb aber sitzen und sah an die Wand, weil sie sich ihrer Frage schämte.
»Wie war die Konferenz?«
»So lala; Ròdenes war krank.«
»Müßt ihr sie wiederholen?»
»Wahrscheinlich.«
Elender Heuchler, kommst mir mit der schäbigsten aller Lügen, der üblichen einfallslosen Geschichte, die alle Männer ihren Frauen auftischen, wie ekelhaft, ich dachte, uns würde so etwas nie passieren.
»Habt ihr was gegessen?«
»Ja, eine Kleinigkeit.«
Tina stand auf und ging in die Küche. Sie lehnte sich an die Küchentür, bot ihm aber nicht an zu helfen und sah ihn nicht an.
»Wie viele wart ihr?«
»Sechs oder sieben. Immerhin.«
Lügner. Sechs oder sieben. Zwei: du und sie, eine Konferenz im Bett. Wahrscheinlich habt ihr über die Unterrichtsreform geredet, während sie die Beine breit gemacht hat und du ihr die Brüste gestreichelt hast, wie du es bei mir machst. Wie du es bei mir gemacht hast. Wer ist sie?
Sie aßen schweigend. Ausgeschlossen, daß Jordi dieses Schweigen nicht verstand, mußte sie noch deutlicher werden?
»Ich gehe ins Bett«, sagte sie statt dessen.
Du bist der Feigling, traust dich nicht, etwas so Einfaches zu fragen wie: warum betrügst du mich, Jordi, du Mistkerl, und dann diese krankhafte Neugier: mit wem, um vergleichen zu können:Was hat sie, was ich nicht habe, was ich nie haben werde, ist sie jünger, älter, sicher ist sie schlanker als ich, kenne ich sie, oder habe ich sie noch nie gesehen?
»Ich auch«, sagte Jordi.
Dusch wenigstens, du Schwein. Jetzt sollte ich dir sagen, daß du in diesem Bett nichts mehr verloren hast.
Aber Tina sagte nichts. Sie sah zu, wie Jordi zu Bett ging, und nach zehn Minuten atmete er tief und gleichmäßig, guten Gewissens, während sie mit weit offenen Augen dalag und nicht glauben konnte, daß das ihnen passierte. Erst um halb vier schlief sie ein, und dann hatte sie schreckliche Träume.
»Was hast du gerade gesagt, Sergi?«
»Ich kann Hongkong nicht finden.«
Hongkong. Sergi Rovira kann auf der Asienkarte Hongkong nicht finden. Das ist wichtig: zu wissen, wo Hongkong liegt. Jetzt, wo sie ihnen gerade von China erzählt hat, ist es inakzeptabel, daß Sergi Rovira Hongkong in Japan sucht. Wo war der Junge nur mit seinen Gedanken? Woran hatte er wohl gedacht, als sie ihnen erklärte, daß Hongkong bis vor kurzem zu Großbritannien gehört hatte und jetzt unter dem Motto »ein Land, zwei Systeme« zu China gehörte, und wie konnte man glücklich sein, wenn man betrogen wird, wenn alle Träume zerstört werden, wußtest du nicht, daß alle Träume irgendwann einmal platzen?
»Warum weinen Sie denn?«
Ein wenig erschrocken schneuzte sie sich und sagte: »Es ist nichts. Ist euch das noch nie passiert, daß euch die Augen jucken und zu tränen anfangen?«
»Beim Zwiebelschneiden ist mir das schon mal passiert.«
»Mir auch.«
»Und mir.«
»Genau, Alba, sehr gut. Also, bei mir ist das so, als hätte ich die ganze Nacht ganz viele Zwiebeln geschnitten.«
In der großen Pause rief Maite sie zu sich in die Bibliothek und zeigte ihr die Ausstellungsobjekte. In einer Ecke katalogisierte Joana die Bücher und alle Schulmaterialien, die ausgestellt werden sollten, von einem Radiergummi der Marke Ebro bis hin zu einem rosafarbenen Alpino-Bleistift. Maite nahm ein vergilbtes Buch zur Hand.