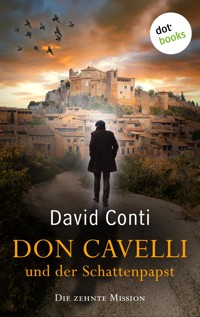Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Don Cavelli
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2021
Eine tödliche Jagd durch den Vatikan: Der fesselnde Kriminalroman »Don Cavelli und das Sizilianische Gebet« von David Conti als eBook bei dotbooks. Die Grundfesten des Vatikan scheinen unerschütterlich – aber es gibt noch eine zweite Macht in Rom, die unbeugsam und unantastbar ist … Wie eine Giftschlange windet sie sich um die Säulen des alten Kirchenstaates: La Famiglia, die Ehrenwerte Gesellschaft. Als die Witwe eines Mafiabosses einen Deal mit der Polizei schließt, stellt sie eine einzige Bedingung: Zuflucht im Vatikan – auf heiligem Boden, der von der gottesfürchtigen Mafia nicht entweiht werden darf … oder etwa doch? Es gibt nur einen Mann, dem Theresa Canova wirklich trauen kann: Geschichtsprofessor Don Cavelli, der im Vatikan exklusives Wohnrecht besitzt und genau weiß, wo dort eine tödliche Falle lauern könnte. Doch was ist mit den Orten, die seit Jahrhunderten niemand mehr betreten hat? Jetzt als eBook kaufen und genießen: Der furiose Vatikan-Thriller »Don Cavelli und das Sizilianische Gebet« von David Conti. Auch die vierte Mission für den Detektiv wider Willen fesselt wieder mit hochspannendem Insiderwissen. Alle Bände können unabhängig voneinander gelesen werden. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Zeit:6 Std. 52 min
Sprecher:Ähnliche
Über dieses Buch:
Die Grundfesten des Vatikan scheinen unerschütterlich – aber es gibt noch eine zweite Macht in Rom, die unbeugsam und unantastbar ist … Wie eine Giftschlange windet sie sich um die Säulen des alten Kirchenstaates: La Famiglia, die Ehrenwerte Gesellschaft. Als die Witwe eines Mafiabosses einen Deal mit der Polizei schließt, stellt sie eine einzige Bedingung: Zuflucht im Vatikan – auf heiligem Boden, der von der gottesfürchtigen Mafia nicht entweiht werden darf … oder etwa doch? Es gibt nur einen Mann, dem Theresa Canova wirklich trauen kann: Geschichtsprofessor Don Cavelli, der im Vatikan exklusives Wohnrecht besitzt und genau weiß, wo dort eine tödliche Falle lauern könnte. Doch was ist mit den Orten, die seit Jahrhunderten niemand mehr betreten hat?
Über den Autor:
David Conti wurde 1964 in Rom geboren und verbrachte dort – unterbrochen von einem mehrjährigen Aufenthalt in München – seine Kindheit und Jugend. Nach einem Studium der Theologie, Geschichte und Germanistik in Perugia, Yale und Tübingen, war er mehrere Jahrzehnte lang in verantwortlicher Position bei einer internationalen Institution in Rom tätig. Seit seinem beruflichen Ausscheiden aus dieser, verbringt er seine Zeit mit Reisen und dem Schreiben der »Don Cavelli«-Reihe. Er lebt abwechselnd in Castel Gandolfo, Zürich und Santa Barbara.
In der »Don Cavelli«-Reihe erscheint bei dotbooks:
»Don Cavelli und der tote Kardinal – Die erste Mission«
»Don Cavelli und der letzte Papst – Die zweite Mission«
»Don Cavelli und die Hand Gottes – Die dritte Mission«
»Don Cavelli und das Sizilianische Gebet – Die vierte Mission«
»Don Cavelli und der Apostel des Teufels – Die fünfte Mission«
Alle Bände sind sowohl als eBooks als auch als Printausgaben erhältlich. Weitere Romane sind in Vorbereitung.
***
Originalausgabe August 2021
Copyright © der Originalausgabe 2021 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Redaktion: Ralf Reiter
Titelbildgestaltung: Wildes Blut – Atelier für Gestaltung Stephanie Weischer unter Verwendung mehrerer Bildmotive von © shutterstock / Malivan_Iuliia / Vladimir Sazonov / Zenith Pictures sowie © pixabay / TeeFarm
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (rb)
ISBN 978-3-96655-631-6
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter.html (Versand zweimal im Monat – unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Don Cavelli 4« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
David Conti
Don Cavelli und das Sizilianische Gebet
Die vierte Mission
dotbooks.
»... Im Namen Garibaldis, Mazzinis und La Marmoras und mit Worten der Demut trete ich der heiligen Gesellschaft bei.«
Aus dem Aufnahmeritual der Mafia
Prolog
»Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen ...«
Während der alte, schmalgesichtige Priester das Gebet sprach, wurde der kostbare Sarg aus poliertem Palisanderholz feierlich in die Erde gesenkt.
»... den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unsern Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria ...«
Die Sonne stand im Zenit an diesem heißen Junitag und brannte erbarmungslos auf die große Menschenmenge nieder, die sich auf Roms größtem Friedhof eingefunden hatte, dem Campo Verano, der aufgrund seiner vielen pittoresken Gräber – andere wiederum nannten sie geschmacklos überladen – trotz seiner Entfernung von Roms sonstigen Sehenswürdigkeiten auch heute wieder zahlreiche Touristen anziehen würde. Irgendwo läutete eine Kirchenglocke.
»... gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes ...«
Jemandem, der den Priester gut gekannt hätte, wäre möglicherweise aufgefallen, dass dieser seine Gebete heute nicht herunterleierte wie sonst, sondern jedes Wort geradezu inbrünstig akzentuierte.
»... am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel ...«
Die Trauergäste schienen einen Querschnitt durch Roms bessere Gesellschaft zu bilden. Männer in teuren schwarzen Maßanzügen, Damen in noch teureren schwarzen Kostümen, eingehüllt in edle Parfums, hochrangige Polizeioffiziere in Uniform mit glänzenden goldenen Knöpfen, Politiker, Künstler und hohe Angehörige des Klerus. Darunter viele Gesichter, die man aus den Medien kannte.
»... er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters; von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten.«
Der selige Rosario Canova war vieles gewesen: angesehener Geschäftsmann, Mäzen, Philanthrop, Ehemann, Onkel und Großonkel. Und nicht zu vergessen: ein zutiefst gläubiger Katholik.
Außerdem war er das Oberhaupt einer der vier Mafiafamilien Roms gewesen.
»Ich glaube an den Heiligen Geist, die Heilige Katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen.«
Der Priester schlug ein Kreuzzeichen über dem offenen Grab, und die Trauergäste, allen voran die junge Witwe, die ihr Gesicht hinter einem schwarzen Schleier verborgen hatte, begannen, einer nach dem anderen, heranzutreten, um Rosario Canova die letzte Ehre zu erweisen.
Nun ruhte er in Frieden. Für einige der Teilnehmer dieses Begräbnisses bedeutete dies, dass sie sich von nun an im Krieg befanden.
Erstes Buch
I
Die Anschuldigungen nahmen kein Ende. Fassungslos vernahm der Angeklagte das von dem Mann auf dem Richterstuhl mit Donnerstimme vorgetragene Urteil für die zahllosen Verbrechen, derer man ihn beschuldigte. Unaussprechliche Gewalttaten und immer wieder: Mord.
Dann wurde das Urteil über Cavelli verkündet: Tod durch Enthaupten. Mit Wucht fuhr der hölzerne Hammer des Richters nieder, wie das Beil des Henkers …
Donato Cavelli erwachte. Sein Herz schlug wie wild, und er brauchte einige Momente, um sich in der Realität zurechtzufinden. Die allerersten Sonnenstrahlen schienen in das offene Fenster seines riesigen Schlafzimmers, und abgesehen von dem warmen Wind, der die Blätter der Magnolien in den Vatikanischen Gärten zum Rauschen brachte, war es draußen vollkommen still.
Der Traum.
Da war er wieder. Cavelli träumte ihn alle paar Monate. Er stand darin vor Gericht und wurde zum Tode verurteilt. Doch er war der Falsche. Bei dem Mann, der tatsächlich eine Reihe blutrünstiger Taten begangen hatte, handelte es sich um Capitano Umberto Cavelli. Er hatte im sechzehnten Jahrhundert gelebt und galt als Ahnherr der Cavelli-Dynastie. Was genau er getan hatte, war nicht überliefert. Sicher war, dass er Papst Julius II. einige, nun ja, wertvolle Dienste geleistet hatte. Dienste für einen Mann, der mehr Kriegsherr als Heiliger Vater gewesen war und über den Niccolò Machiavelli, der von der Republik Florenz beauftragt war, ihn auszuspionieren, gesagt hatte: »Wehe dem, gegen den dieser wütende Greis einen Groll hegt.« Und il terribile, wie man ihn hinter seinem Rücken nannte, hegte gegen sehr viele einen Groll. Umberto Cavelli, den Michelangelo an der Decke der Sixtinischen Kapelle mit einem Schwert in der Hand verewigt hatte, war in seinem Sinne tätig geworden, und zwar so wirkungsvoll, dass Julius II. befohlen hatte, ihn »liberatus ab ullis calamitatibus« – also »frei von allen Nöten« zu stellen. Dies beinhaltete nicht nur eine gewaltige Menge Goldes, sondern auch Wohnrecht im Vatikan, Zutritt zu allen Räumlichkeiten und weitere Privilegien, die für ihn und seine Nachkommen bis zum Jüngsten Tage gelten sollten. Eine päpstliche Urkunde hatte dies feierlich besiegelt und wurde seitdem von der Cavellifamilie gehütet wie die Britischen Kronjuwelen.
Donato Cavelli – oder Don, wie ihn seine Freunde nannten – war der Letzte in der langen Ahnenreihe. Er war nun Anfang vierzig und hatte sein ganzes Leben in der riesigen Wohnung im dritten Stock des prächtigen Palazzos in den Vatikanischen Gärten verbracht. Oft hatte er mit seinen Eltern, als sie noch lebten, oder Freunden über Capitano Umberto Cavelli gescherzt, der ein solcher Segen für die Familie gewesen war. Warum auch nicht? Seine Untaten lagen ein halbes Jahrtausend zurück. Wer regte sich über Taten eines Vorfahren auf, die so lange her waren? Inzwischen waren sie genauso irreal wie ein Kinofilm.
Und dennoch: Diese Träume quälten ihn. Warum nur kamen sie immer wieder? Lag es daran, dass Cavelli noch immer durch ruchlose Taten erworbene Privilegien genoss und über ein durch Zins und Zinseszins ins Gigantische gewachsenes Vermögen verfügte? War dies der Preis, den Don Cavelli dafür zu zahlen hatte? Lange hatte er es sich so erklärt. Doch mehr und mehr hatte sich eine andere Erkenntnis in ihm durchgesetzt: Irgendetwas ganz tief in Cavellis Seele wusste, dass Umbertos Blut auch in seinen Adern floss, und das nicht nur, weil seit damals alle männlichen Erstgeborenen der Cavellis mit zweitem Vornamen Umberto genannt wurden. Er verspürte eine Art Erbschuld. Eine Schuld, die niemals endete und niemals abgetragen werden konnte.
Auf der anderen Seite hatte es ein paarmal in seinem Leben Augenblicke gegeben, in denen er über sich hinausgewachsen war, und dies mit einer Kraft und Waghalsigkeit, die ihm niemand, am wenigsten er sich selbst, zugetraut hatte. In diesen Momenten hatte er sich vollkommen von einer unbekannten Kraft durchdrungen gefühlt und eine direkte Verbindung zu seinem berüchtigten Urahn gespürt. Später dann pflegte er sich regelmäßig selbst auszulachen angesichts solcher esoterischer Überspanntheiten. Nicht einmal engsten Freunden hatte er jemals davon erzählt und schon gar nicht den Kollegen oder seinen Studenten, die ihn nur als seriösen Geschichtsprofessor der altehrwürdigen Sapienza kannten, der von Papst Bonifatius VIII. im vierzehnten Jahrhundert gegründeten, ältesten Universität von Rom, in der er seit vielen Jahren für ein symbolisches Jahresgehalt von einem Euro arbeitete.
Er sah auf die altmodische rechteckige Armbanduhr, die auf seinem Nachtisch lag. Sieben Uhr zwanzig. Es lohnte sich nicht, weiterzuschlafen. Er schwang die Beine aus dem Bett und trat, nur mit seiner Pyjamahose bekleidet, auf die für ihn allein geradezu absurd große Terrasse, die Platz genug für die pompösen Festbankette Rodrigo Borgias geboten hätte und einen überwältigenden Blick über die Vatikanischen Gärten erlaubte. Nachdem er sein übliches Programm an Bizeps-, Trizeps- und Bauchmuskeltraining absolviert hatte, ging er ins Badezimmer. Während er sich nass rasierte, fiel ihm auf, dass der Teil des Bartes, der aus weißen Stoppeln bestand, schon wieder etwas größer geworden war. Aber in seinen schwarzen Haaren war davon noch fast nichts zu sehen. Noch immer verfügte er über diese frappante Ähnlichkeit mit dem früh verstorbenen französischen Filmstar der sechziger Jahre, Gérard Philipe, auf die er gelegentlich angesprochen wurde. Meistens von älteren französischen Touristen, die ihn für das Original hielten, ohne zu bedenken, dass der echte ja bereits uralt sein müsste.
Prüfend strich er mit dem Finger über eine bestimmte Stelle des Waschbeckens. Vor ein paar Wochen war ihm das Zahnputzglas aus der Hand gefallen und hatte im Becken ein kleines Loch verursacht. Normalerweise ein Grund, das Becken komplett auszutauschen, aber Cavelli zögerte noch. Wie vieles im Vatikan waren große Teile der Wohnung noch im Originalzustand der dreißiger Jahre des letzten Jahrhunderts, was gelegentlich eine Einbuße an modernem Komfort bedeutete, aber es hatte eben dieses ganz besondere Flair, das er so mochte, und er hatte es daher nicht über sich gebracht, zu dieser endgültigen Maßnahme zu greifen. Stattdessen nahm er alle paar Tage ein weißes Stück Seife und rieb damit einige Male über das Loch, bis es nicht mehr vorhanden war. In solchen Augenblicken wurde ihm zuweilen bewusst, wie sehr er vom Vatikan geprägt war. Auch dort scheute man vor radikalen Veränderungen zurück und behalf sich viel lieber mit kleinen Modifikationen, die gerade groß genug waren, um ein Problem fürs Erste zu lösen. Auch Cavelli entschied, dass bis auf Weiteres kein Handlungsbedarf bestand. Er ging in die Küche, kochte, während er eine dicke Scheibe Wassermelone aß, einen vierfachen Espresso, schüttete ihn in seine, von ihm so genannte, Grummeltasse, deren dreidimensional aus der Tassenwand herausblickendes schlecht gelauntes Gesicht ihn jeden Morgen daran erinnerte, nicht selbst ebenfalls so zu gucken, kippte den Espresso hinunter, zog seine grauen Trainingssachen an und machte sich auf den Weg zu seiner täglichen Joggingtour zum Villa-Borghese-Park. Ein nicht immer geliebtes Pflichtprogramm, das er aber seit Jahren eisern durchzog. Er sprang die Treppen hinunter, verließ den Palazzo, grüßte im Vorbeilaufen den wachhabenden Schweizer Gardisten an der Porta Sant’Anna und überquerte in lockerem Trab den noch beinahe leeren Petersplatz. Es würde ein heißer Tag werden.
II
Die seltsame Form des abgelegenen Gebäudes im Osten Roms, das aussieht wie ein Kreuzfahrtschiff, welches sich wie eine Schlange windet, hätte man für ein avantgardistisches Museum oder eine andere harmlose Kultureinrichtung halten können. Doch die allgegenwärtigen Metallzäune, die zusätzlich mit Stacheldraht gesichert waren, die zahllosen Kameras und die strengen Sicherheitskontrollen an Zufahrt und Eingang sowie der Umstand, dass sich an den zahlreichen Bürotüren im Inneren keine Namensschilder, ja nicht einmal Nummern, befanden, entlarvten dies schnell als Irrtum. In der Tat handelte es sich um den Hauptsitz der DIA, der Direzione Investigativa Antimafia, dem italienischen Kriminalamt zur Bekämpfung der Mafia. Es verfügte über elf weitere Filialen, die strategisch über das ganze Land verteilt waren, und war direkt dem Innenministerium unterstellt.
Ein Klopfen an seiner Bürotür ließ Colonnello Matteo Rietti auf den kleinen Schwarzweißbildschirm blicken, der an der Wand befestigt war. Erst nachdem er sich vergewissert hatte, dass es sich bei dem Besucher um jemanden handelte, der ihm persönlich bekannt war, drückte er auf den weißen Knopf unter seiner Tischplatte, und die kugelsichere Metalltür entriegelte sich mit einem scharfen Klicken. Ein Bürobote, der wie alle Personen, die sich im Gebäude aufhielten, einen laminierten Dienstausweis mit Foto an der Brusttasche seines Hemdes trug, trat ein, übergab ihm stumm einen gepolsterten Umschlag und verschwand wieder, wobei er darauf achtete, die Tür wieder ins Schloss zu ziehen. Ein dezenter Geruch von Eau de Travail (wie Riettis Mutter den Geruch von Schweiß mit vergifteter Zurückhaltung gern bezeichnet hatte) blieb im Büro zurück. Wie alle Sendungen, die bei der DIA eingingen, war auch dieser Umschlag durchleuchtet worden. Seit 2002 wurde auch geprüft, ob die Umschläge verdächtiges Pulver wie zum Beispiel das hochgradig toxische Rizin oder andere Giftstoffe enthielten. Alle Sendungen, die dicker waren als ein gewöhnlicher Brief, wurden zudem geöffnet und auf Sprengvorrichtungen untersucht. Rietti wusste, dass er sich keine Sorgen machen musste, als er den Inhalt des geöffneten Umschlags auf seinen Schreibtisch kippte. Es handelte sich um ein Wegwerfhandy und einen quadratischen Zettel. Der in Druckbuchstaben geschriebene Text darauf war kurz:
PIN: 230592
Für einen kurzen Moment setzte Riettis Herzschlag aus. Diese spezielle PIN war mit Sicherheit absichtlich gewählt worden. Kein Mitarbeiter der DIA würde diese Zahl je vergessen. Es handelte sich um ein Datum, und es bezeichnete den schwärzesten Tag, den Italien im Kampf gegen die Mafia je erleben musste. Am dreiundzwanzigsten Mai 1992 war Untersuchungsrichter Giovanni Falcone mit seiner Ehefrau und drei Leibwächtern auf dem Weg zu seinem Wochenendhaus in Palermo auf der Autobahn A 29 durch eine ferngezündete Fünfhundertkilobombe TNT, die in einem Drainagerohr versteckt war, ermordet worden. Falcone war der erfolgreichste und berühmteste Mafiajäger gewesen, den es bis dahin gegeben hatte. Eine Legende. Bei der Bevölkerung war er sehr beliebt gewesen. 1992 war Siziliens Flughafen nach ihm und seinem ebenfalls bei einem Sprengstoffanschlag ums Leben gekommenen Kollegen Paolo Borsellino in Aeroporto Palermo-Punta Raisi Falcone e Borsellino umbenannt worden.
Die Maßnahmen für Sicherheit und Geheimhaltung bei der Verfolgung der Mafia waren schon damals hoch gewesen. So wurde 1986 beim sogenannten Maxiprozess in Palermo, bei dem rund vierhundert Mafiosi angeklagt waren, in einem im Inneren eines Gefängnisses gebauten Bunker verhandelt, der sogar Raketenbeschuss standgehalten hätte. Das Gelände drum herum wurde von fünfhundert Sicherheitskräften und einem Panzer geschützt. Der Luftraum war weiträumig gesperrt worden.
Seitdem waren die Sicherheitsvorkehrungen auf immer größere Bereiche ausgedehnt und weiter verschärft worden; so sehr, dass mancher schon den Kopf über eine derartige Paranoia schüttelte, aber ganz sicher arbeiteten diese Personen nicht für die DIA.
Rietti ergriff das Handy, schaltete es an und gab die PIN ein. Er lehnte sich in seinem Drehstuhl zurück und fuhr sich nachdenklich mit der Hand durch seinen graumelierten Dreitagebart. Wer mochte ihm das Handy geschickt haben? Zumindest zwei Dinge über diese Person waren ihm jetzt schon bekannt. Es handelte sich um jemanden, der etwas von Interesse wusste, und um jemanden, der äußerst vorsichtig war. Durchaus zu Recht. Die Ehrenwerte Gesellschaft hatte ihre Informanten überall. In der Politik, beim Militär und auch bei der Polizei. Nicht einmal bei der DIA würde Rietti für sämtliche Mitarbeiter die Hand ins Feuer gelegt haben. Genau genommen hätte er das nur für zwei Männer getan. Nicht weil sie seine engsten Mitarbeiter waren, sondern weil er seit über dreißig Jahren mit ihnen befreundet war. Rietti stand auf und sah aus dem Fenster auf den trostlosen Parkplatz unter ihm. Er zwang sich, seine Erwartungen herunterzuschrauben. Es wäre nicht das erste Mal, dass ein Mafioso, der mit seiner baldigen Verhaftung rechnete, im letzten Moment versuchte, der Anklage zuvorzukommen, indem er eine umfangreiche Aussage gegen die Bosse in Aussicht stellte, dann aber, wenn es ans Liefern ging, nur mit unbedeutendem Kleinkram aufwartete, der kaum zu Verhaftungen führte. Meistens war es so, doch die Hoffnung starb bekanntlich zuletzt. Als das Telefon nach über einer Stunde endlich stumm vibrierte, wartete Rietti eine halbe Minute, bevor er das Gespräch entgegennahm.
»Pronto?«
Die weibliche Stimme am anderen Ende war leise und angespannt. »Colonnello Rietti?«
»Ja.« Rietti würde nicht fragen, mit wem er es zu tun hatte. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt hatte alles zu unterbleiben, was den Gesprächspartner nervös machen konnte. Diese Anruferin schien genau das allerdings aus dem Konzept zu bringen. Sie hatte wohl erwartet, Fragen gestellt zu bekommen. Für einige Momente blieb es ruhig im Hörer. Dann war die Frau wieder zu hören. Jetzt noch leiser und noch vorsichtiger: »Ich will eine vollständige Aussage machen. Alles, was ich weiß.«
Rietti rollte mit den Augen. Das hier klang nicht sehr vielversprechend. »Und das wäre?«
»Ich bin die Witwe von Rosario Canova.«
Rietti brauchte mehrere Sekunden, um die Information zu verdauen. Er wechselte das Telefon von der rechten in die linke Hand und rief am PC die Akte Rosario Canova auf. Ungeduldig scrollte er nach unten, bis auch Fotos von Canovas Ehefrau Theresa auftauchten. Einige heimlich auf große Entfernung aufgenommene, die sie zeigten, wie sie eine Modeboutique verließ, und ein sehr gutes Porträtfoto, auf dem sie in die Kamera lächelte, das wer weiß wie besorgt worden war. Alle Fotos zeigten eine ziemlich attraktive blonde Frau Ende dreißig. Gewohnheitsmäßig bedeckte er mit der Hand ihr Gesicht bis auf die Augen, die nun im Gegensatz zum Mund eher traurig aussahen. Rietti atmete tief durch. Falls diese Person wirklich die war, die sie behauptete zu sein, hatte sie womöglich weitreichende Informationen. Im Geiste sah Rietti die DIA einen Schlag gegen die Mafia führen, welcher die Ehrenwerte Gesellschaft bis in ihre Grundfesten erschütterte. Er versuchte, sich seine Aufregung nicht anmerken zu lassen, aber seine Stimme wurde um einige Grade freundlicher. »Ich bin ganz Ohr, Signora Canova.«
»Ich werde Ihnen alles sagen, was ich weiß, und Sie können sicher sein, das ist mehr, als Sie sich vorstellen können.« Die Stimme der Frau klang etwas hölzern. Als hätte sie sich diesen Satz schon vorher zurechtgelegt. Wieder trat eine Stille ein, und für einige Momente war nur der altersschwache Deckenventilator zu hören. Auch Rietti schwieg, da er das Gefühl hatte, dass die Frau am anderen Ende der Leitung noch nicht fertig war. Sein Instinkt täuschte ihn nicht, und nun lag eine bisher nicht vorhandene Entschlossenheit in ihrer Stimme: »Doch bevor ich das tue, stelle ich eine Bedingung. Wenn Sie die nicht erfüllen, werde ich auch nicht aussagen. Basta!«
»Ich bin sicher, wir kommen zu einer Einigung.«
»Das hoffe ich.«
Dann nannte sie die Bedingung.
III
Langsam stieg Colonnello Rietti die zwanzig steinernen Stufen zu dem berühmten Bronzetor hinauf. In seinen dreißig Jahren Polizeidienst, davon achtzehn bei der Direzione Investigativa Antimafia, hatte er eine ganze Reihe haariger Situationen erlebt, aber er musste ziemlich lange zurückdenken, um sich an einen Moment zu erinnern, bei dem er sich derartig beklommen gefühlt hatte wie jetzt gerade. Lag es daran, dass er außer reden nichts tun konnte, um sein Ziel zu erreichen? Anschließend würde alles völlig von der Gnade seines Gegenübers abhängen. Ein Szenario, das er in der Vergangenheit fast immer erfolgreich zu vermeiden gewusst hatte. Er versuchte, es nicht allzu sehr an sich heranzulassen. Man musste positiv denken, schließlich hatte er sich gründlich auf dieses Gespräch vorbereitet, es würde schon gut gehen, das musste es einfach.
Sein Besuch im Apostolischen Palast war angekündigt, doch als er dem wachhabenden Schweizer Gardisten mit der altertümlichen Hellebarde seinen Dienstausweis zeigte, kam Rietti sich gegenüber dem jungen Mann – im Grunde ein Kollege, der zudem rangmäßig weit unter ihm stand – wie ein Bittsteller vor. Normalerweise war dieser Ausweis so eine Art Zauberstab, mit dem man Respekt oder sogar Angst hervorrufen konnte. Hier nicht. Die italienische Polizei durfte zwar noch auf dem Petersplatz aktiv sein, doch an den Stufen des Petersdoms war Schluss. Ab hier waren nur noch die Kräfte des Vatikan einsatzberechtigt. Der Gardist studierte den Ausweis höflich, aber sorgfältig, dann ließ er Rietti durch das Bronzetor eintreten. Hier herrschte Stille. Am Fuße der von Bernini erschaffenen Scala Regia war ein weiterer Gardist mit Hellebarde postiert, der ihn militärisch grüßte. Ein dritter Gardist forderte ihn auf, ihm zu folgen. Während Rietti die links und rechts von Säulen gesäumte lange Treppe hinaufstieg, kam ihm sein Vorhaben mit jedem Schritt, dessen Echo von den hohen Marmorwänden zurückgeworfen wurde, irrsinniger vor. War nicht schon die Wahl seines Gesprächspartners der erste große Fehler? Der offizielle Weg wäre gewesen, ein Gespräch mit einem hochrangigen Mitarbeiter des Governatorats, der Regierung des Vatikanstaates, zu suchen. Aber genau diesen offiziellen Weg hatte er zu vermeiden versucht. Er kannte niemanden im Governatorat persönlich, aber sein Eindruck von außen war, dass die Männer dort nicht gerade aufgeschlossen waren für alles, was irgendwie aus dem Rahmen fiel. Daher war er auf die Idee verfallen, sich an den Ersten Sekretär des Papstes zu wenden. Auch den kannte er nicht persönlich, aber es existierten zahlreiche wohlwollende Presseartikel über ihn – meist mit einem Foto garniert, das ihn verschmitzt lächelnd zeigte – die vermuten ließen, dass Monsignore Joseph Mattlin, trotz seiner hochrangigen Funktion an der Seite des Heiligen Vaters, keineswegs die Bodenhaftung verloren hatte, sondern mitten im Leben stand. Ein Mann, mit dem man reden konnte. Und der Anfang sah durchaus vielversprechend aus. Mattlin hatte, nach einigem Hin und Her mit dem Vatikanischen Telefonisten, nicht nur Riettis Gespräch persönlich entgegengenommen, sondern darüber hinaus auch zugestimmt, ihm noch am selben Tag volle zehn Minuten seiner knapp bemessenen Zeit zu schenken. Und dies, obwohl Rietti nur sehr allgemeine Andeutungen gemacht hatte, worum es in diesem Gespräch gehen würde.
Der Gardist führte ihn über weitere breite Treppen bis in das oberste Stockwerk des Apostolischen Palastes. Sie durchquerten einen langen Gang, dann zwei leere Vorzimmer und gelangten schließlich zu einer hohen Doppeltür, vor der wiederum ein Hellebardier stand. Rietti schluckte. Ihm war klar, wo er sich befand. Il Appartamento. Die Gemächer des Papstes.
Rietti war nicht besonders religiös, trotzdem ließ etwas in ihm seine Hand vorsichtiger anklopfen als üblich. Ein heiseres »Avanti« forderte ihn auf einzutreten. Rietti durchquerte ein winziges Wartezimmer, das gerade Platz für vier rotgepolsterte, antike Stühle bot, und trat durch eine offene Tür in Monsignore Mattlins Büro ein. Abgesehen von einem Bild des Papstes an der Wand und einem silbernen Kreuz, das auf dem Schreibtisch stand, ließ nichts darauf schließen, dass er sich hier im Zentrum der Macht befand. Rietti registrierte beiläufig, dass es nach frischen Kopien roch. Irgendetwas in ihm war überrascht. Was hatte er hier für einen Geruch erwartet? Weihrauch?
Monsignore Mattlin erhob sich hinter seinem von Aktenstapeln bedeckten Schreibtisch und empfing Rietti mit ausgestreckter Hand und einem herzlichen Lächeln, das nicht aufgesetzt wirkte. Seine Art, Gesprächspartnern wirklich zuzuhören und deren Probleme ernst zu nehmen, waren ein Teil des Geheimnisses, das seine große Beliebtheit erklärte. Rietti war überrascht von dem ungewöhnlich festen Händedruck des Geistlichen. Als Nächstes fielen ihm dessen neugierige, aber müde Augen auf, und er meinte sich zu erinnern, dass der Arbeitstag im Vatikan teilweise schon um vier Uhr dreißig in der Frühe begann. Mattlin wies auf einen der zwei Stühle gegenüber seinem Schreibtisch, dann kam er sofort zu Sache. Offenbar hatte ein Mann in seiner Position keine Zeit für Smalltalk: »Wie kann ich Ihnen helfen, Colonnello Rietti?«
Rietti räusperte sich. »Nun, die Sache ist ein wenig heikel.«
Monsignore Mattlin lächelte nachsichtig. Anscheinend hörte er diesen Satz nicht gerade zum ersten Mal.
»Ich ... oder besser gesagt die DIA ersucht den Vatikan, einer Person für einige Wochen oder so Asyl zu gewähren.« Dass es auch einige Monate werden konnten, behielt Rietti lieber erstmal für sich. Mattlin nickte aufmerksam. Bislang schien er an diesem Wunsch nichts ungewöhnlich zu finden. Auch im Zuge der Flüchtlingskrise hatte der Vatikan einige Familien aufgenommen, die teilweise immer noch dort lebten.
Rietti atmete einmal tief durch. »Es handelt sich um Theresa Canova.«
Auch das schien Mattlin nicht aus der Ruhe zu bringen. Allerdings wohl nur, weil er nichts mit diesem Namen verband.
»Theresa Canova«, fuhr Rietti fort, »ist die Witwe des kürzlich verstorbenen Mafiabosses Rosario Canova.«
Mattlins Augenbrauen gingen langsam in die Höhe und verharrten dort einige Sekunden. Ein Hauch von Unbehagen legte sich über seine Gesichtszüge. Aber noch immer sagte er nichts. Er wartete offenbar auf die Begründung dieses reichlich unverfrorenen Ansinnens. Nun würde es sich erweisen müssen, ob Riettis Vorbereitungen gründlich genug gewesen waren.
»Theresa Canova hat sich bereiterklärt, mit der Direzione Investigativa Antimafia zusammenzuarbeiten. Durch ihre langjährige Ehe mit Rosario Canova weiß sie fast alles, was er wusste, auch über die drei anderen Großfamilien Roms. Cigno, Castellani und Scalfari.« Rietti hielt einen Moment inne, um dem nächsten Satz mehr Gewicht zu verleihen. »Und sie ist zu einer umfangreichen Aussage bereit. Dies könnte der größte Schlag gegen die Mafia werden seit dem Maxiprozess von 1986. Allerdings wird es eine gewisse Zeit brauchen, ihre Aussage, die sehr umfangreich sein wird, aufzunehmen und den Prozess vorzubereiten. In dieser Zeit ist Signora Canova äußerst gefährdet. Die drei Familien werden alles daran setzen, sie zum Schweigen zu bringen. Natürlich haben wir ihr angeboten, sie rund um die Uhr unter Polizeischutz zu stellen. Doch das will sie unter keinen Umständen. Sie befürchtet, dass auch die DIA von der Mafia unterwandert ist, und so leid es mir tut, das sagen zu müssen, ich verstehe sie. Ich kann es mir zwar von niemandem vorstellen, den ich persönlich kenne, aber Signora Canova möchte begreiflicherweise nicht ihr Leben darauf verwetten. Somit scheiden ihre eigene Villa und auch sämtliche Safe-Houses der DIA aus.«
Obwohl Monsignore Mattlin die Antwort kannte, stellte er die Frage trotzdem. »Ich verstehe, aber warum glaubt diese Dame, ausgerechnet bei uns im Vatikan sicher zu sein?«
Riettis Antwort fiel wie erwartet aus: »Weil es heiliger Boden ist. So verrückt es klingt, die allermeisten Mafiosi hier in Italien sind sehr religiös. Jedenfalls die alte Garde. Sie erinnern sich wahrscheinlich noch an den Skandal, als herauskam, dass der Mafiaboss Enrico De Pedis es irgendwie bewerkstelligt hat, sich in der Krypta von Sant’Apollinare beisetzen zu lassen. Ich weiß nicht, wie, aber irgendwie schaffen diese Leute es, in ihren Taten keinen Widerspruch zum Katholischen Glauben zu sehen, im Gegenteil, sie sind sogar davon überzeugt, dass die Mafia bis auf Petrus zurückgeht, aber zweifellos wissen Sie das alles selbst.«
Mattlin nickte unbehaglich, er hatte das auch schon gehört. Es war unerträglich. Erst kürzlich hatte der Vatikan sich gegen den im Land weit verbreiteten Brauch gewendet, dass Marienprozessionen vor dem Haus des örtlichen Mafiabosses haltmachten und sich dort verneigten.
»Vielleicht ist es Ihnen nicht bekannt, Monsignore«, fuhr Rietti fort, »weil es vor Ihrer Zeit war, aber Anfang der neunziger Jahre hielt Johannes Paul II. auf Sizilien zwei Predigten, in denen er die Mafia zur Umkehr aufforderte. Ich muss gestehen, wir bei der Polizei haben damals darüber gelacht. Aber über ein Dutzend Mafiosi sind daraufhin dem Kronzeugenprogramm beigetreten, darunter das Oberhaupt der Camorra, Carmine Alfieri, der berüchtigte Killer Salvatore Grigoli und ...«
»Ich weiß, ich weiß.« Mattlin hob nachdenklich die Hand. »Der Vatikan tut sein Möglichstes im Kampf gegen die Mafia. Immer wieder hat der Heilige Vater öffentlich verkündet, dass schon die Mitgliedschaft dort Gotteslästerung ist, und ohne Zweifel hat das auch manchen auf den richtigen Pfad zurückfinden lassen. Doch unser Weg ist auch hierin ein spiritueller. Asyl hingegen für eine ...«
»Es wäre nicht das erste Mal«, fiel ihm Rietti, so höflich er konnte, ins Wort. »Darf ich Monsignore daran erinnern, dass der Vatikan während des Zweiten Weltkriegs über zwölftausend Flüchtlingen Unterschlupf in Castelgandolfo gewährte und weiteren im Vatikan? Unter ihnen viele Juden und Oppositionelle, die von den Nazis gesucht wurden. Insofern ist es eine ehrwürdige Tradition, dass der Heilige Vater Verfolgte bei sich aufnimmt.«
»Verfolgte, ja ... natürlich«, wandte Mattlin mit erhobenem Zeigefinger ein, »... aber die Ehefrau und zweifellos auch Komplizin eines Verbrechers? Das ist doch etwas gänzlich anderes.«
»Zweifellos war sie das, o ja, doch nun bereut sie. Sie ist eine reuige Sünderin, was könnte christlicher sein?« Rietti blickte Mattlin treuherzig in die Augen, bevor er zu seinem letzten Schlag ausholte: »Heißt es nicht Gott hasst die Sünde, aber er liebt den Sünder?«
Einige Momente kehrte Stille ein, und nur das leise Ticken der goldenen Tischuhr war zu vernehmen. Dann seufzte der Mann in der schwarzen Soutane resigniert. Riettis Argumenten war nichts entgegenzusetzen. Monsignore Mattlin stellte noch einige formale Bedingungen, die zu erfüllen wären, aber innerlich waren ihm zwei Dinge längst klar: Erstens, dass er Signora Canova das Asyl im Vatikan nicht versagen konnte, und zweitens, dass er den Heiligen Vater mit diesen unerfreulichen Neuigkeiten nicht behelligen würde.
Il Appartamento hatte entschieden.
IV
Sämtliche Männer hatten sich mehr oder wenig freiwillig einem Lügendetektortest unterzogen. Auch Colonnello Rietti selbst hatte ihn abgelegt. Paradoxerweise war der volkstümliche Name des Geräts selbst eine Lüge, denn der Polygraph, so der offizielle Name, war keineswegs in der Lage, Lügen zu erkennen. Lediglich registrierte er bei der getesteten Person ein bei ihr vom Üblichen abweichendes Erregungsmuster. Rietti wusste, dass es verschiedene Methoden gab, das Gerät auszutricksen. Das reichte vom Einnehmen diverser Beruhigungsmittel über die Reißzwecke vorne im Schuh, die bei jeder Frage denselben Schmerz und die damit verbundene Erregung auslöste, bis hin zu der Technik, bei Fragen, bei denen man es vorzog zu lügen, diese Fragen im Kopf gegen eine andere zu ersetzen und dann diese Frage wahrheitsgemäß zu beantworten. Bei Soziopathen und Psychopathen, die immerhin etwa zwei Prozent der Bevölkerung ausmachten, war der Polygraph ohnehin nutzlos. Diese Menschen logen so selbstverständlich, wie sie atmeten, ohne dass eine messbare körperliche Veränderung in ihnen vorging.
Dennoch fühlten sich an diesem Tag alle Beteiligten sicherer so. Vor allem die Person, auf die es am meisten ankam: Theresa Canova.
Alle Männer trugen schusssichere Westen und standen über den Knopf im Ohr in ständiger Verbindung mit dem gesamten Team und der DIA-Zentrale, von wo Riettis Stellvertreter, Orso Zizola, die gesamte Operation technisch koordinierte.