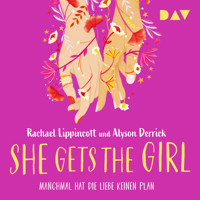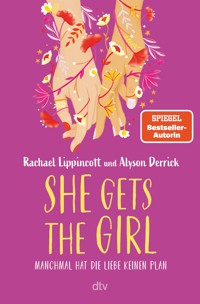9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dtv Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2019
Kann man jemanden lieben, den man nicht berühren darf? »Ich habe die Bedeutung von menschlicher Berührung nie verstanden...bis ich sie nicht haben konnte.« Stellas einzige Überlebenschance ist eine neue Lunge. Bis es soweit ist, muss sie sich von allem und jedem fernhalten, um ihr ohnehin schwaches Immunsystem nicht zu gefährden. Ohne Ausnahme. Will ist ganz anders – er lässt sich nicht unterkriegen und ist bereit, auf volles Risiko zu gehen. Sobald er 18 ist, wird er dem Krankenhaus den Rücken kehren, um endlich mehr von der Welt zu sehen. Vor allem aber ist Will jemand, von dem Stella sich fernhalten muss. Wenn er sie auch nur anpustet, könnte sie infiziert werden. Beide könnten sterben. Aber je mehr Zeit die beiden miteinander verbringen, desto mehr fühlt sich der vorgeschriebene Sicherheitsabstand zwischen ihnen wie eine Strafe an. Wäre ein bisschen mehr Nähe wirklich so tödlich – vor allem, wenn sie verhindert, dass ihre Herzen brechen?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 309
Ähnliche
Über das Buch
Kann man jemanden lieben, den man nicht berühren darf?
Stella hat ihr Leben voll im Griff – bis auf den Umstand, dass sie Mukoviszidose hat und deshalb viel Zeit im Krankenhaus verbringt. Dort trifft sie auf Will. Mit seiner rebellischen Art und seinem frechen Charme scheint er rein gar nichts unter Kontrolle zu haben, kann sich aber dennoch irgendwie in ihr Herz stehlen. Die Krankheit verlangt, dass die beiden auf Abstand bleiben, doch mit jedem Tag wird die fehlende Nähe unerträglicher …
Ein ergreifendes Drama über die Kraft der Liebe
Von Rachael Lippincott ist bei dtv außerdem lieferbar:
All This Time – Lieben heißt unendlich sein (mit Mikki Daughtry)
She Gets the Girl (mit Alyson Derrick)
Rachael Lippincott / Mikki Daughtry / Tobias Iaconis
Drei Schritte zu dir
Roman
Aus dem amerikanischen Englisch von Nina Frey
Für Alyson
– R.L.
Wir widmen dieses Buch, wie auch den Film, allen Patienten, Familien, Medizinern, Pflegern und geliebten Mitmenschen, die Tag für Tag tapfer den Kampf gegen die Mukoviszidose kämpfen. Möge die Geschichte von Stella und Will dazu beitragen, der Krankheit zu mehr Aufmerksamkeit zu verhelfen und sie eines Tages heilbar zu machen.
– M.D. und T.I.
Kapitel 1
Stella
Mein Finger fährt die Zeichnung meiner Schwester nach, eine Lunge, geformt aus einem Blumenmeer. Blüten entsprießen den Rändern der Zwillingsovale, zartrosa, weiß, sogar erikablau. Jede ist so einzigartig, so strahlend, dass sie wirken, als würden sie ewig blühen. Einige der Knospen haben sich noch nicht geöffnet, und mit den Fingerspitzen kann ich fast fühlen, wie sich in den winzigen Sprossen das Leben entfaltet. Die gefallen mir am besten.
Ich frage mich oft, wie es wohl wäre, solch eine gesunde Lunge zu haben. Eine so lebendige. Ich hole tief Luft, spüre, wie sich die Luft in meinen Körper hineinkämpft und wieder hinaus.
Meine Hand rutscht vom letzten Blütenblatt der letzten Blume, sinkt hinab, fährt über den sternengespickten Hintergrund, die stecknadelgroßen Lichter, mit denen Abby versucht hat, die Unendlichkeit einzufangen. Ich räuspere mich, ziehe die Hand fort und nehme stattdessen ein Foto von uns beiden vom Bett. Zweimal das gleiche Lächeln, das unter dicken Schals hervorblitzt, über unseren Köpfen glitzern die Lichterketten im Park um die Ecke so hell wie die Sterne in Abbys Bild.
Es war irgendwie magisch. Der sanfte Schein der Parklaternen, der weiße Schnee auf den Zweigen, die absolute Stille. Für dieses Bild haben wir uns letztes Jahr fast den Arsch abgefroren, doch so war es unsere Tradition. Abby und ich, die sich in die Kälte wagten, um gemeinsam die Weihnachtsbeleuchtung zu bewundern.
Bei diesem Foto weiß ich immer, wie es sich angefühlt hat. Wie es sich angefühlt hat, mit meiner Schwester ins Abenteuer zu ziehen, hinaus in die große, weite Welt.
Ich nehme eine Reißzwecke und pinne das Foto neben die Zeichnung, setze mich auf mein Bett und schnappe mir das kleine Notizbuch und den Stift von meinem Nachttisch. Mein Blick gleitet über die lange To-do-Liste, die ich mir heute Morgen erstellt habe, angefangen mit »Punkt 1: To-do-Liste erstellen«, befriedigenderweise bereits abgehakt, bis ganz hinunter zu Punkt 22: »Übers Jenseits nachdenken.«
Punkt 22 war womöglich etwas arg ehrgeizig für einen Freitagnachmittag, aber wenigstens kann ich jetzt Punkt 17 abhaken: »Wände dekorieren.« Ich sehe mich in dem vorher so kahlen Zimmer um, dem ich fast den ganzen Vormittag hindurch mal wieder meinen Stempel aufgedrückt habe, betrachte die Wände, die jetzt über und über bedeckt sind mit den Bildern, die Abby mir im Laufe der Jahre geschenkt hat, den kleinen Gaben voll Leben und Farbe vor kalkweißem Hintergrund, je eine für jeden Klinikaufenthalt.
Ich am Tropf, und aus dem Infusionsbeutel heraus flattern Schmetterlinge jeden Formats, jeder Form, jeder Farbe. Ich mit Nasenkanüle, und der Schlauch bildet ein Unendlichkeitszeichen. Ich mit meinem Vernebler, und der Dampf, der herauskommt, bildet einen wolkigen Heiligenschein. Und noch das Zartfarbigste, ein verblasster Sternensturm, den sie gemalt hat, als ich das erste Mal hier war.
Das Bild ist nicht ganz so ausgefeilt wie ihre späteren Sachen, aber irgendwie mag ich es genau deshalb am liebsten.
Und direkt unterhalb dieser Pracht steht … meine gesammelte medizinische Ausrüstung, genau neben einem grässlichen grünen Krankenhaussessel aus Kunstleder, der hier im Saint Grace in jedem Zimmer zur Grundausstattung gehört. Argwöhnisch beäuge ich den Infusionsständer, weil ich weiß, dass in genau einer Stunde und neun Minuten die erste von vielen Antibiotikarunden des kommenden Monats beginnt. Hurra.
»Da ist es!«, ruft eine Stimme draußen auf dem Flur. Ich hebe den Kopf, die Tür öffnet sich langsam und es erscheinen zwei vertraute Gesichter. Camila und Mya haben mich im vergangenen Jahrzehnt hier tausendmal besucht, und immer noch schaffen sie es nicht von der Anmeldung bis zu meinem Zimmer, ohne jeden Menschen im Haus nach dem Weg zu fragen.
»Falsches Zimmer«, sage ich und grinse beim Anblick ihrer erleichterten Mienen.
Mya lacht und schiebt die Tür ganz auf. »Hätte mich ehrlich nicht gewundert. Verdammtes Labyrinth.«
»Schon aufgeregt?«, frage ich und springe auf, um sie zu umarmen.
Camila hält mich auf Armeslänge, schmollt, das dunkle Haar sieht fast so niedergeschlagen aus wie sie. »Zweite Fahrt hintereinander ohne dich.«
Stimmt. Nicht zum ersten Mal bringt meine Mukoviszidose mich um irgendeinen Schulausflug, Strandurlaub oder eine Schulveranstaltung. Ungefähr siebzig Prozent der Zeit läuft alles für mich ziemlich normal. Ich gehe zur Schule, ich treffe mich mit Camila und Mya, ich arbeite an meiner App. Nur eben mit reduzierter Lungenfunktion. Aber die übrigen dreißig Prozent beherrscht die Krankheit mein Leben. Was bedeutet, dass ich eben Dinge wie Klassenausflüge in die Ausstellung oder jetzt die Abschlussreise unseres Jahrgangs nach Mexiko verpasse, weil ich Unterstützung aus der Klinik brauche. Und die sieht diesmal eben so aus, dass ich mit Antibiotika vollgepumpt werden muss, um endlich das hartnäckige Halsweh und das Fieber wegzubekommen.
Das und meine abschmierende Lungenfunktion.
Mya schmeißt sich auf mein Bett und lässt sich unter dramatischem Seufzen hineinsinken. »Sind doch nur zwei Wochen. Bist du sicher, dass du nicht mitkannst? Das ist unsere Abschlussfahrt, Stella!«
»Ich bin mir sicher«, sage ich entschieden, und sie wissen, dass es mir ernst ist. Wir sind seit der Mittelstufe befreundet, und mittlerweile ist ihnen klar, dass die Mukoviszidose das letzte Wort hat, was meine Pläne angeht.
Es ist ja nicht so, dass ich nicht mitfahren will. Aber es geht buchstäblich um Leben und Tod. Ich kann nicht einfach nach Cabo – oder sonst wohin – und das Risiko eingehen, es nicht zurück zu schaffen. Das kann ich meinen Eltern nicht antun. Nicht jetzt.
»Aber du hast dieses Jahr das Planungskomitee geleitet. Kannst du denen nicht sagen, sie sollen die Behandlung verschieben? Wir wollen nicht, dass du hier drinnen versauerst«, sagt Camila und weist auf mein sorgfältig dekoriertes Krankenhauszimmer.
Ich schüttle den Kopf. »Wir haben ja noch die gemeinsamen Osterferien! Und ich habe unser Freundinnenwochenende seit der Achten nur ein Mal verpasst, und auch nur wegen dem Schnupfen damals.« Ich lächle Camila und Mya hoffnungsvoll zu. Aber beide springen nicht darauf an, sondern tun lieber weiterhin so, als hätte ich ihre Haustiere abgemurkst.
Mir fällt auf, dass sie beide die mit Badeanzügen gefüllten Taschen halten, die ich sie gebeten hatte mitzubringen, und so reiße ich Camila ihre aus der Hand, versuche verzweifelt, das Thema zu wechseln. »Okay, Modenschau. Die Suche nach dem Topmodell.« Nachdem ich nicht im Badeanzug meiner Wahl am mexikanischen Strand in Cabo braten werde, kann ich wenigstens über meine Freunde etwas davon mitbekommen, indem ich sie bei der Auswahl unterstütze.
Beide werden sichtlich fröhlicher und wir schütten ihre Taschen in einem bunten Mischmasch aus Punkten, Blumen und Leuchtfarben auf meinem Bett aus.
Ich schaue Camilas Badeanzugstapel durch und greife nach einem roten, der irgendwo zwischen Bikinihose und Schnürfaden angesiedelt ist, was zweifellos zeigt, dass es sich um ein Erbstück ihrer großen Schwester Megan handelt.
Ich werfe ihn ihr zu. »Der hier. Wie für dich gemacht.«
Ihre Augen werden groß und sie hält ihn sich an die Taille, rückt sich erstaunt die Metallbrille zurecht. »Also, der würde sicher minimale Bräunungsstreifen machen …«
»Camila«, sage ich und schnappe einen weiß-blau gestreiften Bikini, der fraglos sitzen wird wie eine zweite Haut. »Scherz. Der hier ist perfekt.«
Mit erleichtertem Blick nimmt sie mir den Bikini aus der Hand. Ich wende mich Myas Stapel zu, doch die ist vollauf damit beschäftigt, im grünen Kunstledersessel Textnachrichten zu schreiben und vor sich hin zu strahlen.
Ich grabe einen Einteiler hervor, den sie seit dem Schwimmunterricht in der sechsten Klasse besitzt, und halte ihn ihr mit einem schiefen Grinsen hin. »Wir wär’s mit dem hier, Mya?«
»Super! Sieht toll aus«, sagt sie unter wildem Getippe.
Schnaubend stopft Camila ihre Badeanzüge zurück in die Tasche und grinst mir bedeutungsschwer zu. »Mason und Brooke haben Schluss gemacht«, erklärt sie.
»O Gott. Kann nicht sein!«, sage ich. Das sind Neuigkeiten. Großartige Neuigkeiten.
Vielleicht nicht für Brooke, wahrscheinlich. Aber Mya schwärmt schon für Mason, seit sie in der Zehnten gemeinsam Englisch bei Mrs. Wilson hatten, also ist diese Fahrt ihre Chance, es endlich zu versuchen.
Es macht mich fertig, dass ich ihr nicht dabei helfen kann, einen zehnstufigen Plan für die stürmische Romanze mit Mason unter mexikanischem Himmel zu erstellen.
Mya steckt ihr Handy weg und zuckt betont gelassen die Schultern, während sie sich vor die Wand stellt, um vorgeblich die Bilder zu studieren. »Kein Grund zur Aufregung. Wir treffen ihn und Taylor morgen früh am Flughafen.«
Ich sehe sie bedeutungsvoll an, und da ist es, das Lächeln. »Okay, ist schon ein ziemlicher Grund zur Aufregung!«
Wir quietschen alle aufgeregt durcheinander und ich halte einen supersüßen gepunkteten Einteiler hoch, ein echtes Vintageteil und genau ihr Stil. Sie nickt, schnappt ihn sich und hält ihn sich an. »Ich habe so gehofft, dass du den aussuchst.«
Camila beäugt nervös ihre Uhr, was zu erwarten war. Sie ist amtierende Aufschiebekönigin und hat wahrscheinlich noch kein einziges Stück für Cabo gepackt.
Bis auf den Bikini natürlich.
Sie fühlt sich ertappt und grinst verlegen. »Ich muss mir für den Strand noch ein Badelaken kaufen.«
Wirklich typisch Camila.
Ich stehe auf und spüre, wie mir das Herz schwer wird beim Gedanken an ihren Aufbruch, aber ich möchte sie nicht aufhalten. »Ihr müsst dann echt mal los! Euer Flug ist ja quasi vor dem Aufstehen.«
Mya sieht sich traurig im Zimmer um, während Camila geknickt ihre Badeanzugtasche in der Hand zwirbelt. Die beiden machen es mir noch schwerer, als es ohnehin schon ist. Ich schlucke die Schuldgefühle und den Ärger hinunter, die in mir aufsteigen. Sie sind ja hier nicht diejenigen, die ihre Abschlussreise nach Cabo verpassen. Wenigstens werden sie zusammen sein.
Ich strahle die beiden an und schleife sie praktisch zur Zimmertür. Meine Wangen schmerzen vom ganzen Gute-Laune-Geheuchel, aber ich will es ihnen nicht versauen.
»Wir schicken dir haufenweise Fotos, okay?«, sagt Camila und umarmt mich.
»Wehe, wenn nicht! Photoshoppt mich in ein paar rein«, ermahne ich Mya, die mit Adobe wahre Wunder vollbringt. »Dann merkt ihr noch nicht mal, dass ich nicht dabei war.«
Sie lungern auf der Schwelle herum und ich werfe ihnen einen extragenervten Blick zu und schubse sie spielerisch auf den Flur. »Los, verschwindet! Gute Fahrt!«
»Wir lieben dich, Stella!«, rufen sie noch aus dem Gang. Ich sehe ihnen nach, winke, bis Myas hüpfende Locken völlig außer Sichtweite sind, möchte plötzlich nichts mehr, als mit ihnen zu gehen, zum Einpacken statt zum Auspacken.
Mein Lächeln fällt in sich zusammen, als mein Blick beim Schließen der Tür auf das alte Familienfoto fällt, das ich dort sorgsam befestigt habe.
Es wurde vor ein paar Sommern geschossen, auf der Veranda vor unserem Haus, als wir am vierten Juli grillten. Abby, ich, Mom und Dad, allesamt etwas dümmlich in die Kamera grinsend. Eine Heimwehwelle durchschwappt mich, ich kann das Geräusch des morschen, klapprigen Holzes richtig hören, wie es unter uns knarzte, als wir uns für das Bild nebeneinanderdrängten. Dieses Gefühl fehlt mir so. Wie wir alle zusammen waren, glücklich und gesund. Jedenfalls meistens.
Nicht gerade hilfreich jetzt. Seufzend reiße ich mich los und blicke zum Arzneiwagen hinüber.
Ganz ehrlich, mir gefällt es hier. Seit ich sechs war, ist hier mein zweites Zuhause, also macht es mir normalerweise nichts aus herzukommen. Ich werde behandelt, ich schlucke meine Medikamente, ich schlürfe mein Körpergewicht in Milchshakes, ich darf Barb und Julie sehen, und dann gehe ich wieder, bis es von vorne losgeht. Ganz einfach also. Aber diesmal bin ich angespannt, aufgewühlt sogar. Denn statt einfach nur gesund sein zu wollen, muss ich diesmal tatsächlich gesund werden. Um meiner Eltern willen.
Weil sie einfach alles versaut haben, indem sie sich haben scheiden lassen. Und nachdem sie schon einander verloren haben, werden sie nie damit fertigwerden, wenn sie auch noch mich verlieren. Das weiß ich.
Aber wenn es mir besser geht, dann vielleicht …
Eins nach dem anderen. Ich gehe rüber zum Sauerstoffanschluss in der Wand, überprüfe sorgfältig die Einstellung und lausche dem gleichmäßigen Zischen des Sauerstoffflusses, bevor ich mir den Schlauch um die Ohren lege und die Kanülen der Nasenbrille in meine Nasenlöcher schiebe. Seufzend lasse ich mich auf die vertraut ungemütliche Krankenhausmatratze sinken und hole tief Luft.
Ich greife nach meinem kleinen Notizbuch, um ablenkungshalber zu lesen, was als Nächstes auf meiner To-do-Liste steht. »Punkt 18: Video aufnehmen.«
Ich schnappe mir den Stift und kaue nachdenklich darauf herum, während ich auf die Worte starre, die ich vorhin geschrieben habe. Seltsamerweise würde es mir gerade leichter fallen, übers Jenseits nachzudenken.
Aber Liste ist Liste, und so atme ich tief aus und recke mich zu meinem Nachttisch, wo der Laptop steht. Dann setze ich mich im Schneidersitz auf die neue geblümte Steppdecke, die ich gestern bei Target rausgesucht habe, während Camila und Mya Klamotten für Cabo shoppten. Nicht, dass ich die Decke gebraucht hätte, aber sie waren so begeistert von dem Gedanken, dass ich mir auch etwas Schönes für meinen Klinikaufenthalt kaufe, dass ich sonst ein schlechtes Gewissen gehabt hätte. Wenigstens passt sie jetzt zu meinen Wänden mit ihren leuchtenden, lebendigen Farben.
Der Computer fährt hoch und ich trommele nervös auf der Tastatur herum und mustere mein Spiegelbild auf dem Bildschirm. Überall diese langen braunen Locken. Ich versuche, sie mit den Fingern zu bändigen, wenigstens etwas in Form zu bringen. Frustriert ziehe ich das Haargummi vom Handgelenk und mache mir aus der Not einen unordentlichen Dutt, um für dieses Video zumindest ansatzweise präsentabel auszusehen. Dann greife ich mir Java-Programmieren für Android-Geräte vom Nachttisch und stelle den Laptop drauf, um eine einigermaßen schmeichelhafte Einstellung ohne Doppelkinn hinzubekommen.
Beim Einloggen bei YouTube Live stelle ich die Webcam ein, damit Abbys Lungenbild hinter mir auch richtig zu sehen ist.
Der perfekte Hintergrund.
Ich schließe die Augen und hole tief Luft, höre das vertraute Röcheln meiner Lunge, die verzweifelt versucht, sich durch all den Schleim hindurch mit Luft zu füllen. Dann atme ich lange aus, pflastere mir ein breites Zahnpastagrinsen ins Gesicht, schlage die Augen auf und drücke die Taste, um live zu gehen.
»Hallo Leute. Habt ihr alle einen netten Black Friday und kauft, was das Zeug hält? Ich persönlich habe ja auf die Schneelieferung gewartet, die mir versprochen wurde.«
Ein flüchtiger Blick auf den Monitor, während ich die Kamera Richtung Krankenhausfenster rüberschiebe, zum verhangenen grauen Himmel, den kahlen Bäumen jenseits der Scheibe. Der Livestream-Zähler hat schon den Tausender überschritten, nur ein Bruchteil meiner 23940 YouTube-Abonnenten, die regelmäßig wissen wollen, wie es in meinem Kampf gegen die Mukoviszidose steht.
»Also, eigentlich sollte ich mich gerade für meinen Flug nach Mexiko fertig machen, die Abschlussreise meiner Schule, aber stattdessen mache ich eben Urlaub in meinem zweiten Zuhause, meinem Halsweh sei Dank.«
Und dem ständigen Fieber. Ich denke daran, wie heute Morgen bei der Aufnahme mein Fieber gemessen wurde und die Leuchtziffern des Thermometers fast 39 gezeigt haben. In dem Video erwähne ich das lieber nicht, weil meine Eltern es bestimmt später sehen werden.
Sie glauben, ich habe einfach nur einen hartnäckigen Schnupfen.
»Wer braucht schon zwei Wochen Sonnenschein, blauen Himmel und Strand, wenn man sich in der Nachbarschaft einen ganzen Monat lang verwöhnen lassen kann?«
Ich zähle die Annehmlichkeiten an den Fingern auf. »Also. Ich habe rund um die Uhr Portierservice, Schokopudding bis zum Anschlag und Wäschedienst. Ach, und Barb hat Dr. Hamid breitgeschlagen, dass ich diesmal alle meine Medikamente und Geräte im Zimmer haben darf. Schaut her!«
Ich drehe die Webcam zum Stapel mit den medizinischen Geräten und dem Rollwagen neben mir, den ich bereits perfekt geordnet habe, alphabetisch und chronologisch, entsprechend des Einnahme- und Dosierungsplans, den ich auch in meine selbst entwickelte App eingegeben habe. Endlich ist sie bereit für den Probelauf.
Das war Punkt 14 auf meiner To-do-Liste heute, und ich bin ziemlich stolz darauf, wie es jetzt organisiert ist.
Mein Computer macht Pinggeräusche, die ersten Kommentare sind da. In einem erspähe ich Barbs Namen, umrahmt von Herz-Emojis. Meine Zuschauer lieben sie, genau wie ich. Schon als ich vor über zehn Jahren zum ersten Mal auf diese Station kam, war sie hier die Atemtherapeutin, die mir und meinen Muko-Kollegen Süßigkeiten zugesteckt hat. Wie auch Poe beispielsweise, meinem Spießgesellen. Und wenn unsere Schmerzen höllisch werden, hält sie uns nach wie vor ganz selbstverständlich die Hand.
Vor fünf Jahren habe ich dann angefangen, YouTube-Videos zu drehen, damit Mukoviszidose mehr Aufmerksamkeit bekommt. Im Laufe der Jahre haben so viele Leute meine Operationen und Therapien und Aufenthalte im Saint Grace verfolgt, dass es meinen Verstand übersteigt. Sie haben sogar meine peinliche Zahnspangenphase mit mir durchgemacht und alles Sonstige.
»Meine Lungenfunktion liegt nur noch bei fünfunddreißig Prozent«, sage ich und drehe die Kamera wieder zu mir. »Dr. Hamid sagt, ich bin schon fast oben auf der Transplantationswarteliste, also bleibe ich jetzt einen Monat hier, nehme Antibiotika, unterzieh mich strikt der Behandlung …«
Meine Augen wandern zu der Zeichnung hinter mir, die gesunde Lunge, die genau über meinem Kopf schwebt, gerade außer Reichweite.
Lächelnd angle ich nach einer Flasche vom Medikamentenwagen. »Das heißt, dass ich meine Medikamente genau zur richtigen Zeit nehme, meine Vibrationsweste trage, um den Schleim zu lockern, und« – ich halte die Flasche hoch – »jede Nacht Massen von dieser Flüssignahrung durch die Ernährungssonde kriege. Falls sich unter euch jemand befinden sollte, der sich danach sehnt, fünftausend Kalorien am Tag zu verdrücken und trotzdem den perfekten Cabo-Beach-Body zu behalten, ich bin jederzeit für einen Tausch zu haben.«
Mein Computer pingt in einer Tour, ein Kommentar nach dem anderen trudelt herein. Ich lese ein paar und lasse zu, dass die guten Gefühle all die negativen verdrängen, die ich zu Anfang des Videos hatte.
Mach weiter so, Stella. Wir lieben dich.
Heirate mich!
»Die neue Lunge kann jeden Augenblick kommen, also muss ich bereit sein!« Das sage ich, als würde ich wirklich aus ganzem Herzen daran glauben. Obwohl ich nach all diesen Jahren gelernt habe, meine Hoffnungen nicht allzu hochzuschrauben.
PING! Noch eine Nachricht.
Ich habe auch Muko und du erinnerst mich immer daran, dass ich nicht verzweifeln darf. XOXO
Mir wird warm ums Herz und ich lächle zum Abschluss noch einmal breit in die Kamera, extra für diesen Menschen, der den gleichen Kampf kämpft wie ich. Diesmal ist es aufrichtig. »Also, Leute, danke fürs Zusehen! Ich muss jetzt meine Medikation für den Nachmittag und den Abend noch mal checken. Ihr wisst, was für eine Pedantin ich bin. Ich wünsche euch allen eine tolle Woche. Bis bald!«
Ich beende das Livevideo und atme langsam aus, schließe den Browser, um die strahlenden, winterballschönen Gesichter auf meinem Desktop zu sehen. Camila, Mya und ich Arm in Arm, alle mit demselben tiefroten Lippenstift, den wir gemeinsam bei Sephora ausgesucht hatten. Camila hatte Knallpink gewollt, doch Mya redete uns ein, Rot sei die Farbe, die noch in unserem Leben fehlte. Eine Ansage, die ich immer noch bezweifle.
Ich lasse mich nach hinten sinken und nehme mir den abgewetzten Panda vom Kissen, um ihn fest in den Arm zu nehmen. Flicki, so hat ihn meine Schwester Abby getauft. Und sein Name ist Programm geworden. Das jahrelange Rein und Raus aus der Klinik mit mir hat ihm wirklich zugesetzt. Bunte Flicken bedecken Stellen, wo er aufgerissen und sein Füllmaterial rausgequollen ist, wenn ich ihn während der schmerzhaftesten Prozeduren zu fest gedrückt habe.
Es klopft an der Tür, und keine Sekunde später fliegt sie schon auf, um Barbara hereinzulassen, die mit einer ganzen Armladung Puddinggläser für meine Medikamenteneinnahme hereinprescht. »Hier bin ich wieder! Speziallieferung!«
Was Barb angeht, ist während der letzten sechs Monate alles beim Alten geblieben, sie ist noch immer die Beste. Dieselben kurzen Locken. Dieselben bunten Krankenhauskittel. Dasselbe Lächeln, das das ganze Zimmer erhellt.
Doch dann erscheint hinter ihr eine sichtbar schwangere Julie, eine Infusion in der Hand.
Also, da hat sich in den letzten sechs Monaten tatsächlich was getan.
Ich versuche meine Überraschung zu verbergen und grinse Barb an, die mir den Pudding zum Einsortieren auf den Wagen an den Bettrand stellt und dann eine Liste hervorzieht, um sicherzugehen, dass auch wirklich alles Wichtige dasteht.
»Was täte ich nur ohne dich?«, frage ich.
Sie zwinkert mir zu. »Sterben?«
Julie hängt die Antibiotika-Infusion neben mir auf, ihr Bauch streift meinen Arm. Warum hat sie mir nicht erzählt, dass sie schwanger ist? Ich verkrampfe mich, lächle dürr, während ich ihren Babybauch beäuge und unauffällig davon abrücke. »Da ist ja einiges anders als vor einem halben Jahr.«
Sie reibt sich den Bauch und strahlt mich mit leuchtenden blauen Augen an. »Möchtest du mal fühlen, wie sie tritt?«
»Nein«, sage ich etwas zu hastig. Meine Unverblümtheit scheint sie aus dem Tritt zu bringen, ihre blonden Augenbrauen fahren vor Überraschung in die Höhe. Aber ich will meine miese Aura nicht in die Nähe dieses perfekten, gesunden Babys bringen.
Zum Glück wandert ihr Blick zu meinem Desktop-Hintergrund. »Sind das Fotos von eurem Winterball? Da habe ich auch welche auf Insta gesehen«, sagt sie aufgeregt. »Wie war’s denn?«
»Total lustig«, sage ich mit einer Dreifachladung Enthusiasmus und die Peinlichkeit schmilzt dahin. Ich klicke den Ordner mit den Bildern an. »Drei volle Lieder durchgetanzt. Stretchlimo gefahren. Das Essen war gar nicht mal so mies. Und außerdem habe ich bis halb elf durchgehalten, bevor ich müde wurde, also viel länger als erwartet. Wer braucht schon Elternregeln, wenn der eigene Körper das regelt, stimmt’s?«
Ich zeige ihr und Barb ein paar Bilder, die wir vor dem Ball bei Mya zu Hause gemacht haben, während Julie mich an den Tropf hängt und meinen Blutdruck und meine Sauerstoffwerte misst. Ich kann mich noch daran erinnern, mal Angst vor Spritzen und Co. gehabt zu haben, doch mit jeder Blutabnahme und jeder Infusion hat die sich immer weiter in Luft aufgelöst. Jetzt zucke ich noch nicht mal mit der Wimper dabei. Mit jedem Tasten, mit jedem Piks fühle ich mich stärker. Als würde ich mit allem fertig.
»Supidupi«, sagt Barb, als sie sämtliche Werte abgelesen und mein glitzerndes silbernes A-Linien-Kleid mit dem Anstecksträußchen aus weißen Rosen hinreichend bestaunt haben. Camila, Mya und ich hatten kurzerhand Buketts getauscht, weil wir allesamt partnerlos zum Ball gingen. Ich wollte mich nicht verabreden – nicht, dass mich überhaupt erst jemand gefragt hätte. Es hätte jederzeit sein können, dass ich ausfalle oder während des Balls plötzlich schwächle, was ich niemandem hätte zumuten wollen. Die beiden wollten nicht, dass ich mich als fünftes Rad am Wagen fühlte, und so hatten sie beschlossen, sich ebenfalls keine Dates zu suchen und mit mir als Dreiergespann zu gehen. Nach den neuesten Mason-Entwicklungen sieht es allerdings so aus, als wäre das für den Abschlussball keine Option mehr.
Barb weist mit dem Kopf auf den Wagen, eine Hand in die Hüfte gestemmt. »Ich habe schon noch ein Auge auf dich, aber im Grunde kannst du jetzt loslegen.« Sie hält ein Tablettenfläschchen hoch. »Denk dran, die hier unbedingt zum Essen«, sagt sie, stellt das Fläschchen vorsichtig ab und greift nach dem nächsten. »Und pass auf, dass du …«
»Ich hab’s im Griff, Barb«, sage ich. Gegen ihre mütterliche Art kommt sie einfach nicht an, doch sie hebt ergeben die Hände. Tief in ihrem Herzen weiß sie, dass ich es hinbekomme.
»Übrigens«, sagt Barb langsam, als Julie das Zimmer verlässt. Ihr Blick wird eindringlich: eine sanfte Warnung. »Erst bringst du die Infusion hinter dich, aber … Poe hat soeben Zimmer 310 bezogen.«
»Was? Echt?« Ich mache große Augen und Anstalten, sofort aus dem Bett zu hüpfen und ihn zu suchen. Ich kann nicht glauben, dass er mir nicht gesagt hat, dass er hier ist!
Barb schnellt vor, greift meine Schultern und hat mich schon sanft aufs Bett zurückgedrückt, bevor ich noch richtig stehe. »Welcher Teil von ›erst bringst du die Infusion hinter dich‹ war schwer zu verstehen?«
Ich lächle verlegen, aber was kann ich bitte dafür? Poe war der Erste, mit dem ich mich hier in der Klinik angefreundet habe. Er ist auch der Einzige, der es wirklich kapiert. Wir kämpfen schon ein ganzes verdammtes Jahrzehnt gemeinsam gegen die Krankheit. Also, gemeinsam, aber mit Sicherheitsabstand.
Wir dürfen einander nicht zu nahe kommen. Für Mukoviszidosepatienten ist eine Querinfektion mit bestimmten anderen Bakterienstämmen ein gewaltiges Risiko. Wenn sich zwei Mukos auch nur berühren, kann das für beide tödlich sein. Im wortwörtlichsten Sinne.
Ihr ernster Ausdruck weicht einem milden Lächeln. »Gewöhn dich ein. Entspann dich. Mach dich locker.« Sie beäugt scherzhaft den Medikamentenwagen. »Aber ohne Hilfsmittel.«
Ich nicke und muss auflachen, so erleichtert bin ich über Poes Auftauchen.
»Ich schau später vorbei, um dir mit der Vibrationsweste zu helfen«, sagt Barb im Rausgehen noch über die Schulter. Ich schnappe mir mein Handy und begnüge mich mit einer schnellen Nachricht, statt den Flur hinunter zu Zimmer 310 zu rasen.
Du bist hier? Ich auch. Antibiotika
Keine Sekunde vergeht und auf meinem Display leuchtet seine Antwort auf:
Bronchitis. Ganz frisch. Werd’s überleben. Komm später vorbei und wink mir. Ich penn erst mal.
Ich lasse mich aufs Bett sinken, atme lange und langsam aus.
Die Wahrheit? Dieser Aufenthalt macht mir Angst.
Meine Lungenfunktion ist so schnell auf fünfunddreißig Prozent gesunken. Mehr noch als das Fieber und das Halsweh macht mich fertig, dass ich hier den ganzen nächsten Monat im Krankenhaus sein werde und eine Behandlung nach der anderen über mich ergehen lassen muss, um eine Chance zu haben, während meine Freunde so weit weg sind – und es macht mich nervös. Sehr. Fünfunddreißig Prozent sind eine Zahl, die meiner Mutter schlaflose Nächte bereitet. Nicht, dass sie es sagen würde, aber ihr Computer verrät es. Zahlreiche Suchen nach Lungentransplantationen und Lungenfunktionszahlen, immer neue Wortkombinationen und Formulierungen, aber immer derselbe Gedanke. Wie kann man mir mehr Zeit verschaffen. Deshalb fürchte ich mich mehr als je zuvor. Aber nicht um mich. Wer Muko hat, gewöhnt sich irgendwie an den Gedanken, jung zu sterben. Nein, ich habe eine Heidenangst um meine Eltern. Und was mit ihnen geschieht, wenn es zum Schlimmsten kommt, jetzt, wo sie einander nicht mehr haben.
Aber wenn Poe da ist, jemand, der es kapiert, dann kann ich es durchstehen. Sollte ich ihn tatsächlich mal zu sehen kriegen.
Der Rest des Nachmittags schleppt sich dahin.
Ich werkle an meiner App, überprüfe noch mal, ob ich das mit dem Programmierfehler hinbekommen habe, der immer aufgetaucht ist, sobald ich sie auf meinem Smartphone laufen lassen wollte. Ich streiche etwas Fudicin auf die wunde Haut rund um meine Ernährungssonde, damit sie vielleicht von Feuerrot mehr ins zartere Sommer-Sonnenuntergangsrosa übergeht. Ich überprüfe meinen Medikamentenberg für die »Schlafenszeit«. Ich beantworte die Nachrichten meiner Eltern, die mit jeder vollen Stunde eingehen. Ich starre aus dem Fenster in den endenden Nachmittag und sehe ein Pärchen in meinem Alter, wie es lachend und küssend ins Krankenhaus schlendert. Glückliche Paare sieht man nicht alle Tage eine Klinik betreten. Beim Anblick ihrer verschlungenen Hände und schmachtenden Blicke frage ich mich, wie es wäre, wenn mich jemand so ansähe. Die Leute starren immer auf meine Kanülen, meine Narben, meine Sonde, aber nicht auf mich.
Nicht gerade ein Anreiz für die Jungen, an meinem Schließfach Schlange zu stehen.
Im ersten Highschooljahr war ich mit Tyler Paul »zusammen«, aber das währte nur einen Monat, bis ich mir irgendwo was einfing und für einige Wochen ins Krankenhaus musste. Schon nach ein paar Tagen wurden seine Nachrichten immer rarer, und ich beschloss, mit ihm Schluss zu machen. Außerdem war das kein bisschen so wie das Paar dort im Hof. Tylers Hände fühlten sich beim Halten immer ganz verschwitzt an und er sprühte sich immer mit so viel Axe ein, dass ich bei jeder Umarmung einen Hustenanfall bekam.
Diese Gedankengänge sind zur Ablenkung nicht gerade förderlich und so versuche ich mich an Punkt 22 auf meiner Liste, »Über das Jenseits nachdenken«, und lese etwas in Liebe, Tod, Unsterblichkeit: Die Reise unserer Seele.
Aber schon ziemlich bald liege ich lieber einfach nur herum, starre an die Decke und lausche dem Pfeifen meines Atems. Ich kann hören, wie die Luft sich an dem Schleim vorbeikämpft, der sich in meiner Lunge breit macht. Ich rolle mich auf die Seite und öffne eine Ampulle Flovent, um meiner Lunge auf die Sprünge zu helfen. Die Flüssigkeit gieße ich in den Vernebler neben meinem Bett und die kleine Maschine erwacht mit einem Brummen, stößt ihre Dämpfe aus dem Mundstück aus.
Ich setze mich auf, starre auf das Bild von der Lunge, atme ein und aus.
Und ein und aus.
Und ein und … aus.
Hoffentlich geht mein Atem etwas weniger schwer, wenn meine Eltern in den nächsten Tagen vorbeischauen. Ich habe ihnen jeweils erzählt, dass der andere mich heute Morgen ins Krankenhaus bringt, bin aber in Wahrheit an der Kreuzung neben Moms neuer Wohnung in ein Taxi gestiegen. Ich wollte nicht, dass einer von ihnen mich wieder hier sehen muss, bevor ich nicht etwas fitter wirke.
Allein die sorgenvollen Blicke meiner Mutter, als ich schon fürs Packen mein Sauerstoffgerät brauchte.
Es klopft an der Tür und ich reiße meinen Blick von der Wand los, in der Hoffnung, es sei Poe, der mir winken kommt. Ich ziehe mein Mundstück ab und Barbs Kopf erscheint. Sie lässt eine chirurgische Schutzmaske und Latexhandschuhe auf den Tisch neben meiner Tür fallen.
»Neuzugang oben. Viertelstunde?«
Mein Herz macht einen Satz.
Ich nicke und sie verschwindet, nicht ohne mir noch einmal zugelächelt zu haben. Ich schnappe mir das Mundstück und nehme noch eine letzte Ladung Flovent, sauge vor meinem Aufbruch noch einmal den Dampf so tief in meine Lunge, wie ich nur kann. Ich schalte den Vernebler ab, nehme mein tragbares Sauerstoffgerät von der Auffüllstation neben dem Bett, drücke den runden Anschaltknopf in der Mitte und ziehe mir den Riemen über die Schulter. Nachdem ich die Kanüle eingeführt habe, streife ich mir neben der Tür die blauen Latexhandschuhe über und verstecke Mund und Nase hinter der Hygienemaske, deren Gummibänder ich mir um die Ohren ziehe.
Ich schlüpfe in meine weißen Converse, drücke die Tür auf und zwänge mich hinaus in den weiß getünchten Korridor, entscheide mich für den Umweg, damit ich an Poes Tür vorbeikomme.
Ich gehe am Stationszimmer vorbei und winke einer jungen Pflegehelferin namens Sarah zu, die mir über das neue, schicke Stahlmodul hinweg zulächelt.
Das haben sie vor meinem letzten Aufenthalt vor sechs Monaten installiert. Es ist so hoch wie die alte Station, doch die war aus abgenutztem Holz und wahrscheinlich schon seit Eröffnung des Krankenhauses vor über sechzig Jahren da. Ich erinnere mich noch daran, wie ich klein genug war, um mich auf dem Weg zu Poes jeweiligem Zimmer daran vorbeizuschleichen, mein Kopf noch deutlich unter der Tischkante.
Jetzt reicht der Tresen mir bis zum Ellbogen.
Auf dem Weg durch den Flur muss ich grinsen, als ich eine kleine kolumbianische Flagge orte, mit Tesa an einer Tür angebracht, die mittels eines umgedrehten Skateboards einen Spaltbreit aufgehalten wird.
Ich spähe hinein. Poe hat sich zu einem erstaunlich winzigen Ball zusammengerollt und schläft unter seiner karierten Decke. Über ihm wacht Gordon Ramsay über seinen Schlaf, ein Mann von Welt im Posterformat.
Ich zeichne ein Herz auf die weiße Wandtafel, die er außen an seine Tür geklebt hat, damit er weiß, dass ich da war, und ziehe weiter den Flur hinunter zu der hölzernen Doppeltür, hinter der es zum Klinik-Hauptgebäude geht, dann mit dem Fahrstuhl hinauf und über die Brücke rüber zum Haus 2 und von dort dann direkt auf die Intensivstation der Neonatologie.
Wenn man hier seit über zehn Jahren ein und aus geht, kennt man die Klinik so gut wie das eigene Elternhaus. Jeden verschlungenen Gang, jede versteckte Treppe, jede geheime Abkürzung habe ich immer und immer wieder erforscht.
Doch bevor ich die Doppeltür meiner Station aufschieben kann, schwingt neben mir eine Krankenzimmertür auf, und als ich mich überrascht umdrehe, sehe ich einen großen, schmalen Jungen, der mir völlig fremd ist. Er steht seitlich in der Tür von Zimmer 315, hält einen Zeichenblock in der einen und einen Kohlestift in der anderen Hand und trägt ums Gelenk ein weißes Krankenhausarmband, genau wie ich.
Ich bleibe wie angewurzelt stehen.
Sein verwuscheltes bitterschokofarbenes Haar ist zur Perfektion zerzaust, als sei er eben der Teen Vogue entstiegen und mitten im Saint-Grace-Krankenhaus gelandet. Seine Augen sind dunkelblau und kräuseln sich beim Sprechen in den Winkeln.
Doch am allermeisten fällt mir sein Lächeln auf. Es ist schief und reizend und so warm, dass es einen anzieht wie ein Magnet.
Er ist so süß, dass meine Lungenfunktion sich wie um weitere zehn Prozent reduziert anfühlt.
Zum Glück reicht dieser Mundschutz mir übers halbe Gesicht, weil ich mit süßen Typen bei diesem Krankenhausaufenthalt nun mal gar nicht gerechnet habe.
»Ich habe ihre Pläne gecheckt«, sagt er und klemmt sich den Stift lässig hinters Ohr. Ich schiebe mich ein bisschen nach links und sehe, dass er das Pärchen angrinst, das ich vorhin ins Krankenhaus habe kommen sehen. »Also, wenn ihr nicht gerade mit dem Arsch auf die Klingel kommt, habt ihr mindestens eine Stunde eure Ruhe. Und vergesst nicht. Ich muss in diesem Bett noch schlafen, Leute.«
»Schon mitgedacht.« Ich sehe, wie das Mädchen die Tasche in ihrer Hand aufzieht und ihm Decken zeigt.
Moment mal. Wie bitte?
Der Süße pfeift. »Da schau her. Die Pfadfinder lassen grüßen.«
»Wir sind ja keine Tiere, Alter«, sagt ihr Freund und grinst ihn breit an, von Kerl zu Kerl.
O Gott. Er erlaubt seinen Freunden, es in seinem Bett zu treiben, als wären wir hier im Stundenhotel.
Ich schneide eine Grimasse und gehe weiter zum Ausgang, bringe so viel Abstand wie möglich zwischen mich und das, was auch immer da läuft.
So viel zum Thema süß.
Kapitel 2
Will
»Okay, bis später dann!«, sage ich mit einem letzten Zwinkern zu Jason und schließe diskret meine Zimmertür. Dabei muss ich direkt in die leeren Augenhöhlen der Totenschädelzeichnung blicken, die an meiner Tür hängt, mit der Sauerstoffmaske über dem Mund, darunter die Worte: »Ihr, die ihr eintretet, lasset alle Hoffnung fahren.«
Das wäre der passende Werbespruch für dieses Krankenhaus. Oder für eines der fünfzig anderen, in denen ich die letzten acht Monate meines Lebens verbracht habe.
Ich bekomme gerade noch mit, wie am Ende des Flurs das Mädchen mit den abgewetzten weißen Converse, das ich vorhin bei ihrem Einzug ins Zimmer weiter unten beobachtet habe, hinter der Schwingtür verschwindet. Sie war ganz alleine gekommen, hatte eine riesige Reisetasche geschleppt, die für drei Erwachsene gereicht hätte, aber sie hatte dabei ziemlich scharf ausgesehen.
Denn mal ganz ehrlich: Im Krankenhaus kriegt man nicht alle Tage ein halbwegs attraktives Mädchen vor die Nase, keine fünf Türen von einem entfernt.
Ich blicke zu meinem Skizzenbuch hinab, klappe es achselzuckend zu und stopfe es in meine hintere Hosentasche, bevor ich ihr den Gang hinterherdackle. Was Besseres habe ich ja nun mal nicht zu tun und hier werde ich die nächste Stunde ganz bestimmt nicht verbringen.
Ich schiebe mich durch die Tür und sehe, wie sie über den grauen Fliesenboden huscht und dabei jedem zuwinkt und ein Schwätzchen einlegt, dem sie über den Weg läuft, als veranstalte sie hier ihre eigene, höchstpersönliche Thanksgiving-Parade. Sie steigt in den großen Glasaufzug, den über der Eingangshalle Ost, direkt neben dem riesigen, voll geschmückten Weihnachtsbaum, den sie heute Morgen hier aufgestellt haben müssen, noch bevor überhaupt die letzten Truthahnreste abgenagt waren.
Gott bewahre, allein der Gedanke, die Riesentruthahndeko hätte nur eine Minute länger dagestanden als nötig.
Ich sehe zu, wie sie sich beim Knopfdrücken den Mundschutz richtet und sich die Türen langsam hinter ihr schließen.
Dann steige ich die Treppe neben dem Aufzug hinauf, versuche, niemanden anzurempeln, während ich zusehe, wie der Aufzug beharrlich zu Ebene Fünf hinauftuckert. Natürlich. Ich renne die Stufen so schnell hinauf, wie meine Lunge es erlaubt, und schaffe es sogar rechtzeitig bis zu Ebene Fünf, um einen Hustenanfall zu bekommen und mich davon zu erholen, bevor sie dem Fahrstuhl entsteigt und um eine Ecke verschwindet. Ich reibe mir die Brust, räuspere mich und folge ihr weiter, ein paar Flure entlang und dann hinauf auf die breite gläserne Bücke, die ins nächste Gebäude führt.
Obwohl sie erst heute Morgen angekommen ist, weiß sie offensichtlich genau, wo sie hinwill. In Anbetracht ihres Tempos und der Tatsache, dass sie jeden Menschen in diesem Laden zu kennen scheint, wäre ich nicht überrascht, wenn sie sich als die Bürgermeisterin herausstellt. Ich bin seit zwei Wochen hier und habe erst gestern kapiert, wie man sich unbemerkt von meinem Zimmer aus zur Cafeteria in Haus 2 schleicht, und ich bin wirklich keine Orientierungspfeife. Im Laufe der Jahre bin ich in so vielen Krankenhäusern gewesen, dass die Suche nach Schleichwegen inzwischen eine Art Hobby für mich ist.
Sie bleibt vor einer Doppeltür stehen, auf der EINGANGOST: