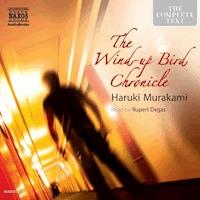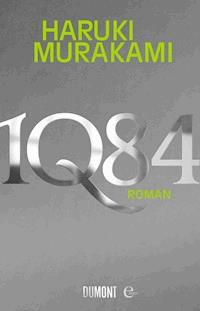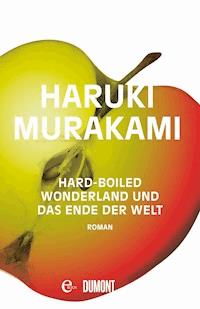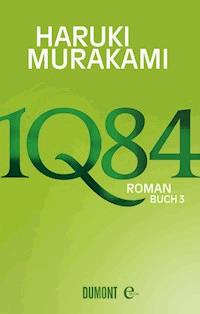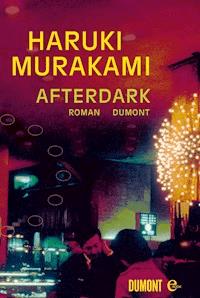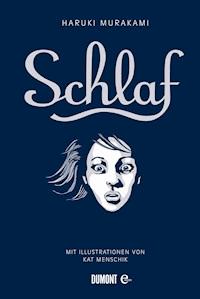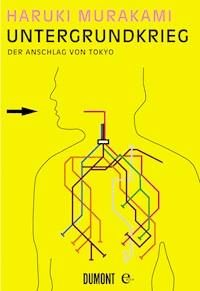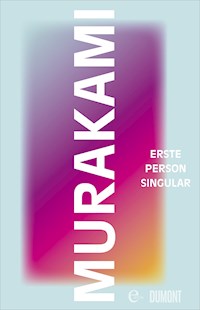
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: DUMONT Buchverlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Ab 10 Euro
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2021
»Solange Murakami leben und schreiben wird, wird er dieses Universum erweitern« PATTI SMITH Frauen, die verschwinden, eine fiktive Bossa-Nova-Platte von Charlie Parker, ein sprechender Affe und ein Mann, der sich fragt, wie er wurde, was er ist: Die Rätsel um die Menschen, Dinge, Wesen und Momente, die uns für immer prägen, beschäftigen die Ich-Erzähler der acht Geschichten in ›Erste Person Singular‹. Es sind klassische Murakami-Erzähler, die uns in eine Welt aus nostalgischen Jugenderinnerungen, vergangenen Liebschaften, philosophischen Betrachtungen, Literatur, Musik und Baseball entführen. Melancholisch, bestechend intelligent und tragikomisch im allerbesten Wortsinn sind diese Geschichten, die wie beiläufig mit der Grenze zwischen Fiktion und Realität spielen. »Ein Buch voll Schönheit und Erkenntnisblitzen« Denis Scheck, ARD DRUCKFRISCH
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 197
Ähnliche
Frauen, die verschwinden, eine fiktive Bossa-Nova-Platte von Charlie Parker, ein sprechender Affe und ein Mann, der sich fragt, wie er wurde, was er ist: Die Rätsel um die Menschen, Dinge, Wesen und Momente, die uns für immer prägen, beschäftigen die Ich-Erzähler der acht Geschichten in ›Erste Person Singular‹. Es sind klassische Murakami-Erzähler, die uns in eine Welt aus nostalgischen Jugenderinnerungen, vergangenen Liebschaften, philosophischen Betrachtungen, Literatur, Musik und Baseball entführen. Melancholisch, bestechend intelligent und tragikomisch im allerbesten Wortsinn sind diese Geschichten, die wie beiläufig mit der Grenze zwischen Fiktion und Realität spielen und immer wieder den Verdacht nahelegen, dass Autor und Ich-Erzähler mehr als nur ein paar Gemeinsamkeiten haben.
© Markus Tedeskino/Ag. Focus
HARUKI MURAKAMI, 1949 in Kyoto geboren, lebte längere Zeit in den USA und in Europa und ist der gefeierte und mit höchsten Literaturpreisen ausgezeichnete Autor zahlreicher Romane und Erzählungen. Sein Werk erscheint in deutscher Übersetzung bei DuMont. Zuletzt erschienen die Romane ›Die Ermordung des Commendatore‹ in zwei Bänden (2018) und in einer Neuübersetzung ›Die Chroniken des Aufziehvogels‹ (2020).
URSULA GRÄFE, geboren 1956, hat in Frankfurt am Main Japanologie und Anglistik studiert. Aus dem Japanischen übersetzte sie u.a. Yukio Mishima, Hiromi Kawakami und Sayaka Murata. Für DuMont überträgt sie die Werke Haruki Murakamis ins Deutsche. 2019 erhielt sie den japanischen ›Noma Award for the Translation of Japanese Literature‹.
HARUKI MURAKAMI
ERSTE PERSONSINGULAR
Erzählungen
Aus dem Japanischenvon Ursula Gräfe
Die japanische Originalausgabe erschien 2020 unter dem Titel ›Ichininsho tansu‹ bei Bungeishunju Ltd., Tokyo.
Copyright © 2020 Haruki Murakami
eBook 2021
© 2021 für die deutsche Ausgabe: DuMont Buchverlag, Köln
Alle Rechte vorbehalten
Übersetzung: Ursula Gräfe
Lektorat: Stephan Kleiner
Umschlaggestaltung: Lübbeke Naumann Thoben, Köln
Satz: Angelika Kudella, Köln
eBook-Konvertierung: CPI books GmbH, Leck
ISBN eBook 978-3-8321-7063-9
www.dumont-buchverlag.de
AUF EINEM KISSEN AUS STEIN
Ich möchte hier von einer jungen Frau erzählen. Auch wenn ich zugeben muss, dass ich so gut wie nichts über sie weiß. Nicht einmal an ihren Namen und ihr Gesicht kann ich mich erinnern. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass auch sie sich weder an meinen Namen noch an mein Gesicht erinnert.
Als ich sie kennenlernte, war ich im zweiten Studienjahr und noch keine zwanzig Jahre alt. Sie war schätzungsweise Mitte zwanzig. Wir jobbten zu denselben Zeiten im selben Restaurant. Irgendwann verbrachten wir einmal eine Nacht miteinander. Danach habe ich sie niemals wiedergesehen.
Mit neunzehn waren mir die Regungen meines Herzens nahezu unbekannt, ganz zu schweigen von jenen anderer Menschen. Dennoch bildete ich mir ein, einigermaßen über die Beschaffenheit von Freude und Traurigkeit Bescheid zu wissen, auch wenn ich ihre vielen Nuancen und ihre Wechselbeziehung nie ganz durchschaute, weshalb ich mich häufig unbehaglich und hilflos fühlte.
Dennoch möchte ich von meiner Begegnung mit dieser jungen Frau erzählen.
Und eines weiß ich doch über sie – sie schrieb Gedichte und hatte eine Anthologie herausgegeben. »Anthologie« ist vielleicht ein wenig hoch gegriffen, handelte es sich doch nur um ein sogar für eine Veröffentlichung im Selbstverlag sehr einfach gebundenes Heft. Dennoch hinterließen einige der Gedichte darin einen ungewöhnlich tiefen Eindruck bei mir. Die meisten handelten von der Liebe oder vom Tod. Es war geradezu, als wollte sie demonstrieren, dass Gegensätze wie diese untrennbar verbunden waren.
Du und ich
wir sind einander fern,
ist es nicht so?
Hätte ich auf dem Jupiter
umsteigen sollen?
Lege ich mein Ohr
auf ein Kissen aus Stein,
verstummt er,
der rauschende Strom
meines Blutes
»Ich muss dich mal was fragen«, sagte sie, als wir nackt unter dem Futon lagen. »Wahrscheinlich rufe ich beim Orgasmus den Namen eines anderen Mannes. Macht dir das was aus?«
»Eigentlich nicht«, erwiderte ich, auch wenn ich mir nicht ganz sicher war. Andererseits – warum sollte mich so etwas stören? Im Grunde war es ja nur ein Name. Und Namen machten für gewöhnlich keinen großen Unterschied.
»Und wenn ich ihn so richtig laut herausschreie?«
»Das wäre allerdings unangenehm«, sagte ich hastig, denn ich wohnte in einem morschen alten Holzhaus mit Wänden so dünn wie Waffeln. Wenn sie hier mitten in der Nacht schrie, wüssten sämtliche Nachbarn Bescheid.
»Gut, dann beiße ich in ein Handtuch«, sagte sie.
Also holte ich ein sauberes und möglichst festes Handtuch aus dem Badezimmer, um es neben mein Kissen zu legen.
»Geht das?«, fragte ich.
Sie kaute ein wenig auf dem Handtuch herum wie ein Pferd auf einer neuen Trense. Dann nickte sie.
Unsere Verbindung war eine gänzlich zufällige. Ich war nicht sonderlich scharf auf sie und sie sicher auch nicht auf mich. Wir jobbten in jenem Winter etwa zwei Wochen lang in einem beliebten italienischen Restaurant unweit des Bahnhofs Yotsuya. Allerdings arbeiteten wir in verschiedenen Bereichen, sodass sich nie eine Gelegenheit zu einem richtigen Gespräch ergab. Ich war Tellerwäscher und Küchenhilfe und sie Kellnerin. Alle Aushilfen außer ihr waren Studenten, und wahrscheinlich unterschied sich ihr Verhalten deshalb ein wenig von dem der anderen. Mitte Dezember kündigte sie, und jemand schlug vor, noch einmal in eine Kneipe um die Ecke zu gehen. Auch mich lud man dazu ein. Es war eigentlich keine richtige Abschiedsfeier. Wir tranken nur etwa eine Stunde lang Bier vom Fass, aßen ein paar Snacks und unterhielten uns. Ich erfuhr, dass sie vor dem italienischen Restaurant bei einem kleinen Immobilienmakler und in einem Buchladen gearbeitet hatte. Sie sei an keiner ihrer Arbeitsstellen mit ihren Vorgesetzten ausgekommen, erzählte sie. In dem italienischen Restaurant sei sie zwar mit niemandem aneinandergeraten, doch sie komme mit der geringen Bezahlung nicht über die Runden, sodass sie sich einen neuen Job suchen müsse, auch wenn sie keine Lust dazu habe.
Jemand fragte, was sie machen wolle.
»Egal«, sagte sie und rieb sich mit dem Finger an der Seite ihrer Nase (wo sie zwei kleine Muttermale hatte, die wie ein Sternbild anmuteten). »Ich kriege eh nichts Tolles.«
Ich wohnte damals in Asagaya und sie in Koganei. Also stiegen wir gemeinsam am Bahnhof Yotsuya in die Chuo-Schnellbahn und setzten uns nebeneinander auf eine Sitzbank. Es war bereits elf Uhr abends, und es blies ein winterlich kalter Wind. Es war die Jahreszeit, in der man Handschuhe und Schal tragen musste. Als sich die Bahn Asagaya näherte und ich aufstand, blickte sie zu mir auf. »Meinst du, ich könnte heute vielleicht bei dir übernachten?«, fragte sie leise.
»Klar, aber wieso?«
»Weil es nach Koganei noch so weit ist«, sagte sie.
»Aber meine Wohnung ist total klein und auch nicht aufgeräumt«, entgegnete ich.
»Macht nichts.« Sie griff nach dem Ärmel meines Mantels. Also nahm ich sie mit in meine winzige, schäbige Wohnung, wo wir uns eine Dose Bier teilten. Nachdem wir sie sehr langsam geleert hatten, zog sie sich wie selbstverständlich vor meiner Nase aus und schlüpfte nackt in meinen Futon, worauf ich ebenfalls unter die Decke kroch. Ich hatte das Licht ausgeschaltet, aber die Flammen des Gasofens erhellten den Raum. Ungelenk schmiegten wir uns unter der Bettdecke aneinander, um uns zu wärmen. Eine Zeit lang sprachen wir nicht. Wahrscheinlich wussten wir aus Verlegenheit über unsere plötzliche Nacktheit nicht, was wir sagen sollten. Doch ich spürte, wie unsere Körper sich allmählich erwärmten und unsere Anspannung nachließ. Es war ein erstaunliches Gefühl von Intimität.
»Vielleicht rufe ich beim Orgasmus den Namen eines anderen Mannes. Macht dir das was aus?«
»Liebst du ihn?«, fragte ich, als ich ihr das Handtuch gab.
»Ja, sehr«, sagte sie. »Ich liebe ihn sehr. Er geht mir nicht aus dem Kopf. Aber er liebt mich nicht. Eigentlich hat er eine Freundin.«
»Aber du triffst dich trotzdem mit ihm?«
»Er ruft mich an, wenn er mit mir schlafen will«, sagte sie. »Wie wenn man was zu essen bestellt.«
Ich wusste nicht, was ich dazu sagen sollte, also schwieg ich. Sie zeichnete schon eine ganze Zeit lang mit der Fingerspitze irgendwelche Muster auf meinen Rücken, vielleicht schrieb sie auch etwas.
»Er hat gesagt, ich hätte ein hässliches Gesicht, aber einen tollen Körper.«
Ich fand sie nicht gerade hässlich, aber als hübsch hätte ich sie auch nicht bezeichnet. Mittlerweile kann ich mich weder an ihr Gesicht noch an ihre Figur erinnern. Es ist mir unmöglich, ihr Aussehen zu beschreiben.
»Aber wenn er anruft, gehst du zu ihm?«
»Ich kann nicht anders, ich liebe ihn«, sagte sie, als wäre es das Selbstverständlichste auf der Welt. »Egal, was die Leute sagen, aber ab und zu will ich wenigstens mit einem Mann schlafen.«
Ich überlegte eine Weile. Damals hatte ich keine Vorstellung, was eine Frau konkret meinte, wenn sie sagte, sie wolle manchmal einfach nur mit einem Mann schlafen. (Und wenn ich genau darüber nachdenke, weiß ich es bis heute nicht.)
»Sich zu verlieben, ist wie eine Geisteskrankheit, für die die Krankenkasse nicht zahlt«, sagte sie mit tonloser Stimme, so als würde sie den Satz von der Wand ablesen.
»Aha«, sagte ich erstaunt.
»Also, von mir aus kannst du dir ruhig auch jemand anderes vorstellen«, sagte sie. »Bist du in jemanden verliebt?«
»Ja, schon.«
»Dann könntest du doch ihren Namen rufen, wenn du kommst. Macht mir nichts aus.«
Ich war damals wirklich in eine Frau verliebt, konnte aber die Beziehung umständehalber nicht vertiefen. Also überlegte ich, ob ich vielleicht ihren Namen rufen sollte, was mir aber letztendlich doch zu albern vorkam, sodass ich nur stumm in der anderen Frau ejakulierte. Und bevor sie den Namen des Mannes hinausschreien konnte, schob ich ihr hastig das Handtuch zwischen ihre gesunden und kräftigen Zähne, die jeden Zahnarzt begeistert hätten. Wie der Name des Mannes lautete, weiß ich nicht mehr, nur noch, dass er sehr verbreitet und alltäglich war. Aber ich erinnere mich noch deutlich, dass ich mich wunderte, wie viel ein solcher Allerweltsname jemandem bedeuten konnte. Mitunter berührt allein ein Name einen Menschen bis in sein tiefstes Inneres.
Am nächsten Morgen hatte ich schon früh einen Uni-Termin, bei dem ich eine für die Zwischenprüfung wichtige Arbeit abgeben musste. Natürlich ließ ich ihn sausen (was später zu allen möglichen Problemen führte, aber das ist eine andere Geschichte). Kurz vor Mittag standen wir endlich auf, machten Wasser heiß, tranken Instantkaffee und aßen Toast. Im Kühlschrank waren noch Eier, die wir uns dazu kochten. Der Himmel war klar und wolkenlos, und blendend helles Morgenlicht erfüllte den ganzen Raum.
Ihren Toast mit Butter kauend fragte sie, welches Fach ich studierte. Literatur, sagte ich.
Ob ich Schriftsteller werden wolle?
Nicht unbedingt, antwortete ich wahrheitsgemäß. Damals hatte ich tatsächlich nicht die Absicht. Es war mir nicht einmal in den Sinn gekommen, obwohl in meinem Fachbereich massenhaft Leute verkündeten, Romane schreiben zu wollen. Nach meiner Antwort schien sie jegliches Interesse an mir verloren zu haben (wobei dieses vermutlich von vorneherein nicht besonders groß gewesen war).
Im hellen Licht des Tages mutete mich das Handtuch, auf dem sich die Abdrücke ihrer Zähne deutlich abzeichneten, reichlich bizarr an. Sie musste richtig fest zugebissen haben. Auch sie selbst erschien mir bei Tageslicht ganz anders. Kaum zu glauben, dass die zierliche, knochige Frau vor mir dieselbe sein sollte, die im durch das Fenster einfallenden winterlichen Mondlicht lustvoll in meinen Armen gestöhnt hatte.
»Ich schreibe Tanka«, sagte sie unvermittelt.
»Tanka?«
»Du weißt doch, was Tanka sind?«
»Klar.« Natürlich wusste ich das, auch wenn diese Art von Kurzgedichten eine mir fremde Welt war. »Aber ehrlich gesagt, lerne ich zum ersten Mal jemanden kennen, der Tanka schreibt.«
Sie lachte amüsiert. »Aber du weißt, dass es solche Leute gibt?«
»Gehörst du einem von diesen Clubs an?«
»Nein, das nicht.« Sie zuckte mit den Schultern. »Tanka kann man doch auch für sich allein schreiben, oder? Ist ja nicht wie Basketball oder so was.«
»Welche Art von Tanka schreibst du denn?«
»Willst du eins hören?«
Ich nickte.
»Wirklich? Oder bist du nur höflich?«
»Wirklich«, sagte ich.
Das war nicht gelogen. Mich interessierte ernsthaft, welche Art von Gedichten die Frau verfasste, die noch vor wenigen Stunden in meinen Armen gestöhnt und, wenn auch durch das Handtuch erstickt, laut den Namen eines anderen Mannes gerufen hatte.
Sie zögerte. »Es ist mir peinlich, so früh am Morgen ein Tanka von mir zu rezitieren. Falls du meine Gedichte wirklich lesen möchtest, schicke ich sie dir zu. Du musst mir bloß deine Adresse geben.«
Ich kritzelte meinen Namen und meine Adresse auf einen Zettel. Nach einem kurzen Blick darauf faltete sie ihn viermal und steckte ihn in die Tasche ihres blassgrünen, ziemlich abgetragenen Mantels, an dessen rundem Kragen eine silberne Brosche in Form einer Maiglöckchenrispe steckte. Sie glitzerte in der Sonne, die durch das Fenster schien. Ich kenne mich mit Blumen nicht aus, aber aus irgendeinem Grund sind Maiglöckchen schon immer meine Lieblingsblumen gewesen.
»Danke, dass ich bei dir übernachten durfte. Ich hatte überhaupt keine Lust, so spät noch allein mit dem Zug nach Koganei zu fahren«, sagte sie, als sie ging. »Bei Frauen ist das manchmal so.«
Wir wussten beide, dass wir uns nicht wiedersehen würden. Sie hatte am vergangenen Abend nur nicht allein mit der Bahn nach Koganei fahren wollen – das war der einzige Grund für unsere gemeinsame Nacht gewesen.
Eine Woche später erhielt ich mit der Post ihre »Gedichtsammlung«. Ehrlich gesagt, hatte ich kaum damit gerechnet, dass sie sie mir wirklich schicken würde. Ich dachte, sie hätte mich vergessen (oder so schnell wie möglich vergessen wollen), sobald sie in ihrer Wohnung in Koganei angekommen war. Doch sie hatte das Buch eigens in einen Umschlag gesteckt und ihn, nachdem sie ihn adressiert und frankiert hatte, in einen Briefkasten geworfen oder sich vielleicht sogar die Mühe gemacht, ihn zur Post zu bringen. So war ich nicht wenig überrascht, als ich eines Morgens den Umschlag im Briefkasten fand.
Der Titel des Büchleins lautete Auf einem Kissen aus Stein. Als Name der Autorin war einfach »Chiho« vermerkt. So hieß sie also. Es war nicht erkennbar, ob Chiho ihr richtiger Name oder ein Pseudonym war. Eigentlich hätte ich ihren Namen bei der Arbeit gehört haben müssen, konnte mich aber nicht daran erinnern. Dennoch war ich mir fast sicher, dass niemand sie dort Chiho genannt hatte. Auf dem neutralen braunen Umschlag stand kein Absender, er enthielt auch keine Karte und keinen Brief, nur die schmale, mit einer Art weißem Seidenfaden geheftete Gedichtsammlung. Sie bestand auch nicht aus billigen Abzügen, sondern war professionell auf dickes, hochwertiges Papier gedruckt. Offenbar hatte die Autorin die fertigen Seiten aufeinandergestapelt, den Pappeinband darumgelegt und die Seiten sorgfältig mit Nadel und Faden zu diesem Büchlein zusammengeheftet, um den Buchbinder zu sparen. Ich versuchte mir vorzustellen, wie sie schweigend und allein die Nadel führte, aber es wollte mir nicht recht gelingen. Die erste Seite trug einen Stempel mit der Zahl 28. Offenbar hielt ich das 28.Exemplar einer limitierten Auflage in der Hand. Wie viele mochten es insgesamt sein? Nirgendwo stand ein Preis. Vermutlich hatte es von Anfang an keinen gegeben.
Statt das kleine Buch sofort aufzuschlagen, ließ ich es eine Zeit lang auf meinem Schreibtisch liegen und warf gelegentlich einen Blick auf den Einband. Es war nicht so, dass es mir an Interesse mangelte, doch war ich der Ansicht, es erfordere ein gewisses Maß an geistiger Vorbereitung, eine Gedichtsammlung von einem anderen Menschen zu lesen, vor allem da es sich um eine Person handelte, mit der ich eine Woche zuvor intimen körperlichen Kontakt gehabt hatte. Schon aus Respekt. Am Wochenende nahm ich das kleine Buch schließlich zur Hand. Ich schlug es auf und las es, an die Wand am Fenster gelehnt, im dämmrigen Licht des Winternachmittags. Die Sammlung enthielt zweiundvierzig Gedichte, eines auf jeder Seite. Es gab weder ein Vor- noch ein Nachwort oder ein Erscheinungsjahr, nur die in großer schwarzer Schrift auf weißes Papier gedruckten Tanka.
Natürlich erwartete ich keine literarische Meisterleistung. Wie gesagt, empfand ich lediglich ein gewisses persönliches Interesse. Ich fragte mich, welche Art von Tanka eine Frau schrieb, die mir, durch ein Handtuch gedämpft, den Namen eines anderen Mannes ins Ohr schrie. Beim Lesen stellte ich jedoch fest, dass einige der Gedichte mich ergriffen.
Ich hatte keine Ahnung von Tanka (woran sich seither auch nichts geändert hat), weshalb ich kein objektives Urteil darüber abgeben konnte, welche etwas wert waren und welche nicht. Doch abgesehen von fachlichen Kriterien gefielen mir einige der Gedichte besser als andere, konkret waren es acht. Sie besaßen irgendein Element, das mich im Innersten berührte.
Zum Beispiel dieses:
Wenn jetzt
das Jetzt ist
und ich
diesem Jetzt
nicht entrinnen kann,
bleibt nur das Jetzt
Im Bergwind
enthauptet
stumm sammelt sich
am Fuß der Hortensie
das Juni-Wasser
Es war sonderbar, aber als ich in dem Büchlein blätterte und mir die in großen schwarzen Zeichen gedruckten Gedichte laut vorlas, erschien vor meinem inneren Auge ihr Körper, wie ich ihn in jener Nacht gesehen hatte. Nicht ihre wenig ansehnliche Gestalt im grellen Licht des nächsten Morgens, sondern ihr im Mondlicht schimmernder Körper, den ich in meinen Armen gehalten hatte. Ihre wohlgeformten runden Brüste, die festen kleinen Brustwarzen, ihr spärliches schwarzes Schamhaar und ihr sehr feuchtes Geschlechtsteil. Ich erinnerte mich, wie sie während des Orgasmus mit geschlossenen Augen fest in das Handtuch gebissen und immer wieder sehnsüchtig den Namen dieses anderen Mannes gerufen hatte. Einen ganz gewöhnlichen Namen, der mir ganz und gar entfallen war.
Bei dem Gedanken,
dich nie wiederzusehen,
denke ich,
ich kann nicht anders,
als dich wiederzusehen
Werden wir uns wiedersehen
oder ist es, wie es ist,
zu Ende
vom Licht hinweggefegt,
von Schatten zertreten?
Wie gesagt, erinnere ich mich nicht einmal an den Namen der Frau und kaum an ihr Gesicht. Alles, woran ich mich erinnere, sind der Name »Chiho« auf dem Einband der Gedichtsammlung, ihr weicher, schutzloser Körper im Schein des weißen winterlichen Mondes, der durch das Fenster fiel, und die beiden sternbildartigen Muttermale an ihrer Nase. Mitunter frage ich mich sogar, ob sie noch lebt. Ich kann mich des Gedankens nicht erwehren, dass sie sich irgendwann das Leben genommen haben könnte. Denn viele ihrer Gedichte oder zumindest die in dem bewussten Band kreisten um das Motiv des Todes. Und aus irgendeinem Grund das der Enthauptung. Vielleicht sah sie darin ein Symbol für den Tod.
Im Laufe des Nachmittags
fällt im strömenden Regen
eine namenlose Axt
und enthauptet
die Dämmerung
Doch hoffe ich aus tiefstem Herzen, dass sie irgendwo auf dieser Welt noch am Leben ist. Dass sie lebt und weiter Gedichte schreibt. Warum? Warum mache ich mir die Mühe, über solche Dinge nachzudenken? Obwohl nichts auf dieser Welt mein Dasein mit dem ihren verbindet. Wir könnten auf der Straße aneinander vorbeigehen oder in einer Cafeteria nebeneinander an einem Tisch sitzen und würden uns (wahrscheinlich) nicht einmal erkennen. Wir waren einander kurz begegnet wie zwei Geraden, die sich an einem gewissen Punkt schneiden, um sogleich wieder auseinanderzustreben.
Viele Jahre sind seither vergangen. Es scheint seltsam (oder vielleicht auch nicht), doch im Nu sind wir Menschen alt. Jeder Augenblick bringt unseren Körper unwiderruflich seinem Verfall näher. Kaum dass man die Augen schließt und sie wieder öffnet, stellt man fest, wie viel mit diesem einen Wimpernschlag verschwunden ist, alles – ob es nun einen Namen hatte oder nicht – davongeweht von einem nächtlichen Sturm, ohne die geringste Spur zu hinterlassen. Alles, was bleibt, ist eine schwache Erinnerung. Und Erinnerungen sind nicht sonderlich zuverlässig. Wer vermag mit Sicherheit zu sagen, was in der Vergangenheit wirklich passiert ist?
Doch wenn wir Glück haben, bleiben zumindest ein paar Worte erhalten. In der Tiefe der Nacht steigen sie auf einen Hügel, kriechen in passend für sie ausgehobene kleine Löcher, bleiben dort ganz still und lassen die wilden Winde der Zeit vorüberziehen. Und wenn bei Tagesanbruch der Sturm endlich abflaut, wagen sich die überlebenden Worte aus der Erde hervor. Meist sind sie leise und schüchtern und vermögen sich nur mehrdeutig auszudrücken. Dennoch sind sie bereit, Zeugnis abzulegen. Als ehrliche und unvoreingenommene Zeugen aufzutreten. Doch solche standhaften Worte zu schaffen oder zu finden und zu hinterlassen, erfordert bedingungslose Hingabe mit Leib und Seele. Jemand muss im winterlichen Mondschein sein Haupt auf ein Kissen aus kaltem Stein betten.
Vielleicht gibt es außer mir keinen anderen Menschen auf der Welt, der sich an die Gedichte der jungen Frau erinnert, geschweige denn einige davon auswendig kennt. Vielleicht ist das schmale fadengebundene Büchlein mit Ausnahme der Nummer 28 mittlerweile vergessen, verlorengegangen oder wurde in die Schwärze zwischen Jupiter und Saturn gesogen. Möglicherweise hat die junge Frau (falls sie noch lebt) die Gedichte aus ihrer Jugend selbst längst vergessen. Vielleicht sind sie noch so hartnäckig in meinem Gedächtnis verankert, weil die Erinnerung mit den Abdrücken ihrer Zähne auf dem Handtuch verbunden ist, in das sie in jener Nacht gebissen hatte. Ich weiß nicht, welchen Sinn oder Wert es hat, sich so etwas zu behalten und das verblichene Heft mit den Gedichten hin und wieder aus der Schublade zu holen, um erneut darin zu lesen. Ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung.
Doch immerhin sind die Gedichte geblieben. Während andere Worte und Gedanken zu Staub geworden und verschwunden sind.
Enthaupten oder
enthauptet werden,
lege deinen Nacken
auf ein Kissen aus Stein,
und hallo!, du wirst zu Staub
CRÈME DE LA CRÈME
Einmal erzählte ich einem jüngeren Freund eine sonderbare Geschichte, die ich mit achtzehn erlebt hatte. Warum ich davon anfing, ist mir entfallen. Es hatte sich einfach so ergeben. Jedenfalls handelte es sich, wie man sich leicht ausrechnen kann, um ein lange zurückliegendes Ereignis, um eine uralte Geschichte, die noch dazu keine Quintessenz hatte.
»Ich war damals mit der Schule fertig, studierte aber noch nicht. Also war ich ein Ronin, einer, der die Aufnahmeprüfung für die Uni nicht bestanden hat und bis zur nächsten warten muss«, begann ich. »Ich hing in der Luft, was mir aber nicht viel ausmachte. Schließlich konnte ich noch immer auf eine halbwegs anständige Privatuni gehen, wenn ich Lust hatte. Meine Eltern hatten gewollt, dass ich an einer staatlichen Uni studierte, also nahm ich an den Prüfungen teil, obwohl mir klar war, dass ich nicht bestehen würde, wie es dann auch geschah. Die staatlichen Aufnahmeprüfungen hatten damals einen obligatorischen Mathe-Teil, doch leider fehlte mir jegliches Interesse an Analysis. Also vertrödelte ich ein Jahr. Statt Tutorien zu besuchen, um mich auf die Wiederholung der Prüfung vorzubereiten, hing ich in der Stadtbücherei herum und las Romane. Meine Eltern nahmen wohl an, ich würde dort lernen. Aber was sollte ich machen? Mir das Gesamtwerk von Balzac reinzuziehen, machte mir eben mehr Spaß, als mich mit der blöden Analysis abzuquälen.«
Anfang Oktober jenes Jahres erhielt ich eine Einladung zu einem Klavierkonzert von einem Mädchen, das ein Jahr jünger war als ich. Wir hatten bei derselben Lehrerin Klavierunterricht gehabt. Einmal spielten wir vierhändig ein Stück von Mozart. Doch mit sechzehn hatte ich den Unterricht aufgegeben und sie fortan nie wieder gesehen. Keine Ahnung, warum sie mich plötzlich einlud. Konnte es sein, dass sie sich für mich interessierte? Auf keinen Fall. Sie war bildhübsch, wenn vielleicht auch nicht ganz mein Typ, kleidete sich modisch und war auf einer teuren Privatschule für Mädchen gewesen. Und keineswegs an gewöhnlichen, uncoolen Jungs wie mir interessiert.
Immer wenn ich bei unserem Duett einen Fehler machte, hatte sie mich strafend angesehen. Sie spielte viel besser als ich, außerdem war ich sehr aufgeregt, weshalb ich häufig danebengriff, obwohl ich den leichteren Part hatte. Hin und wieder stieß ich mit meinem Ellbogen gegen ihren, worauf sie mir jedes Mal diesen »Echt jetzt!«-Blick zuwarf. Mitunter schnalzte sie auch leise, aber hörbar missbilligend mit der Zunge. Ich habe es jetzt noch im Ohr. Möglicherweise war es sogar dieses Zungenschnalzen, das mich dazu bewog, mit dem Klavierspielen aufzuhören.