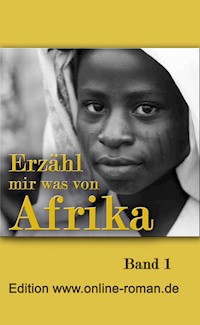
Erzähl mir was von Afrika E-Book
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Henss, Ronald
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2012
14 Kurzgeschichten zeigen die Faszination des „Schwarzen Kontinents“ aus unterschiedlichen Perspektiven. Geographisch umspannen sie den Kontinent von Nord nach Süd und von West nach Ost, von Ägypten bis Südafrika, von Guinea bis Kenia. Auf der Zeitachse reichen die Geschichten von den Anfängen der Menschheit bis in die Zukunft. Sie erinnern an dunkle Kapitel der Vergangenheit und sie beleuchten das afrikanische Alltagsleben und Probleme der Gegenwart.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 178
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Erzähl mir was von Afrika
Herausgegeben von Ronald Henss
Dr. Ronald Henss Verlag
Dr. Ronald Henss Verlag Sudstraße 2 66125 Saarbrücken www.ronald-henss-verlag.de [email protected]
© Alle Rechte bei den Autoren
Umschlaggestaltung: Ronald Henss unter Verwendung eines Fotos von Norbert Gaisbauer ©
eBook im epub-Format
ISBN 978-3-939937-66-1
Weitere Ausgaben
Inhalt
Carmen Caputo: Nagobi und ihre Träume
Didier: Babas balle
AnneGrießer: Die Geschichte vom unglaublich fruchtbaren Opa Yongai
Birge Laudi: Das Buschmannohr
Hassan Aftabruyan: Als uns Kalal vom Staub erzählte
Regina Besting: Der Mann auf dem Dach
Christiane Stüber: Sinnverkehr(t)
Margit Breuss: Nachbarn
V. Groß: Die Geister Afrikas
Susanne Weinhart: Malesch, Mädchen
Mila Carnel: Fräulein Afrika
Keno tom Brooks: Briewe uit Namibia, #12 Bruder Johannes
Anja Labussek: Ein letztes Mal – In Memoriam Karen (Tania) Blixen
Raiko Milanovic: Der Blick nach Süden
Über die Autoren
Carmen Caputo
Nagobi und ihre Träume
Unbarmherzig brannten Sonnenstrahlen auf die staubbedeckte Erde Namibias und ließen die Luft vor Hitze flimmern. Seit Monaten hatte es nicht mehr geregnet. Die Trockenheit hatte die Hirsefelder zerstört, auch Jams und Maniok, und erschwerte das ohnehin mühselige Leben noch mehr.
Nagobi saß im Schatten der Holzhütte und sah den klaren Himmelszügen nach. Nein, Regen würde es auch die nächsten Wochen nicht geben, hatte Großvater gesagt, nicht mit diesem Himmel, nicht mit diesem Blau.
Nagobi dachte nicht weiter darüber nach. Sie hatte andere Gedanken in ihrem kleinen, dunklen Mädchenkopf.
In ihrem Schoß lag ein kleiner angeschmuddelter Schreibblock, der einzige Reichtum, den sie besaß. Sie schrieb gerne, die Handschrift zog flüssig über die durchgezogenen Linien, worauf sie sehr stolz war. Der Bleistift war alt und abgenutzt, nur kurze Zeit würde sie damit noch schreiben können. Geld, um einen neuen Stift kaufen zu können, besaß sie nicht.
„Er muss einfach noch ausreichen“, dachte sie energisch, „ich muss es schaffen, ich muss einfach.“ Dabei fegte sie etwas Staub von ihrem bunten Kleid, das Großmutter für sie genäht hatte, und begann zu schreiben.
Schon sehr früh – Nagobi hatte gerade Laufen gelernt – waren ihre Fantasie, ihr Ideenreichtum und ihre Neugier auf das Leben außerhalb des Dorfes ungewöhnlich gewesen. Nagobi fragte und fragte. Sie fragte, bis sie von den anderen Kindern belacht wurde und die Erwachsenen nur den Kopf schüttelten.
Die Männer ablehnend, denn Mädchen hatten nichts zu fragen, nicht in diesem Teil der Welt. Auch wenn Missionare und Hilfsorganisationen Schulen gebaut hatten und jeden Tag singende Kinder um sich scharten, tolerierten es die meisten Männer nur.
Die Frauen hingegen sahen Nagobi mitleidvoll an, denn sie ahnten, was für ein Leben ihr bevorstand und sie wussten, für ein Mädchen würde es besser sein, sich dem Dorf und den Traditionen anzupassen, je früher, desto besser.
Das war Großmutter Ragionis Rat: „Du musst lernen zu nicken, hörst du, Nagobi? Einfach nicken und du wirst ein gutes Leben haben.“
Nagobi nickte nicht und weder störten sie die bösen Blicke der Männer noch das Gelächter der Kinder. Je älter sie wurde, umso mehr begann sie die Welt zu hinterfragen.
Eines Nachts hatte sie wach gelegen und beschlossen, einen Traum aufzuschreiben, die Seiten in eine Glasflasche zu stecken und in den Fluss zu werfen. Sie hatte an der großen Wandkarte von Mutter Rutha entdeckt, dass der kleine Fluss, der sich am Dorf entlangzieht, in den Auob mündet, der wiederum in den Malopo und der in den großen, in den Oranje, der direkt ins weite Meer hineinfließt.
„Irgendjemand wird sie finden und die Welt verändern“, dachte sie, drehte sich um und schlief zufrieden ein.
„Was sitzt du denn hier herum, Nagobi, es gibt genügend Arbeit für dich!“ Verbittert starrte Martita zuerst auf das Mädchen, dann auf den Block in seinem Schoß. „Schreiben ist etwas für Reiche, merk dir das doch endlich.“
Sie selbst hatte nie Schreiben oder Lesen gelernt. In ihrer Kindheit hatte auf dem Dorfplatz noch keine Schule gestanden, sie hatte nie etwas anderes gelernt als sich um Haus und Familie zu kümmern. So war das Leben, so war Martita geboren, so in Tradition erzogen; und sie hatte früh gelernt es hinzunehmen.
„Woher du nur diesen Unsinn im Kopf hast“, schimpfte sie weiter.
Dieses Kind brachte ihr nur Ärger ein. Sogar die Dorfältesten hatten sich Gedanken über Nagobi gemacht und Martita darauf angesprochen.
„Martita“, hatten sie gesagt, „Schreiben und Lesen akzeptieren wir inzwischen, aber die Fragerei deiner Tochter ist bedenklich.“
Es hatte Mutter Rutha, einer deutschen Ordensschwester, einige Monate Überzeugungsarbeit gekostet, bis die Dorfältesten zögernd den Mädchen den Besuch der kostenlosen Schule erlaubt hatten. Aber damit war ihre Einsicht auch am Ende. Eine Frau blieb schließlich eine Frau, ob mit oder ohne Bildung, darüber waren sie sich einig.
„Du bist die Mutter, du musst ihr die Träume ausreden. Du musst sie auf das Leben als Frau vorbereiten.“
Martita nickte wie sie immer nickte, wie sie es gelernt hatte zu nicken. Von Großmutter.
„Sie haben ja Recht“, dachte Martita, „Aber soll es ihr wirklich so ergehen wie jeder hier im Dorf? Die Zeiten haben sich verändert, vielleicht verändern sich auch die Köpfe der Menschen.“
Martita liebte ihre Tochter, vielleicht auch ein Stück ihrer Träume, vielleicht auch die Hoffnung, dass diese neue Generation Frauen, die mit Nagobi heranwuchs, stark sein würde, stärker als sie es je gewesen war. Sie war zu alt um es zu ändern, ihr Leben zu hart, als dass sie ihre Energie in Träume und Ziele hätte verschwenden können.
„Ach, Mama, lass mich doch, bitte!“ Nagobi verlegte sich aufs Betteln. „Du weißt doch, ich muss schreiben. Wenn nicht heute, dann schreibe ich morgen oder übermorgen, Mama, bitte ... Morgen helfe ich dir auch wieder beim Brotbacken. Bitte ...“
„Träume! Du hast nichts als Unsinn im Kopf, schon als kleines Kind. Als ob du die Welt damit verändern könntest! Komm schon, wir haben nicht den ganzen Tag Zeit. Vater wird schimpfen, wenn du die Steine nicht wäschst.“
Verständnisvoll aber unnachgiebig sah Martita in Nagobis Augen, strich ihr über das Haar und lächelte. „Meine kleine Nagobi, wenn du wüsstest, wie sehr ich mir ein besseres Leben für dich wünsche.“ Martita seufzte auf.
Nagobi bemerkte die Traurigkeit in ihren Augen. „Stell dir nur vor, Mama, wie die Menschen am anderen Ende der Welt meine Worte lesen werden. Kannst du dir ihre Gesichter vorstellen? Vielleicht geht es anderen Frauen anders. Mutter Rutha erzählt uns manchmal von den Frauen in Europa, sie leben anders als wir.“
In Nagobis Stimme lag eine Art Trotz, den zu zeigen sie nur ihrer Mutter gegenüber wagte.
„Nein!“ Martitas Stimme wurde hart. „Aber ich kann mir das Gesicht von deinem Vater vorstellen, wenn er heimkommt und sieht, dass du herumsitzt.“
Ohne ein weiteres Wort zu verschwenden, drehte sich Martita um und ging ins Haus zurück.
„Ich beeile mich, Mama, ganz bestimmt“, rief Nagobi hinter ihr her.
Sie senkte die Schultern und begann zu schreiben, Seite um Seite, unzählige Seiten, die Bücher füllen würden, wenn sie nur mehr Hefte und einen neuen Bleistift gehabt hätte ...
Jeder Mensch könnte schreiben und lesen; niemand würde auf die Ungebildeten herabsehen; jede Frau würde den Männern ebenbürtig sein, kein Mensch wäre besser als der nächste; für jeden gäbe es genügend zu essen, zu trinken; die Welt würde krieglos werden; lachende Kinder überall auf der Erde, lachende Frauen; und ... und ... Nagobi schrieb und schrieb, bis auch der letzte Rest Blei verschrieben war.
Langsam ertrank die Sonne gelbrot im Nebenfluss des Auob.
Sie lief ans Ufer hinunter und während das warme Wasser ihre nackten Füße umspülte, nahm sie die kleinen Zettel, rollte sie ineinander und steckte sie in die längliche Glasflasche, die sie seit Tagen bei sich getragen hatte.
Dann warf sie sie ins mückenbedeckte Wasser und sah ihr nach, wie sie langsam mit den kaum fühlbaren Windzügen fortglitt.
Nagobi dachte an Mutter und an die Steine, die sie immer noch nicht gewaschen hatte. Sie beeilte sich nach Hause zu kommen und spürte, wie sich ein warmes Gefühl in ihrem Herzen ausbreitete.
Längst hatte Martita begonnen, sich Sorgen zu machen. Sie stand vor der ärmlichen Hütte und wartete. „Nagobi, wo bist du nur so lange gewesen?“ Sie nahm sie erleichtert in die Arme.
Nagobi senkte schuldbewusst den Kopf und schwieg, ganz entgegen ihrer sonstigen Art, den Mund nicht stillstehen zu lassen.
„Vater ist noch nicht da, geh und wasche die Steine.“
Didier
Babas balle
Man kann beim besten Willen nicht behaupten, dass er ein besonders sympathischer Junge war, der kleine Baba. Dafür war er viel zu sehr von sich selbst überzeugt und das, was man eine große Klappe nennt, gesellte sich, wie meistens in solchen Fällen, noch dazu. Er war nicht der typische Loser und das wusste er. Und ich auch. Wenn ich mir meine Volleyballmannschaft zusammenstellte, sicherte ich mir gern Babas Künste. Zugegeben, er spielte zu eigensinnig, drosch den Ball immer gleich rüber anstatt „passe“ zu spielen, wie das Zuspiel auf Französisch heißt. Aber im Gegensatz zu den anderen Kleinen, die unbedingt immer mitspielen wollten, bekam er den Ball wenigstens über das Netz. Seine Selbstsicherheit half ihm dabei. „La balle m’aime et moi, j’aime la balle!”, erklärte mir Baba mit stolz geblähter Brust einmal nach einem wunderbar herausgespielten Punkt. Ich sehe ihn noch heute vor mir: seinen meist unbekleideten, drahtigen Oberkörper, seine kurzen, schwarzen Locken, sein breites, weißes Grinsen, seine schmuddelige kurze, rote Sporthose. Schwer zu sagen, wie alt Baba war, vielleicht zehn. Die afrikanischen Kinder bleiben ja oft länger klein und schmächtig, weil die Reisgerichte manchen Wunsch des wachsenden Kinderkörpers unerfüllt lassen. Aber zum Volleyballspielen reichte es allemal.
Ich sehe auch die anderen noch alle vor mir, diesen „Kindergarten“, die versammelte Jugend von acht bis achtzehn aus der Nachbarschaft des Centers, wie sie hinter dem Haus auf dem steinigen Acker baggerten und pritschten, auf jenem unebenen Spielfeld, das ich im September in einer schweißtreibenden Sammelaktion erst bespielbar gemacht hatte. Die dicken, roten Felsbrocken und die vielen kleineren Steine, die ich aufgesammelt hatte, liegen vielleicht heute noch als großer Haufen an der Rückseite des Hauses. Ich sehe auch noch vor mir, wie Baba, Martin oder Maldini – ihre richtigen Namen habe ich nie gekannt – den Ball über die hohe, graue Mauer auf das Nachbargrundstück droschen. Und Baba wohnte da irgendwo und kannte die Leute. Er war es meist, der dafür sorgte, dass der Ball bald wieder auftauchte. „Je vais checher la balle“, rief er selbstbewusst und peste über den Basketballplatz zum Haupteingang des Peuple de l’Injil um vor Ort nach dem Ball zu forschen. Meist kam „la balle“ dann in hohem Bogen über die Mauer geflogen und das Spiel ging weiter. „La balle“ – das französische Wort ist ja mit dem deutschen „Ball“ nicht ganz bedeutungsgleich, denn „la balle“ heißt eigentlich Kugel und „ballon“ ist der Ausdruck für „Ball“, aber jeder, der schon einmal im französischsprachigen Afrika gewesen ist, wird bestätigen können, dass afrikanisches Französisch seine eigenen Gesetze hat, über die jedes Mitglied der Académie Française nur die Hände überm Kopf zusammenschlagen kann.
Volleyball war übrigens nur eines der Freizeit-Angebote, die unsere protestantische Missions-Außenstelle, die wir, dem muslimischen Gepräge von Conakry gemäß, als Peuple de l’Injil bezeichneten, für die Jugendlichen des Viertels bereithielten. Der Name ist ein französisch-arabischer Mix und bedeutet so viel wie „Volk des Evangeliums“. Die Nennung des arabischen Begriffs „Injil“ fungiert dabei als Wink mit dem Zaunpfahl und sollte in etwa folgende Botschaft übermitteln: „Schaut euch euren Koran mal genau an. Wir kommen auch drin vor!“ Die amerikanischen Missionare, mit denen ich zusammenarbeitete, und ich, die deutsche Aushilfskraft, benutzten freilich lieber den einprägsameren und viel kürzeren Ausdruck Center. Und das war es ja auch, dieses Haus mit Unterrichtsräumen, einem Lesesaal, der sonntags zum Gottesdienstraum wurde, Tischfußball, einem Garten, einer Tischtennisplatte, Basketball- und eben dem von mir eigenhändig ins Leben gerufenen Volleyballplatz: eine Anlaufstelle, ein Jugendtreff, ein Zentrum gegen Langeweile und Alltagsfrust. Dass sich mit Küche, Bad und Schlafzimmer auch meine Privatgemächer in diesem Haus befanden, war für die meisten reine Nebensache und ich als Betreuer des Centers eine zwar beliebte, aber letztlich austauschbare Figur. Das bekam ich vor allem dann zu spüren, wenn ich meiner Hauptaufgabe, Englischunterricht für Erwachsene, nachging und deswegen der Spielbetrieb in den späten Nachmittagsstunden ruhte. Da gab es manchmal wüste Klagen und Beschwerden, wie man ihnen denn den Zutritt verweigern konnte! Auch Baba, frech und vorlaut, wie er war, forderte gern sein Recht ein, die Spielanlagen benutzen zu dürfen, das er mit dem Erwerb der Peuple de l’Injil-Mitgliedskarte für den eher symbolischen Preis von umgerechnet einem Dollar uneingeschränkt und auf Lebenszeit zuerkannt bekommen zu haben meinte.
Ziemlich genau ein halbes Jahr hatte ich auf diese Weise in der unbeschreiblich schwülen Tropenhitze und unter fortgesetzten Angriffen bissiger Moskitos, gegen die das Netz, unter dem ich jede Nacht zubrachte, nicht immer hundertprozentigen Schutz bot, überlebt, als sich das ereignete, was unter dem Namen „Ereignisse vom 2. und 3. Februar“ in die jüngere Geschichte dieses bitterarmen, aber bis dahin wenigstens friedlichen Landes eingehen sollte. Es war Freitagmorgen und irgendwie war alles anders als sonst. Eine gespenstische Ruhe, die alles Leben zu lähmen schien, lag über der sonst pulsierenden Stadt. Unterbrochen wurde sie nur durch vereinzelte Knallgeräusche, die vage aus der Ferne zu mir drangen und denen ich nicht sonderlich viel Bedeutung beimaß. In dieser Stadt knallte es öfter mal. Die Ruhe rührte vor allem daher, dass die Hauptstraße zum Stadtzentrum – Hauptstraßen kann man in Conakry an einer Hand abzählen – wie leer gefegt war. Nur vereinzelt fuhren dort Autos, wo sich sonst die in Europa ausgesonderten Blechkisten gegenseitig über den Asphalt jagten. Als ich bei einem Blick über die Mauer des Center-Geländes einen Armeelaster mit lauter bis an die Zähne bewaffneten Soldaten auf der Ladefläche sah, der einsam in Richtung Zentrum sauste, war mir klar, dass etwas nicht stimmte.
Wenig später kam Abdourahamane, der gelegentlich für die Mission als Nachtwächter arbeitete, und erklärte: „On tire là-bas!“ („Da wird geschossen!“) Bald konnte ich sie auch auf meinem Grundstück hören: die Salven aus den Gewehren der guineischen Armee. Ausnahmezustand. Die Zeit schien den Atem anzuhalten, der Alltag aus den Angeln gehoben.
Per Funk wurde ich von Dan, dem Leiter der Administrativ-Abteilung der Mission, darüber informiert, dass im Zentrum Unruhen ausgebrochen seien. Dan hörte sich ziemlich verängstigt an. Er war „en ville“ gewesen um den üblichen Papierkram zu erledigen und mitten in die Tumulte geraten. Er hatte mit ansehen müssen, wie aufgebrachte Soldaten das Innenministerium stürmten, den Minister aus seinem Büro zerrten und brutal verprügelten.
Alle Missionare wurden auf Kanal 24, den alle vom Team gleichzeitig hören konnten, aufgefordert zu Hause zu bleiben. Die amerikanische Botschaft habe bereits Evakuierungsmaßnahmen ins Auge gefasst. Doch noch wolle man abwarten und vor allem dafür beten, dass Dan heil aus der Sache herauskommen möge. Denn natürlich waren Tausende auf der Flucht aus dem Stadtzentrum. Gleichzeitig hatte das Militär aber an allen wichtigen Verbindungsstraßen Sperren errichtet.
Einen Steinwurf vom Center entfernt befand sich eine Tankstelle, von der es hieß, sie gehöre dem Präsidenten. Hier tummelten sich seit dem frühen Morgen einige Soldaten und noch viel mehr Zivilisten. Durch ein Loch in der Wand, die das Grundstück umgab, konnte ich sehen, wie meine Nachbarn schwer beladen mit randvollen Eimern und Kanistern aus Richtung Tankstelle kamen.
Als ich des besseren Panoramas wegen aufs Dach des Hauses stieg, sah ich, was los war. Plünderer waren eifrig damit beschäftigt, Benzin in Kanister zu füllen. Andere brachen Teile vom Dach ab, wieder andere flohen mit Gegenständen aus dem Verkaufsraum. Soldaten schossen immer wieder in die Luft. Es sah nach einer völlig außer Kontrolle geratenen Situation aus. Bis an den Horizont säumten Schaulustige die Straße. Sie standen als endlose Menschenkette auf den Wällen, die sich am Rand der Hauptstraße durch die Ausbauarbeiten gebildet hatten. Die wenigen Zivilwagen, die gelegentlich über die völlig vereinsamte Straße fuhren, wirkten wie Zugvögel, die den Abflug nach Süden verpasst haben. Als Abdourahamane, der es sich wie üblich, nachdem er von mir mit einem Becher Wasser versorgt worden war, auf einem der Stoffstühle auf der Veranda des Centers bequem gemacht hatte, sah, dass ich vom Dach kam, schimpfte er mit mir: Das könne ich nicht machen, das sei zu gefährlich. „Wieso“, fragte ich, „es wird doch keiner auf mich schießen!“
Das vielleicht nicht, aber es gebe immer wieder Opfer durch „balles errées“, verirrte Kugeln, zum Beispiel wenn Soldaten in die Luft schössen. Ich verstand das nicht: Wie soll man von einer Kugel getötet werden können? Wenn sie senkrecht in die Luft fliegt, kann sie doch nur als harmloses Hagelkorn wieder runterkommen, nachdem ihr die Puste ausgegangen ist. Oder sprach Abdourahamane von Querschlägern, wie ich sie aus Western kannte? Wie kann es aber Querschläger geben, wenn jemand in die Luft schießt? Oder schießen afrikanische Gewehre um die Ecke? Abdourahamane konnte sich mir nicht verständlich machen. Ich stieg trotzdem vorläufig nicht mehr aufs Dach und wenn doch, dann mit einem vagen Gefühl von Furcht.
Die Meuterei hatte auch ihr Gutes. Was sonst ein fast lebensbedrohlicher Akt war – das Überqueren der Hauptstraße – war heute ein Kinderspiel. Auf der anderen Seite, wo der Ortsteil Haifa beginnt, besuchte ich Samoura, einen pensionierten Soldaten aus der Volksgruppe der Yalunke. Als ich ihn vor einem halben Jahr kennen lernte, hatte er mir täglich einmal sein Knie vorgeführt, in dem sich Wasser angesammelt hatte, das operativ entfernt werden musste. Das Knie sah tadellos aus, aber er konnte die kritischen Stellen immer genau bezeichnen und wusste seinen Gesundheitszustand mit weitschweifigen medizinischen Analysen zu kommentieren. Inzwischen hatte ich mich an sein furchtbares Französisch gewöhnt. Als Yalunke sprach er jedes französische „eu“ „ee“ aus (also „Diee“ statt „Dieu“ um nur ein Beispiel zu nennen), und anfangs hatte ich kein Wort seiner Ausführungen verstanden. Dennoch war Samoura, der ständig in ein herrliches Gekicher ausbrach, ein stets unterhaltsamer, ein „formidabler“ Gastgeber. Seine Pension, die aus Frankreich bezahlt wurde, sicherte ihm und der undurchsichtigen Dutzendschar der mit ihm lebenden Angehörigen die nötige Anzahl Reissäcke und mir bei jedem Besuch eine Flasche Fanta oder Cola. Die musste einer seiner zahlreichen Sprösslinge jedes Mal eilends im Laden um die Ecke besorgen.
Der alte Samoura kam mir, wie üblich mit nacktem Oberkörper und kurzer Hose, gleich entgegen, als ich den verdreckten Innenhof mit dem angeketteten Affen betreten wollte. Mit einer eigentlich unnötigen Geste wies ich auf das Geballer hin, von dem die Luft zunehmend schwanger war. „C’est les militaires“, erklärte er. Die wollten mehr Geld und begehrten gegen die Korruption auf, die verantwortlich dafür sei, dass einige Soldaten seit Monaten keinen Lohn empfangen hätten. Nun hole man sich den eben mit Gewalt. Dem Innenminister sei es schlecht ergangen. Er habe dafür leiden müssen, dass der Verteidigungsminister rechtzeitig das Weite gesucht habe.
Dann gehe ich, weiter in den Ortsteil Haifa eindringend, zu Sami, einem Kongolesen, der in der Firma seines Chefs eine glänzende Laufbahn vor sich hatte. Als erster Mann sollte er die Aufsicht über eine Druckerei in Guinea führen, die Tochter des Chefs war seine Verlobte. Dann verliebte er sich in ein hübsches Mädchen, das nicht seine Verlobte war, schlief in der Nacht vor der Hochzeit mit ihr und – um es kurz zu machen – die Sache flog auf. Sami hat jetzt keine Arbeit und keine Frau und natürlich auch kein Geld mehr. Aber ein Radio hat er, mit dem man sehr gut Radio France internationale hören kann; und das tun wir und hören den Bericht eines aufgeregten Reporters, der erzählt, dass der Präsident sich in einen Bunker unterhalb seines Palastes verkrochen hat. Führende Militärs haben die Unruhen offenbar für ihre Interessen genutzt. Jetzt wollen sie an die Macht, der Präsident soll gestürzt werden. Der Palast ist von Panzern umstellt und wird von Stalinorgeln und anderen schweren Geschützen beschossen. Die Präsidentengarde liefert sich mit den Aufständischen heftige Gefechte. Die Zukunft Guineas steht auf der Kippe.
Als ich mich von Sami verabschiede und das Grundstück verlasse, auf dem ein gutmütiger Freund ihn umsonst wohnen lässt, schauen wir auf die Kawasaki-Niederlassung Haifa, die genau wie die Tankstelle von Vandalen-Horden geplündert wird.
Letztere löst sich in den nächsten Stunden quasi in ihre Einzelbestandteile auf, am Ende werden nur noch Mauern und Metallgerüste stehen. Ich gehe, von Sami kommend, neugierig hinüber zu dem Bienenschwarm auf der Tankstelle und werde Zeuge, wie ein Soldat einen Mann mit seinem Gürtel peitscht, der sich unerlaubt an der Benzinspritze zu schaffen macht. Der Mann windet sich wie eine Hyäne unter den Schlägen, aber er weicht nicht. Da schießt der Soldat mehrmals in die Luft. Ein Kollege tut es ihm gleich. Das laute Geknatter ist mir nicht geheuer. Das Chaos, das hier herrscht, noch weniger. Mir wird ziemlich mulmig zumute. Ich spüre, dass die Stimmung jederzeit kippen und es zu Blutvergießen kommen kann. Die Bilder vom Völkermord in Ruanda kommen hoch. Als ich den wilden Haufen hinter mir lasse und die paar Schritte zum Center zurücklege, stoße ich auf Michel, einen Nachbarn vom Volksstamm der Toma. Michel gehört auch zum Militär. Bisher habe ich ihn nur in Zivil gesehen. Richtig Furcht einflößend kommt er mir jetzt vor: Er hat seine grüne Militäruniform angezogen und sich ein Militärfahrzeug unter den Nagel gerissen, neben dem er jetzt stolz posiert. Bewaffnet ist er natürlich auch. Anscheinend hat der Jeep kein Benzin mehr, aber das Problem lässt sich mit einem der vielen Eimer lösen, die an diesem Tag schon durch das Viertel getragen wurden. Wie immer verstehe ich nur die Hälfte von dem, was die Nachbarn mir erzählen. Aber so viel ist auch mir klar: Eigentlich sollte Michel mit dem Militärfahrzeug nicht hier und nicht jetzt stehen.





























