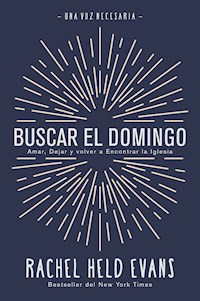Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Brendow, J
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2016
Irgendwann fällt es Rachel immer schwerer, sich in ihrer Gemeinde zu engagieren. In der Schulzeit als brennende Missionarin unterwegs, kommen ihr irgendwann Zweifel: Politisch fragwürdige Ansichten, verurteilende und ausgrenzende Haltungen gegenüber Randgruppen, religiöser Starrsinn und die Scheu, sich offensichtliche Wahrheiten einzugestehen – Kirche scheint so weit von dem entfernt, was Jesus gelebt und gepredigt hat. Also macht sich Rachel auf die Reise, um zu verstehen, was sie eigentlich noch festhält – und wo sie vielleicht doch einen Platz in der Gemeinschaft der (Schein)Heiligen finden könnte …
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 364
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Rachel Held Evans
Wie ich glaube, ohne zu verzweifeln: Kirche leben, leiden und lieben
Aus dem Amerikanischen übersetzt von Anja Lerz
Für die Bibelzitate wurde vorwiegend die Einheitsübersetzung verwendet.
Weitere verwendete Bibelübersetzungen:
Lutherbibel, revidierter Text 1984, durchgesehene Ausgabe,
© 1999 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart.
Hoffnung für alle © 1983, 1996, 2002 by Biblica Inc. TM
Neues Leben. Die Bibel © 2002 und 2006 SCM R. Brockhaus
im SCM-Verlag GmbH & Co. KG, Witten
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
ISBN 978-3-86506-914-6
© 2016 der deutschsprachigen Ausgabe by
Joh. Brendow & Sohn Verlag GmbH, Moers
© 2015 by Rachel Held Evans
Published in Nashville, Tennessee, by Nelson Books, an imprint of Thomas Nelson.
Nelson Books and Thomas Nelson are registered trademarks of HarperCollins
Christian Publishing, Inc.
Einbandgestaltung: Brendow Verlag, Moers
Titelgrafik: fotolia Soloviora Luidmyla / fotolia ildab
Satz: Brendow PrintMedien, Moers
E-Book-Herstellung: Zeilenwert GmbH 2016
www.brendow-verlag.de
Für Amanda – die kleine Schwester, zu der ich aufschaue und die die Person ist, die mir am meisten Hoffnung für die Zukunft der Kirche gibt.
Und für die Community auf meinem Blog – ich habe jedes Wort dieses Buches für euch geschrieben.
Mir ist eine „verbeulte“ Kirche, die verletzt und beschmutzt ist, weil sie auf die Straßen hinausgegangen ist, lieber als eine Kirche, die aufgrund ihrer Verschlossenheit und ihrer Bequemlichkeit, sich an die eigenen Sicherheiten zu klammern, krank ist. Ich will keine Kirche, die darum besorgt ist, der Mittelpunkt zu sein, und schließlich in einer Anhäufung von fixen Ideen und Streitigkeiten verstrickt ist. Wenn uns etwas in heilige Sorge versetzen und unser Gewissen beunruhigen soll, dann ist es die Tatsache, dass so viele unserer Brüder und Schwestern ohne die Kraft, das Licht und den Trost der Freundschaft mit Jesus Christus leben, ohne eine Glaubensgemeinschaft, die sie aufnimmt, ohne einen Horizont von Sinn und Leben. Ich hoffe, dass mehr als die Furcht, einen Fehler zu machen, unser Beweggrund die Furcht sei, uns einzuschließen in die Strukturen, die uns einen falschen Schutz geben, in die Normen, die uns in unnachsichtige Richter verwandeln, in die Gewohnheiten, in denen wir uns ruhig fühlen, während draußen eine hungrige Menschenmenge wartet und Jesus uns pausenlos sagt: „Gebt ihr ihnen zu essen!“
– Papst Franziskus1
Inhalt
Cover
Titel
Impressum
Widmung
Zitat
Vorwort
Prolog
Dämmerung
I. Taufe
1 Wasser
2 Glaubenstaufe
3 Nackt an Ostern
4 Chubby Bunny
5 Genug
6 Flüsse
II. Beichte
7 Asche
8 Ja zu Vorschlag Nummer 1
9 Schmutzige Wäsche
10 Was haben wir getan
11 Meet the Press
12 Staub
III. Weihe
13 Hände
14 Die Mission
15 Epic Fail
16 Füße
IV. Abendmahl
17 Brot
18 Die Mahlzeit
19 Tanzparty bei den Methodisten
20 Offene Hände
21 Offenes Abendmahl
22 Wein
V. Konfirmation
23 Atem
24 Wegkreuze
25 Der zitternde Riese
26 Osterzweifel
27 Mit Gottes Hilfe
28 Wind
VI. Krankensalbung
29 Öl
30 Heilung
31 Von der evangelikalen Trägheit des Herzens
32 Das ganze Ding mit dem Leichenwagen
33 Parfüm
VII. Ehe
34 Kronen
35 Geheimnis
36 Körper
37 Königreich
Epilog
Dunkel
Danksagungen
Fußnoten
Vorwort
Immer wenn ich mir selbst einen Schrecken einjagen will, überlege ich mir, was wohl mit der Welt passieren würde, wenn Rachel Held Evans mit dem Schreiben aufhörte.
Während ich durch die Seiten dieses Buches pflügte, wurde mir bewusst, dass ich mein Leben lang auf „Es ist kompliziert“ gewartet habe. Dieser Jesus, den Rachel unbändig liebt, ist derselbe Jesus, in den ich mich vor langer Zeit verliebt habe, bevor die Heucheleien der Kirche und meines eigenen Herzens alles vermasselten. „Es ist kompliziert“ half mir dabei, der Kirche und mir selbst zu vergeben und mich wieder ganz neu in Gott zu verlieben. Es war, als wären mit der Zeit Straßensperren zwischen mir und Gott aufgebaut worden, und während ich dieses Buch las, spürte ich, wie Rachels Worte diese Hindernisse eins ums andere aus dem Weg räumten, bis ich zum Ende des Buches hin wieder einen unverstellten Blick auf Gott hatte.
Rachels Christsein ist die tägliche Übung grenzenloser Gnade – gegenüber sich selbst, der Kirche, gegenüber denjenigen, die die Kirche vor der Tür stehen lässt. Der Glaube, den sie in „Es ist kompliziert“ beschreibt, ist weniger eine Art Verein, zu dem man gehört, sondern mehr eine Art Strömung, in die man sich hineinbegibt – eine Strömung, die einen beständig zu Leuten und Orten trägt, vor denen man sich in Acht nehmen sollte, so jedenfalls wurde sie es gelehrt. Rachel stellt nicht nur fest, dass sie diese Leute liebt, sondern dass sie selbst „eine von denen“ ist. In „Es ist kompliziert“ überzeugt uns Rachel davon, dass es kein „die da“ im Gegensatz zu einem „wir“ gibt; es gibt einfach nur uns. Dieser Gedanke ist gleichzeitig tröstlich und auch ein bisschen beängstigend. Mir scheint, als wären „tröstlich“ und „ein bisschen beängstigend“ Eigenschaften, die beschreiben, wie Glaube sein sollte.
„Es ist kompliziert“ ist kurz gesagt mein Lieblingsbuch, geschrieben von meiner Lieblingsautorin. Wenn mich ab jetzt jemand nach meinem Glauben fragt, werde ich einfach dieses Buch weitergeben. Herr im Himmel, was bin ich dankbar für Rachel Held Evans.
– Glennon Doyle Melton
Autorin von „Aufstehen, Krone richten, weitermachen: Entwaffnend ehrliche Gedanken, die helfen, das Leben zu meistern“ und Gründerin von momastery.com sowie Together Rising.
PROLOG
Dämmerung
Ich will dir erzählen, wie die Sonne aufging, Strahl für Strahl …
– Emily Dickinson
Der deutsche Theologe Dietrich Bonhoeffer schrieb: „Die Frühe des Morgens gehört der Gemeinde des auferstandenen Christus. Beim Anbruch des Lichtes gedenkt sie des Morgens, an dem Tod, Teufel und Sünde bezwungen darniederlagen und neues Leben und Heil den Menschen geschenkt ward.“2
Das sind nicht ganz so gute Neuigkeiten für jemanden wie mich. Ich weiß „beim Anbruch des Lichtes“ kaum, wer ich eigentlich bin; über den theologischen Gehalt der Auferstehung könnte ich um diese Zeit wohl kaum nachdenken. Ich bin nicht unbedingt das, was man als Frühaufsteher bezeichnen würde, und ehrlich gesagt bin ich um die Zeit lieber diejenige, die „bezwungen darniederliegt“. Das Glück, das einem Sonnenaufgang innewohnt, bleibt für mich eines der unerreichbaren Geschenke der Natur, so wie Nordlicht oder Naturlocken. Ich hätte die arme Maria von Magdala zweifellos mit einem leisen, von meinem kuschligen Kissen gedämpften Grunzen verscheucht, wenn sie mich gebeten hätte, an jenem schicksalsträchtigen Morgen mit wohlriechenden Ölen zum Grab des Herrn zu gehen. Ich hätte die Hauptveranstaltung einfach verschlafen.
Die Religiösen haben es schon immer auf uns Nachteulen abgesehen. In meinem Stundenbuch steht, die Morgengebete sollten zwischen 4.30 Uhr und 7.30 Uhr gesprochen werden. Wie ich zu einer Zeit, in der ich schon meinem Mann gegenüber kaum einen zusammenhängenden Satz herausbringe, mit Gott sprechen soll, weiß ich beim besten Willen nicht. Dennoch heißt es von den am höchsten verehrten Heiligen der Kirche, sie sollen Frühaufsteher gewesen sein. Außerdem erinnere ich mich, wie Pastoren in meiner Kindheit ehrfürchtig über ihre Stille Zeit am frühen Morgen sprachen, als habe Gott strenge Sprechzeiten. Sogar die großartigen Kathedralen dieser Welt haben ihre Eingangstüren im Westen und die Altäre im bevorzugten Osten. Alte europäische Friedhöfe, mit verwitterten Grabsteinen hier und da, spiegeln bis heute die Sitte wider, die Toten mit den Füßen zur aufgehenden Sonne hin zu begraben, wobei die aufgehende Sonne Hoffnung symbolisiert und für die Erwartung steht, dass bei der Wiederkunft Christi die Gläubigen vom Tode auferstehen und ihm in die Augen schauen werden. Ich kann nur hoffen, dass das alles in meiner Zeitzone irgendwann nach neun Uhr morgens stattfindet.
Wenn die frühen Morgenstunden tatsächlich der Gemeinde des auferstandenen Christus gehören, dann schläft meine Generation aus.
In den Vereinigten Staaten haben 59% der jungen Erwachsenen im Alter von 18–29 Jahren mit einem christlichen Hintergrund der Kirche den Rücken gekehrt. Unter denjenigen von uns, die um das Jahr 2000 herum volljährig wurden, behauptet ein gutes Viertel, sie hätten überhaupt keine religiöse Zugehörigkeit, was uns noch deutlicher vom Glauben trennt als die Mitglieder der „Generation X“ zur gleichen Zeit in ihrem Leben. Und wir sind sozusagen doppelt so sehr dem Glauben entfremdet wie die „Baby Boomer“, als sie in unserem Alter waren. Es gibt Schätzungen, die besagen, dass etwa acht Millionen junger Erwachsener die Kirche vor ihrem 30. Geburtstag verlassen werden.3
Mit 32 gelte ich gerade noch so als „Millennial“, als ein Mitglied der Generation Y. (Sagen wir es so: Ich besitze immer noch eine Menge aufgezeichneter Folgen von Friends – auf Kassetten!) Aber obwohl ich mit einem Fuß in der Generation X stehe, neige ich dazu, mich am stärksten mit den Haltungen und dem Ethos der Generation der Jahrtausendwende zu identifizieren, und deswegen werde ich häufig darum gebeten, vor Gemeindeleitern darüber zu sprechen, warum junge Erwachsene die Kirche verlassen.
Darüber könnte man unzählige Bücher schreiben, und das haben ja auch schon so einige gemacht. Ich kann nicht hinreichend über die sozialen und geschichtlichen Entwicklungen sprechen, die das religiöse Leben Amerikas nicht nur prägen, oder über die Kräfte, die so viele meiner Altersgenossen vom Glauben an und für sich wegzerren. Die Probleme, die die Evangelikalen umtreiben, sind andere als die, die Protestanten im Allgemeinen so beschäftigen, welche sich wiederum von denen unterscheiden, die katholische oder episkopale Pfarreien betreffen, welche wiederum ganz anders sind als die, die auf das Christentum dort Einfluss nehmen, wo es tatsächlich im Aufschwung ist – nämlich im globalen Süden und Osten.
Aber ich kann meine eigene Geschichte erzählen, die, so deuten es Studien an, anscheinend immer gewöhnlicher wird.4 Ich kann darüber sprechen, wie ich in einem evangelikalen Umfeld aufgewachsen bin, wie ich alles, was ich je über Gott geglaubt habe, angezweifelt habe, wie ich die Kirche geliebt, verlassen und mich nach ihr gesehnt habe und wie ich nach ihr gesucht und sie an unerwarteten Orten gefunden habe. Und ich kann von den Geschichten meiner Freunde und Leser erzählen, von alten und jungen Leuten, deren Kommentare, Briefe und E-Mails sich lasen wie Postkarten von ihrer geistlichen Reise, Depeschen aus Amerikas nachchristlichem Grenzland. Die Lösungen, nach denen die Gemeindeleiter suchen, kann ich nicht bieten, aber ich kann die Fragen formulieren, die viele aus meiner Generation stellen. Ich kann ein wenig von ihrer Angst und ihrer Hoffnung beschreiben.
Das jedenfalls habe ich versucht, als ich neulich gebeten wurde, 3000 evangelikalen Jugendmitarbeitern bei einer Konferenz in Nashville, Tennessee, zu erklären, warum Millennials aus der Kirche austreten.
Ich sagte ihnen, wir hätten den Kulturkrieg satt, hätten es satt, dass das Christentum sich mit Parteipolitik und Macht einlässt. Wir Menschen der Generation Y wollen dafür bekannt sein, wofür wir stehen, sagte ich, nicht nur, wogegen wir sind. Wir wollen uns nicht entscheiden zwischen Wissenschaft und Religion oder zwischen unserer intellektuellen Integrität und unserem Glauben. Stattdessen sehnen wir uns danach, dass unsere Kirchen sichere Orte sind, wo wir zweifeln und Fragen stellen und die Wahrheit aussprechen können, auch wenn die unbequem ist. Wir wollen über das schwer verdauliche Zeugs sprechen – biblische Auslegungen, religiöse Vielfalt, Sexualität, die Versöhnung der Rassen und soziale Gerechtigkeit – aber ohne vorgegebene Lösungen oder einfache, oberflächliche Antworten. Wir wollen unser ganzes Selbst über die Schwelle der Kirchentür bringen, ohne unser Herz oder unseren Verstand draußen zu lassen, ohne eine Maske zu tragen.
Ich erklärte, wenn unsere schwulen, lesbischen, bisexuellen und transgender Freunde nicht bei Tisch willkommen seien, fühlten wir uns auch nicht willkommen, und dass nicht jeder junge Erwachsene heiratet oder Kinder bekommt – was bedeutet, dass wir aufhören müssen, unsere Gemeinden um Kategorien herum aufzubauen. Stattdessen sollten wir anfangen, sie um Leute herum aufzubauen. Und ich sagte ihnen, dass wir, entgegen beliebter Vorurteile, eben nicht mit hipperen Lobpreisbands, schnieken Kaffeebars oder Pastoren in skinny Jeans zurückgewonnen werden können. Wir Millennials sind unser ganzes Leben lang Werbung ausgesetzt gewesen, deswegen riechen wir Bullshit auf einen Kilometer Entfernung. Die Kirche, die Gemeinschaft der Christen, ist der allerletzte Ort, an dem wir uns noch ein Produkt andrehen lassen oder unterhalten werden wollen.
Millennials suchen nicht nach einem „moderneren“ oder „hipperen“ Christentum, sagte ich. Wir suchen nach einem wahrhaftigeren Christentum, einem authentischeren Christentum. Wie jede Generation vor uns und jede nachfolgende auch suchen wir nach Jesus – demselben Jesus, der an jenen seltsamen Orten zu finden ist, an denen er schon immer zu finden war: in Brot, in Wein, in der Taufe, im Wort, im Leiden, in der Gemeinschaft und unter den Geringsten von ihnen.
Kaffeebars oder Nebelmaschinen werden nicht gebraucht.
Natürlich sagte ich all das mitten auf einer riesigen Bühne, die voll ausgestattet war mit Beleuchtung, Trampolinen und, Tatsache, einer Nebelmaschine. Ich fühle mich bei solchen Veranstaltungen nie so ganz wohl – nicht weil meine Worte nicht willkommen oder nicht wahr wären, aber weil ich mich überfordert fühle, wenn ich sie sage. Ich bin keine Wissenschaftlerin und keine Statistikerin. Ich habe nie eine Jugendgruppe geleitet, war nie Pastorin einer Gemeinde. Die Wahrheit sieht so aus, dass ich mich an vielen Sonntagmorgen nicht einmal aus dem Bett hieve, besonders an Tagen, an denen ich mir nicht sicher bin, ob ich an Gott glaube, oder an denen ein interessanter Talkgast bei „Meet the Press“ eingeladen ist. Vor einem Haufen Christen über die Kirche zu sprechen bedeutet für mich, an ein Mikro heranzutreten und zu versuchen, in dreißig Minuten oder weniger die wichtigste, komplizierteste, schönste und herzzerreißendste Beziehung meines Lebens zu schildern, ohne dabei zu schreien oder zu weinen oder schlimme Wörter zu benutzen. Manchmal wünschte ich, sie würden jemanden mit etwas mehr emotionalem Abstand für diese Vorträge finden, jemanden, der sich nicht komplett auf links drehen muss und all sein Herzblut vergießt, nur weil jemand ganz harmlos fragt: „Und in welche Gemeinde gehst du so zurzeit?“
Vielleicht liegt es daran, dass ich dieses Buch nicht schreiben wollte … Jedenfalls am Anfang nicht. Oh, ich habe versucht, aus der Nummer herauszukommen. Ich habe an alternativen Vorschlägen und Exposés herumgestrickt und gefeilt und ein paar davon meinem Verlag vorgestellt, in der Hoffnung, die Lektoren würden es sich noch einmal anders überlegen. Das Buch dann zu schreiben dauerte doppelt so lange wie geplant. Obendrein habe ich eine riesige Tasse Chai über meinem Laptop ausgekippt, als ich mit meinem ersten Manuskriptentwurf etwa halb fertig war. Weil ich glaubte, ich hätte das halbe Manuskript verloren, beschloss ich, dass Gott wohl auch nicht wollte, dass ich ein Buch über die Kirche schreibe. (Wir konnten den größten Teil des Manuskripts wiederherstellen, aber meine Caps-Lock-Taste klemmt manchmal immer noch.)
Ich wollte meine Geschichte nicht gedruckt sehen, weil ich ehrlich gesagt den Schluss immer noch nicht kenne. Ich bin immer noch in den Entwicklungsjahren meines Glaubens. Da sind zugeknallte Türen und verdrehte Augen und trotzige Ansagen von wegen „Ich hasse dich!“, die ich jeder Person oder Organisation vor den Latz geknallt habe, die die institutionelle Kirche repräsentiert. Ich bin wütend und launisch, hoffnungsvoll und naiv. Ich versuche, meinen eigenen Weg zu gehen, aber ich habe noch nicht herausgefunden, wie das geht, ohne den alten zu verdammen, ohne ihn in Grund und Boden zu brüllen, meine Unabhängigkeit zu erklären und dann so schnell ich kann in die entgegengesetzte Richtung zu rennen. Bücher über Kirchen und Gemeinden werden von Leuten mit einem Plan mit zehn Schritten und so geschrieben, nicht von Christen, die sich mit den Fingernägeln an der Kante über dem Abgrund festhalten.
Und dennoch schreibe ich. Ich schreibe, weil ich den Verdacht habe, dass ich, der ungelenke Teenager auf dem Bild im Jahrbuch, trotzdem etwas über die Welt zu sagen habe und eine Art Hoffnung bieten kann, und wenn es nichts anderes ist als ein paar hundert Seiten „geht mir genauso“. Ich schreibe, weil wir manchmal in unserer Verletzlichkeit näher an der Wahrheit sind als in unseren sicheren Sicherheiten und weil ich trotz all meiner Zweifel und Unsicherheit, trotz meines beständigen Drangs, am Sonntagmorgen einfach auszuschlafen, die ersten flüchtigen Lichtbänder der Dämmerung gesehen habe, die durch mein Schlafzimmerfenster gedrungen sind, und weil da so ein schwaches, hoffnungsvolles Leuchten am Horizont ist. Selbst wenn ich nicht an die Kirche glauben kann, glaube ich doch an die Auferstehung. Ich glaube an die Hoffnung des Sonntagmorgens.
Es schien passend, das Buch um die Sakramente zu gliedern, weil es die Sakramente waren, die mich wieder in die Kirche zurückgeholt haben, nachdem ich längst aufgegeben hatte. Als mein Glaube zu wenig mehr als einer abstrakten Größe zusammengeschrumpft war, zu einer Reihe Behauptungen, die man bestätigen oder ablehnen kann, lud mich der greifbare, spürbare Charakter der Sakramente dazu ein, Gott wieder in den alltäglichen Dingen zu berühren, zu riechen, zu schmecken, zu hören und zu sehen. Diese haben Gott aus meinem Kopf geholt und in meine Hände gelegt. Sie haben mich daran erinnert, dass der christliche Glaube eben nicht nur geglaubt werden will; er will auch gelebt, geteilt, gegessen, ausgesprochen und ausgeübt werden, und zwar in der Gegenwart anderer Menschen. Die Sakramente haben mich daran erinnert, dass ich nicht für mich alleine Christ sein kann, und wenn ich es noch so sehr versuche. Ich brauche eine Gemeinschaft. Ich brauche die Kirche.
Um es mit Barbara Brown Taylor zu sagen: „In Zeiten des Informationsüberflusses … ist das Letzte, das wir brauchen, mehr Information über Gott. Wir brauchen die Praxis der Auferstehung, durch die Gott die Leben derer rettet, die durch ihre intellektuelle Zustimmung staubtrocken geworden sind, deren Vorrat an Brot des Lebens erschreckend klein ist. Sie wollen um jeden Preis mehr Gott erfahren. Nicht mehr über Gott. Mehr Gott.“5
Deshalb erzähle ich euch meine Geschichte in sieben Abschnitten, durch die Bildsprache der Taufe, der Beichte, des Sakraments der Weihe, des Abendmahls, der Konfirmation, der Krankensalbung und der Ehe. Das sind die sieben Sakramente, die die römisch-katholische Kirche und die orthodoxe Kirche kennen, aber man braucht sie nicht als die einzigen Sakramente der Kirche zu betrachten. Ich könnte auch leicht über das Sakrament des Pilgerns, das Sakrament der Fußwaschung, das Sakrament des Wortes, das Sakrament des Hähnchenauflaufs oder über eine beliebig lange Liste weiterer äußerlicher Zeichen für innere Gnade schreiben. Wenn ich diese sieben Sakramente nutze, geht es mir nicht um ein theologisches oder ekklesiologisches Ziel, sondern um ein sehr literarisches. Sie sind die Heringe, die mein kleines Zelt, mein kleines Heiligtum von einer Geschichte am Boden halten. Ich habe sie ausgesucht, weil sie eine gewisse Allgemeingültigkeit beinhalten, denn selbst in Gemeinden, die nicht ausdrücklich sakramental sind, wird doch die Auffassung, was den Wahrheitsgehalt der Sakramente im Allgemeinen angeht, geteilt.
Die Kirche sagt uns, dass wir geliebt sind (Taufe).
Die Kirche sagt uns, dass wir fehlerhaft sind (Beichte).
Die Kirche sagt uns, dass wir berufen sind (Weihe).
Die Kirche gibt uns zu essen (Abendmahl).
Die Kirche heißt uns willkommen (Konfirmation).
Die Kirche salbt uns (Krankensalbung).
Die Kirche vereinigt uns (Ehe).
Natürlich kann die Kirche auch lügen, verletzen, beschädigen und ausschließen. Dieses Buch betrachtet die dunklen Ecken der Kirche ebenso wie ihre Pracht im Licht der Buntglasfenster. Aber dieser Generation, die sich schwer damit tut, herauszufinden, wofür Kirche eigentlich gut ist, wünsche ich, dass diese sieben Mysterien uns daran erinnern, zu „schmecken und (zu) sehen, dass der Herr gut ist“ (Psalm 34,8) – und vielleicht nicht aufzugeben. Ich hoffe, sie erinnern uns daran, wie sehr wir einander brauchen.
Ich habe auf diesen Seiten Geschichten von Kirchengemeinden aus unterschiedlichen Traditionen versammelt – Baptisten, Mennoniten, Anglikaner, Katholiken, Pfingstler, Konfessionslose –, und ich habe mich großzügig an Texten von Christen bedient, von Alexander Schmemann (orthodox) über Nadia Bolz-Weber (evangelisch-lutherisch) und Will Willimon (methodistisch) bis zu Sara Miles (episkopal). Ich habe Geschichten von Laien und Pastoren, Freunden und Bloglesern, Kirchgängern und Kirchenfernen gesammelt. Das hier ist meine Geschichte, aber sie ist auch die vieler anderer.
Das Buch heißt auf Englisch „Searching for Sunday“, auf der Suche nach dem Sonntag. Aber es geht weniger darum, nach einer Sonntagskirche zu suchen, als darum, nach der Auferstehung am Sonntagmorgen zu suchen. Es geht um all die seltsamen Wege, durch die Gott Totes zurück ins Leben holt. Es geht darum, aufzugeben und neu anzufangen. Es geht darum, warum ich – selbst an Tagen, an denen ich befürchte, dass all das Reden über Jesus und Auferstehung und ewiges Leben ein Haufen Stuss ist, der uns nur irgendwie durch eine im Grunde bedeutungslose Existenz helfen soll –, warum ich also selbst an solchen Tagen gerne mit den Füßen zur aufgehenden Sonne hin begraben werden möchte.
Für alle Fälle.
TEIL I
Taufe
EINS
Wasser
… es [gab] einst einen Himmel […] und eine Erde,
die durch das Wort Gottes aus Wasser entstand und
durch das Wasser Bestand hatte.
– 2. Petrus 3,5
Am Anfang schwebte der Geist Gottes über dem Wasser.
Das Wasser war finster und tief und überall, so sagen uns die Vorväter, ein endloses Urmeer.
Dann teilte Gott die Wasser, schob einen Teil davon hinunter, um Ozeane, Flüsse, Tautropfen und Quellen zu schaffen, und schleuderte die restlichen reißenden Ströme nach oben, wo sie hinter einem gläsernen Firmament eingeschlossen wurden, komplett ausgestattet mit Türen, die sich für den Mond öffnen, und Fenstern, durch die der Regen auf die Erde fallen kann. In der Kosmologie des antiken Nahen Ostens hing alles Leben zwischen diesen Wassern, verletzlich wie ein ungeborenes Kind im Mutterleib. Mit einem Seufzen des Geistes konnten die Wasser in und über die Erde hereinbrechen und ihre Bewohner in kürzester Zeit ertränken. Die Geschichte von der Sintflut beginnt, als „alle Quellen der gewaltigen Urflut auf[brachen] und die Schleusen des Himmels [sich] öffneten“ (1. Mose 7,11). Der Gott, der am Anfang die Wasser geteilt hatte, wollte neu anfangen, also spülte Gott die Welt weg.
Für Menschen, deren Überleben von den unergründlichen Launen des Tigris, Euphrats und Nils abhing, stellte Wasser sowohl Leben als auch Tod dar. In Ozeanen wimmelte es nur so von Monstern, renitenten Geistern und riesigen Fischen, die einen Mann am Stück verschlucken konnten. Die Flüsse waren randvoll mit wankelmütigen Möglichkeiten – sie konnten reiche Ernte bringen, den Handel vorantreiben oder austrocknen. In diese Welt hinein sprach Gott die Sprache des Wassers, verwandelte die Flüsse der Feinde in Blut, rief Quellen aus Felsen in der Wüste hervor, spielte Kuppler an Brunnen und verhieß eine Zukunft, in der das Recht strömen soll wie Wasser und die Gerechtigkeit wie ein nie versiegender Bach. Und die Menschen erwiderten sein Reden, indem sie nach Geburt, Geschlechtsverkehr, Menstruation, Opfern, Konflikten und Fehltritten die Reinheit von Körper und Geist in rituellen Bädern suchten. „Entsündige mich mit Ysop, dann werde ich rein“, schreibt der König-Dichter David, „wasche mich, dann werde ich weißer als Schnee“ (Psalm 51,9).
Es ist naiv, anzunehmen, all diese uralten Visionen müssten wörtlich verstanden werden, um wahr zu sein. Wir wissen, wie unsere Vorfahren auch, um die Gefahr und die Notwendigkeit des Wassers. Wasser lässt uns im Mutterleib gedeihen, wo unser geistähnliches Gewebe das Fruchtwasser in sich aufnimmt und wieder ausscheidet, das unsere Lungen und Knochen und Gehirne wachsen lässt. Wasser strömt durch unseren Körper und macht unseren Planeten blau. Wasser wirbelt bei einem Tsunami Autos herum wie Blätter, Wasser, das in einem Augenblick ein Schiff verschlucken und über Äonen hinweg einen Canyon aushöhlen kann, Wasser, nach dem wir mit milliardenschwerem Gerät auf dem Mars suchen wie Affen nach Läusen, Wasser, das wir im Namen Gottes auf kahle Babyköpfe träufeln, Wasser, mit dem wir foltern und weinen, Wasser, das die unsichtbaren Krankheiten verbreitet, an denen auch heute wieder viertausend Kinder sterben werden, Wasser, das, wenn es nur ein paar Grad wärmer wird, die Erde überfluten und uns alle wegwaschen wird.
Aber so wie Wasser Moses auf dem Nil seinem Schicksal entgegentrug, so trug das Wasser auch ein anderes Baby aus dem Körper seiner Mutter heraus in eine erwartungsvolle Welt. Jetzt in Fleisch gekleidet, wurde der Gott, der einst über den Wassern schwebte, von den Händen eines unbändigen Predigers aus der Wildnis in ebenjene Wasser untergetaucht. Als Gott wieder auftauchte, sprach er von lebendigem Wasser, das den Durst für immer stillt, und davon, wiedergeboren zu werden. Er ging fischen und wusch die Füße seiner Freunde. Er berührte die, die kultisch unrein waren. Er spuckte in den Staub, schickte Dämonen in den Ozean und spazierte über ein aufgewühltes Meer. Er hatte Durst, und er weinte.
Nachdem die Regierung sich ihn von den Händen gewaschen hatte, hing Gott am Kreuz, wo Blut und Wasser aus seiner Seite flossen. Wie Jona wurde er für drei Tage verschluckt.
Dann besiegte Gott den Tod. Gott stieg aus den Tiefen empor und atmete wieder. Als er seine Freunde am Ufer traf, sagte er ihnen, sie sollten sich nicht fürchten, sondern hinausgehen und alle Welt taufen.
Der Geist, der einst über den Wassern schwebte, hat sie bewohnt. Jetzt ist jeder Tropfen heilig.
ZWEI
Glaubenstaufe
Alles Wasser hat ein perfektes Gedächtnis und versucht
immer wieder dorthin zurückzukehren, wo es war.
Toni Morrison
Ich wurde von meinem Vater getauft. Seine Gegenwart neben mir in dem hüfthohen Wasser des Taufbeckens war nur einer von vielen Vorteilen, die es mit sich brachte, wenn man einen Vater hat, der zwar ordiniert ist, aber kein Pastor und der so an meinem geistlichen Leben teilhaben kann, ohne es zu ruinieren. Die Erwartungen an die Tochter eines Bibelschullehrers sind viel geringer als an eine Pastorentochter, das kann ich euch sagen. Meistens ging es darum, dass mir in der Sonntagsschule freundlich angedeutet wurde, ich könnte doch ein paar meiner vielen Fragen an die eine Person in meinem Leben richten, die Althebräisch spricht und mir beim Frühstück bestimmt genau erklären könne, wie Gott es fertiggebracht hat, das Licht vor der Sonne zu erschaffen.
Deshalb glaubte ich meinem Vater meistenteils, wenn er mir versicherte, ich würde nicht in die Hölle kommen, wenn ich mit meiner Taufe wartete, bis ich beinahe 13 war. Meistenteils. Ich wusste, dass ich die Grenzen des „zurechnungsfähigen Alters“ strapazierte, also den Punkt, an dem Kinder nicht mehr gratis bei O’Charley’s essen dürfen oder in Abhängigkeit von der Rechtschaffenheit ihrer Eltern in den Himmel kommen, und ich wusste, dass manche Christen glauben, man müsse getauft sein, um errettet zu werden. Ein Klassenkamerad in der fünften Klasse hatte mir eine rasante Einführung in die Welt der unterschiedlichen Denominationen beschert. Man hatte mich darüber informiert, dass ich, obwohl ich Jesus schon im Kindergarten in mein Herz eingeladen hatte, trotzdem den Deal besiegeln und mich zügig taufen lassen müsste, bevor ein Autounfall oder ein Absturz von der großen Rutsche mich geradewegs zum Teufel befördern könnte.
„Mein Pastor sagt, man muss erst mit Wasser getauft werden, bevor man vom Heiligen Geist getauft werden kann“, erklärte mir der Junge wie ein Allgemeinmediziner, der einen zum Spezialisten verweist. Ein Allgemeinmediziner, der gerade am Klettergerüst hangelte, wohlgemerkt. „Du solltest dich wohl besser darum kümmern.“
„Na und? Mein Papa war auf dem theologischen Seminar, und er sagt, man muss nicht getauft sein, um in den Himmel zu kommen“, feuerte ich zurück.
(Ich sollte vielleicht erwähnen, dass ich eine christliche Grundschule besuchte, wo Sprüche wie „Die Hermeneutik von meinem Papa ist viel toller als wie die von deinem Papa“ anerkannter Schulhofschnack waren.)
Viele Kinder auf der Parkway Christian Academy gingen in die Pfingstgemeinde auf der anderen Straßenseite. Wenn nach Gebetsanliegen gefragt wurde, erzählten sie himmlische Geschichten von Dämonen, die sich nachts in ihre Kinderzimmer schlichen und das Licht anknipsten oder die Klospülung betätigten. Sie nahmen geistliche Kampfführung außerordentlich ernst und betrachteten meine Familie als sehr liberal, weil wir am Feiertag Satans Süßes oder Saures sammeln gingen. Mein Vater sagte, Dämonen seien in der Versuchungsbranche unterwegs und nicht in der Klospülliga. Aber seine Versicherungen hielten mich nicht davon ab, an manchen Abenden zitternd unter meiner Bettdecke zu liegen, wo ich mich nicht traute, die Augen zu öffnen und mich der zähen Präsenz zu stellen, die ich spüren konnte und von der ich wusste: Das muss einfach ein gefallener Engel sein, der nur darauf wartet, sich eines kleinen Mädchens zu bemächtigen, das an Halloween nach Süßigkeiten gefragt und sich nicht rechtzeitig um seine Taufe gekümmert hat. Als ich langsam in das zurechnungsfähige Alter kam, hatte ich ausreichend unterschiedliche Lehrmeinungen innerhalb der Kirche mitbekommen, sodass ich auf Nummer sicher gehen wollte. Deshalb arbeitete ich immer mehr Fragen in unsere theologischen Debatten am Abendbrottisch ein, in der Hoffnung, meine Eltern mochten einen Termin mit dem Pastor vereinbaren. Als ich erfuhr, dass manche Kinder getauft werden, bevor sie ihren ersten Zahn bekommen, war ich unglaublich neidisch.
Unsere Gemeinde glaubte an die Bibel, also praktizierten wir die Taufe durch Untertauchen. Glaubenstaufe nannten wir das. Hätten wir im 16. Jahrhundert in der Schweiz gelebt, wären wir für diese Überzeugung umgebracht, symbolisch ertränkt oder vielleicht auch verbrannt worden von anderen Protestanten, die die „Wiedertaufe“ der radikalen Reformer als Ketzerei betrachteten (Fun Fact: In den auf die Reformation folgenden Jahrzehnten wurden mehr Christen von anderen Christen in den Märtyrertod geschickt als im Römischen Reich6). Wäre ich in eine orthodoxe Familie hineingeboren worden, hätte man mich als Kleinkind dreimal nacheinander untergetaucht – erst im Namen des Vaters, dann im Namen des Sohnes und dann noch einmal im Namen des Heiligen Geistes –, bevor man mich, verwirrt und spuckend, in die Arme eines Paten gelegt hätte. Wäre meine Familie katholisch, hätte ich ein weiches, weißes Taufkleid getragen, und ein Priester hätte mir Weihwasser über meine Babyglatze gegossen, um die Befleckung der Ursünde abzuwaschen. Wären wir Mormonen gewesen, hätten zwei Zeugen an den Seiten des Taufbeckens gestanden, um sicherzugehen, dass auch wirklich mein ganzer Körper untergetaucht wurde. Wären wir Presbyterianer, hätten ein paar Spritzer gereicht, die meinen Platz in der Bundesfamilie symbolisierten. Während es Meinungsverschiedenheiten bezüglich der richtigen Form der Taufe noch und nöcher gibt, ziehen es Christen heutzutage glücklicherweise immerhin vor, sich gegenseitig nur mit bösen Blicken zu bedenken anstatt mit dem Scheiterhaufen.
Ich glaube, das spielt alles gar keine so große Rolle. Das Wort Glaubenstaufe scheint mir sowieso eine Fehlbezeichnung zu sein, weil der Begriff weit mehr Willenskraft suggeriert, als die meisten von uns unter diesen Umständen aufbringen. Ob du als Baby, das sich in den Armen eines nervösen Priesters windet, nass gemacht wirst oder als Erwachsener, der von einem Erweckungsprediger untergetaucht wird, du tust es jedenfalls in den Händen derer, die dich zuerst zum Glauben führten, den Menschen, die dich Jesus vorgestellt haben – oder dich ihm vorstellen werden. „In der Taufe“, schreibt Will Willimon, „ist der Empfänger der Taufe genau das – ein Empfänger. Man kann sich schlecht selbst taufen. Sie wird an dir und für dich ausgeführt.“7 Es geht um eine Adoption, nicht um ein Vorstellungsgespräch.
Die Gemeinde, die mich adoptierte, saß in den Südstaaten, war evangelikal und, folgerichtig, verrückt nach American Football. Unter der Trainerschaft von Gene Stallings rollte die Alabama Crimson Tide auf ihre zwölfte National Championship zu. Deswegen waren die traditionellen Kirchenbänke der Bible Chapel in Birmingham am Sonntagmorgen nach einem Spieltag voller rotweißer Haarbänder, Krawatten, Sportjacken und Blusen – die heiligen Gewänder der zweiten großen Religion Alabamas (oder der ersten – kommt darauf an, wen man fragt).8 Es gab ein paar wenige Auburn-Fans in der Gemeinde, aber die waren fast so schwer zu fassen wie Demokraten. Wir versammelten uns unter einer Gewölbedecke aus Sandkiefernholz und blickten, wie gute Protestanten eben, auf eine schwere, schmucklose Kanzel. Es waren die 80er, deswegen riechen meine frühen Erinnerungen an Jesus alle nach Haarspray.
Damals hatte ich noch keine Vorstellung von Evangelikalismus als einer relativ modernen Ausdrucksform des Christentums, deren Wurzeln im Pietismus des 18. Jahrhunderts und in den großen amerikanischen Erweckungsbewegungen liegen. Stattdessen verstand ich evangelikal als ein Adjektiv, das bedeutungsgleich war mit „echt“ oder „authentisch“. Es gab Christen, und dann gab es eben noch evangelikale Christen wie uns. Nur den Evangelikalen war das Heil gewiss. Alle anderen waren lauwarm und liefen Gefahr, aus Gottes Mund ausgespuckt zu werden. Unsere katholischen Nachbarn waren verdammt. 900 Meilen entfernt war mein zukünftiger Ehemann in Princeton, New Jersey, dabei, beim Pinewood Derby an der Montgomery Evangelical Free Church Pokale zu gewinnen. Er hat den Namen der Schule viele Jahre lang als „frei von Evangelikalen“ verstanden, wie bei „zuckerfreier Kaugummi“. Er erinnert sich daran, wie er einmal seine Mutter gefragt hat: „Aber sind die Evangelikalen denn nicht die Guten?“ Wie früh wir doch lernen, unsere Stämme zu identifizieren.
Unser Pastor in der Bible Chapel – Pastor George – stammte aus New Orleans und ließ das die Welt mit seinem donnernden Bayou-Dialekt und den gold-lila gestreiften Krawatten auch merken. Er war stämmig, verspielt und ein echter Erzähler, dessen Lieblingsillustrationen in seinen Predigten sich um Fische drehten, die entwischten, oder um Alligatoren, die ihn beinahe bei lebendigem Leibe gefressen hätten. Meine Mutter neckte ihn manchmal nach den Gottesdiensten, er sei so schlimm wie die Gideons, eine Gruppe Bibelverteiler, deren Geschichten über wundersame Ereignisse mit der Bibel sie nie ganz glaubte (etwa die, in der ein Hund seinem obdachlosen Herrchen eine zerfledderte Bibel brachte, bevor er in dessen Armen starb).
Bis auf ein paar Ausnahmen habe ich alle von Pastor Georges berühmten Predigten verpasst, weil meine kleine Schwester Amanda und ich normalerweise in den Kindergottesdienst geschickt wurden, wenn die Ankündigungen, die Lieder und der musikalische Part vorbei waren. Meine Mutter ist Sonntagsschullehrerin in dritter Generation und rigorose Verteidigerin altersgerechter Lehre, die nur wenig Toleranz für Leute aufbringt, die ihre Kinder im Gottesdienst behalten und auf dem Kirchenblättchen herumkritzeln lassen, während der Prediger lang und breit über das stellvertretende Sühneopfer schwadroniert. Weil sie als Kind gezwungen wurde, genau das zu tun – oft drei- bis viermal die Woche, in einer strengen unabhängigen Baptistengemeinde –, machte sie unserem Vater und jedem anderen, der danach fragte, klar, dass wir nur zweimal die Woche zur Kirche gingen: einmal am Sonntagmorgen und einmal am Mittwochabend. Wir waren Konservative, keine Gesetzlichen.
Aber selbst als Kind lernt man recht schnell, dass Kirche nicht zu den im Schaukasten angegebenen Zeiten anfängt und aufhört. Nein, Kirche zog sich wie die letzte Schulstunde, während wir mit Dad im heißen Auto auf Mom warteten, die im Gemeindesaal noch Kontakte pflegte. Kirche begleitete uns in die in Gold getauchten Sonntagnachmittage unserer Kindheit, an denen Amanda und ich in unserer weißen Unterwäsche wie kleine Bräute durchs Haus tobten. Wenn die ganze Familie die Grippe hatte, klingelte die Kirche an der Tür und brachte Hähnchenauflauf vorbei. Manchmal rief sie noch nach Mitternacht an, um um Gebet zu bitten und zu weinen. Sie tratschte in der Abholzeit an der Schule und war freitagabends unser Babysitter. Sie neckte mich und zog mich an meinen Rattenschwänzen und lehrte mich singen. Die Kirche veranstaltete eine riesige Überraschungsparty zu Dads 40. Geburtstag und weihte mich vorher in das Geheimnis mit ein. Die Kirche kam viel öfter zu mir, als dass ich hinging, und darüber bin ich froh.
Angesichts des normalen Wochenrhythmus der Helds fühlte es sich komisch an, an einem frühen Sonntagabend zu unserem Taufgottesdienst in die lange, baumbesäumte Auffahrt der Bible Chapel einzubiegen. Amanda und ich saßen nervös angeschnallt auf der Rückbank unseres Chevy Caprice. Teilweise hatten wir meine Taufe auch deswegen hinausgeschoben, damit sie und ich am gleichen Tag getauft werden konnten. Ich betrachtete das als nur ein weiteres Beispiel für Amandas unheimliche Begabung, mir in Sachen Reife immer eine Nasenlänge voraus zu sein, obwohl ich drei Jahre älter bin als sie. Sie ist altklug, hat Grübchen, olivenfarbene Haut und tiefgründige, moosgrüne Augen, die bis heute sofort verraten, was ihr Herz bewegt – ob Freude oder Liebeskummer. So konnte Amanda auch dem verknöchertsten Kirchenältesten ein Lächeln entlocken. Sie war vertrauensvoll, leicht zu beeindrucken, leicht zu durchschauen und gut – der letzte Mensch auf der Welt, den man weinen sehen wollte.
Pastor George nannte Amanda „Miss AWANA“, weil sie bei den Treffen, in denen wir jeden Mittwochabend Bibelverse auswendig lernten, so hervorstach. AWANA stand dabei für Approved Workmen Are Not Ashamed (anerkannte Arbeiter schämen sich nicht) und war weit weniger sozialistisch gemeint, als es klingt. Vielmehr beinhaltete es den Erwerb von Auszeichnungen und Anstecknadeln für das erfolgreiche Aufsagen von Versen, die in unseren spiralgebundenen Broschüren abgedruckt waren. Die ganze Sache roch köstlich nach Zuckerkeksen und dem frisch laminierten Papier unserer Auswendiglernbücher, und Amanda trug den Duft jede Woche mit sich nach Hause, zusammen mit einem Arm voll Schleifen und Pokalen. Aber anstatt damit anzugeben, bot sie mir an, ihre Ausbeute mit mir zu teilen. Wenn sie merkte, dass ich mit leeren Händen nach Hause gekommen war, schob sie mir manchmal leise einen der Kronen-Anstecker aus Plastik in die Finger, die sie verdient hatte. Die sollten die Kronen symbolisieren, die wir einst im Himmel dafür bekommen würden, dass wir so viele Bibelverse auswendig gelernt hatten. Es machte mir Angst, wie sehr sie zu mir aufsah, wie sehr sie mir vertraute und zu mir hielt, selbst wenn ich es nicht verdiente. Ich war ihr eine gute große Schwester, bis ich in die Pubertät kam und es ihr in der darauffolgenden Krise übel nahm, wie mühelos sie geliebt wurde. Einmal, als ich meinte, sie wäre nicht ausreichend gerügt worden, nachdem wir uns zu Hause in irgendeinem Malheur wiedergefunden hatten, nannte ich sie Zimperliese und verspottete sie, indem ich hämisch das Lied „Holy, holy, holy“ sang. Das ist das Gemeinste, was ich je jemandem angetan habe. Überhaupt jemals. Sie hatte so ein zartes Gemüt, dass ich sofort wusste, dass ich etwas Wertvolles verletzt hatte, nur aus Spaß, und dass ich imstande war, Böseres zu vollbringen, als ich mir je vorgestellt hätte. Nicht einmal das Wasser der Taufe konnte diese Sünde wegwaschen, dessen war ich mir sicher.
An unserem Tauftag folgten wir unserer Mutter in den kahlen Nebenraum der Kirche, wo wir dünne Taufhemden über unsere T-Shirts und Jeansshorts zogen. Mir war unwohl wegen meiner Brüste. Meine „Stolpersteine“ wuchsen früh und reichlich, und jedes Mal, wenn ich merkte, dass ein Kind aus der Sonntagsschule sie anguckte, fühlte ich mich wie die Hure Babylon. (Ich habe erst nach dem College gelernt, die Züchtigkeitskultur zu dekonstruieren, und da war dann schon alles zu spät.) Nasse Kleider würden mir keinen Gefallen tun, so viel war mir klar. Zum Glück sollten wir vor dem Untertauchen sowieso die Arme vor der Brust verschränken, und Mama hatte mich mit einem Sport-BH, einem Unterhemd und einem dicken Baumwoll-T-Shirt ausgestattet. Sie bürstete mein schlaffes braunes Haar, das wie die Fäden eines Wischmopps unter einem künstlich aufgebauschten Pony herunterhing, und ich sah zu, wie ihre braunen Augen das Ekzem musterten, das auf meinen Armen ausbrach, meine vornübergebeugten Schultern und meine Zahnlücke. Ich weigerte mich, Make-up zu tragen, und das machte sie wahnsinnig, besonders an so einem Tag, an dem ein weißes Gewand jeden Hauch Farbe aus meinem blassen Gesicht verbannte. Amanda sah natürlich engelsgleich aus. Ihr Haar war gelockt und zu zwei asymmetrischen, hüpfenden Rattenschwänzen zusammengebunden – eine kleine Engelsgestalt neben einem verängstigten Gespenst mit Busen.
„Das Gute ist“, sagte Mom, deren Munterkeit sich von der nervösen Spannung deutlich abhob, „dass ich einen Fön eingepackt habe.“
Na, wenn das keine Erleichterung war.
Während mein Vater den Überblick über meine theologische Entwicklung behielt, blieb es meiner armen Mutter vorbehalten, mich durch die sozialen Nuancen des Kirchenlebens zu navigieren, eine Aufgabe, die ich ihr immens erschwerte, indem ich das Erstere sehr viel wichtiger nahm als das Letztere. Es ist eine Sache, einer Elfjährigen zu erklären, dass man nicht wissen kann, ob Anne Frank in den Himmel oder in die Hölle gekommen ist, und eine ganz andere Geschichte, ihr zu erklären, warum es vielleicht nicht so ganz angebracht war, die Frage vor lauter Gemeindefrauen bei einer Brautparty zu stellen. Aber so klang meine Art Small Talk eben. Hätte ich ein bisschen was vom Charme und der Schönheit meiner Mutter geerbt und die Tugend meiner Schwester geteilt, wäre ich vielleicht damit durchgekommen, aber stattdessen quälte ich mich durch die Fettnäpfe der religiösen Kultur der Südstaaten, wo von einem guten Christenmädchen erwartet wird, wenigstens ein Weilchen über das Wetter oder Football zu plaudern, bevor sie auf die ewige Verdammnis zu sprechen kommt. Als von Geburt an Introvertierte habe ich die Kunst des Umgarnens nie gemeistert. Obendrein widersetzte ich mich meiner Mutter ganz bewusst, indem ich mich weigerte, Lippenstift und Handtasche zu tragen oder mir Gedanken darum zu machen, was ich zum Gottesdienst anzog, weil ich ganz genau wusste, dass ihr diese Dinge wichtig waren. Ich betrachtete mich gerne als Wildfang (so wie meine Heldin Laura Ingalls Wilder), aber ohne das Interesse an Wettkampfsportarten oder Naturleben. Zum Glück hat meine Mutter eine Schwäche dafür, sich auf die Seite des Außenseiters zu stellen, und daher hatte ich nie Zweifel daran, dass sie auf meiner Seite war.
An meinen Taufgottesdienst erinnere ich mich nicht besonders gut, außer daran, dass der Kirchenraum vom Baptisterium aus so ganz anders aussah. Als ob ich ihn durch ein Weitwinkelobjektiv betrachtete. Und ich erinnere mich daran, wie tröstlich es war, durch das lauwarme Wasser zu waten und dann dort meinen Vater vorzufinden. Vertraute Arme, die mich leiteten, vertraute Hände, die meine Nase zuhielten, eine vertraute Stimme, die etwas über den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist sagte, eine vertraute Kraft, die mich niederdrückte und mich wieder heraufzog, wie sonst, wenn er mich in seinen Armen herumwirbelte. Und ich erinnere mich daran, wie froh ich war, meine Mutter zu sehen, die mit offenen Armen darauf wartete, mich in ein Handtuch zu wickeln, und wie wir zusammen dabei zusahen, wie Amanda an der Reihe war und hineinwatete. Das Wasser schien so viel tiefer, es ging ihr bis zu den Schultern. Hinterher gab es einen kleinen Empfang, und jemand hatte daran gedacht, gefüllte Eier zu machen, weil sie wussten, dass ich das liebte.
Aber am meisten erinnere ich mich daran, wie ich mich fragte, warum ich mich jetzt nicht sauberer fühlte, warum ich mich nicht heiliger fühlte oder leichter oder Gott näher, wo ich doch wiedergeboren war … schon wieder. Ich fragte mich, ob meine pfingstkirchlichen Klassenkameraden recht hatten und ich eine zweite Taufe, eine Geistestaufe, brauchte oder ob ich nicht feierlich genug bei der Sache gewesen war oder mich nicht ausreichend auf meine Taufe vorbereitet hatte, damit sie auch wirkte. Ich hatte zu dem Zeitpunkt noch nicht gelernt, dass man für gewöhnlich aus den großen Momenten – der Hochzeit, dem Buchvertrag, der Reise, dem Tod, der Geburt – als ganz genau dieselbe Person herauskommt, als die man hineingegangen ist, und dass die vielleicht seltsamste Überraschung des Lebens die ist, dass es immer wieder demselben alten Du geschieht.
Wenn Martin Luther wieder eine seiner dunkleren Phasen durchmachte (was häufig geschah, der Kerl war ganz eindeutig bipolar veranlagt), soll er sich getröstet haben, indem er sich sagte: „Martin, bleib ruhig, du bist getauft.“ Ich vermute, sein Trost kam nicht daher, dass er sich den eigentlichen Moment der Taufe ins Gedächtnis rief oder sich auf die Taufe als eine Art zauberhaften Glücksbringer verließ, sondern daher, dass er sich daran erinnerte, wofür seine Taufe stand: für seine Identität als ein geliebtes Kind Gottes nämlich. Denn letzten Endes ist die Taufe eine Namensgebung. Als Jesus aus den Wassern des Jordans emporkam, erklärte eine Stimme vom Himmel herab: „Das ist mein geliebter Sohn, an dem ich Gefallen gefunden habe.“ Es fing nicht erst mit der Taufe an, dass Jesus geliebt wurde, noch wurde er mehr geliebt, als die Taufe zu einer Erinnerung geworden war. Die Taufe benannte ganz einfach die Wirklichkeit seiner Existenz und die Tatsache, dass er unendlich geliebt war. Meine Freundin Nadia formuliert es so: „Identität. Das ist immer Gottes erster Schritt.“9
Und so ist es auch bei uns. In der Taufe werden wir als geliebte Kinder Gottes identifiziert, und unsere Adoption in diese ausufernde, schöne, dysfunktionale Familie, die die Gemeinde Gottes ist, wird von denen gefeiert, die mit Fön und gefüllten Eiern am Ufer stehen. Daher steht das Taufbecken in aller Regel in der Nähe der Kirchentür. Der Mittelgang symbolisiert die Lebensreise des Christenmenschen zu Gott hin, eine Reise, die mit der Taufe beginnt.
Die gute Nachricht ist: Du bist ein geliebtes Kind Gottes. Die schlechte ist: Du kannst dir deine Geschwister nicht aussuchen. Nadia ist eine lutherische Pastorin, die in der fundamentalistischen Tradition der Gemeinde Christi aufgewachsen ist, die es, wie meine auch, Frauen verbietet, Pastorinnen zu werden. Als sie zur evangelisch-lutherischen Kirche übertrat, bat sie ihren lutherischen Mentor, sie zu taufen. Ihr Mentor lehnte weise ab und erinnerte sie daran, dass eine Handlung Gottes weder rückgängig gemacht noch wiederholt werden kann. Obwohl sie die Gesellschaft und die Verhaltensweisen ihrer ersten Gemeinde abgelegt hatte, konnte sie sie nicht aus ihrem geistlichen Stammbaum löschen. Sie waren immer noch ihre Familie.