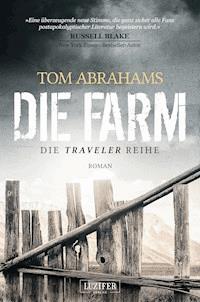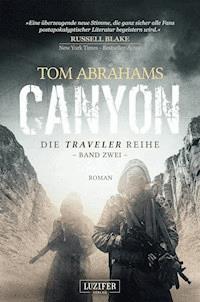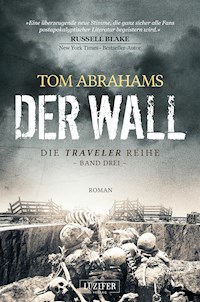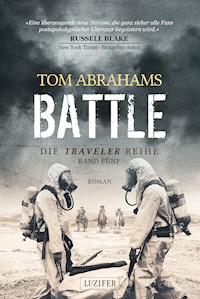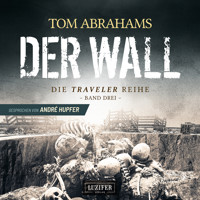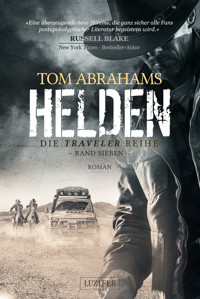
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Luzifer-Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Traveler
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2023
Marcus Battle ist der Welt überdrüssig. Und er ist sich sicher, dass die Welt genauso empfindet. Doch als ein alter Freund seine Hilfe benötigt, kehrt er einmal mehr in die Welt der Gewalt und Korruption zurück, die er so lange zu meiden versucht hatte. Ein Jahrzehnt nach seinem Verschwinden hinter dem Wall, der Texas vom Rest seiner ehemaligen Heimat abtrennt, beginnt eine repressive Regierung die einzigen noch lebenden Menschen zu bedrohen, die ihm etwas bedeuten. Er ist bereit, alles für sie zu opfern und noch einmal an Orte zurückzukehren, die kein Mensch ein zweites Mal sehen sollte … ★★★★★ »Eine überzeugende neue Stimme, die ganz sicher alle Fans postapokalyptischer Literatur begeistern wird.« - Russell Blake, New York Times Bestseller Autor Die TRAVELER-Reihe – das sind actionreiche Endzeit-Abenteuer mit einem Schuss Neo-Western.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 473
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Helden
Traveler-Reihe – Band 7
Tom Abrahams
Übersetzt von Raimund Gerstäcker
© 2019 Tom Abrahams
Dieses Buch ist frei erfunden. Sämtliche Namen, Charaktere, Firmen, Einrichtungen, Schauplätze, Ereignisse und Begebenheiten sind entweder das Produkt der Fantasie des Autors oder wurden fiktiv verwendet. Jede Ähnlichkeit mit tatsächlichen Personen, lebend oder tot, Ereignissen oder Schauplätzen ist rein zufällig.
Für Courtney, Sam und Luke. Sie sind meine Helden.
Impressum
Deutsche Erstausgabe Originaltitel: HERO Copyright Gesamtausgabe © 2023 LUZIFER Verlag Cyprus Ltd. Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Cover: Michael Schubert Übersetzung: Raimund Gerstäcker
Dieses Buch wurde nach Dudenempfehlung (Stand 2023) lektoriert.
ISBN E-Book: 978-3-95835-822-5
Sie lesen gern spannende Bücher? Dann folgen Sie dem LUZIFER Verlag aufFacebook | Twitter | Pinterest
Sollte es trotz sorgfältiger Erstellung bei diesem E-Book ein technisches Problem auf Ihrem Lesegerät geben, so freuen wir uns, wenn Sie uns dies per Mail an [email protected] melden und das Problem kurz schildern. Wir kümmern uns selbstverständlich umgehend um Ihr Anliegen.
Der LUZIFER Verlag verzichtet auf hartes DRM. Wir arbeiten mit einer modernen Wasserzeichen-Markierung in unseren digitalen Produkten, welche Ihnen keine technischen Hürden aufbürdet und ein bestmögliches Leseerlebnis erlaubt. Das illegale Kopieren dieses E-Books ist nicht erlaubt. Zuwiderhandlungen werden mithilfe der digitalen Signatur strafrechtlich verfolgt.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über
Inhaltsverzeichnis
»Heldentum ist, immer noch einen weiteren Moment zu überstehen.«
– George F. Kennan, amerikanischer Historiker und Diplomat –
Prolog
17. März 2054, 21:00 Uhr 21 Jahre und 6 Monate nach dem Ausbruch Eine Meile südlich des Walls, Nord-Texas
Der Späher pfiff. Die Luft war rein. Zeit, zu verschwinden.
Andrea Cruz war schon jetzt außer Atem. Ein Schweißfilm überzog ihr Gesicht und ließ ihr langes, obsidianschwarzes Haar auf der Stirn kleben. Mit einer Hand umfasste sie die Unterseite ihres Bauches und spürte die leise Bewegung des Lebens, das in ihr heranwuchs. Mit der anderen umklammerte sie das Handgelenk ihres Sohnes. Der Sechsjährige war still. Kein einziges Wort hatte er in der letzten Stunde dieser zermürbenden Reise gesagt.
»Ich kann nicht mehr«, sagte sie atemlos zu dem Mann, der sie führte. »Wir werden es nicht schaffen. Es ist zu weit.«
Der Mann, der ihr gesagt hatte, sie solle ihn Zorro nennen, schüttelte den Kopf. Obwohl er flüsterte, war der Frust in seiner Stimme deutlich zu hören. »Wir gehen jetzt weiter, oder ich lasse dich hier zurück.«
»Ich habe dich bezahlt«, beschwerte sie sich.
»Nicht genug«, sagte Zorro. »Ja oder nein? Kommst du mit oder bleibst du hier?«
Schnaufend verfluchte sie den Mann und wischte sich mit der Rückseite ihres Unterarms über die Stirn. »Gut«, sagte sie. »Wir gehen weiter.«
Sie kauerten hinter einem dunklen, zweistöckigen Gebäude am nördlichen Rand der namenlosen Stadt, ganz in der Nähe der mit einem Wall bewehrten Grenze, die Texas von den ehemaligen Vereinigten Staaten von Amerika trennte. Es war eine wolkenlose Nacht, nicht gerade geeignet für den Versuch, sich auf die andere Seite des Walls in die Freiheit zu schleichen.
Der Mond stand im ersten Viertel und reflektierte gerade genug Sonnenlicht, um die Landschaft in ein mattes Weiß zu tauchen. Zwischen dem Stadtrand und dem Wall gab es nichts als tote Felder und gelegentlich eine Baracke oder einen Wachstand.
»Haltet euch gebückt«, sagte Zorro. »Wir überqueren die Straße und schlagen uns ins Feld. Dort sind wir geschützt durch das hohe Gras. Bleibt ja unten.«
»Bueno«, sagte sie. »Verstanden.«
Zorro steckte sich zwei Finger in den Mund und pfiff. Der Späher erwiderte das Zeichen. Zorro begann zu rennen, geduckt, als wiche er unhörbaren Schüssen aus, und sprintete über den Highway in Richtung des Feldes.
Andrea griff ihren Sohn mit beiden Händen, packte ihn unter den Armen und hob ihn an ihre Hüfte. Sie rannte hinterher. Ihre Füße schmerzten, ihre untere Rückenpartie ebenfalls. Ihr Sohn wimmerte leise, während er hin und her geschaukelt wurde, und beschwerte sich auf diese Weise, dass er Hunger hatte.
In diesen kurzen Sekunden, in denen sie über den Highway lief, fühlte sie sich nackt. Der Mond leuchtete ihr viel zu hell. Ihre Schritte, so behutsam sie ihre Füße auch auf den rissigen Asphalt des Highways aufzusetzen versuchte, dröhnten laut in der leisen, windstillen Nacht.
Sie hatte Zorro ihr letztes Geld gegeben, damit er ihnen bei der Flucht auf die nördliche Seite des Walls half. Wenn sie es jetzt nicht schafften, würden sie nie wieder eine Chance bekommen.
Der Wall war so sehr eine Barriere zwischen Freiheit und Unterdrückung, wie er es immer gewesen war. In gewisser Weise war er nur das erste Hindernis auf dem Weg zu einem Leben, das zumindest an so etwas wie Selbstbestimmung erinnerte.
Vor Jahren, nach dem Ausbruch der Krankheit, aber noch vor der Dürre, hatte die Regierung den Wall errichtet, um den Zusammenbruch der Zivilisation auf Texas zu begrenzen. Damals hatte eine lose zusammenhängende Gruppe von Banden, die sich das Kartell nannte, rücksichtslos die Kontrolle über die Region südlich des Walls übernommen. Dann war das Kartell untergegangen, niedergekämpft von den Dwellern. Sie waren noch schlimmer gewesen als das Kartell und hatten, nachdem auch sie untergegangen waren, ein Machtvakuum hinterlassen. Zahlreiche kleinere, miteinander konkurrierende Banden waren das Ergebnis gewesen. Texas war wieder zum Wilden Westen geworden. Daran hatte sich in den letzten zwei Jahrzehnten nichts Wesentliches geändert.
Statt von einem straff organisierten Kartell oder von Gruppen mit strukturierten Hierarchien beherrscht zu werden, war Texas zu einem Niemandsland geworden, nicht mehr als ein loser Zusammenschluss von unterschiedlichen Einflussgebieten. Die Grenzen blieben unscharf, und die Starken zwangen den Schwachen oder Ängstlichen ihren Willen auf.
Die Regierung, oder das, was davon übrig war, konzentrierte sich hauptsächlich auf ihren militärischen Arm, der Recht und Ordnung mit harter Hand durchsetzte. Ihr Haupteinflussbereich lag zwar nördlich des Walls, aber sie war auch in Texas vertreten. Sie betrachtete es als ihre Aufgabe, die anarchischen Tendenzen in Schach zu halten und dafür zu sorgen, dass sie nicht auf das übergriffen, was einst die Vereinigten Staaten gewesen waren.
Aber das war nicht alles. Es gab noch einen weiteren Grund, warum die Regierung ihre Truppen in den Pinienwäldern, in den Ebenen und im Hügelland des Lone Star State umherstreifen ließ.
Nachdem es jahrelang praktisch nicht geregnet hatte, waren die Ernten und der Viehbestand stark zurückgegangen. Die Wirtschaft war zusammengebrochen. Die Regierung hatte verkündet, es gebe zu viele Menschen und nicht genug Nahrung. Deshalb war Andrea auf der Flucht.
Sie erreichte das Feld, auf dem sich vor allem trockenes Unkraut ausbreitete. Beinahe ihr Kind fallen, als sie auf dem unebenen Boden über eines der dichten, hüfthohen Grasbüschel stolperte. Im letzten Moment griff Zorro hinter einem der Büschel hervor und hielt sie fest.
»Gracias«, sagte sie und ließ sich neben ihn auf die Knie sinken. Das Atmen fiel ihr schwer. Ihre Brust schmerzte jetzt genauso wie ihr Rücken. Langsam setzte sie ihren Sohn auf den Boden ab. »Danke für deine Hilfe.«
Zorro nickte und erhob sich wieder, um über das Gras hinweg in Richtung des Walls zu spähen. Er hockte sich wieder hin, beugte sich zu ihr und balancierte dabei auf seinen Zehen und Fingerspitzen. »Wir werden etwa dreißig Sekunden lang rennen, so schnell wir können, und dann anhalten«, flüsterte er. »Da draußen steht eine alte Viehtränke, verrostet, voller Dreck und toter Tiere. Geradeaus vor uns. Dort stoppen wir.«
»Eine Viehtränke?«
»Na sowas wie eine große Metallschüssel«, sagte Zorro und machte große kreisende Bewegungen mit seinen Händen. »Du weißt schon, für die Kühe, damit sie trinken können. Las vacas, si?«
»Bueno«, antwortete Andrea. »Lo intiendo. Ich verstehe. Kühe. Hay agua? Ist da Wasser?«
Zorro warf ihr einen Blick zu, der fragte, ob sie den Verstand verloren hatte. Natürlich war da kein Wasser. Wie sollte es da Wasser geben? Diese Frage war zu dumm, um sie mit etwas anderem als einem spöttischen Grinsen zu beantworten.
Er flüsterte wieder: »Andale. Vamanos.«
Bevor sie antworten konnte, war Zorro auf den Beinen und rannte wie ein Fuchs. Er huschte durch das Gras und war außer Sichtweite, bevor sie auch nur einen Schritt gemacht hatte. Diesmal trug sie ihren Sohn nicht, sondern hielt seine Hand. Sie bewegten sich gemeinsam vorwärts. Das Gewicht ihres Bauches zog an ihrem Rücken und belastete ihre Knie und Füße. Jeder Schritt war schmerzhaft und mühsam. Sie zog ihren Sohn mehr, als dass sie ihn führte. Er war zu langsam, um mit ihr Schritt zu halten. Er wimmerte wieder und beschwerte sich, sein Arm tue weh. Andrea ignorierte ihn und lief weiter.
In ihrem Kopf zählte sie in ihrer spanischen Muttersprache bis dreißig. »Veinte-dos, veinte-tres, veinte-cuatro …«
Dann sah sie Zorro. Sein Kopf und seine Augen ragten aus einem hohen Unkrautbüschel heraus. Unkraut war das Einzige, was jetzt noch verlässlich wuchs.
Er winkte ihr mit beiden Händen zu und gestikulierte hastig, sie solle sich beeilen. Im fahlen Licht sah sie seine vor Adrenalin geweiteten Augen. Der Schleuser wirkte angespannt und drängte sie vorwärts. Als sie nur noch wenige Schritte von ihm entfernt war, veränderte sich sein Gesichtsausdruck plötzlich. Seine dicken Brauen zogen sich zusammen, und Zorro wandte sich von ihr ab und blickte über seine Schulter, als hätte er etwas gehört.
Andreas Atem, das Schlurfen ihrer Füße, das Wimmern ihres Sohnes und das pulsierende Pochen in ihren Ohren machten es ihr schwer, etwas anderes wahrzunehmen. Aber der blitzartig die Nacht durchzuckende Knall des Schusses war nicht zu überhören. Er zerriss die trockene, stille Luft im selben Moment, in dem Zorros Kopf zurückschnellte und sich sein Körper unnatürlich verdrehte. Andrea keuchte und ließ sich instinktiv zu Boden fallen, wobei sie ihren Sohn mit sich riss.
Der Junge schrie vor Schmerz, vor Verwirrung, aber Andrea zog ihn mit aller Kraft an sich. Sie legte ihre ganze Hand auf seinen Mund, zog ihn an ihren Körper, an ihren Bauch, und schaukelte ihn im Schutz des hohen, toten Unkrauts hin und her.
»Schhhh, mijo«, flüsterte sie, mit einem dicken Klumpen im Hals und Augen voller Tränen, die ihre Sicht trübten. »Schhhh.«
Ein paar Schritte von ihr entfernt, halb verdeckt durch die trockene Vegetation, lag Zorros Körper zusammengesunken auf dem Boden. Seine Augen waren weit aufgerissen und starrten sie an. Sie schloss die Augen, was die Tränenflüssigkeit herausdrückte und über ihre Wangen laufen ließ. Ihr Körper zitterte und widersetzte sich störrisch auch der größten Anstrengung, möglichst unhörbar zu bleiben. Wenn sie es nur schaffte, unhörbar zu bleiben …
Dann knirschten Schritte durch das Feld. Stimmen, zwei oder drei, sprachen in gedämpftem Ton. Andrea versuchte, sie trotz des pulsierenden Pochens in ihren Ohren zu verstehen. Das Blut, das Adrenalin, das durch ihren Körper rauschte, war zu viel für sie.
Zitternd legte sie ihre Lippen an das Ohr des Jungen und flüsterte ihm ins Ohr, bat ihn, still zu sein, flehte ihn an, so reglos wie möglich zu bleiben.
»Sei eine Statue«, sagte sie zu ihm. »Tu so, als wäre es ein Spiel.«
Es war zu spät. Eine der Stimmen war jetzt über ihr. Sie blickte auf und sah einen Mann, der ihr die Hand reichte. Das Mondlicht umrahmte die Umrisse seines Körpers. Im Gegenlicht lag sein Gesicht im Schatten, sodass Andrea nichts darin erkennen konnte. Seine Stimme jedoch war erstaunlich freundlich.
»Nimm meine Hand«, sagte er sanft. »Ich helfe dir hoch.«
Andrea zögerte und drückte ihren Jungen fester an sich. Sie blinzelte die Tränen weg, die ihr noch immer in den Augen standen, und schüttelte den Kopf.
»Ich tue dir nichts«, sagte der Mann. »Komm ruhig mit. Ich gebe euch Wasser und etwas zu essen.«
Andrea wollte ihre Hand heben, zögerte, dann streckte sie sie aus. Seine kräftigen Finger waren schwielig und rau. Sie gehörten zu Händen, deren Besitzer seit langer Zeit bei jedem Wetter im Freien arbeitete.
Er zog sie auf die Beine und hielt sie fest. »So ist es gut«, sagte er, wobei sein Südstaaten-Akzent über die Worte tanzte und die Vokale dehnte, als würde er sich mit jeder einzelnen Silbe Zeit lassen.
Mit dem anderen Arm hielt Andrea ihren Sohn fest. Der Junge klammerte sich an sie, die Beine um ihre Seite geschlungen und die Hände fest in ihrem Nacken verschränkt.
Jetzt, im Stehen, sah sie zwei weitere Männer. Einer der beiden balancierte ein Gewehr auf der Schulter. Der andere, ein dünner, drahtiger Mann, der seiner Statur nach ein Junge hätte sein können, zeigte auf sie. Selbst in der Dunkelheit kam er ihr bekannt vor.
»Das ist sie«, sagte der Dünne mit einer hohen Stimme, die zu seiner Körperform passte. »Sie hat Zorro bezahlt.«
Jetzt wusste Andrea, wer er war. Ihr Kiefer spannte sich an, und Wut verdrängte die Angst. Das war der Späher, der Mann, der Zorro signalisiert hatte, der Weg sei frei.
»Was soll das?«, fragte sie mit gepresster Stimme. »Was ist hier los?«
Der Mann, der ihr aufgeholfen hatte, stemmte die Hände in die Hüften. Er war groß, breitschultrig und trug ein Basecap auf dem Kopf. Der Schirm der Mütze verdunkelte seine Augen und machte es unmöglich, sie zu sehen.
»Nun«, sagte er, warf einen Blick in Richtung des Dünnen und ging nicht auf die Frage von Andrea ein, »ich glaube, man muss kein Genie sein, um mitzubekommen, dass das hier die Frau ist, die Zorro bezahlt hat. Ich meine, sieh sie dir doch mal an. Vermutlich wird ihr Baby gleich jetzt bei uns schlüpfen.«
Die beiden anderen Männer kicherten. Für Andrea war die Situation ganz und gar nicht lustig. Sie hob ihren Jungen höher auf ihre Hüfte.
»Wer seid ihr?«, brachte sie mit sich vor Frustration überschlagender Stimme heraus. »Was habt ihr vor? Warum habt ihr Zorro getötet?«
Der Mann mit dem Basecap rieb sich das Kinn, dann streckte er erneut die Hand aus und hielt sie ihr hin. Andrea blickte darauf, nahm sie aber nicht. Der Mann zuckte mit den Schultern und ließ die Hand sinken.
»Also gut«, sagte er. »Schon klar. Ich nehme es dir nicht übel. Du bist Andrea Cruz? Du brauchst nicht zu antworten. Ich weiß, dass du Andrea Cruz bist. Und der Kleine in deinen Armen ist Javier. Javi, stimmt‘s?«
Andrea zuckte bei der Erwähnung des Kosenamens ihres Sohnes zusammen. Woher wussten sie das?
»Das Baby«, sagte der Mann mit dem Basecap. »Hast du ihr schon einen Namen gegeben?«
Ihr? Woher wusste er, dass es ein Mädchen war? Wie um alles in der Welt konnte er von ihrem kleinen Mädchen, ihrer Mija, wissen? Woher wusste er das? Nicht einmal Zorro hatte es gewusst.
»Oh, entschuldige bitte«, sagte er und drehte sich halb zu den beiden anderen Männern um, während er sprach. »Ich bin so unhöflich. Ich wollte nicht unhöflich sein. Das bringt der Job einfach mit sich, weißt du? Sicher verstehst du, dass wir hier draußen am Wall mit Nettigkeiten nicht viel am Hut haben. Das Leben ist hart hier. Dabei geraten gute Manieren leicht unter die Räder. Soll keine Entschuldigung sein, nur eine Erklärung.«
Der Mann nahm sein Basecap ab und entblößte einen kahlen Kopf, auf dem sich das Mondlicht spiegelte. Er hielt die Mütze an seine Brust und verbeugte sich. »Mein Name ist Warner. Das hier ist Blessing. Er hat geschossen. Es war ein sehr guter Schuss, wenn ich das sagen darf. Der kleine, dürre Kerl da drüben, der uns alles über dich erzählt hat, heißt Frankie.«
»Was wollt ihr?«, wiederholte Andrea. »Hast du nicht gesagt, du hättest Wasser?«
Warner setzte sein Basecap wieder auf und lächelte. »Ja, das habe ich tatsächlich gesagt, nicht wahr? Blessing, gib Miss Andrea hier etwas Wasser. Und gib Javi ein Stück Jerky. Ich wette, der Junge hat schon eine ganze Weile nichts mehr gegessen. Wie lange seid ihr schon unterwegs? Vier Tage, nicht wahr? Und die ganze Strecke von Giddings bis hierher zu Fuß?«
Blessing machte einen Schritt nach vorn und stieg dabei über Zorros Körper, um ihr eine Feldflasche zu reichen. Er schüttelte die Flasche aus verbeultem Aluminium ein paar Mal in ihre Richtung. Das Wasser schwappte hörbar.
Andrea betrachtete die Feldflasche zögernd, dann nahm sie sie. Sie schraubte den Deckel ab und ließ ihn an der Kette baumeln, mit der er am Hals des Behälters befestigt war. Zuerst schnupperte sie an der Öffnung. Ihr Blick huschte zu Blessing und dann zu Warner, bevor sie ihrem Sohn das Wasser gab.
Javi legte seine kleinen Hände auf die seiner Mutter und trank gierig, während sie die Flasche für ihn hielt. Aus seinen Mundwinkeln liefen kleine Rinnsale, bis sie die Flasche wegzog.
Der Junge hielt noch immer Andreas Hand und schnappte nach Luft, um wieder zu Atem zu kommen. Er versuchte, die Feldflasche wieder anzusetzen, aber sie hielt ihn davon ab. »Nicht zu viel auf einmal, mein Mijo«, sagte sie. »Ich will nicht, dass dir schlecht wird.«
Er wischte sich mit der freien Hand über den Mund und klammerte sich mit der anderen verlegen an ihr fest. Andrea setzte die Feldflasche an ihre Lippen und trank. Wie lange war es her, dass sie etwas getrunken hatte? Stunden? Einen ganzen Tag? Sie ließ das Wasser in ihren Mund rinnen, spülte es in den Wangen hin und her und schluckte. Sie schloss die Augen und genoss es. In dem Moment war es ihr egal, woher es kam.
»Trink ruhig aus«, sagte Warner. »Wir haben genug. Gib Javi auch noch etwas, wenn du willst. Kein Grund zur Eile.«
Sie senkte die Feldflasche, hielt sie an ihre Brust und leckte sich die Lippen. »Ihr seht nicht gerade wie Soldaten aus«, sagte sie. »Wo sind eure Uniformen?«
»Wie kommst du denn nur auf so eine Idee?«
Der Späher kicherte. Warner warf ihm unter der Krempe seiner Mütze hervor einen Blick zu. Der Mann versteifte sich und verstummte.
Andrea gab die noch geöffnete Feldflasche zurück. Warner blickte darauf und gab Blessing ein Zeichen, die Flasche zu nehmen. Andrea legte eine Hand auf ihren Bauch, die Finger weit gespreizt, und streichelte darüber, als wolle sie das Kind trösten, das noch in ihr war.
»Nur die Garde tötet Menschen am Wall«, sagte sie. »Nur die Soldaten der Garde … tun, was sie tun.«
»Schön und gut«, sagte Warner. »Sagen wir es mal so: Ich habe es nicht so mit Uniformen. Ich bin eher ein Freigeist.«
Andrea wies auf Blessing, sprach aber zu Warner. »Was ist mit ihm?«
»Blessing?«, fragte Warner. »Er gehört zu mir. Guter Mann. Toller Schütze. Bruder Blessing kann ein Staubkorn in einem Wirbelsturm treffen.«
Jetzt war es Andrea, die sarkastisch auflachte. »Guter Mann?«, fragte sie und ließ ihre Hand schützend auf ihrem Bauch. »Das war wohl alles andere als eine gute Tat.«
Warner hob einen Finger und wedelte damit. »Das ist nicht fair, verstehst du? Erstens bin ich nicht derjenige, der hier das Gesetz bricht. Ich bin nicht derjenige, der versucht hat, sich über die Grenze zu schleichen.«
Er rückte sein Basecap zurecht und schob es dabei etwas nach hinten. Zum ersten Mal sah Andrea seine Augen. Sie waren schwarz. Schwärzer als ihr Haar. Schwärzer als die Nacht. Sie schienen fast das gesamte Licht um sie herum aufzusaugen. Andrea konzentrierte sich wieder auf ihren Bauch, und ihr lief ein Schauer über den Rücken. Sie presste die Hand fester auf ihre Mitte.
»Und schon gar nicht bin ich derjenige … in deinem Zustand«, sagte er und dehnte das letzte Wort, als ob es ihm schwerfiele, es auszusprechen. »Aber das wissen wir doch beide, nicht wahr, Andrea?«
Eine Welle der Übelkeit durchflutete sie. Es war nicht die Art von Übelkeit, die morgens im ersten Trimester auftrat. Es war eine, die eine Schwäche aus ihrem Innersten bis in ihre Finger und Zehen trug.
Ein breites Lächeln durchzog Warners Gesicht und er nickte dem Jungen zu. »Wie fühlst du dich, Javi?«
Der Junge saß jetzt auf dem Boden. Sein Kopf schwankte bedenklich, als könne er ihn nicht mehr lange halten. Seine Augen waren schmal. Er murmelte etwas Unverständliches.
Andrea hockte sich hin und legte ihre Hände auf seine Schultern. »Javi? Mijo?«
Er schwankte und sein Kinn fiel ihm auf die Brust. Sein Körper sackte bewusstlos in ihre Arme. Aus dem Augenwinkel bemerkte sie, wie Blessing mit der Feldflasche hantierte.
Während die Übelkeit nachließ, stieg die Wut wieder an. Andrea hielt ihren Sohn fest umklammert und schrie Warner an, wobei sie ihn zweisprachig beschimpfte. »Was hast du getan? Was hast du meinem Sohn gegeben? Was war in dem Wasser?«
Warner zuckte mit den Schultern. »Nur eine Kleinigkeit, damit er schlafen kann.«
In diesem Moment spürte Andrea die ersten Auswirkungen des Mittels, das man ihr verabreicht hatte. Die Umgebung verschwamm vor ihren Augen und sie begann, das Gleichgewicht zu verlieren. Sie versuchte, ihren Sohn hochzuheben. Sie versuchte, aufzustehen. Aber weder das eine noch das andere gelang ihr. Stattdessen sank sie zu Boden, und die Welt drehte sich ruckartig im Uhrzeigersinn um sie herum. Das Letzte, was sie sah, war Warner, der neben ihr stand und Blessing befahl, etwas zu tun, was sie nicht ganz verstand. Dann wurde die Welt schwarz.
Kapitel 1
16. April 2054, 15:30 Uhr 21 Jahre und 7 Monate nach dem Ausbruch Chatham, Virginia
Marcus Battle schnappte sich die Schrotflinte vom Küchentisch und betrachtete die sich nähernde Bedrohung auf dem Wanddisplay. Das Bild schwenkte weiträumig von einer Seite zur anderen und zeigte das weitwinklige Sichtfeld einer Überwachungskamera, die in einem Baum am Rande der großen Farm versteckt war.
Obwohl es später Nachmittag war und das helle Sonnenlicht das Bild durch die geringe Auflösung der Kamera noch unschärfer machte, war es deutlich genug, um die Position des bewaffneten Eindringlings auf seinem Grundstück auszumachen. Jemand kam von der Straße aus, zu Fuß. Der ungebetene Besucher hatte noch etwa eine Viertelmeile Weg vor sich an der Scheune im hinteren Teil des Grundstücks vorbei zum Eingang des bescheidenen Wohngebäudes.
Marcus hatte genug Zeit gehabt, die Schrotflinte zu holen, die er im Schlafzimmerschrank aufbewahrte. Er hätte auch die Neun-Millimeter-Glock 19 nehmen können, die in der Messerschublade neben dem Herd lag, aber die Schrotflinte war ihm bedeutend lieber. Er hatte vor, dem Eindringling ganz nahe zu kommen, so nahe, dass er ihm in die Augen blicken konnte, bevor er abdrückte.
Es war schon ein paar Monate her, dass zuletzt unangemeldete Besucher sein Land betreten hatten. In diesen Tagen kamen immer weniger Eindringlinge. Die Dürre hatte die Menschen aus dem flachen, vertrockneten Hügelland hin zu den Seen oder an die Küste getrieben. Auf eine seltsame Art und Weise vermisste Marcus die Auseinandersetzung mit den fehlgeleiteten oder böswilligen Seelen, die unbefugt sein Grundstück betraten und etwas suchten, das er nicht bereit war zu teilen. Wie ein ignoriertes Kind, das sich nach Aufmerksamkeit sehnt, selbst nach negativer, sehnte sich Marcus in seinem einsamen Dasein nach Interaktion jeglicher Art. Die Schrotflinte versprach diese Interaktion auf eine Art und Weise, wie sie die anderen, weniger persönlichen Formen der Selbstverteidigung nicht bieten konnten.
Marcus schob sich durch die Hintertür und bewegte sich lautlos von der überdachten Terrasse auf der Rückseite des Hauses in das angrenzende Waldstück. Er war barfuß, und der dichte Teppich aus bronzefarbenen Kiefernadeln dämpfte seine Schritte. Er bahnte sich seinen Weg zwischen den hohen, absterbenden und toten Kiefern hindurch, die immer noch demjenigen Schatten spendeten, der unter ihrem Dach unterwegs war.
Die Stolperdrähte und die anderen Fallen, mit denen er immer wieder Fremde abgewehrt hatte, waren nicht mehr aktiv. Doch sie hatten ihm gute Dienste geleistet, und er hatte vor, sie wieder in Betrieb zu nehmen. Er hatte eine Menge Dinge vor, die ihm immer schwerer fielen.
Seine Knie schmerzten und die Arthritis in seinen Schultern flammte auf, als er in einem weiten Halbkreis vom Haus weg nach Osten eilte. Die trockene Luft war warm, Schweiß rann über seine Stirn. Er hielt die Waffe, eine Mossberg Shockwave, die er vor ein paar Jahren eingetauscht hatte, mit beiden Händen. Kurze Zeit später erreichte er einen Punkt, an dem er wieder auf gleicher Höhe mit dem Haus war. Hinter der alten, baufälligen Scheune, die mehr Brennholz als Gebäude war, fand Marcus den perfekten Platz, um die herannahende Bedrohung zu beobachten. Obwohl ihm das Lesen zunehmend Schwierigkeiten bereitete, konnte er alles, was in der Ferne lag, so klar wie durch ein Fernglas erkennen. Aufmerksam beobachtete er den Eindringling.
Marcus suchte das Grundstück ab, das mit gelegentlichen Baumstümpfen und den Überresten eines hölzernen Viehzauns abgegrenzt war, aber er sah sonst niemanden auf seinem Land. Es schien ein einzelner Mann zu sein, der eine Pistole im Holster an seiner Seite trug. Der Mann ging langsam, wie jemand, der am Ende einer langen Reise ist. Er lehnte sich in seine Schritte hinein und hob kaum die Stiefel, während er vorwärts schlurfte und eine Wolke aus Staub und Schmutz hinter sich her zog.
Der Gang des Fremden und die Art, wie er sich bewegte, kamen ihm vage bekannt vor, aber Marcus konnte es nicht genauer einordnen. Jedenfalls gab es niemanden, den er heute oder in nächster Zeit erwartete.
Marcus wartete, bis der Mann, der weiter auf das Haus zusteuerte, an ihm vorbeigegangen war. Dann arbeitete er sich um die Scheune herum in Richtung Westen vor. Wieder schlug er einen weiten Bogen, bis er hinter dem Mann war, und verringerte dann schnell den Abstand. Als der Fremde ihn kommen hörte, war es bereits zu spät. Marcus hob die Schrotflinte und hielt sie in Brusthöhe vor sich. Laut hörbar lud er die Waffe durch und befahl dem Mann, die Hände zu heben.
Sie waren nur noch wenige Schritte von der Veranda entfernt. Marcus war Herr der Lage, und der Mann wusste es. Er senkte den Kopf und blickte über seine Schulter nach hinten.
»Ich habe Menschen schon für weniger umgebracht, als meine Veranda ohne Einladung zu betreten«, sagte Marcus. Mit den Jahren klang seine Stimme immer rauer. Soweit er sich erinnern konnte, immerhin war das ein gutes Vierteljahrhundert her, wurde er darin seinem Vater immer ähnlicher.
Der Fremde sagte zunächst nichts. Er tat wie ihm geheißen, hob die Hände über den Kopf und hielt sie dort.
»Bist du bewaffnet?«, fragte Marcus. »Ich bin mir ziemlich sicher, dass du bewaffnet bist.«
»Ja«, sagte der Fremde. »Die Pistole an meiner Seite.«
»Ich nehme dir jetzt die Waffe ab«, sagte Marcus. »Du bewegst dabei nicht einmal einen kleinen Finger. Wenn du es doch tust, werde ich dich gleich hier erledigen. Und das wird mich wütend machen, weil ich gerade erst die Veranda sauber gemacht habe. Hast du mich verstanden?«
»Alles klar.«
Marcus trat einen Schritt zurück und nahm die Schrotflinte in eine Hand. Er näherte sich dem Fremden von der Seite, griff mit der anderen Hand die Pistole und zog sie aus dem Lederholster, das am Gürtel des Mannes befestigt war.
»Ich bin nicht hier, um deine Brust zu durchlöchern«, sagte der Fremde.
Marcus steckte die Pistole in seinen Hosenbund, nahm die Schrotflinte wieder mit beiden Händen und stellte sich dem Mann frontal gegenüber.
»Da hast du verdammt recht«, sagte er und bereitete sich innerlich darauf vor, seinem Überraschungsgast eine Standpauke darüber zu halten, was es üblicherweise nach sich zog, wenn man ohne Einladung sein Land betrat. Dass der Mann überhaupt noch lebte, verdankte er nur dem Umstand, dass Marcus im Laufe der Jahre ein anderer geworden war. Der Marcus früherer Tage hätte diesen ungebetenen Gast schon längst ins Jenseits befördert gehabt.
Während er sich noch seine Worte zurechtlegte, kniff er die Augen zusammen und konzentrierte sich auf das Gesicht des Mannes. Es kam ihm irgendwie bekannt vor …
Der Fremde, der vielleicht erahnte, dass Marcus ihn erkannte, lächelte vorsichtig. Er sah den alten Mann an und wandte dann den Blick ab, als könnte zu langes Starren Marcus dazu bringen, doch noch den Abzug zu betätigen.
»Ich bin wegen Lou hier«, sagte der Mann. »Sie braucht deine Hilfe.«
Marcus spürte den Stich eines Wurfmessers in seinem Herzen. Lou. Er hatte diesen Namen seit Jahren nicht mehr laut ausgesprochen. Noch länger war es her, dass jemand anderes ihn gesagt hatte. Auf keinen Fall würde sie irgendeinen fremden Typen schicken, der auch noch viel zu leicht seine Waffe hergab. Niemals.
»Das bezweifle ich«, sagte Marcus und versuchte, seine Überraschung und Skepsis zu verbergen. »Wenn Lou etwas von mir bräuchte, was ich stark bezweifle, würde dieser Knallfrosch selbst zu mir kommen und mich fragen.«
»Das kann sie nicht«, sagte der Fremde. »Es ist zu gefährlich.«
Marcus studierte das Gesicht des Mannes. Es waren seine Augen, die ihm vertraut vorkamen. Vielleicht auch die Form seines Kiefers.
»Kennen wir uns?«, fragte Marcus.
»Ja«, sagte der Mann. »Ich bin Dallas. Dallas Stoudemire.«
Dallas Stoudemire.
Marcus zuckte zusammen, als er den Namen hörte. Er kannte diesen Mann tatsächlich. Diese Ausgabe von Dallas hier war nicht so schlaksig, wie er ihn in Erinnerung hatte. Er war fülliger geworden. Die Bartstoppeln an seinem Kinn hatten sogar ein paar graue Flecken. Oder sah er da blonde Haare?
Trotzdem hielt er weiter die Waffe auf den Eindringling gerichtet. »Warum sollte Lou dich zu mir schicken, Dallas? Was hast du mit ihr zu tun? Und was will sie von mir?«
»Kann ich meine Hände runternehmen?«, fragte er. »Sie sind ziemlich schwer und ich bin schon eine ganze Weile gelaufen. Ich bin müde und habe riesigen Durst.«
Marcus trat einen weiteren Schritt zurück und musterte Dallas von oben nach unten. Wenn dieser Typ der Dallas war, an den er sich erinnerte, dann war alles gut. Wenn er es nicht war, und die meisten Menschen waren nicht mehr dieselben, die sie vor elf Jahren gewesen waren, war es klug, ihn weiterhin mit der Waffe in Schach zu halten.
Marcus winkte mit der Schrotflinte in Richtung des hölzernen Schaukelstuhls mit der hohen Rückenlehne, der auf der Veranda in der Nähe der Tür stand. Dallas folgte mit seinen Augen.
»Wie wäre es, wenn du dich auf den Stuhl dort drüben setzt?«, fragte Marcus. »Entspann dich. Wir werden uns in Ruhe unterhalten. Wenn ich dir abkaufe, was du mir zu verkaufen versuchst, spendiere ich dir etwas zu trinken.«
»Abgemacht«, sagte Dallas. Er schlenderte die paar Schritte und setzte sich. Sein Gewicht ließ den Stuhl auf den gebogenen Kufen hin und her schaukeln. Die Kieferholzdielen der Veranda knarrten.
Noch im Hinsetzen griff er in seine Jacke.
Marcus hielt ihn auf. »Stopp!«, rief er. »Was machst du da?«
»Oh, sorry«, sagte Dallas und hob seine Hände, wobei er Marcus die offenen Handflächen zeigte. »Mein Fehler. Lou hat mir etwas mitgegeben, das ich dir zeigen soll. Es erklärt so ziemlich alles.«
»Immer schön langsam«, sagte Marcus.
Dallas nickte bedächtig und zog mit einer Hand langsam seine Jacke auf, während er mit der anderen in die Innentasche griff. Er fischte ein rechteckiges Stück Papier heraus und hielt es Marcus zwischen Zeige- und Mittelfinger hin.
»Hier, bitte«, sagte er. »Sieh dir das an.«
Marcus' Augen tanzten zwischen dem Papier und Dallas hin und her, während er sich vorsichtig näherte. Er blieb misstrauisch gegenüber dem Mann, den er einst gekannt haben mochte. Schließlich schnappte er sich das Papier und machte sogleich einen Schritt zurück, um den Sicherheitsabstand zwischen sich und seinem Besucher wiederherzustellen.
Dallas wippte mit dem Stuhl vor und zurück, wobei er sich mit den Zehen auf der Veranda abstieß. Obwohl er für Marcus viel zu bequem dasaß, um eine tatsächliche Bedrohung sein zu können, hielt er dennoch mit einer Hand die Schrotflinte auf ihn gerichtet, während er mit der anderen das Papier umdrehte. Was er sah, kostete ihn seine ganze Kraft, um nicht die Fassung zu verlieren. Ein dicker Klumpen bildete sich in seiner Kehle, und er biss sich auf die Innenseite seiner Wange, um die Tränen zurückzuhalten.
Es war ein Farbfoto. Es glänzte. Es war neu. Marcus strich mit dem Daumen über die glatte Oberfläche. »Woher hast du das?«
Dallas zuckte mit den Schultern, während sich seine Füße immer noch auf und ab bewegten. »Es gehört mir.«
Marcus runzelte die Stirn. »Nein, ich meine, wie um alles in der Welt ist es dir gelungen, ein Foto zu bekommen?«
»Ich habe einen Drucker«, sagte Dallas. »Eines Tages war ich unterwegs, auf der Suche nach allem Möglichen. Ich fand das Gerät in einem verlassenen Haus auf einer Farm. Rudy hat es repariert. Der Drucker ist nicht der beste, aber wir haben etwas Tinte und Fotopapier. Der Drucker ist alt. Alt im Sinne von vor dem Ausbruch der Seuche hergestellt. Funktioniert aber noch.«
Marcus fragte nicht, warum sie wertvollen Strom für den Betrieb eines Druckers verschwendeten. Oder warum Dallas Plündertouren unternahm. Oder wie er auf die Idee kommen konnte, ausgerechnet einen Drucker und Tinte aus einem verlassenen Haus mitzunehmen. Südlich des Walls war die Lage scheinbar immer noch eine andere, primitivere. Zumindest war es früher so gewesen. Marcus konnte sich nicht sicher sein, wie es jetzt aussah. Und er war sich ganz und gar nicht sicher, ob er es wissen wollte. In diesem Moment war das Bild in seiner Hand das Einzige, was ihn interessierte.
Das Foto hatte einen goldenen Farbton, als wäre es kurz vor Sonnenuntergang aufgenommen worden. Es waren fünf Personen zu sehen. Niemand lächelte. Das Bild erinnerte Marcus an das berühmte Gemälde American Gothic, das ein Farmerpaar aus dem Mittleren Westen zeigt. Der Mann hält eine Mistgabel. Sowohl der Mann als auch die Frau haben einen mürrischen Gesichtsausdruck. Der Mann starrt geradewegs aus der Leinwand heraus den Betrachter an. Die Frau schaut nach links, als hätte etwas ihre Aufmerksamkeit auf sich gezogen.
Anders als auf dem Gemälde kannte Marcus die Namen der Personen auf dem Foto. Auf der linken Seite war Rudy Gallardo. Er sah dünner und grauer aus, als Marcus ihn in Erinnerung hatte. Die Zeit und die Dürre hatten diesen Effekt auf die Menschen, und er fragte sich, wie viel älter er für Dallas aussah.
Neben Rudy war seine Frau Norma. Wundersamerweise hatte sie sich kaum verändert. Sie wirkte so stark wie eh und je. Ihre Füße standen schulterbreit auseinander und sie hatte ihren Arm um Rudys Schulter gelegt. Ihr Blick war so energisch, wie Marcus ihn in Erinnerung hatte.
Auf der anderen Seite des Fotos war Dallas zu sehen. Marcus hob kurz den Kopf und blickte auf das reale Gegenüber auf seiner Veranda. So wie es aussah, war das Foto vor nicht allzu langer Zeit aufgenommen worden. Dallas entsprach seinem fotografischen Abbild fast bis ins letzte Detail.
Auf dem Foto lag seine Hand auf dem Kopf eines kleinen Jungen mit nacktem Oberkörper und wilden Haaren. Das Kind war vier oder fünf Jahre alt. Der Junge hielt eine leere Messerscheide aus Leder gegen seine olivfarbene Haut, und seine Shorts hingen locker an seiner Taille herunter. Zweifellos war er der Sohn seiner Mutter. Der Junge war ihr wie aus dem Gesicht geschnitten.
Auf der anderen Seite des Jungen, in der Mitte des Bildes, befand sich eine Frau, die Marcus wiedererkennen würde, egal, wie lange er sie nicht gesehen hatte. Louise.
Lou.
Auch sie war älter geworden. Aus ihrem Gesicht war auch die letzte Spur des Babyspecks verschwunden, der ihre Wangen bis ins späte Teenageralter immer ein klein wenig pausbäckig hatte wirken lassen. Sie trug ihr Haar kürzer, schulterlang, und das einst allgegenwärtige Astros-Basecap fehlte auf ihrem Kopf.
Eine ihrer Hände war hinter dem Rücken des Jungen. Die andere hielt sie unter dem vorstehenden Bauch, der den Stoff ihres geblümten, knielangen Kleides spannte. Marcus hielt sich das Foto noch dichter vor die Augen, um sicherzugehen, dass es sich nicht um eine optische Täuschung oder einen Blendeffekt handelte. Es war weder das eine noch das andere.
Lou war mit ihrem zweiten Kind schwanger. Und das war ein Todesurteil.
Kapitel 2
16. April 2054, 16:00 Uhr 21 Jahre und 7 Monate nach dem Ausbruch Chatham, Virginia
»Wie konnte das passieren?«, fragte Marcus, der sofort begriff, was das Foto bedeutete. Es gab einen guten Grund, warum niemand in die Kamera lächelte.
Dallas hörte auf zu schaukeln und kicherte. »Soll ich dir erklären, wie …?«
»Nein«, sagte Marcus ohne jeden Anflug von Humor in seiner Stimme. »Mir geht es nicht um das Wie, sondern um das Warum. Wie konnte sie so dumm sein? Lou war nie eine von den Dummen. Streitlustig, sarkastisch und eigensinnig, ja. Aber nicht dumm.«
Das Lächeln auf Dallas' Gesicht verflog. »Das ist es also, was du uns sagen willst? Du hast uns seit sechs Jahren nicht mehr gesehen, oder? Keine Briefe. Keine Besuche. Keine Nachrichten irgendwelcher Art. Und das Erste, was du sagst, ist, dass wir dumm sind?«
In seinen Worten schwang deutlicher Ärger mit. Dallas' Gesicht war angespannt. Sein Blick, der zuvor warm und freundlich gewesen war, wurde kalt und verurteilend.
Marcus ließ seine Waffe sinken und stellte sich vor Dallas hin. Er blieb bewusst über ihm stehen und sah auf ihn hinunter, während er sprach.
»Meine erste Frage war, warum du hier bist«, korrigierte Marcus und hielt das Foto hoch. »Ich schätze, diese Antwort habe ich bekommen.«
»Sie braucht – wir brauchen – deine Hilfe, Marcus«, sagte Dallas, und der Klang seiner Stimme wurde wieder weicher. »Ich habe das Geld, das ich noch hatte, aufgebraucht, um hierher zu kommen. Du musst mit mir zurück nach Baird kommen. Du bist der Einzige, der uns aus der Patsche helfen kann.«
Marcus stieß geräuschvoll die Luft aus. »Da bin ich mir nicht so sicher.«
»Über welchen Teil davon?«
»Alles davon«, sagte Marcus. »Ich bin mir nicht sicher, ob ich den Wall noch einmal überqueren will. Und ich bin mir nicht sicher, ob du es bemerkt hast, aber ich bin nicht mehr der fitte und noch halbwegs junge Veteran, der ich einst war. Ich tippe mal darauf, dass du leicht jemanden findest, der besser qualifiziert ist als ich.«
»Können wir darüber nochmal reden?«, fragte Dallas. »Vielleicht gehen wir rein und nehmen uns einen Schluck zu trinken?«
Marcus seufzte, trat zurück und gab Dallas ein Zeichen, aufzustehen. Die beiden gingen ins Haus und betraten den Flur des hundertfünfzig Jahre alten Farmhauses. Mit leisem Klappern fiel die Fliegengittertür hinter ihnen zu.
Drinnen war es dunkel. Durch die Fenster drangen Streifen von Tageslicht, in denen der Staub tanzte. Die Fenster waren innen wie außen vergittert. Die Holzböden, ungeschliffen und uneben, knarrten unter den Füßen, als Marcus seinen Gast durch einen schmalen Flur führte, der an zwei Zimmern auf beiden Seiten vorbei in die Küche im hinteren Teil des Hauses führte.
Die Küche war heller als der Rest des Hauses. Größere Fenster ließen die Nachmittagssonne herein. Die weißen Arbeitsflächen, Schränke und Bodenfliesen reflektierten das Licht und ließen den Raum heller und fast fröhlich erscheinen.
Marcus nickte in Richtung eines runden Eichentisches an einer Seite der Küche. Um den Tisch herum standen vier passende Stühle, alle gepolstert mit Stoffkissen, die mit geknoteten Schlaufen an den Sitzflächen und Rückenlehnen befestigt waren. Das Muster auf dem Stoff bestand aus roten Scheunen und Heuhaufen.
»Die Möbel waren schon da«, sagte Marcus. »Nicht mein Geschmack, aber ich lade auch eher selten Gäste ein.«
Dallas sagte nichts und zog einen Stuhl hervor, dessen Füße über den weißen Kachelboden schabten. Er ließ sich auf den Stuhl fallen und stützte sich mit den Ellbogen auf dem Tisch ab. In der Mitte des Tisches stand ein Einweckglas mit Honig, in dem ein Stück Wabe eingeschlossen war, als wäre es dort eingefroren.
»Ich habe dieses Haus ausgesucht, weil es abgelegen ist und so gut wie niemand weiß, dass ich hier bin«, erklärte Marcus. »Chatham erging es nicht so gut, als die Dürre begann. Ich glaube, ich bin vielleicht einer von zwei oder drei Menschen, die noch hier leben. Die Regierung lässt mich auch in Ruhe.«
»Dein neues Haus ist größer als das letzte«, sagte Dallas. »Wie lange bist du schon hier?«
Marcus griff in seinen Kühlschrank, der rumpelte und brummte, aber offenbar seine Funktion erfüllte. Er hob einen durchsichtigen Plastikkrug aus dem obersten Regal. Er war halb voll mit Wasser.
»Sind es sieben Jahre, seit ich von Lynchburg hierhergezogen bin?«, überlegte Marcus. »Kann auch etwas länger her sein, oder es ist seitdem doch weniger Zeit vergangen. Alles verläuft ineinander, um ehrlich zu sein.«
Er nahm zwei Gläser aus dem Schrank neben dem Kühlschrank, stellte sie mit einem Klirren auf die Steinarbeitsplatte und füllte beide. Er stellte den Krug auf dem Tresen neben dem Gewehr ab, trug beide Gläser zum Tisch und setzte sich Dallas gegenüber.
Marcus blickte auf das Foto, das vor Dallas auf dem Tisch lag, und wies mit dem Kinn darauf. Dallas folgte seinem Blick und betrachtete es. Es lag mit dem Motiv nach oben und war an einer Seite zerknittert und eingerissen.
»Ist das dein Junge?«, fragte Marcus.
Dallas ließ den größten Teil des Wassers in seinem Glas in seinen Mund laufen. Trotzdem schaffte er es, gleichzeitig ein verärgertes Stirnrunzeln zustande zu bringen. Er schluckte das Wasser hinunter und räusperte sich.
»Natürlich«, sagte er.
»Wollte nur sichergehen«, sagte Marcus. Er zuckte mit den Schultern und nahm einen Schluck Wasser.
»Deine Frage sagt mehr darüber aus, was du über Lou denkst, als über mich«, bemerkte Dallas.
»Mag sein«, überlegte Marcus.
»Sein Name ist David.«
»Wer?«
Dallas runzelte wieder die Stirn. »Der Junge. Mein Sohn. Sein Name ist David, nach Lous Vater.«
Marcus holte das Glas zu sich heran und nahm einen weiteren Schluck. »Ach so?«
»Sein zweiter Vorname ist Battle.«
Marcus hielt mitten im Trinken inne. Er blickte über das Glas hinweg auf das Foto. Er setzte das Glas ab, streckte die Hand aus und zog das Foto über den Tisch, über den das glänzende Papier wie Seide glitt. Er nahm es hoch und betrachtete es erneut. Er holte es sich nah vor die Augen und hielt es dann wieder mit ausgestrecktem Arm, wobei er abwechselnd die Augen weit aufriss und zusammenkniff.
»Bist du blind?«, fragte Dallas.
Jetzt war Marcus derjenige, der die Stirn runzelte und so tat, als sei er beleidigt. Er ließ das Foto sinken, ignorierte die Frage und schnaubte. »Blöder Name«, sagte er und legte das Foto zurück auf den Tisch.
»David?«
»Battle. War bestimmt deine Idee.«
»Was ist eigentlich dein verdammtes Problem mit mir?«, fragte Dallas. »Ich kann mich nicht erinnern, dass du früher dermaßen störrisch und unangenehm warst. Ich meine, du warst ganz sicher nicht der beliebteste Typ von Texas, aber du warst auch nicht das Arschloch, dem alle aus dem Weg gehen.«
Marcus tippte mit seinem Finger auf das Foto. »Mein Problem ist Folgendes. Du hättest es besser wissen müssen. Eins ist ein Segen. Zwei sind ein Fluch.«
Dallas hielt sein Glas mit beiden Händen auf dem Tisch und rieb beide Daumen daran auf und ab. Seine Augen waren auf den Tisch oder auf einen Punkt dahinter gerichtet.
»Mein Problem ist«, sagte Marcus, »dass du hier unangemeldet auftauchst, so tust, als sei nichts passiert, und ich soll alles stehen und liegen lassen und dir helfen.«
Er strich mit der Hand über den Tisch und wischte mit seinen Fingern eine feine Staubschicht zur Seite. Der Staub wirbelte auf und verflüchtigte sich.
»Mein Problem ist«, sagte Marcus, »dass du nicht mit deinem Kopf gedacht, sondern die Entscheidung deinem Schwanz überlassen hast. Damit hast du deine ganze Familie in Gefahr gebracht. Du hast Rudy und Norma in Gefahr gebracht. Und jetzt willst du mich in Gefahr bringen.«
Dallas' Augenbrauen zuckten und er hob seinen Kopf, um Marcus' Blick zu begegnen. Seine Augen glänzten. Sein Stirnrunzeln spiegelte jetzt mehr Traurigkeit als Ärger und Enttäuschung wider. Sein Mund ging auf, als wollte er etwas sagen, aber er tat es nicht.
»Was ist?«, fragte Marcus. »Spuck es aus. Du solltest langsam anfangen, überzeugender zu werden.«
Dallas schluckte schwer. »Wir dachten nicht, dass wir noch mehr haben könnten. Es hat so lange gedauert, das erste zu bekommen. Es war eine so schwierige Geburt, dass wir dachten, damit wäre das Thema durch.«
»Offensichtlich war es das nicht.«
Dallas‘ Kiefer war sichtlich angespannt, er hielt das Glas fest umklammert. »Ich bin nicht zu dir gekommen, um mir einen Vortrag anzuhören.«
»Warum bist du dann gekommen?«, fragte Marcus.
»Wir brauchen dich, um Lou und das Baby in Sicherheit zu bringen«, sagte Dallas. »Wir wissen von einem sicheren Ort. Sie nehmen Familien mit mehreren Kindern auf. Sie bieten ihnen Unterschlupf und halten die Soldaten der Garde fern.«
»Warum heuert ihr nicht einen von diesen Kojoten an?«, fragte Marcus. »Du weißt schon, diese Typen, die man dafür bezahlt, dass sie einen über den Wall bringen, in welche Richtung auch immer?«
»Du kannst ihnen nicht vertrauen«, sagte Dallas. »Sie liefern dich an die Garde oder die nächstbeste Bürgerwehr aus, wenn sie eine Chance auf mehr Geld oder Drogen oder was auch immer sehen.«
Marcus lehnte sich in seinem Stuhl zurück, wodurch sich das Stoffpolster unter seinem Gewicht auf unbequeme Weise verschob. Er rieb sich den Nacken. Seine Haut war trocken, fast lederartig, und die Berührung erinnerte ihn daran, wie alt er inzwischen war. Wie viele Jahre hatte er jetzt auf dem Buckel? Sechzig? Er hatte schon lange nicht mehr versucht, mitzuzählen. Sein Daumen fand eine verhärtete Stelle in der Nähe der Schädelbasis und massierte sie, um die Spannung zu lösen.
»Okay«, sagte Marcus, »sagen wir mal, ich beiße an. Sagen wir, ich verlasse die Annehmlichkeiten meines Zuhauses, was ich in der Vergangenheit mehr als einmal getan habe, und schaffe es, uns irgendwie nach Baird zu lotsen. Und was dann? Wir ziehen mit einer schwangeren Frau los, nach Norden in dieses … Walhalla?«
»Sie wird nicht mehr schwanger sein, wenn wir ankommen«, sagte Dallas. »Das Baby war schon fast unterwegs, als ich aufgebrochen bin.«
Marcus schüttelte den Kopf und schnaubte. »Ist das dein Ernst? Du weißt, dass da draußen alle möglichen bewaffneten Idioten auf der Suche nach kleinen und großen Schätzen unterwegs sind. Nicht nur die Garde sucht nach schwangeren Frauen oder Familien mit mehr als einem Kind. Und das ist nur das erste von mehreren Problemen.«
»Ich meine es ernst«, sagte Dallas. »Es wären du, ich, Lou und die beiden Kinder. Was ist das zweite Problem?«
»Du lässt deine Frau das Kind allein zur Welt bringen?«
»Du kennst Lou«, sagte Dallas, und der Hauch eines Lächelns zuckte um seine Mundwinkel. »Sie hört auf niemanden. Das ist das Eine.«
»Stimmt«, sagte Marcus. »Und was ist das Andere?«
»Rudy und Norma sind bei ihr.«
Beide Männer saßen ein paar Minuten schweigend da. Stille füllte den Raum zwischen ihnen. Hin und wieder tranken sie einen Schluck, wobei Dallas‘ Schlucke größer waren als die von Marcus. Als Dallas sein Glas leerte, kippte er es fast auf den Kopf, um auch den letzten Rest Flüssigkeit herauszuholen.
Auch Marcus trank aus und trug dann beide Gläser zurück zum Tresen, um nachzufüllen. Er brachte die Getränke an den Eichenholztisch und hob sein Glas in Dallas‘ Richtung, wobei er fragend den Kopf neigte.
»Glaubst du, dass es diesen Ort, von dem du gesprochen hast, wirklich gibt? Ich habe gehört, dass das alles nur Mythen und Legenden sind, um den Menschen ein wenig Hoffnung vorzugaukeln. Entweder das oder es ist eine Falle, um auch noch die Familien anzulocken, die sie nicht selbst gefunden haben. Die Garde jagt übrigens nicht nur hier Babys, sondern auch südlich des Walls. Und dann sind da noch die Stämme. Es ist ein harter Weg zum Wall, und wenn man ihn überquert hat, wird es noch härter. Ich kenne mich in der Gegend nördlich des Walls nicht so gut aus wie im Süden.«
Dallas lehnte sich im Stuhl zurück und ließ seinen Blick durch die Küche schweifen. Sein Blick wanderte von einer Seite des Raumes zur anderen, bevor er sich wieder auf Marcus konzentrierte. »Dafür, dass du sagst, du wärst hier draußen isoliert, scheinst du eine Menge mitzubekommen«, sagte Dallas mit einer Spur von Misstrauen in seiner Stimme. »Vielleicht stimmt deine Geschichte überhaupt nicht. Vielleicht bist du gar kein Einzelgänger, der Angst davor hat, den Menschen, die er angeblich liebt, wehzutun.«
Marcus schniefte und wischte sich mit dem Handrücken über die Nase. Er lächelte. Es war ein echtes Lächeln, wenngleich eines ohne Freude oder Humor. Es war das Lächeln eines Mannes, der verstand, dass niemand wusste, wer er war, was seine Beweggründe waren und wie er sein Leben so gut wie möglich zu meistern versuchte. Er stellte das Glas ab, stützte sich auf die Ellenbogen, verschränkte die Finger ineinander und schüttelte den Kopf.
»Ich habe nie gesagt, dass ich isoliert bin«, sagte er. »Ich schotte mich ab. Das ist ein Unterschied. Ich halte eine Schicht zwischen der Welt und mir. Das ist es, eine Schicht. Ich bin nicht von allem getrennt, Dallas. Das habe ich nie gesagt. Das weißt du doch. Ich habe mich immer wieder erklärt.«
»Wie du meinst«, sagte Dallas und schaute auf den Tisch, während er sprach, »für uns – für Lou – schienst du wirklich isoliert und von allem getrennt zu sein.«
Marcus blies die Backen auf und atmete hörbar aus. Er hatte Gespräche wie dieses schon geführt. Sogar viele Male. Sicher, es waren etliche Jahre vergangen. Aber hier zu sitzen, über seine Lebensentscheidungen zu reden und darüber, wie sehr er damit andere verletzt hatte, würde er nicht akzeptieren. Schon jetzt kratzte Dallas‘ Besuch an der Schutzschicht, die er sorgsam zwischen sich und allen, die ihm etwas bedeuteten, aufgebaut hatte.
»Ich mache das nicht mit. Du bist zu mir gekommen, Dallas. Wenn du über mein Leben urteilen willst, nimm die Tür und verschwinde. Ich bin sowieso nicht an einer Reise entlang der gelben Pflastersteinstraße, die nach Oz führt, interessiert. Das habe ich schon hinter mir.«
Dallas bewegte sich in seinem ungemütlicher werdenden Stuhl, der dabei leise knarrte. Er nahm einen weiteren Schluck Wasser, und sein Gesicht wurde weicher. »Tut mir leid«, sagte er. »Du hast recht. Ich bin nicht hier, um alte Wunden aufzureißen. Ich bin hier, um dich um Hilfe zu bitten. Wir brauchen dich, Marcus. Lou braucht dich.«
»Das hast du schon gesagt.«
»Wir wissen, wo sich die Zuflucht befindet«, sagte Dallas. »Es ist kein Mythos und keine Falle.«
»Woher weißt du das?«
»Ich weiß es einfach.«
Marcus studierte Dallas aufmerksam. Der Mann glaubte, was er sagte, selbst wenn er sich irren sollte. Nach so vielen Jahren an so vielen verschiedenen Orten konnte Marcus erkennen, wann jemand die Wahrheit sagte und wann er log. Vielleicht spielten die vielen allein verbrachten Jahre eine Rolle. Seine Sinne waren so geschärft, dass er schon kleinste Nuancen in der Mimik, im Tonfall und in den Körperbewegungen erkennen und interpretieren konnte.
»Okay«, sagte Marcus. »Wo müssen wir hin?«
»Einen Moment mal«, sagte Dallas. »Bevor ich dir das sage, will ich es wissen. Bist du dabei oder nicht?«
Marcus hob das Glas wieder vom Tisch, nahm einen Schluck und behielt Dallas im Auge. Das Wasser war immer noch kühl, aber näher an der Zimmertemperatur als beim ersten Glas. Er spülte es in seinem Mund hin und her und ließ sich Zeit, über die Frage nachzudenken.
Er wollte sein Zuhause nicht verlassen. Er hatte es einmal für eine Frau getan, die er nicht kannte. Das nächste Mal war es aus Rache gewesen. Alles andere als gute Gründe. Die erste Tat war so selbstlos, wie ein Mensch nur sein kann. Beim zweiten Mal hatte er aus purem Egoismus gehandelt.
Dieses Mal fühlte es sich an wie irgendetwas dazwischen. Es war selbstlos, Lou und den Kindern, die er nie kennengelernt hatte, zu helfen. Es war egoistisch, es für sich selbst zu tun, seine Schutzschicht aufzugeben und etwas zu unternehmen, das ihm das Gefühl gab, wieder Teil der Welt zu sein. Er schluckte das Wasser herunter und atmete aus.
»Ich bin dabei.«
Kapitel 3
Sally Miller zog sich die Kapuze ihres Hoodies über den Kopf und zog sie an den Kordeln zu. Sie atmete so tief ein, wie es ihre Lunge zuließ, und konzentrierte sich. Langsam, mit zusammengepressten Lippen, atmete sie aus.
»Bist du bereit?«, fragte sie und legte ihre Hand auf die Schulter der namenlosen Frau neben ihr. Natürlich hatte die Frau einen Namen, aber Sally kannte ihn nicht. Sie wollte ihn auch gar nicht wissen. Im Notfall war es besser, wenn sie alles glaubhaft abstreiten konnte.
Die Frau nickte und zog das Neugeborene näher an ihre Brust. Das Kind war in schwarzen Stoff gewickelt, ebenso wie die Frau. Sie mussten so unsichtbar wie möglich sein. Schließlich war das hier nichts Geringeres als die postapokalyptische Version der Underground Railroad, des Netzwerkes, das im 19. Jahrhundert geflüchteten Sklaven in die Freiheit half.
»Die nächste Station ist fünf Blocks entfernt«, flüsterte sie. »Bleib dicht bei mir. Du tust genau das, was ich dir sage, und zwar genau dann, wenn ich es dir sage. So funktioniert die Underground Railroad. Ich bin nur dein erster Schaffner. Ich bringe dich zum zweiten. Der zweite bringt dich zum dritten. Ich weiß nichts über deine Reise, abgesehen von meinem Abschnitt. Soweit alles klar?«
Die Frau nickte erneut. Ihre Augen waren weit aufgerissen, voller Angst und Argwohn eines Menschen auf der Flucht. Sally wünschte sich, sie könnte auch die Augen der Frau mit schwarzem Stoff abdecken. Sie waren so groß, so weiß, dass sie in der vergleichsweise dunklen Garage fast leuchteten.
Sally hielt zwei Finger hoch. »Ihr seid doch nur zu zweit, oder? Ich will nur sichergehen. Also zwei?«
»Ja«, antwortete die Frau mit zittriger Stimme. »Mein Mann ist bei unserer Tochter. Sie nehmen …«
Sally hielt der Frau ihre Hand vor den Mund und brachte sie zum Schweigen. »Das muss ich nicht wissen. Ich will es gar nicht wissen. Alles, was ich wissen muss, ist, dass ihr bei mir zu zweit seid und dass ihr meine Anweisungen genau befolgt.«
»Okay«, sagte die Frau. »Das kriege ich hin. Ich mache, was du sagst.«
Sally schenkte ihr ein schmales Lächeln und machte eine Kopfbewegung. »Hier entlang.«
Sie manövrierten sich zwischen Kistenstapeln, alten Fahrrädern und Gartengeräten hindurch zu einer Tür an der Seite der Garage. Die Frau stolperte über einen Stapel PVC-Rohre, aber Sally fing sie auf.
Sally streckte die Arme nach dem Kind aus. »Ich kann das Baby tragen, wenn du willst.«
Die Frau wandte sich von Sally ab, und ihre weißen Augen wurden schwarz, als sie sie zusammenkniff. Sie machte einen Schritt zurück und stolperte beinahe erneut, bevor sie wieder ihre Balance fand.
Sally winkte ab. »Kein Problem«, sagte sie und versuchte, die Frau zu beruhigen. »Es ist alles in Ordnung. Alles in Ordnung. Du trägst sie.«
»Es ist ein Junge«, sagte die Frau, und die in ihrer Körperhaltung sichtbare Anspannung ließ etwas nach. »Sein Name ist …«
Schnell hielt Sally der Frau aufs Neue den Mund zu. »Ich muss und will das nicht hören.«
Die Frau wirkte erst beleidigt, dass Sally den Namen ihres Kindes nicht wissen wollte. Dann überzog Verständnis ihr besorgtes Gesicht und sie nickte.
»Auf geht’s«, sagte Sally. Sie sah auf ihre Armbanduhr. »Wir sind fünfunddreißig Sekunden zu spät. Das müssen wir aufholen. Sobald ich die Tür öffne, musst du dich beeilen.«
Ohne ein weiteres Wort tippte Sally den elektronischen Code für das Garagentor ein, und es klickte. Sie zog die Tür gerade weit genug auf, um hindurchzupassen. Als die Frau mit dem Kind hinter ihr die Schwelle überschritten hatte, schloss Sally die Tür wieder. Ein Summen ertönte, und das Schloss rastete wieder ein.
Sie befanden sich im Herzen von Atlanta, dem Regierungssitz seit dem Ausbruch der Seuche. Sally erinnerte sich nicht an die Zeit, in der die Lungenerkrankung über die Welt gekommen war. Sie wusste nur noch, dass ihre Mutter und ihr Vater den Gewaltausbrüchen zum Opfer gefallen waren, die in der Folge um sich gegriffen hatten. Die Seuche hatte zwei Drittel der Weltbevölkerung getötet, die Gewalt einen Großteil der Übriggebliebenen. Sie hatte beides überlebt.
Jetzt schmuggelte sie Frauen aus der Hauptstadt in ein Gebiet außerhalb der Reichweite der Garde, der Eliteeinheit des Militärs, die für die Überwachung der viel zu niedrigen Geburtenrate zuständig war. Sie konnte jetzt einen Drink gebrauchen. Ihre Schläfen pulsierten. Ein ordentlicher Schluck direkt aus der Flasche wäre jetzt genau die richtige Medizin. Sie hätte vor der Mission einen Drink nehmen sollen. Sally öffnete eine zitternde Hand und ballte sie wieder zur Faust. Jetzt war kein guter Zeitpunkt, um von der einen Sache loszukommen, die ihr Halt gab und sie funktionieren ließ.
Sally eilte eine Gasse entlang, die hinter einem Häuserblock auf der Nordseite der Stadt verlief. Sie spürte die Frau neben sich, beschleunigte das Tempo und behielt es zwischen schnellem Gehen und Joggen bei. Sie widerstand dem Drang zu rennen. Zu große Eile würde nur die Aufmerksamkeit auf sie ziehen. Es war früher Morgen, und die einzigen Menschen, die um diese Zeit auf der Straße waren, waren Betrunkene, Nutten, betrunkene Nutten, Betrunkene auf der Suche nach Nutten und die Garde.
Sie erreichten das Ende der Gasse, und Sally streckte ihren Arm aus, um die Frau zu stoppen. Sie drückte sich gegen einen Holzzaun und spähte um die Ecke zu einer zweispurigen Straße, die nach Norden und Süden führte. Noch vier Blocks.
»Weiter geht’s«, flüsterte Sally.