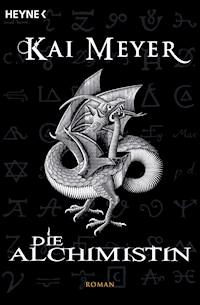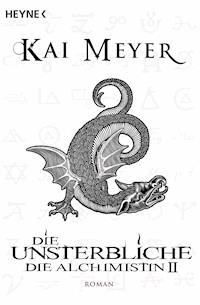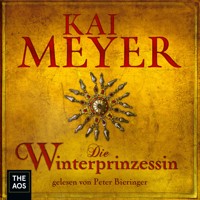Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Von Morgen Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Spannende Mittelalter Romane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2024
Das große Mittelalter-Epos von Bestseller-Autor Kai Meyer Tauchen Sie jetzt ein! Frühjahr 1210. Der Bürgerkrieg hat das Land verheert, und ein Raunen geistert durch Dörfer und Burgen: Eine neue Heilige predigt den Kreuzzug gegen die Ungläubigen. Doch nur Frauen sollen ihr folgen, unberührt und jung. Die Menschen nennen sie die Magdalena, aber in Wahrheit steckt im Gewand der Predigerin die junge Gauklerin Saga. Von der skrupellosen Gräfin Violante von Lerch in diese Rolle gezwungen, besitzt Saga ein besonderes Talent: Sie ist die beste Lügnerin der Welt. Was immer sie behauptet, die Menschen müssen ihr glauben. Während Saga mit tausenden Anhängerinnen gen Jerusalem zieht, macht sich ihr Zwillingsbruder Faun auf, sie aus den Fängen der Gräfin zu befreien. Gemeinsam mit der Herumtreiberin Tiessa folgt er dem Kreuzzug der Jungfrauen durch ein verwüstetes Europa, über das Mittelmeer bis ins Heilige Land. Nicht nur Gräfin Violante, auch der mächtige Templerorden, Papst Innozenz und sogar der Kaiser – ein jeder hat eigene mitleidlose Gründe, den Krieg der Jungfrauen gegen die Ungläubigen zu entfachen. Und Saga erkennt: Wenn es ihr nicht gelingt, ihre eigene Schwäche zu besiegen, wird sie fünftausend Unschuldige geradewegs in die Hölle führen. Als die Stunde der Entscheidung naht, steht Saga vor der größten Aufgabe ihres Lebens. Gemeinsam mit Faun und Tiessa kommt sie einer monströsen Verschwörungen auf die Spur – der Lüge im Herzen der Christenheit ... Spannend wie kein anderer verwebt Kai Meyer historische Fakten mit einer spannenden Abenteuergeschichte, epischen Schlachten und einer tragischen Liebe.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 1086
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Beliebtheit
Ähnliche
KAI MEYER
Der Roman über den Kreuzzug der Jungfrauen
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Michael Meller Literary Agency GmbH, München.
Copyright © Kai Meyer 2006
Covergestaltung: Jamie Designs
Copyright dieser Ausgabe © 2024 Von Morgen Verlag
Prolog in Flammen
Mensch und Gott
Lügengeist
Die lange Nacht
Die Abreise
Papstpalatst
Die beste Waffe
Der lebende Tote
Violantes Plan
Fauns Hinrichtung
Der Soldat und das Mädchen
Der Bethanier
Zweifel
Der Ruf der Magdalena
Herr der Lüge
Der Böse Weg
Verfolger
Tiessas Tanz
Das erste Opfer
Die Geschichte des Söldners
Burg Hoch Rialt
Am Abgrund
Maria und der Herzfresser
Nebelfrauen
Die Felsenburg
Drachenbrut
Falkenflug
Ins Dunkel
Die Unsterblichen
Die Archen der Verdammten
Die zerrissene Stadt
Zinders Abschied
Der Segen des Papstes
Lebende Legende
Das Attentat
Fonticus
Ein Wiedersehen
Blutspuren
Blinde Passagiere
Flucht
Der Tempel
Ein Segen des Papstes
Ein Gespräch unter Frauen
Trimvirat der Ordensritter
Tiessas Schicksal
Die Asche der Wahrheit
Die Flucht
Vor der Katastrophe
Blutbad
Die Besessene
Die Flotte der Sklavenjäger
Das Ende
Staub zu Staub
Katervater
Die Johanniterburg
Krak des Chevaliers
Am Basaltfluss
Gahmuret
Verbrannte Waffen
Unter Toten
Die letzte Jagd
Epilog
Nachwort des Autors
Leseempfehlung
»Es gab weibliche Ritter unter den Franken, mit Rüstungen und Helmen, gekleidet wie Männer, die ins dichte Schlachtgetümmel ritten und männliche Härte zeigten trotz der Schwäche ihres Geschlechts. Sie trugen Panzerhemden und wurden erst erkannt, als sie der Waffen entkleidet und entblößt wurden.«
Imad ad-Din, Saladins Sekretär, 12. Jahrhundert
»Frauen zogen in den fränkischen Reihen mit, saßen keck mit gespreizten Beinen nach Männerart im Sattel, trugen Männergewand und sahen mit ihren Lanzen und Rüstungen wie Männer aus, blickten auch ganz kriegerisch und taten noch männlicher als die Amazonen.«
Niketas Choniates, byzantinischer Chronist, 12. Jahrhundert
Prolog in Flammen
Anno Domini 1204
Sechs Jahre vor dem Kreuzzug der Jungfrauen
Die Nacht war aus Asche, als der Maskierte einen Weg durch das brennende Konstantinopel suchte. Die beiden Kinder an seinen Händen waren verstummt und blickten mit aufgerissenen Augen in die Zerstörung ringsum; sie weinten lautlos und mit starren Gesichtern.
Es roch nach Ruß und geöffneten Leibern, nach vergossenem Wein und dem Angstschweiß der Geschändeten. Wo der Maskierte die Pulks aus betrunkenen Eroberern umgehen konnte, tat er es so früh wie möglich. Meist hörte er die Schreie der Opfer, bevor er jemanden sah. Dann zog er seine beiden Söhne in die ausgebrannten Ruinen der Häuser, schlich durch Gassen, in denen sich der Schutt geborstener Fassaden türmte, suchte den Schutz der lichtlosen Keller.
Ihre Verfolger blieben unsichtbar. Doch der Maskierte spürte ihre Nähe.
Der kleinere der beiden Jungen stolperte – nicht zum ersten Mal. Der Mann fluchte leise, zerrte ihn zurück auf die Füße und wünschte insgeheim, er könnte sanfter sein, liebevoller, wie es sich für einen Vater gehörte.
Es war der dritte Tag der Plünderung, und noch immer wehten Feuer in lodernden Flammenstürmen über Dächer und Kuppeln Konstantinopels hinweg, schlängelten sich in zerfransten Glutspiralen an Türmen empor und fauchten hungrig durch die Gassen und einstigen Prachtstraßen. Dort, wo es für die Flammen am wenigsten zu holen gab, wüteten sie mit der größten Beharrlichkeit: in den Elendsquartieren am Stadtrand und am Ufer des Lycus, in den schäbigen Vergnügungsvierteln hinter dem Prospherionhafen und den Anlegestellen an der Südküste.
Nur in den Palästen waren alle Brände rasch gelöscht worden. Hier hatten die Eroberer eigenhändig jede Glut erstickt, damit ja kein Stück dem Feuerorkan zum Opfer fiel: Die Diener der Kirche Roms achteten sorgsam auf ihre Beute.
Der Maskierte war auf der Seite der Sieger gewesen, als der finale Angriff auf die Stadt begann. Vor über einer Woche, am sechsten April, war draußen am Goldenen Horn zur letzten Schlacht geblasen worden. Die Schiffe der Verteidiger hatten verzweifelt versucht, die Kreuzfahrer auf ihren venezianischen Galeeren von den Stadtmauern fern zu halten. Aber es hatte nicht lange gedauert, ehe die ersten Ritter aus dem Westen an Land gegangen waren. Das Viertel von Blachernae war zuerst gefallen, seine Stadtmauer geborsten, die Männer auf den Zinnen niedergemacht. Während der byzantinische Kaiser seinem Volk den Rücken kehrte und feige durchs Goldene Tor nach Thrazien floh, fielen seine Krieger unter dem Ansturm der Feinde, zusammengetrieben und massakriert wie Vieh. Die ältesten unter den Eroberern waren längst übereingekommen, dass es nie zuvor eine Plünderung wie diese gegeben hatte. Nirgends sonst waren die Kirchen vergoldet bis unters Dachgebälk, nirgends die Paläste bis zum Bersten gefüllt mit Reichtum. Konstantinopel war ihnen allen wie das Himmelreich erschienen. Doch die Hauptstadt von Byzanz, das Herz des östlichen Christentums, war gefallen. Das Paradies stand in Flammen. Und seine Einwohner waren tot, vertrieben, den Gelüsten ihrer Peiniger ausgeliefert.
Der Maskierte zerrte die Kinder vorwärts. Der Junge weinte jetzt noch heftiger, verschluckte sich fast an seinem Schluchzen.
»Er kann nicht mehr laufen«, sagte sein ältester Sohn, die ersten Worte seit einer Ewigkeit. »Du musst ihn tragen.«
Der Maskierte nickte stumm. Er, der so viele Kämpfe geschlagen hatte, fühlte sich hilflos wie nie zuvor. Selbst auf das Naheliegende war er nicht gekommen. Er packte den Kleinen unter den Achseln und hob ihn auf seine Arme. »Halt dich gut fest. Hörst du?«
Der Kleine schluchzte etwas.
»Hast du verstanden? Gut festhalten!«
So hetzten sie weiter, der Junge schwer und immer schwerer, den Kopf an die Schulter seines Vaters gepresst. Sein älterer Bruder, mit sechs Jahren selbst noch ein kleines Kind, stolperte neben ihnen her, mit kurzen Schritten, außer Atem, aber tapfer wie ein Erwachsener. Der Maskierte war maßlos stolz auf ihn. Er liebte beide Kinder, aber der Erstgeborene war ihm immer näher gewesen. Warum hätte er daraus ein Geheimnis machen sollen? Er hatte auch unter seinen Hunden Favoriten, die schnellen, die scharfen, all jene, die sich aufs Kämpfen verstanden.
Nicht mehr weit bis zur Aelios-Zisterne. Er konnte ihren schwarz gezahnten Dachstuhl sehen, Teile der zerfallenen Außenmauer über den unterirdischen Wassergewölben. Feuer wüteten im Inneren, er sah ihren Schein auf schwarzen Qualmballen über dem nördlichen Viertel. Von dort aus war es nur noch ein Steinwurf bis zum Charisius-Tor in der Stadtmauer. Dahinter lag im Norden und Osten offenes Land. Freiheit und Rettung, dafür betete er.
Bevor er gezwungen gewesen war, mit den Kindern die Flucht zu ergreifen, hatte er Boten an seine Getreuen ausgesandt. Sie lungerten auf dem weiten Platz vor der Hagia Sophia, auf den Foren des Konstantin und Theodosius, im Schatten des Valens-Aquädukts und auf der Rennbahn nahe des Bucoleon-Palastes, wo längst keine Pferde und Hunde mehr hechelten, sondern aus allen Richtungen Frauen zusammengetrieben wurden. Dem Geschäft des Tötens war das Geschäft des Raubens gefolgt, und es waren keine Stunden vergangen, ehe die Ersten das Geschäft des Fleisches entdeckt hatten. Nun wurden Kinder und Mädchen aus den Ruinen gezerrt, aus Verschlägen in halb verschütteten Kellern und Fluchtkammern hinter angekohlten Mauern, um den unersättlichen Appetit der Eroberer zu stillen.
Der Junge regte sich in seinen Armen. Der Maskierte umschloss den kleinen Körper fester.
Wenn nur ein Viertel seiner Getreuen dem Aufruf folgten, konnte er hoffen. Vielleicht sogar einige mehr, falls sie genug Kraft aufbrachten, um den Weg durch die Stadt zum Tor und zur Straße nach Adrianopel zu finden.
Lasst alles zurück, besagte seine Botschaft an sie. Sammelt euch und folgt mir. Gehorcht nur mir, nicht den anderen. Ich bin der, für den ihr kämpft. Und kämpft für meine Söhne!
Er verlangte viel von ihnen, das wusste er. Keiner von ihnen kannte die wahren Gründe für seine Flucht. Sie ahnten nichts von der geheimen Zusammenkunft und dem Vertrag. Ausgehandelt in nur wenigen Tagen hatte das Dokument ausgelöscht, was Jahrhunderte lang gewachsen war.
Er selbst hatte vorausgesehen, was geschehen würde. Den Angriff, den Untergang. Er hatte es zugelassen, wusste um seinen Teil der Schuld. Aber er hatte nicht den Geruch erahnen können, hatte sich nicht ausgemalt, wie es war, wenn Tausende von Kriegern über eine Stadt herfielen, mit der es nichts, rein gar nichts in ihrer Heimat aufnehmen konnte.
Nun blieb ihm nur die Flucht. Und die verzweifelte Hoffnung, dass er das Tor erreichte, ehe die anderen ihn fanden.
Der Maskierte bog mit den Kindern aus dem Gewirr der Gassen auf die Hauptstraße. Sie führte in gerader Linie vom Forum des Theodosius hinaus aus der Stadt. Der Vierjährige schluchzte noch immer an seiner Schulter, beinahe ein Röcheln, viel zu heiser für ein Kind. Vielleicht vom Rauch, vielleicht auch, weil er unter Schock stand und das Grauen keinen Unterschied kannte zwischen Alt und Jung. Linkisch strich der Mann ihm über den Rücken, doch er wusste, dass keine noch so zärtliche Geste den Schrecken mildern konnte.
Sie sahen das Tor vor sich, ein mächtiger Klotz aus grauem Gestein, so wuchtig wie die meisten Bauten an diesem verschwenderischen Ort. Der Maskierte zögerte. Auf den Zinnen standen keine Wachen. Womöglich würde ihre Flucht leichter sein, als er erwartet hatte.
Oder man hatte ihnen eine Falle gestellt.
»Gahmuret von Lerch!«
Die Stimme erklang hinter ihm. Sie hatten ihn gefunden. So kurz vor dem Ziel.
»Seht nicht hin!«, flüsterte er seinen Söhnen zu und wusste doch, dass sie nicht gehorchen würden.
Langsam, fast bedächtig setzte er den kleineren Jungen neben seinem Bruder ab. Dann zog er sein Langschwert und drehte sich um, schützte die Kinder so gut es ging mit seinem Körper.
»Bischof Oldrich.« Er nickte dem älteren Mann in der Straßenmitte zu, als wäre dies ein Wiedersehen zwischen alten Freunden. Aber der Maskierte, Graf Gahmuret von Lerch, hatte keine Freunde mehr, nicht seit heute Morgen, seit dem größten Vertrauensbruch von allen.
Geblieben waren ihm nur seine Söhne.
Bischof Oldrich von Prag trug keine seiner Insignien, die er sonst so selbstverliebt zur Schau stellte. Stattdessen war er zum Kampf gerüstet, in rußgeschwärztes Eisen von Kopf bis Fuß. Sein enger Helm ruhte auf einem schweren Kettenkollier. Die breiten Schulterprotektoren aus Stahl ließen ihn kräftiger erscheinen als er war; ein bodenlanger roter Umhang war mit einer Federkrause daran befestigt und beulte sich im rauchgeschwängerten Wind. Kleine Augen, so grau wie das Eisen seines Rüstzeugs, starrten unter dem Helm hervor, die verwüstete Straße entlang auf Gahmuret von Lerch und die beiden weinenden Kinder.
Das gute Dutzend Männer in Oldrichs Rücken zog die Schwerter blank. Kämpfer seiner Leibgarde. Der Bischof gönnte sich beim Ton ihrer Klingen jenes stolze Lächeln, das ihm daheim in Prag allein der Gesang der Chorknaben entlockte.
Einen Augenblick lang hatte Gahmuret keinen anderen Wunsch, als diese triumphierende Grimasse von den Zügen des Älteren zu schälen wie die Haut von einem Apfel.
Bischof Oldrich gab seinen Männern einen Wink. In breiter Reihe schoben sie sich an ihm vorüber, rückten geschlossen auf den Mann mit der Maske zu.
»Niemand entkommt aus der Hölle, Gahmuret, auch Ihr nicht!« Der Bischof umfasste die ausgebrannten Ruinen auf beiden Straßenseiten mit einer weiten Geste. Das Fanal der Flammen spiegelte sich auf seiner Rüstung. Zwischen den Trümmern waren keine weiteren Menschen zu sehen. Falls noch Leben in den Steingerippen dieses Viertels existierte, war es klug genug, sich zu verkriechen.
»Euer Pathos war schon immer schwer zu ertragen«, entgegnete Gahmuret und nahm die Maske ab. Einigen der Soldaten entwich beim Anblick seiner verwüsteten Züge ein Stöhnen. Monatelang hatte er vermieden, dass seine Söhne ihn so sahen; jetzt aber war es wichtiger, die Gegner zu verunsichern. »Ihr verkündet Prophezeiungen, seit ich Euch kenne, Bischof Oldrich, aber Ihr seid zu feige, selbst für ihre Erfüllung einzutreten.«
Die Krieger waren nur noch zehn Schritt von Gahmuret entfernt. Er überlegte, ob er versuchen sollte, vor ihnen davonzulaufen. Das Charisius-Tor war nicht weit, nicht einmal hundert Schritt, und er mochte es vor ihnen erreichen. Aber die Kinder würden nicht schnell genug sein. Und selbst wenn – draußen vor den Mauern würde man sie ebenso abschlachten wie hier im Inneren.
»Es tut mir leid um Euch, dessen seid versichert.« Oldrich nahm seinen Helm ab und klemmte ihn in die Armbeuge. »Ihr habt Euch tapfer geschlagen.«
Die Miene des Bischofs änderte sich nicht, nur der Flammenschein erzeugte die Illusion von Bewegung auf seinen Zügen. Gahmuret streckte das Schwert aus und zeigte damit in einem langsamen Halbkreis die Reihe seiner Gegner entlang. Hinter ihm wimmerte der kleinere der beiden Jungen; der ältere ergriff die Hand seines Bruders, war aber selbst zu verängstigt, um ihn zu trösten.
»Zwölf Männer gegen einen?«, sagte Gahmuret zum Bischof. »Die Kirche muss mich wahrlich fürchten.«
»Euer Wissen macht Euch zu einem gefährlichen Mann.« Gahmuret nickte. Statt weiter mit dem Bischof zu sprechen, wandte er sich an dessen Gefolgschaft. Die Gesichter der Männer wirkten entschlossen, kantig, unnahbar. »Bevor ihr mich tötet, werde ich dieses Wissen hinausbrüllen, sodass jeder von euch es hören kann. Und was, glaubt ihr, wird dann mit euch geschehen?«
Hier und da ein leichtes Zucken, das Runzeln einer Stirn, ein Flackern in rotgeränderten Augen. Zu viel Rauch, zu viel Tod. Aber genug Verstand, um den Sinn seiner Worte zu erfassen.
Fünf Schritte trennten die Männer von der Spitze seines Langschwertes. Es war eine starke Klinge, sie hatte schon seinem Vater gute Dienste geleistet.
»Wenn ihr wisst, was ich weiß, dann wird Oldrich auch euch töten lassen. Und wenn nicht er, dann jene, die meinen Tod beschlossen haben.«
Der Oberste der Garde hob die Hand. Er war der Einzige, der einen geschlossenen Helm trug. Die Männer blieben stehen.
»Zwölf Männer, Oldrich«, wiederholte Gahmuret. In seiner Linken hielt er immer noch die Maske. Seit der Schlacht um Zara war sie sein zweites Gesicht. »Wie viele werden nötig sein, um diese zwölf zu erschlagen? Hundertzwanzig? Und wie viele von denen werden es wissen, bevor sie diese hier zum Schweigen bringen?«
»Seid still!«, zischte der Bischof. Es klang, als hätte das Fauchen der Feuer Silben geformt.
»Erst wenn Ihr mich und meine Söhne gehen lasst.« Gahmuret fürchtete nicht um sein eigenes Leben, nur um das der Kinder. Sie waren Zeugen des Verrats an ihrem Vater.
Die Hand des Gardeführers war noch immer erhoben. Niemand regte sich. Gahmuret sah, wie es hinter den Gesichtern der Männer arbeitete. Aus seiner eigenen Miene konnte niemand mehr ablesen, was er dachte. Selbst sein Lächeln war ein vernarbter Albtraum. Er war froh, dass die Jungen hinter ihm standen und sein Gesicht nicht deutlich sehen konnten.
Er unterbrach die schwingende Halbkreisbewegung seiner Schwertspitze. Die Klinge an seinem ausgestreckten Arm zeigte jetzt auf den gesichtslosen Anführer.
Quer über den Hals des Gardeführers, gerade unterhalb des Adamsapfels, verlief eine scheußliche Narbe. Gahmuret hatte Geschichten über diesen Mann gehört, schreckliche Gerüchte. Er war bereits tot gewesen, hieß es. Nun tötete er, um weiterzuleben, sagte man.
Gahmuret fixierte die Augenschlitze. »Wenn ihr angreift, stirbst du zuerst«, knurrte er dem Mann entgegen. »Ganz gleich, was danach mit mir geschieht – du wirst sterben!« Das war eine alte List beim Kampf gegen eine Übermacht: Such dir einen aus und bedrohe ihn von Angesicht zu Angesicht. Nur ihn allein. Wenn du Glück hast, großes Glück, wird er unsicher und hält die Übrigen zurück.
»Tötet ihn!«, befahl der Bischof.
»Dich fällt mein Schwert«, sagte Gahmuret zum Gardeführer, »und euch andere mein Wissen.«
»Tötet ihn – oder ihr werdet alle sterben!«, keifte Oldrich.
»Ihr werdet sterben, wenn ihr mit anhört, was ich zu sagen habe. Und ich werde es jetzt sagen!«
Der Bischof stieß ein zorniges Brüllen aus. Falls es Worte waren, trug der Flammenwind sie davon. Der Gardeführer riss das Schwert nach oben.
Ein Raunen ging durch die Reihe der Krieger. Ihre Blicke geisterten an Gahmuret vorüber und entdeckten etwas in seinem Rücken, drüben am Charisius-Tor. Wildes Geschrei erhob sich dort. Eine Schar von Männern strömte durch den Steinbogen, flutete von außen herein in die Stadt.
»Graf Gahmuret!«, brüllte eine vertraute Stimme. »Ihr habt uns gerufen, und wir haben Euch draußen im Dunkel erwartet. Nun sehen wir, was Euch aufgehalten hat.«
Gahmurets Narbenlächeln wurde breiter. Sie waren tatsächlich gekommen. Weit mehr als ein Viertel, sogar mehr als die Hälfte seiner Männer. Treue, brave, kühne Seelen!
»Bringt meine Söhne in Sicherheit!«, rief er über die Schulter. Bischof Oldrich verengte die Augen, so als könnte er nicht erkennen, was da vom Ende der Straße näher kam. Vielleicht wollte er es nur nicht glauben.
Der Gardeführer mit dem vernarbten Kehlenschnitt streckte die Klinge in Gahmurets Richtung aus, bis sich die beiden Schwertspitzen berührten. Ein stählernes, tödliches Versprechen.
Irgendwo stürzte ein brennender Dachstuhl ein. Flammen krallten sich in den Himmel.
Eine neue Silhouette trat plötzlich vor wallende Funkenwolken.
Das Weinen der Kinder schwoll an – und verstummte.
Erstes Buch
Mensch und Gott
„Die Lüge ist der gemeinsame Code zwischen Mensch und Gott, die sich von Angesicht zu Angesicht gegenüberstehen und sich an der Geschicklichkeit in einer beiden bekannten Kunst erkennen, der Kunst der Lüge.“
Maria Bettetini, Philosophin
Lügengeist
Burg LerchAnno Domini 1210Sechs Jahre nach dem Untergang Konstantinopels
Hoch über dem Burghof verharrte Saga in der Luft. Sie balancierte mit nackten Füßen auf einem Seil, das sich vom Wachturm auf der Ostmauer hinüber zu einem Zinnenkranz im Westen spannte. Dreißig Schritt lagen zwischen den beiden Gebäuden. Dreißig Schritt Leere und ein Strick, nicht breiter als ihr Zeigefinger.
In der Tiefe ging ein Raunen durch die Menschenmenge. Alle Augen waren auf das Mädchen gerichtet, das in schwindelerregender Höhe sein Leben aufs Spiel setzte. Kinderhände krallten sich in das Leinenzeug ihrer Mütter. Männer, die den Markttag damit verbracht hatten, lautstark ihre Ziegen, Stoffe und Früchte anzupreisen, pressten gespannt die Lippen aufeinander. Ein lallender Betrunkener bekam von einem zweiten Zecher einen Schlag versetzt, der ihn stumm zu Boden schickte.
Dann verebbte auch das letzte Flüstern. Niemand rührte sich. Saga ertastete mit den Zehen die Markierung in der Mitte des Seils. Ihre Fußsohlen waren angespannt und leicht gekrümmt. Sie hatte beide Arme zur Seite ausgestreckt und hielt in jeder Hand eine lodernde Fackel. Vom Boden aus ließ die Nähe der Flammen ihren Mut noch größer erscheinen; tatsächlich aber hielt sie mit den Fackeln ihr Gleichgewicht.
Noch zwei weitere Schritte, bis ihr Zwillingsbruder Faun oben auf dem Westturm von ihrem Vater das vereinbarte Zeichen erhielt. Sie hatte ihm den Rücken zugewandt, aber sie wusste, dass Faun dort hinten auf das Trommelsignal wartete. Er stand breitbeinig auf den Zinnen, unweit des Abgrunds. Auch er hielt eine Fackel, am ausgestreckten Arm emporgereckt in den Abendhimmel.
Bewegungen unten im Burghof störten Sagas Konzentration. Sie ließ ihren rechten Fuß reglos über dem Seil schweben, um durch die Ablenkung nur ja keinen Fehler zu begehen. Es gab kein Netz dort unten, nichts, das sie auffangen würde, falls sie abstürzte.
Aber Saga stürzte nie. Sie hatte dieses Kunststück schon viele Dutzend Mal vorgeführt, ohne auch nur einmal aus dem Gleichgewicht zu geraten.
Jetzt aber irritierte sie der plötzliche Trubel im Hof. Als sie nach unten blickte, sah sie im Schein der Feuerbecken Eisen blitzen. Vier Burgwächter drängten sich vom Tor her durch die Menge. Die Menschen machten widerstrebend Platz. Starr verfolgte Saga den Weg der Bewaffneten zur Westseite des Hofes und verlor sie aus den Augen, als sie unter ihr hindurch waren; sie hätte sich auf dem Seil herumdrehen müssen, um ihnen hinterherzublicken. Trotzdem hörte sie das Murren der dicht gedrängten Menge, dann und wann die barschen Aufforderungen der Soldaten, unverzüglich zur Seite zu treten.
Schließlich ließ das Lärmen nach. Stattdessen polterten gedämpfte Schritte im Inneren eines Gebäudes, immer dann ein wenig lauter, wenn die Soldaten auf ihrem Weg die Treppe hinauf eine der Schießscharten passierten. Sie waren jetzt im Westturm.
Faun war der einzige Mensch dort oben.
Saga schwankte leicht, die Sorge machte sie unvorsichtig. Sie fragte sich, was er diesmal angestellt hatte. Dabei lag es doch auf der Hand. Das, was er immer tat.
Sie hätte ihrem Zwillingsbruder gern einen Blick über die Schulter zugeworfen, aber das hätte ihr Gleichgewicht noch stärker gestört. Ihr Herz schlug schneller als sonst. Ihre eingeübte Ruhe war auf einen Schlag wie fortgewischt.
Warum gerade jetzt? Warum schon wieder? Konnte Faun nicht einmal die Finger von den Sachen anderer Leute lassen?
Ihr rechter Fuß fand den Kontakt zum Seil. Ohne nachzudenken machte sie einen weiteren Schritt. Das war die vereinbarte Stelle, zwei Schritte nach der Hälfte des Weges. Unten im Burghof begann ihr Vater seine Trommel zu schlagen, erst leise, dann immer schneller und lauter. Die Zuschauer vergaßen die Störung durch die Soldaten, alle blickten wieder nach oben.
Saga wusste ohne hinzusehen, was Faun gerade tat. Sobald der Trommelwirbel seinen Höhepunkt erreichte, senkte ihr Bruder seine Fackel und steckte das Seil hinter ihr in Brand. Bis zur Mitte war es mit einem Ölgemisch bestrichen, an dem sich die Flammen in Windeseile entlangfraßen, ohne sofort den Hanf zu verzehren. Saga blieb genug Zeit, die andere Seite zu erreichen, bevor der Strick verbrannte und unweigerlich in die Tiefe fiel.
Hundertmal geprobt, fast ebenso oft vor Zuschauern aufgeführt. Sie und Faun waren perfekt aufeinander eingespielt. Sie teilten weit mehr als nur die Stunde ihrer Geburt: nahezu das gleiche Geschick als Artisten – er war der bessere Jongleur, sie kletterte flinker –, Fertigkeiten auf mehreren Musikinstrumenten, akzeptable Singstimmen. Allein aufs Stehlen verstand Faun sich besser. Er achtete darauf, nicht aus der Übung zu kommen.
Erschrockene Schreie wurden laut, als Faun die Fackel in einem glühenden Bogen senkte und das Seil in Brand setzte. Saga wusste, was die Menschen von unten aus jetzt sahen: Hinter ihr schoss eine flammende Spur durch den Abendhimmel, wie ein letzter Strahl der untergehenden Sonne im Westen. Das Feuer wanderte schneller, als Saga sich vorantasten konnte, aber auch das gehörte zum einstudierten Teil der Vorführung. Auf halber Strecke endete das Öl, jenseits davon war das Seil mit Wasser getränkt. Hier verharrten die Flammen für eine Weile und kamen ihr nicht näher.
Trotzdem blieben ihr nur wenige Augenblicke. Dann würde das verbrannte Seil reißen.
Alles aussperren. Das Seil ansehen. Die Verteilung deines Gewichts spüren. Ganz ruhig weitergehen.
Doch Saga zögerte – zum ersten Mal während all der Jahre, in denen sie mit ihrer Familie auf Burghöfen und Marktplätzen gastierte. In ihrem Rücken hörte sie das Klirren von eisernem Rüstzeug, dann grobe Stimmen. Ihr Vater schlug ununterbrochen die Trommel, darum konnte sie nicht verstehen, was hinter ihr gesprochen wurde. Nahmen die Bewaffneten Faun in Gewahrsam, weil er einmal mehr etwas an einem der Marktstände gestohlen hatte? Sie würden ihm hoffentlich nicht an Ort und Stelle etwas antun.
Das Wissen um die Zeit, die ihr auf dem brennenden Seil noch blieb, war ihr längst in Fleisch und Blut übergegangen. Gerade genug für einen Blick zurück.
Denk an dein Gleichgewicht! Mach jetzt nur keinen Fehler! Sie blieb auf der Stelle stehen. Drehte ihre Hüfte, dann die Schulter, zuletzt ihren Kopf. Aus dem Augenwinkel sah sie, dass sich die Burgwachen auf der Turmplattform drängten; einer verpasste Faun einen Schlag mit dem Schwertknauf.
»Nein!«, stöhnte sie.
Fauns Kopf – kahl rasiert nach Art der männlichen Gaukler – sackte nach vorn, dann brach er hinter den Zinnen zusammen. Zwei Soldaten packten ihn an den Armen und zerrten ihn hinab in den Turm. Ihre Brutalität entsetzte Saga. Faun hatte sich nicht mal zur Wehr gesetzt.
Am liebsten wäre sie zurückgelaufen, ungeachtet des Abgrunds und der Flammen. Sie musste sich zwingen, wieder nach vorn zu blicken und ihren Weg fortzusetzen. Wenn sie länger zögerte, würde sie abstürzen. Keine Zeit mehr. Sie musste weiter.
Der Trommelschlag setzte sich fort. Hatte ihr Vater nicht bemerkt, was geschehen war? Doch, sicher, er musste die Soldaten gesehen haben. Aber der Auftritt hatte Vorrang. So war es schon immer gewesen. Manchmal hasste Saga ihn dafür. Nichts war so wichtig wie das Gelingen der Vorstellung, die Begeisterung des Publikums – und, zu guter Letzt, die Münzen in den Holzschüsseln, mit denen ihre vier jüngeren Schwestern durch die Menge liefen.
Saga geriet erneut ins Schwanken. Sie durfte jetzt nicht an ihren Vater denken, nicht einmal an Faun. Horch nur auf die Trommel! Sie vertreibt alles andere, lässt dich schweben, macht dich leicht, ganz leicht.
Und weiter, mach schon!
Mit der Ruhe der Menge war es vorbei. Die Zuschauer tobten. Viele Aahs und Oohs ertönten, aufmunternde Rufe und, wie üblich, auch die Aufforderung des einen oder anderen Witzbolds, einfach stehen zu bleiben und abzuwarten.
Aber Saga konzentrierte sich nur auf die Trommel. Für gewöhnlich schärfte das alle Sinne. Nur das Gefühl in ihren Fußsohlen zählte und das Gleichgewicht ihrer ausgestreckten Arme. Das Gefährliche war, dass sie nicht spüren konnte, wie weit die Flammen das Seil bereits verzehrt hatten. Es würde keine Vorwarnung geben, ehe der Strick zu Asche zerfiel.
Die Trommel. Nur die Trommel war jetzt wichtig. Auf ihren Klängen musste sie sich treiben lassen, so als griffen ihr die Laute unter die Arme und trugen sie zu den Zinnen hinüber.
Saga starrte auf ihre Füße. Noch drei Schritte. Die Schärfe ihres Blickes verlagerte sich vom Seil und ihren Zehen zum Burghof tief darunter. Die Menge teilte sich, als die Bewaffneten Sagas Zwillingsbruder quer durch das Publikum zum Haupthaus schafften.
Zwei Schritte.
Die Rufe wurden lauter. Anfeuerndes Gebrüll stieg mit den Rußfahnen zahlloser Feuerbecken zu ihr auf. Die Trommelschläge hätten all das übertönen sollen, doch Sagas Konzentration war endgültig zerstört. Aus allen Richtungen schienen jetzt Geräusche auf sie einzudringen. Das Fauchen der hungrigen Flammen. Das Säuseln des frischen Abendwindes. Das Ächzen des brennenden Hanfstricks.
Fauns Gedanken inmitten der ihren: Achte nicht auf mich! Mach weiter! Beeil dich!
Seine Stimme war nur Einbildung, ebenso das Wispern der Flammen. Aber die Vorstellung gab Saga den nötigen Stoß nach vorn. Sie setzte alles aufs Spiel, federte einmal auf und nieder – viel zu stark! –, stieß sich ab, schleuderte die Fackeln nach beiden Seiten von sich und flog mit einem Satz auf den Zinnenkranz zu.
Hinter ihr zerfiel das Seil in einem Funkenregen. Wie eine brennende Ameisenstraße löste sich die hintere Hälfte in tausend Glutpartikel auf, die taumelnd in die Tiefe stoben. Die unversehrte Seite sackte unter Saga davon, zischte schlängelnd in den Abgrund und schlug im selben Moment gegen die Turmmauer, als Saga die Zinnen zu fassen bekam.
Niemand war da, um ihr zu helfen. Früher hatte dort ihre Mutter auf sie gewartet, doch seit ihrer Krankheit konnte sie keine Treppen mehr steigen.
Saga landete mit einem angezogenen Knie zwischen zwei Zinnen, stieß sich grauenvoll hart das Schienbein, verkeilte sich mit ausgestreckten Armen und zog sich blindlings vornüber. Einen Augenblick lang war ihr, als würde ihr zweites Bein sie zurückreißen, wie es da ausgestreckt über dem Abgrund baumelte und ihr plötzlich so schwer erschien wie Granit. Dann aber fiel sie vorwärts auf die Turmplattform, krachte auf die linke Schulter, rollte sich ab und blieb auf dem Rücken liegen.
Unten im Hof brandete Jubel auf. Hochrufe aus hunderten Kehlen, tobender Applaus, ausgelassenes Lärmen, Klatschen und Brüllen.
Saga lag auf dem Rücken, spürte jeden schmerzenden Knochen in ihrem Körper und bekam keine Luft. Es dauerte eine halbe Ewigkeit, ehe sie wieder atmen konnte. Ein schmerzerfülltes Lächeln flirrte um ihre Lippen. Sie hatte sich bepinkelt; das Leinen ihrer Beinlinge klebte warm und feucht an ihren Oberschenkeln.
Über ihr am dunkelblauen Himmel funkelte der erste Stern. Sie starrte ihn an wie etwas ungeheuer Schönes, vollkommen Einzigartiges.
Ich tue das niemals wieder, sagte sie sich und wusste es doch besser. Bis zur nächsten Burg, zum nächsten Ort, zum nächsten Markttag würde sie fluchen und schimpfen – und dann erneut auf ein Seil klettern und vor dem Feuer fliehen. Wie armselig, überlegte sie, seinen Lebensunterhalt damit zu verdienen, dass man vor etwas davonläuft. Und wie irrsinnig, dabei sein Leben aufs Spiel zu setzen.
Sie war dem Tod noch nie so nahe gewesen wie gerade eben. Er hatte die Hand schon nach ihr ausgestreckt, da oben auf dem Seil.
Nie wieder, es sei denn –
Faun!
Die Erinnerung verdichtete sich, das Bild der gerüsteten Wachleute in ihren leichten Kettenhemden und den wappenlosen Steppwämsern. Faun halb bewusstlos in ihrer Mitte.
Sie musste herausfinden, was mit ihm geschehen sollte. Heiliger Jesus, warum konnte er das Stehlen nicht sein lassen? Benommen rappelte sie sich hoch, kämpfte gegen ihren Schwindel. Die nassen Beinlinge rochen nicht schlimmer als die heiße Luft, die sich im Inneren des Burghofs staute und selbst hier oben noch ganz erbärmlich stank.
Im Dunkeln fand sie den Zugang zur Treppe und machte sich schwankend an den Abstieg.
Ihr Vater kam ihr im Schein der Feuerbecken entgegen, als sie gerade den Turm verließ. Er fasste sie an den Schultern. »Geht’s dir gut?«
»Ich hab mich bepinkelt.«
Er zerrte sie an sich und umarmte sie. Sie erwiderte die Geste nicht. Im Augenblick fiel es ihr schwer, ihn zu mögen. Vielleicht war auch seine Sorge nur Spiel, nur Gaukelei für die Augen der Zuschauer. Bei ihm konnte man nie ganz sicher sein.
»Wo ist Faun?«, fragte sie und entwand sich seinen Armen. »Hast du gesehen, wohin sie ihn gebracht haben?«
Die Züge ihres Vaters verhärteten sich. Sein Kopf war so stoppelig wie der von Faun – alle Männer unter den Gauklern schoren sich das Haupt, nur Mädchen und Frauen trugen langes Haar. »Lass uns jetzt nicht von ihm sprechen. Er hat einmal zu oft sein Glück herausgefordert und sich –«
»Nicht von ihm sprechen?« Sie trat einen Schritt zurück und wäre fast über die eigenen Füße gestolpert. Ihre Knie waren noch immer ganz weich. »Ich kann nicht glauben, dass du das ernst meinst.«
»Zuerst machen wir weiter«, beschwor er sie mit warnendem Unterton. »Später können wir hören, was sie ihm vorwerfen.«
»Er ist dein Sohn!«, brüllte sie ihn an, viel zu heftig, viel zu laut. Erst jetzt bemerkte sie, wie viele Menschen ihre Ankunft am Boden erwartet hatten, um sie jubelnd in Empfang zu nehmen. Doch die Gesichter, die ihr wie ein lebender Wall entgegenstarrten, blieben nun stumm. Alle schienen gespannt auf den Streit zu sein, der da zwischen Vater und Tochter entbrannte. Saga las in ihren Augen, was sie dachten: Es sind nur Gaukler! Lasst sie sich zerfetzen, vielleicht wird sogar das ganz amüsant.
Sie beschloss, die Meute zu ignorieren, und konzentrierte sich wieder auf ihren Vater. »Wir können nicht einfach zusehen, wie sie ihn in den Kerker sperren!«
Ihr Vater beugte sich an ihr Ohr, damit die Umstehenden seine Worte nicht hörten. »Faun ist ein Dieb, Saga. Er ist mein Sohn, und ich liebe ihn. Aber das ändert nichts an der Tatsache, dass er ein verfluchter Unruhestifter ist.«
»Hast du nie in deinem Leben gestohlen?«
»Ich hab mich nicht so oft dabei erwischen lassen.«
Sie starrte so fest es eben ging in seine Augen. Ihr Vater war ein strenger Mann, und manchmal vergaß er über alle Prinzipien sein Herz. Aber er war niemals kalt gewesen. Wenn es nun doch diesen Anschein hatte, dann konnte das nur eines bedeuten: Er hatte Angst. Angst um Faun, gewiss, aber noch mehr Angst um seine ganze Familie. Diebstahl war ein schweres Verbrechen, und es bestand nicht der geringste Zweifel, dass Faun schuldig war. Nicht einmal Saga konnte das bestreiten.
»Ich suche ihn.«
»Nein«, widersprach er heftig. »Das wirst du nicht! Wir kümmern uns später darum. Die Vorstellung ist noch nicht zu Ende.«
»Ich stinke nach Pisse. Ich kann jetzt nicht –«
»Dann zieh dich um. Eine Weile lang kann ich sie noch hinhalten.« Er deutete zu dem kleinen Podest, das der Gauklerfamilie als Bühne diente. Die Menge hatte ihre Aufmerksamkeit nun wieder dorthin verlagert. Sagas jüngere Schwestern zeigten im Fackelschein einen Entfesselungstrick. »Danach gehst du dort hoch und tust deine Arbeit«, fuhr ihr Vater fort. »Die Leute warten auf dich, Saga.«
Sie ließ ihn stehen und rannte los. Aber sie lief nicht zum Palas, in den die Burgwachen Faun verschleppt hatten, sondern hinüber zu einem der beiden Planwagen, in denen die Familie durch die Lande reiste.
Die Leute warten auf dich, hatte ihr Vater gesagt. Gemeint hatte er nicht sie, sondern den Lügengeist. Die Seilnummer, die Entfesselungskünste, die Späße – all das diente nur als Vorspiel für die wahre Attraktion des Abends.
Saga hasste sich dafür, dass sie ihrem Vater gehorchte. Nach dem, was heute mit Faun geschehen war, noch mehr als sonst.
Die Wagen standen unweit des Podests am Rand des Hofes. Ihre bunt bemalten Planen aus gefettetem Leinen dienten als Hintergrund der Bühne.
Ihr Vater hatte lange gezögert, ehe er sich entschieden hatte, die Einladung der Gräfin zu einem Auftritt anzunehmen. Die Lage in der Grafschaft war angespannt, seit Violante von Lerch und ihr Mann Gahmuret sich während des Thronstreits auf die Seite Philipps von Schwaben gestellt hatten. Zwar war Philipp schließlich gekrönt worden – um dann aber, vor zwei Jahren, von einem seiner Verbündeten ermordet zu werden. Nun herrschte sein Erzrivale Kaiser Otto IV. über das Heilige Römische Reich, und die Mitläufer des Schwaben mussten um Leib und Leben fürchten.
Die Grafschaft Lerch war Otto gewiss ein Dorn im Auge, und sich länger als nötig hier aufzuhalten mochte ein Fehler sein – auch für Gaukler und Spielleute. Letztlich aber hatte Sagas Vater das ungewöhnliche Ersuchen der Gräfin zu sehr geschmeichelt. Spielleute wurden nur selten förmlich geladen; meist mussten sie dankbar sein, dass die Obrigkeit sie nicht verjagte, gerade in Zeiten wie diesen, so kurz nach dem Ende des Bürgerkrieges. Die Aussicht auf einen guten Verdienst war daher das beste aller Lockmittel. Sagas Vater hatte nicht widerstehen können.
Aufgebracht und viel zu achtlos kramte Saga in ihrer Kiste. Schließlich fand sie ein sauberes Paar Beinlinge: zwei einzelne Hosenbeine, die unter dem Saum ihrer halblangen Tunika mit der Bruch, einer windelartigen Unterhose, verschnürt wurden. Wie die meisten Spielleute trug sie zweifarbige Kleidung, die linke Hälfte rot, die rechte grün. Auch die Beinlinge waren unterschiedlich gefärbt, passend zur jeweiligen Körperseite.
Als sie das schmutzige Paar abgestreift hatte, entdeckte sie an der Öffnung des Planwagens zwei kichernde Jungen, die rotgesichtig auf ihre nackten Beine starrten. Sagas Körper war schlank und hellhäutig, vielleicht eine Spur zu muskulös.
»Verschwindet!« Im Grunde war sie dankbar, dass da jemand war, auf den sie ihren Zorn entladen konnte. Noch lieber wäre ihr gewesen, die Kleinen hätten sich widersetzt; dann hätte sie ihnen eine Tracht Prügel verabreichen können.
Gedanken an Faun stiegen in ihr auf, und sie schämte sich. Wäre die Lage umgekehrt gewesen, hätte Faun sicher alles getan, um sie freizubekommen – oder wäre bei dem Versuch selbst im Verlies gelandet.
Von Kind an war Faun immer derjenige mit den verrückten Ideen gewesen, Zwillinge hin oder her. Saga war ruhiger, nicht gerade in sich gekehrt, aber – so hoffte sie jedenfalls – ein wenig verantwortungsvoller als er. So war es meist sie, die für ihn gerade stehen musste. In einem aber hatte ihr Vater Unrecht: Faun war kein schlechter Dieb, nur ein nimmersatter. Meist stahl er Dinge, die der ganzen Familie zugutek amen. Ein Laib Brot, ein Lederschlauch mit gewürztem Wein für die kalten Abende auf der Straße, ein Mantel für eines der vier jüngeren Mädchen.
Saga streifte die frischen Beinlinge über, verknotete sie unter der rot-grünen Tunika und sprang hinaus ins Freie. Das Entfesselungskunststück ihrer Schwestern war beendet, der verhaltene Applaus verklungen. Nun stand ihr Vater auf der Bühne und überbrückte mit ein paar derben Späßen die Zeit bis zu Sagas Auftritt. Seltsam, dass er nur dort oben so vergnügt sein konnte. Im Kreis seiner Familie war er stets voller Sorge, manchmal aufbrausend. Saga hatte selten ein ehrliches Lachen auf seinen Zügen gesehen, erst recht seit dem Tod seiner beiden ältesten Söhne. Sie waren während des Bürgerkrieges ums Leben gekommen. Saga und Faun waren damals noch Kinder gewesen.
»O-ho, seht, seht!«, deklamierte ihr Vater mit ausgreifender Geste in ihre Richtung. »Die wagemutige, die liebreizende, die wunderschöne … Saga-vom-Seil!«
Sie setzte ihr strahlendstes Lächeln auf, strich ihr kastanienbraunes Haar zurück und überließ sich ihren erprobten Instinkten. Schwungvoll sprang sie neben ihren Vater auf die Bühne und stieß ihn spielerisch beiseite – so war es abgesprochen und zigmal ausgeführt. Er riss theatralisch die Hände empor und eilte buckelnd davon. Das Publikum grölte schadenfroh. Hölzerne Krüge stießen gegeneinander. Wein spritzte und troff aus Mundwinkeln.
Saga begann ihre Ansprache. Laut und mit allerlei einstudiertem Wortwitz bereitete sie die Zuschauer auf den Höhepunkt des Abends vor. Sie endete mit einer tiefen Verbeugung und den Worten: »Lasst mich euch belügen und betrügen – und gebt reichlich von eurem Geld dafür!«
Das Publikum johlte und klatschte. Ein paar kleine Kinder in vorderster Reihe quietschten vergnügt. Saga erkannte die beiden Jungen vom Wagen unter ihnen und war drauf und dran, einen von ihnen auf die Bühne zu holen. Dann aber fiel ihr Blick auf einen fetten Kerl, der weder applaudierte noch jubelte. Stattdessen betrachtete er das Treiben auf der Bühne mit der Arroganz eines Gockels. Er trug drei Tuniken übereinander, ein Zeichen bescheidenen Wohlstands; die oberste und kürzeste war mit Stickereien verziert. Trotz der lauen Abendluft hatte er eine Mütze auf dem Kopf, die mit schmuckvollen Bordüren besetzt war.
»Ihr da!«, rief sie und zeigte mit dem Finger auf ihn. »Ja, Ihr! Ein Edelmann seid Ihr gewiss, mein Herr, und einer, der etwas von Heiterkeit und Frohsinn versteht.«
Den Zuschauern entging seine saure Miene nicht, was zu allerlei Gelächter führte. Saga wusste sehr wohl, dass der Dicke kein echter Adeliger war – nie hätte sie sonst gewagt, ihn offen zu brüskieren –, aber die Eitelkeit und schlechte Laune der Edlen war ihm zweifellos vertraut. Vermutlich war der Kerl ein Händler, der im vergangenen Frühjahr ein wenig Glück mit seinen Geschäften gehabt hatte – mehr Glück als Verstand, so wie er aussah.
»Wollt Ihr mir wohl auf der Bühne Gesellschaft leisten?«, rief sie zu ihm hinüber, ehe er in der Menge untertauchen konnte.
»Auf die Bühne! Auf die Bühne!«, rief das Publikum.
»Seid unbesorgt, ich will weder Euren Beutel noch Eure Jungfräulichkeit!«, rief Saga in die Runde.
Noch mehr Lacher. Ein Betrunkener trommelte sich mit den Fäusten auf die Brust, als gelte der Jubel ihm. Sagas Vater sagte oft, es gäbe keine Anzüglichkeit, die nicht noch unterboten werden konnte. Die Masse ist dumm, pflegte er zu sagen. Ein Maultier hat mehr Verstand als hundert Menschen auf einem Haufen.
Der Händler näherte sich der Bühne, mehr geschoben als aus freiem Willen. Schließlich erklomm er mit einem Ächzen das Podest und grinste nervös in die Runde, ehe er Saga einen finsteren Blick zuwarf.
Sie achtete nicht darauf. Stattdessen verschloss sie sich vor allen äußeren Einflüssen und horchte in ihr Inneres. Horchte, bis sie den Lügengeist in ihren Gedanken fand und bereit war für ihren großen Auftritt.
»Ihr seid ein stattlicher Anblick, mein Herr«, sagte sie mit der Stimme des Lügengeistes. Für jeden anderen unterschied sich der Klang dieser Worte nicht von den vorausgegangenen, doch in Sagas Ohren ertönten sie verzerrt und schrill. Es war eine abstoßende Stimme, die sie da aus ihrem Inneren heraufbeschwor; ganz und gar angemessen, dass sie allein der Lüge diente.
»Nun ja«, stammelte der Händler und blickte an sich hinab. Mochte er vorher letzte Zweifel an seiner Erscheinung gehabt haben, so waren sie nun verflogen. Er glaubte Saga. Glaubte ihr jedes Wort. Die Macht des Lügengeistes ließ ihm keine andere Wahl – doch davon ahnte er nichts.
»Die Menschen können nicht anders, als Euch zu lieben«, sagte Saga mit ihrer Lügenstimme. Sie auf einen einzelnen Menschen zu richten war einfach. Schwieriger war es, größere Gruppen in den Bann des Lügengeistes zu ziehen.
»Ja, ja!«, schrien ein paar Männer im Publikum. »Wir lieben Euch!« Hässliches Gelächter erschallte aus allen Richtungen, aber der Händler schien es misszuverstehen. Er verbeugte sich, lüpfte seine Haube und genoss den hämischen Jubel.
Sagas Vater hatte ihren Auftritt vollmundig angekündigt, und nun sah die Menge ihre Erwartungen bestätigt. Die beste Lügnerin auf Erden sollte sie sein, und, bei Gott, das war sie wohl.
Keiner konnte sich ihren Worten entziehen, wenn sie den Lügengeist heraufbeschwor. Jedermann musste ihr glauben – solange er glauben wollte.
»Mein Herr.« Saga war vorsichtiger in der Wahl ihres nächsten Schwindels. »Ihr seid schön anzuschauen, Ihr seid mit beträchtlichem Wohlstand gesegnet – aber seid Ihr auch ein gläubiger Mann?«
Niemand hätte das verneint. Die Ketzerfeuer im ganzen Land brannten auch unter dem neuen Kaiser Otto mit unverminderter Wut.
»Das bin ich«, sagte der Händler. »Gott sei mein Zeuge.«
»Dann seid Ihr sicher auch gewiss, dass ein Schutzengel Eure Hand und Euer Herz behütet.«
»Ist das so?«, fragte der Händler leise und nur in ihre Richtung, doch was da an Zweifel durchklang war schwach und ohne Überzeugungskraft.
»Sicher, mein Herr. Jeder hier weiß, dass ein Engel Euch zu Euren außergewöhnlichen Erfolgen verhilft.« Sie deutete auf eine Stelle neben seinem Kopf. »Da sitzt er, ich kann ihn sehen.« Sie lächelte in die Menge, versicherte sich ihrer ungeteilten Aufmerksamkeit und sagte dann zum Händler: »Ihr könnt es auch.«
Dem dicken Mann stand jetzt Schweiß auf der Stirn, aber aus seinen Augen war der letzte Rest von Argwohn verschwunden. Er schaute nach rechts und schien tatsächlich zu sehen, was Saga ihm vorgaukelte. Weil er glauben wollte, dass ein Engel ihn schützte, sogar schon selbst über diese Möglichkeit nachgedacht hatte, war das Wesen jetzt für ihn sichtbar geworden. Allerdings nur für ihn allein.
»Ihr seht ihn!«, verkündete Saga und spürte, wie sich ihr Magen zusammenkrampfte. Meist wurde ihr schlecht vom Klang der Lügenstimme. Einmal hatte sie sich auf offener Bühne übergeben müssen, so abstoßend fand sie das Krächzen des Lügengeistes. Längst wusste sie, dass niemand sonst sie so hörte, dass die Stimme nur in ihrem Kopf diesen abscheulichen Tonfall hatte. Die Verunsicherung war seither gewichen, aber der Ekel blieb, wurde von Jahr zu Jahr immer schlimmer. Damals, als sie zum ersten Mal entdeckt hatte, was da in ihrem Inneren schlummerte, als sie erkannt hatte, dass sie lügen konnte wie niemand sonst auf der Welt – da war das für sie Furcht einflößender gewesen als ihre erste Blutung; vor beidem hatte niemand sie gewarnt. Manchmal kam ihr der Lügengeist wie ein eigenständiges Wesen vor, eine zweite Intelligenz hinter der ihren. Aber sie hütete sich, irgendwem außer Faun davon zu erzählen. Nicht einmal ihr Vater kannte alle Ängste, die sie mit der Lügenstimme verband. Er sah nur die Jahrmarktsattraktion. Welche Gefahr sollte schon von etwas ausgehen, das keinen eigenen Körper besaß?
Die Lüge war für ihn ein Talent, eine Kunst, vor allem aber ein Geschäft – und kein Risiko, solange man sie zu harmlosen Zwecken nutzte. Gaukelspiel, zum Beispiel. Brave Späße auf Kosten anderer.
Der Händler zog mit der rechten Hand die Mütze vom Kopf und tupfte sich damit Schweißperlen von der Stirn. Die linke aber wanderte hinauf zu dem unsichtbaren Wesen auf seiner Schulter und tastete vorsichtig über ein Engelsgesicht, das nur er sehen konnte. Saga war stolz auf sich. Zielsicher hatte sie das perfekte Opfer für den Lügengeist aus der Menge gepickt: über die Maßen selbstverliebt und bereit, jede Lüge zu glauben, solange sie nur seiner Eitelkeit schmeichelte.
Das Publikum tobte. Häme überschwemmte den Burghof. Über allem hing der Duft von gebratenem Hammel und der Gestank der Tiergehege, in denen Schafe, Ziegen und Kühe den Tag über in der prallen Sonne den Käufern präsentiert wurden und nun halb betäubt vor sich hin dösten.
»Euer Engel wird Euch vor allem Schaden bewahren«, sagte Saga eindringlich und ignorierte das Rumoren in ihren Eingeweiden.
»Schon mein ganzes Leben lang«, bestätigte der Händler. Er klang weder benommen noch berauscht. Er war völlig überzeugt von Sagas Schwindel.
Der Rest war ein Kinderspiel. Saga hatte ihr Opfer in der Hand. Sie konnte verlangen, was sie wollte – solange der andere überzeugt war, dass der Schutzengel ihn sicher behütete, würde er jedes Risiko eingehen. Zu Schweinen in den Koben steigen und sich im Schlamm suhlen. Vor Publikum den nackten Hintern entblößen. Aber auch einer heimlich Geliebten alle Gefühle offenbaren. Saga musste ihr Opfer nur überzeugen, dass es zu seinem Besten geschah, dass sie selbst und das Publikum ihn dafür haltlos bewunderten. Für gewöhnlich schmückte sie ihre Lügen mit möglichst vielen Einzelheiten aus, auch deshalb waren sie oft so viel glaubwürdiger als die Wirklichkeit. Und je eitler der Geck, desto größer die Dummheit, zu der er sich verführen ließ.
Sie warf ihrem Vater einen kurzen Blick zu. Er nickte aufmunternd. Niemals, nicht ein einziges Mal, hatte er Zweifel an der Richtigkeit ihres Tuns geäußert. Sogar Saga selbst hatte mit den Jahren vergessen, wie es gewesen war, als sie noch Skrupel gehabt hatte, andere Menschen der Lächerlichkeit preiszugeben. Längst gehörte es zu ihrem Tagwerk, so wie ein Bauer die Kühe molk und ein Schmied seinen Amboss schlug.
Wäre nur nicht die Übelkeit gewesen. Der Ekel und die Abscheu vor der schrillen Geisterstimme in ihrem Inneren.
Und heute, ganz besonders, die Angst um Faun.
Mach weiter!, sagte der Blick ihres Vaters.
Mehr! Zeig uns mehr!, schrien die aufgerissenen Augen der Zuschauer.
Und Saga fuhr fort, den Händler zum Narren zu machen. Am Ende der Darbietung verkniff sie es sich nicht, seinen Dank für ihre weisen Worte entgegenzunehmen. Noch in vielen Wochen würde er glauben, an diesem Abend viel Gutes und Wunderbares erfahren zu haben. Es gab nichts, für das er sich schämen musste. Saga führte ihn von der Bühne, verbeugte sich ein letztes Mal und zog sich zurück.
Hinter den Planwagen fiel sie auf die Knie und kotzte sich die Seele aus dem Leib. Ihr Vater sah es, aber er kam nicht herüber.
Als Faun die Bewusstlosigkeit abschüttelte, nahm er als Erstes den Gestank wahr. Es roch nach altem Schweiß, nach verdorbenen Essensresten und Rattendreck. Gerüche, die ihm nach siebzehn Jahren auf der Straße nicht fremd waren. Doch so geballt an einem Ort sorgten sie dafür, dass er nur mit Mühe das gestohlene Hühnerbein vom Nachmittag im Magen behielt.
Seine erste Sorge galt Saga. Er hatte gesehen, wie sie schwankend auf dem brennenden Seil gestanden und zu ihm und den Soldaten herabgeblickt hatte. Als die Männer ihn durch die Tür des Palas gestoßen hatten, drohte sie gerade ihren Halt zu verlieren.
Die Angst um sie lag wie ein Stein in seinen Eingeweiden. Er hatte das Gefühl, nicht aufstehen zu können, so schwerfällig und erschöpft fühlte er sich. Es war eine neue Erfahrung für ihn, dass Furcht einen ebenso auslaugte wie körperliche Anstrengung.
Er hatte Tränen der Wut in den Augen, als er sich mühsam hochstemmte und zur Kerkertür schleppte. Die Burgwachen hatten ihn grob vor sich her gestoßen, aber nicht misshandelt – abgesehen von dem einen letzten Schlag hier im Verlies, der ihm die Sinne geraubt hatte. Dass nichts Schlimmeres geschehen war, machte ihm ein wenig Hoffnung; vielleicht würde er hier doch wieder herauskommen. Die Strafen für Diebstahl unterschieden sich überall im Reich. Er war nicht sicher, wie ein solches Vergehen in der Grafschaft Lerch gehandhabt wurde. Dennoch gehörte nicht viel dazu, sich die Konsequenzen auszumalen. Schweißausbrüche überkamen ihn, und er fragte sich, ob er ernstlich krank wurde. Krank vor Angst, vor allem aber aus Sorge um Saga.
»Heh!«, rief er und schlug gegen die Kerkertür. »Ist da draußen jemand?« Er bezweifelte, dass man allein zu seinen Ehren einen Wächter abgestellt hatte. Für einen Moment hielt er den Atem an, lauschte auf eine Antwort, auf Schritte, vielleicht auf die Laute anderer Gefangener.
Die einzige Antwort war das Schweigen der meterdicken Kerkermauern.
Der Raum besaß nur eine kleine strohbestreute Bodenfläche, war aber mehr als dreimal so hoch wie Faun. Das einzige Licht fiel durch ein schmales Fenster, kurz unter der Decke. Draußen war es längst stockdunkel, daher musste vor der Öffnung dort oben eine Fackel brennen. Sie befand sich wahrscheinlich auf Bodenhöhe; der Kerker selbst musste demnach im Erdinneren liegen, drei Mannslängen tief in den Lerchberg getrieben. Faun erinnerte sich vage an eine steile Treppe, aber der größte Teil des Weges hierher verschwand in seiner Erinnerung hinter einem Schleier aus Kummer und den Nachwirkungen der Bewusstlosigkeit. Fast zu spät bemerkte er, dass sich jemand an der Tür zu schaffen machte. Er trat einen Schritt zurück und spannte seinen Körper. Die Vorstellung erbitterter Gegenwehr mochte einen Hauch von Heldenmut an diesen verzweifelten Ort bringen, aber Faun war sich seiner Chancen durchaus bewusst. Seine Arme und Beine waren muskulös und drahtig, und er lief schneller als jeder andere, den er kannte – aber er war keine Kämpfernatur. Er verstand sich aufs Bogenschießen, weil das zu einem seiner Kunststücke gehörte, genauso wie das Messerwerfen. Doch es war zwecklos, sich für einen geübten Faustkämpfer auszugeben. Falls sie kamen, um ihn zu richten, würde er ihnen nichts entgegenzusetzen haben.
Das Scharren und Schaben am Eingang brach ab. Nicht die Tür ging auf, sondern eine kleine Luke auf Augenhöhe. Eine Silhouette schob sich vor flackerndes Fackellicht.
»Dein Name?«, fragte eine weibliche Stimme.
Er gab keine Antwort, versuchte erst zu erkennen, wer da zu ihm sprach. Er hatte Wächter erwartet wie jene, die ihn hergebracht hatten. Aber eine Frau?
»Dein Name!« Diesmal war es keine Frage mehr, sondern ein barscher Befehl.
»Faun.«
»Du bist der Sohn der Gauklerfamilie, nicht wahr?«
Sein Gefühl sagte ihm, dass sie all das bereits wusste. Zweifel schienen dieser Stimme fremd zu sein, sie klang fest wie Granit. Sehr fraulich und doch so scharf und gläsern wie ein Eiszapfen.
»Ja«, sagte er und fügte rasch hinzu: »Egal, was mir vorgeworfen wird, ich habe nichts –«
Sie unterbrach ihn. »Ich weiß genau, was du getan hast. Drei Händler haben Klagen gegen dich vorgebracht.«
Drei?, durchfuhr es ihn. Also ging es nicht nur um die verdammte Gugel, die er heute Morgen von einem der Marktstände vor dem Burgtor geklaut hatte. Er hatte die Kapuze mit dem angenähten Schulterteil seinem Vater schenken wollen. Sollten sie etwa auch beobachtet haben, wie er das geröstete Huhn und – ja, und die Paar Stiefel …? Sie waren für Saga gedacht gewesen und lagen versteckt am Boden seiner Kiste im Planwagen.
»Meine Männer haben all die Dinge gefunden, die du gestohlen hast«, sagte die Frau. »Sie haben eure Wagen durchsucht, gerade eben erst. Dein Vater schien nicht gut auf dich zu sprechen zu sein.«
Natürlich, dachte Faun. Sein Vater war niemals gut auf ihn zu sprechen. Faun hatte es mit Zuneigung versucht, mit Nähe, mit besonderem Mut und Arbeitseifer. Zuletzt mit Geschenken. Sein Vater hatte sie angenommen – die Familie war zu arm, um irgendetwas auszuschlagen, für das sie nicht bezahlen musste –, aber seine Abneigung gegen Faun hatte sich dadurch nicht gelegt. Faun war überzeugt davon, dass sein Vater ihn an seinen älteren Brüdern maß. Und dem Anspruch würde er nie gerecht werden. Die beiden waren ermordet worden, als marodierende Söldner während des Bürgerkrieges ein Dorf gebrandschatzt hatten, in dem die Familie gastierte. Ihre Eltern waren mit den Zwillingen entkommen – aber die beiden ältesten Söhne waren ermordet und verbrannt worden. In den Jahren des Krieges zwischen Welfen und Staufern um die Reichskrone waren solche Ereignisse an der Tagesordnung gewesen. Irgendwann hatte niemand mehr gewusst, wem die Soldaten eigentlich gehorchten, die einem das Dach über dem Kopf anzündeten. Für das einfache Volk hatte es ohnehin nie eine Rolle gespielt. Als der Welfe Otto von Braunschweig vor einem Jahr die Kaiserkrone empfangen hatte, war das für die Menschen im Land weder Grund zur Erleichterung noch Wut gewesen; kaum jemand wusste, welcher Seite er in diesem Krieg das eigene Elend zu verdanken hatte. War Otto das geringere Übel? Derzeit stand eher das Gegenteil zu befürchten, denn der Kaiser führte Krieg in Süditalien und scherte sich einen Dreck um Armut und Leid in der Heimat.
Faun versuchte, die Frau hinter der Luke zu fixieren. Doch noch immer sah er sie nur als Schattenriss, als formloses Dunkel auf der anderen Seite der Tür. Er ahnte, wer sie war. Wer sonst hätte die Soldaten meine Männer nennen können, wenn nicht Gräfin Violante selbst? Aber warum zeigte sie Interesse an einem einfachen Dieb?
»Wie werdet Ihr mich bestrafen?«, fragte er.
»Ist dir der Kerker nicht Strafe genug?« Zum ersten Mal lag da eine Spur von Belustigung in ihrer Stimme. Er war nicht sicher, ob er ihre Art von Humor gerne teilen wollte.
»Werdet Ihr mich dem Scharfrichter vorführen lassen?«
»Du hättest es wohl verdient.«
Er griff nach dem Strohhalm, den ihre Wortwahl verhieß. »Aber?«
»Du hast ein hastiges Mundwerk. Ist deine Schwester genauso dreist wie du?«
Faun machte einen Satz nach vorn und stemmte die Handflächen neben die Luke. Die Silhouette zuckte leicht. »Was ist mit ihr? Geht es ihr gut?«
Die Gräfin machte eine lange Pause, ehe er begriff, dass ihr Schweigen die Strafe für seine Ungeduld war.
»Deine Schwester«, begann sie schließlich sehr langsam, »ist ein höchst interessantes Mädchen.«
»Sie hat nichts damit zu tun!«, stieß er hervor. »Es ist wahr, ich habe all diese Dinge gestohlen. Aber Saga ist unschuldig. Das müsst Ihr mir glauben!«
An ihrem Tonfall hörte er, dass sie lächelte. »Da haben wir es wohl mit einem besonderen Fall von Geschwisterliebe zu tun. Ist das nicht so, Faun? Wie sehr liebst du deine Schwester? Und, viel wichtiger: Wie sehr liebt sie dich?«
Faun war sprachlos. Was hätte er darauf erwidern können? Wir sind Zwillinge, du Miststück. Wir sind eins. Das waren wir immer.
»Deine Antwort.« Die Stimme wurde eine Spur ungeduldiger.
»Natürlich lieben wir uns.« Es klang seltsam brüchig, wie er das sagte, sogar in seinen eigenen Ohren. Er ballte die Fäuste, bis seine Hände schmerzten.
»Würde sie versuchen, dich aus einem Kerker zu befreien? Würde sie ihr Leben für dich aufs Spiel setzen?«
Das Blut sackte ihm aus den Zügen, seine Hände fühlten sich lahm und schlaff an. Er taumelte einen Schritt zurück und wäre auf dem klammen Stroh beinahe ausgerutscht.
»Was wollt Ihr von meiner Schwester?«
Sie lachte leise. »Du hast Verstand, Faun Hühnerdieb. Das stimmt mich hoffnungsvoll, was deine Schwester angeht. Verstand ist eine gute Voraussetzung.«
»Für was?« Er begriff nicht, was sie da redete. Welches Interesse hatte die Gräfin an Saga, wenn sie sie nicht ebenfalls für eine Diebin hielt?
»Dies«, sagte sie leichthin, »und jenes.«
Unvermittelt zog sie sich von der Luke zurück. Durch die Öffnung sah er nur noch die Fackel an der Mauer gegenüber. Einen Herzschlag lang schien es, als sei die Silhouette selbst entflammt, so als hätte er mit purem Feuer gesprochen, nicht mit einem Menschen.
»Was meint Ihr damit?« Wieder schlug er gegen die Tür.
»Schlaf gut, kleiner Dieb.«
Die Luke schlug zu. Keine Geräusche mehr.
Nur das Schweigen der Mauern klang lauter als zuvor.
Die lange Nacht
Saga wartete, bis alle schliefen.
Ihre vier Schwestern lagen in Decken gewickelt zwischen ihr und dem Ausstieg des Planwagens; ihre Eltern nutzten wie üblich den zweiten Wagen als Nachtlager. Lisa, die jüngste der vier, hatte sich beim Einschlafen an ihre älteste Schwester gekuschelt. Saga küsste flüchtig das weizenblonde Haar der Vierjährigen und schob sie behutsam beiseite. Lautlos glitt sie ins Freie.
Die Nacht war kühl. Das Hügelland rund um den Lerchberg lag in sternenklarem Schlummer. Die nahen Wälder flüsterten sanft. Ganz in der Nähe glühte noch die Asche einer Feuerstelle, daneben schnarchte ein Betrunkener.
Die Zelte und Wagen der Händler standen auf einer Wiese unweit des Burgtors. Alle hatten den Hof verlassen müssen, als die Nacht anbrach und das Marktfest seinen Abschluss fand. Die Soldaten hatten hinter ihnen das Tor verriegelt, als gelte es, eine feindliche Armee fern zu halten. Niemandem, der nicht dorthin gehörte, war es gestattet, innerhalb der Burgmauern zu übernachten. Schon bei ihrer Ankunft vor drei Tagen war den Gauklern aufgefallen, wie streng die Kontrollen gehandhabt wurden. Die Karren waren weit gründlicher als üblich durchsucht worden. Jeder Neuankömmling hatte angeben müssen, woher er kam und was er dort über die Lage im Land gehört hatte. Einige Händler waren abgewiesen worden, ohne dass man ihnen die Gründe genannt hatte.
Trotz des ausgelassenen Treibens im Burghof lag Furcht über Burg Lerch. Sagas Vater hatte seinen Kindern hinter vorgehaltener Hand die möglichen Ursachen erklärt. Als Anhängerin des unterlegenen Philipp von Schwaben drohte der Gräfin wie Dutzenden anderer Edelleute im ganzen Reich die Rache des Kaisers; nicht, weil Otto IV. ein übermäßig grausamer Mann war, sondern weil er sich nach dem Bürgerkrieg gezwungen sah, jeden Unruheherd im Keim zu ersticken. Adelige, die auf der Seite seines Feindes gekämpft hatten, blieben eine Gefahr. Aufruhr lag in der Luft. Violante und ihr Ehemann Graf Gahmuret von Lerch hatten als enge Freunde Philipps gegolten.
Dass nicht längst kaisertreue Edle die Burg bewohnten, hatte einen Grund: Gahmuret war seit mehr als sechs Jahren verschollen. Damals, im Jahr 1204, war er mit Tausenden anderen ins Heilige Land aufgebrochen, um die Sarazenenpest aus Jerusalem zu vertreiben. Der Kreuzzug war nach der Schlacht um Konstantinopel zerfallen, viele Ritter nie heimgekehrt. Gahmuret war einer von ihnen.
Saga blieb im Schatten des Planwagens stehen und blickte zur Burg. Es war ein stattliches Anwesen, wenn auch nicht übermäßig groß. Eine feste Mauer schützte die Gebäude rund um den Palas. Mehrere Wachtürme erhoben sich über den Zinnen, und es gab einen hohen Bergfried, der das umliegende Land weit überragte. Westlich des Lerchbergs lagen jenseits eines Waldstreifens ausgedehnte Güter. Saga hatte einmal gehört, dass die Abgaben aus sieben Dörfern nötig waren, um einen Ritter und seine Burg zu unterhalten. Die Grafschaft Lerch hatte weit mehr als sieben Ortschaften zu bieten, doch die Tage verschwenderischen Reichtums waren seit dem Bürgerkrieg vorüber. Es hieß, Graf Gahmuret habe seinen Freund Philipp von Schwaben bei dessen Kampf um die Krone großzügig mit Gold unterstützt und dafür sogar Teile seiner Ländereien beliehen. Heute tat die Gräfin ihr Möglichstes, die Güter des Hauses Lerch zurück zu altem Glanz zu führen und die Freundschaft zum früheren König vergessen zu machen. Doch der Schatten des allmächtigen Kaisers, der jederzeit wieder auf sie fallen konnte, machte es ihr schwer, tüchtige Lehnsmänner auf ihre Höfe zu locken. Die Lage schien verfahren, und die Ahnung allmählichen Niedergangs hing schwermütig über der Gegend.
Trotz alldem hatte sich die Entscheidung von Sagas Vater, seine Familie hierher zu führen, als eine glückliche erwiesen. Die Menschen, dankbar für ein wenig Spaß und Unterhaltung in finsteren Zeiten, hatten großzügig die Schalen der Mädchen gefüllt. Der Lohn für die vergangenen Tage übertraf bereits jetzt den ihrer letzten Auftritte oben im Norden.
Saga bewegte sich noch immer nicht, während sie weiterhin die Zinnen der Burg beobachtete. Soldaten patrouillierten dort oben, Männer in den weißen, wappenlosen Steppwämsern der Burgwache. Die schwere Zugbrücke war verschlossen und würde wohl erst bei Tagesanbruch wieder herabgelassen werden. Vor dem Tor und rechts davon erstreckte sich ein Wassergraben um den Fuß der östlichen Mauer; er war von Menschenhand ausgehoben worden und speiste sich aus einer Quelle, die zwischen ein paar Felsen auf dem Bergrücken entsprang. Links vom Tor ging das Ufer des Grabens in eine Wiese über, die schon nach wenigen Schritten an einer schroffen Felskante endete. Zur Westseite hin fiel der Lerchberg steil ab, von dort aus schien es nahezu unmöglich, in die Feste einzudringen. Gerade deshalb legte Saga ihr größtes Augenmerk auf diesen Teil der Mauern.
Sie warf einen zögernden Blick zurück zum Wagen, dann gab sie sich einen Ruck, löste sich aus seinem Schatten und ging los. Sie unterdrückte den Drang zu rennen, denn das hätte bei den Wächtern auf den Zinnen für Argwohn gesorgt. Scheinbar ziellos schlenderte sie durchs Lager vor der Burg, als könnte sie in der sternklaren Nacht keinen Schlaf finden.
Sie wanderte nach Westen. Das letzte Stück legte sie im Schutz tiefer Schatten zurück, zwischen einigen Wagen und Zelten, die nah an der Steilwand des Lerchberges standen.
Die Westmauer wuchs nicht übergangslos aus dem Fels. Vielmehr bildete der Berg am Fuß der Burg einen schmalen Wulst aus Felsbuckeln, die unten entlang der Mauer verliefen. Eine geschickte Artistin konnte mühelos darüber hinwegbalancieren – und mit ein wenig Glück die Mauer selbst an Fugen und Vorsprüngen ersteigen.
Zuletzt war es viel leichter, als sie erwartet hatte. Behände schob sie sich an dem groben Mauerwerk empor. Nur ein einziges Mal geriet sie in Bedrängnis, als eine Windbö aus dem Nichts an der Burg vorüberfegte. Saga konnte sich gerade noch festklammern, die nackten Zehen tief in eine Mauerfuge gepresst, ihre Finger um die Kanten rauer Steinblöcke gekrallt. Sie spürte Blut über ihren Handrücken laufen, als sie sich die Nagelbetten einriss. Ein Krampf loderte in ihrem linken Fuß, so schmerzhaft, dass sie schreien wollte und sich auf die Unterlippe biss. Für eine Weile schien das ganze Unterfangen zum Scheitern verurteilt.
Doch der Wind kam nicht wieder, und wenig später erreichte sie die Zinnen. Sie hatte kein einziges Mal nach unten gesehen. Große Höhen machten ihr längst keine Angst mehr.
Wie sie erwartet hatte, konzentrierten die Wachen ihre Aufmerksamkeit auf die Süd- und Ostseite der Burg. Dort befanden sich das Lager und der Weg zum Tor. Weiter entfernt führte die alte Handelsstraße durch die Wälder, von der es hieß, sie folge dem Verlauf eines ungleich älteren Weges aus vergessenen Tagen.