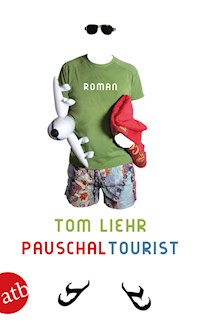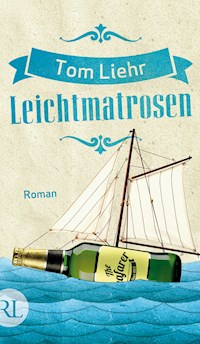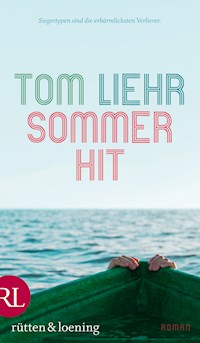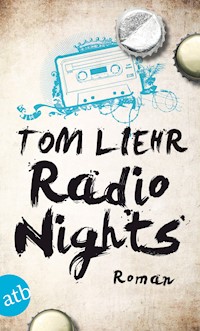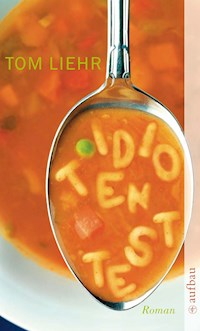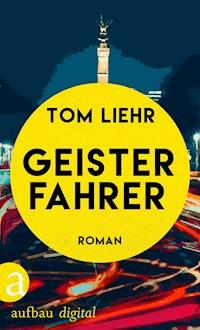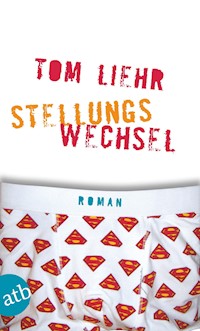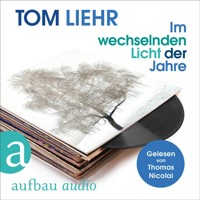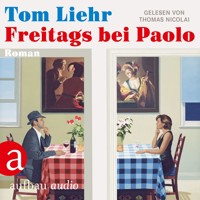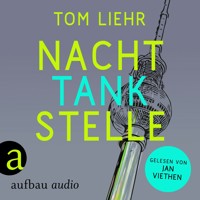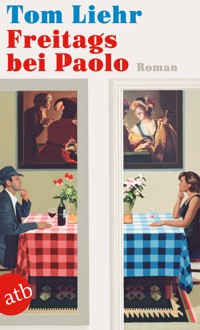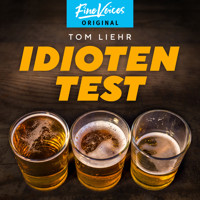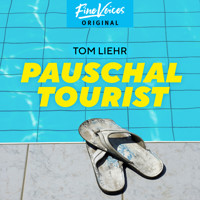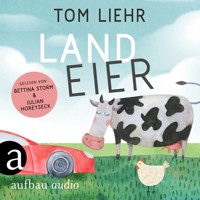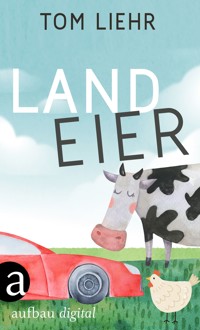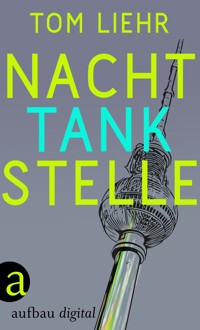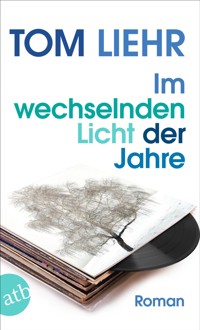
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2024
Ist es nie zu spät, um erwachsen zu werden?
Eigentlich ist Alexander Bengt mit seinem Leben zufrieden; seine Frau Tabea liebt ihn, genau wie seine beiden Kinder. Doch eines bereitet ihm Sorgen: sein nächster Geburtstag – der grausam runde Sechzigste. Ausgerechnet da zieht ein amerikanischer Songwriter in der Nachbarschaft ein, den Alexander bewundert und der ihn sogar auffordert, gemeinsam einen Song zu schreiben. Alexander hat das Gefühl, nun noch einmal richtig durchstarten zu können. Aber dann geschieht ein tragischer Unfall, und plötzlich sieht er sein ganzes Leben infrage gestellt ...
Der neue Tom Liehr – ein Roman wie ein guter Song über Liebe, Leid und Glück.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 457
Ähnliche
Über das Buch
Alexander Bengt wohnt mit seiner hinreißenden Frau Tabea, der Tochter Lavida und dem Sohn Favel in Kleinmachnow, südwestlich von Berlin. Sein Leben scheint nahezu perfekt: Tabea betreibt eine erfolgreiche Yogaschule, und Alexander schreibt unter einem Pseudonym Tierkrimis, die immer beliebter werden. Eigentlich könnte es nicht besser sein. Doch Alexander droht in einem halben Jahr sechzig zu werden – er wird bald kein erwachsener Junge mehr sein, sondern ein alter Mann. Dann jedoch zieht ein paar Häuser weiter der amerikanische Singer-Songwriter Ayksen Brahoon ein, den Alexander seit seiner Jugend bewundert. Die beiden freunden sich an und wollen sogar zusammen einen Song schreiben. Alexander hat schon die Hoffnung, seinen sechzigsten Geburtstag schadlos überstehen zu können. Bis es zu einem schweren Unfall kommt – und sein scheinbar perfektes Leben komplett aus den Fugen gerät.
Über Tom Liehr
Tom Liehr war Redakteur, Rundfunkproduzent und DJ. Er lebt in Berlin.
Im Aufbau Taschenbuch sind seine Romane »Radio Nights«, »Idiotentest«, »Stellungswechsel«, »Geisterfahrer«, »Pauschaltourist«, »Sommerhit«, »Leichtmatrosen« und »Freitags bei Paolo« lieferbar.
Mehr zum Autor unter www.tomliehr.de.
ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE
Einmal im Monat informieren wir Sie über
die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Registrieren Sie sich jetzt unter:
http://www.aufbau-verlage.de/newsletter
Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir
jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!
Tom Liehr
Im wechselnden Licht der Jahre
Roman
Übersicht
Cover
Titel
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Inhaltsverzeichnis
Titelinformationen
Informationen zum Buch
Newsletter
Motto
Widmung
Prolog
Teil eins — West-Berlin
Einführungsphase
Hochgeschwindigkeitszug
Silvester
Katapult
Papier
Teil zwei — Kleinmachnow
Speckgürtel
Zweihundertfünfzig bis zur Null
Begegnungen
Klassentreffen
Überraschungsbesuch
Tiere
Gassi gehen
Waschbärbuch
Teil drei — Koma
Aufprall
Kopfbahnhof
Zwischenwelt
I Will Survive
Weltmeister
Teil vier — Der Sinn des Lebens ist, möglichst lange nicht zu sterben
Kaffee, zuckerfrei
Zahlenspiele
Chronale Hypochondrie — (Neun Monate später)
Nachbemerkungen
Impressum
Der Sinn des Lebens ist, möglichst lange nicht zu sterben.
(Tabea Bengt)
•
In every movie I watch from the ’50s There’s only one thought that swirls Around my head now And that’s that everyone there on the screen Yeah, everyone there on the screen Well, they’re all dead now They’re all dead now
»Here To Forever«, Death Cab For Cutie, auf »Asphalt Meadows« (2022, Atlantic Records)
Für Sebastian
Prolog
Sie ging an dem langen Zaun entlang, der das große Grundstück umgab. Brahoon hatte nach seinem Einzug zwar die vergoldeten Symbole entfernen lassen, die der Vorbesitzer auf jedem zweiten Zaunpfahl hatte anbringen lassen, aber es sah immer noch hässlich aus, protzig und überkandidelt. Es war nicht einfach ein Zaun, sondern ein Bollwerk, das Potenz ausstrahlen sollte, zugleich Macht und Männlichkeit und Überheblichkeit.
Sie erreichte das mächtige, fast zehn Meter breite Eingangstor, das, wie sie irgendwo gelesen hatte, geöffnet wurde, indem es im Boden versank, und neben dem an einem Pfeiler aus poliertem Granit eine sehr große, ebenfalls polierte Messingplatte angebracht war, mit einem golfballgroßen, glänzenden Klingelknopf in der Mitte und der gravierten Hausnummer darüber, aber ohne einen Namen oder wenigstens Initialen. Ein filigranes Lochmuster unter dem Klingelknopf verriet den Lautsprecher dahinter und eine daumennagelgroße, runde, dunkle Scheibe oben an der Platte die Kamera. Sie klingelte, meinte sie jedenfalls, denn man hörte nichts, wenn man den Knopf betätigte, es gab keine Reaktion, kein Geräusch. Es geschah aber auch sonst nichts. Sie klingelte abermals und abermals erfolglos. Sie wartete eine halbe Minute, klingelte noch einmal. Wieder keine Antwort.
Aber es gab eine zweite Einfahrt, wusste sie, an der Seite des Anwesens – einen Lieferantenzugang, wie anno dunnemals, als die edlen Herrschaften nicht mit niederen Tätigkeiten und Menschen, die diese ausführten, konfrontiert werden wollten. Sie ging am Zaun entlang, durch den wenig zu erkennen war, denn das riesige Grundstück war direkt hinter dem Zaun zusätzlich von einem zwei Meter hohen aufgeschütteten Erdwall umgeben, der Neugierige abhalten sollte. Man hätte es sich auch einfacher machen und statt des Zauns eine Mauer errichten könnten, dachte sie, aber dann hätten vermutlich Leute versucht, auf die Mauer zu klettern, mit mitgebrachten Leitern oder so. Als der Rapper Bullshitso noch hier gewohnt hatte, vor seinem großen Prozess, an dessen Ende ihn eine mehrjährige Haftstrafe erwartet hatte, waren hin und wieder Menschen mit Kameradrohnen aufgetaucht, aber die Leibwächter des Rappers hatten die Fluggeräte mit Luftgewehren beschossen und oft sogar getroffen, wogegen dann wieder einige Drohnenbesitzer geklagt hatten, allerdings ohne Erfolg, denn es hatte am Zaun sogar Schilder gegeben, die erläuterten, dass Besitzer von Kameradrohnen, die über das Grundstück gesteuert würden, diese Behandlung erwarten müssten. Seit Brahoon hier wohnte, gab es diese Schilder nicht mehr, und es war deutlich stiller geworden. Nur hin und wieder kamen Touristen oder ehemalige Fans und warfen einen Blick auf den Zaun aus gebürsteten, geflochtenen Stahlstreben, der das legendäre mächtige Bullshitso-Anwesen umgab. Und auf den grasbewachsenen Erdhügel dahinter. Mehr sah man nicht.
Sie erreichte die kleinere Nebenstraße, in der der aufwendige Zaun um das Gelände weiterging, und, tatsächlich, das zweite, deutlich schmalere Tor – sie meinte sich zu erinnern, dass es sich um eine Einfahrt für Lieferanten handelte, obwohl man nicht mit Lieferfahrzeugen auf das Gelände kam – stand offen. Sie blieb erst draußen stehen, suchte nach einer Möglichkeit, sich bemerkbar zu machen, aber hier gab es keine Klingel, keine Kamera, nichts – nur ein Plastikschild, auf dem in zwei Sprachen »BETRETEN STRENG VERBOTEN« stand. Sie zuckte die Schultern und ging die ersten paar Schritte auf dem gepflasterten Weg, der über den Erdwall führte.
Und dann passierten mehrere Dinge beinahe gleichzeitig. Das Geräusch eines offenbar tieffliegenden Rettungshubschraubers erklang, ein unfassbar lautes Geräusch, das schnell immer noch lauter wurde. Sie drehte sich zur Straße um und blickte in die Richtung, aus der sie das Geräusch vermutete, aber der Hubschrauber blieb weiterhin nur hörbar, und in diesem Augenblick spürte sie die Vibration ihres Smartphones, das sie in der Hosentasche trug. Sie nahm das Gerät aus der Tasche, sah auf das Display und las den Namen ihrer Tochter, machte die Wischgeste, um den Anruf anzunehmen, hielt sich das Telefon an das eine Ohr und mit der freien Hand das andere Ohr zu, um irgendwas verstehen zu können, und dann schrie sie: »Hallo, Schätzchen«, was vermutlich nicht zu hören war, denn der Rettungshubschrauber flog in diesem Moment fast direkt vor ihr über die Straße hinweg, und das in so niedriger Höhe, dass sie den Luftzug der Rotoren spüren konnte. Der Einsatzort konnte nur ein paar Dutzend Meter entfernt sein, doch er lag nicht auf dem Brahoon-Anwesen.
Was sie aber weder spürte, noch hörte oder sah, das war der bullige, hochbeinige Pick-up, der im gleichen Moment hinter ihr vom Grundstück auf den Erdwall gefahren kam, um das Tor zur Straße zu durchqueren, die Schnauze weit nach oben gerichtet, weshalb die Person am Steuer auch nicht sehen, geschweige denn anderswie wahrnehmen konnte, dass fast direkt hinter der Hügelkuppe eine Frau stand, die sich beide Ohren zuhielt und in die andere Richtung und zum Himmel starrte, aber aufgrund des Luftzugs auch noch ein bisschen in die Hocke gegangen war.
Teil eins
West-Berlin
Einführungsphase
Als Tabea Folkers in unsere Klasse kam und sich uns vorstellte, bekam ich zuerst nichts davon mit, weil ich hochkonzentriert dabei war, in meinem Mathe-LK-Arbeitsheft das Logo für meine zukünftige Band The Disease zu entwickeln. Mit einem schwarzen Kuli krakelte ich am dreißigsten oder vierzigsten Entwurf für einen Schriftzug herum. Das machte ich seit ein paar Tagen fast ununterbrochen – seit mir die Idee gekommen war, eine Band mit diesem Namen zu gründen, die es unbedingt schaffen müsste, Vorband bei den Konzerten von The Cure zu werden. Denn das wäre der Bringer, dachte ich mir: erst The Disease und anschließend The Cure, also erst die Krankheit, dann die Heilung, und das an einem Abend und auf derselben Bühne. Die ganze Welt würde über uns sprechen. Robert James Smith und ich würden beste Freunde werden. Die Idee, mit einem Popstar befreundet zu sein, fand ich fast noch besser als die, selbst einer zu werden. Berühmtheit kam mir aufwendig und ziemlich herausfordernd vor. Es sozusagen aus zweiter Hand zu genießen, das stellte ich mir wesentlich entspannter vor. Und ich war sicher, dass The Cure noch viel erfolgreicher werden würden, als sie es zu diesem Zeitpunkt schon waren.
Ich hatte allerdings wenig Ahnung von Musik, ich war, soweit ich wusste, eher kein guter Sänger, und ich kannte unterm Strich niemanden, der für eine Band infrage kam, der komponieren, arrangieren, texten oder wenigstens ein einfaches Instrument spielen konnte. Ich beherrschte zwei Weihnachtslieder leidlich auf der Blockflöte (»Es ist ein Ros’ entsprungen« und »O du fröhliche«), die ich meinen Eltern zuletzt vor fünf Jahren hatte vorspielen müssen, um an Heiligabend mein Recht auf Bescherung durchzusetzen. Jens Brinkmann, der in der Klasse schräg vor mir saß, hatte eine Akustikgitarre und musizierte in seiner evangelischen Kirchengruppe, was ihn sowieso disqualifiziert hätte, doch Jens Brinkmann sah außerdem noch aus wie jemand, dem es Spaß machte, freiwillig in einer evangelischen Kirchengruppe zu sein und dort gottesfürchtiges Liedgut von sich zu geben: Zwei, drei Pickel mehr, und von seiner Gesichtshaut wäre überhaupt nichts mehr sichtbar gewesen. Die Schüler, die in den Jugendorganisationen der Parteien herumhingen oder sich sonstwo ehrenamtlich engagierten, sahen alle so aus. Es war ihre einzige Chance auf ein Sozialleben, in solche Gruppen einzutauchen. Harald Metzger beispielsweise, der mal in »Politischer Weltkunde« der Klasse gestanden hatte, Bundeskanzler werden zu wollen, was leicht irres Gekicher bei den Mitschülern verursacht hatte: Er sah exakt so aus, wie er hieß, und niemand wollte mit dem klobigen, dickbebrillten, verlangsamt wirkenden Typen befreundet sein. Deshalb hockte er nachmittagelang als Zuschauer in der örtlichen Bezirksverordnetenversammlung, was so ziemlich das Langweiligste war, das man sich vorstellen konnte, und er tat das, wie wir alle wussten, in der Hoffnung, dass man dort auf ihn aufmerksam würde und ihn in irgendein belangloses Gremium kooptierte, das über die Aufstellung von Fußgängerampeln oder die Fassadenfarbe einer öffentlichen Bibliothek entschied. Er war in der Schüler-Union, der Jungen Union und in der CDU Mitglied, er schlurfte regelmäßig in irgendwelche Versammlungen, aus denen spätnachts schlimme und verräucherte, strikt männlich dominierte Trinkgelage wurden, und klebte an den Wochenenden Plakate oder verteilte Zettel an Wahlkampf- und Infoständen, während die höheren Tiere ihre Räusche ausschliefen oder potenzielle Wählerinnen in ehebrecherischer Weise heimsuchten. Allerdings schaffte es Harald Metzger später immerhin bis ins Berliner Abgeordnetenhaus, mit Mitte vierzig und nach drei Jahrzehnten der Zettelverteilerei, aber die höchste Position, die er je bekleidete, war der stellvertretende Vorsitz im Bauausschuss. Dort blieb er zwei Monate, bis er aufgrund eines Skandals, den ein anderer lange vor Haralds Wahl verursacht hatte, genötigt wurde, sich einem kollektiven Rücktritt anzuschließen, und nach all der Mühe quasi über Nacht wieder in die Bedeutungslosigkeit zurückfiel. Nach einer Legislaturperiode als Hinterbänkler nahm man ihn auch nicht wieder auf die Liste.
Besetzungsprobleme bei The Disease oder Fragen zu Songs, Stil und all solchen Sachen waren Aspekte, über die ich mir später Gedanken machen könnte. Am Anfang stünde ein schnittiges Logo, das sich Schüler – vor allem Schülerinnen – meines Alters dann mit Kulis auf die Unterarme oder ihre Federmappen tätowieren würden, wie ich das eine Zeit lang mit den coolen Logos einiger Metal-Bands gemacht hatte, obwohl ich Metal eigentlich scheiße fand und von den meisten Bands kein einziges Stück kannte (außer »United« von Judas Priest, die hatten auch den besten Schriftzug, wie ich fand). So oder so, wenn das Logo stimmte, wäre der Rest Pillepalle. Marketing war alles. Mein Musikgeschmack war ohnehin ziemlich heterogen, oberflächlich und unbestimmt (nur Heavy Metal mochte ich definitiv nicht und natürlich keine Schlager, weil unsere Eltern Schlager liebten und wir nichts lieben durften, was unsere Eltern liebten); ich hörte den gleichen Pop, den alle anderen auch hörten, machte mir aber nicht viel daraus – es bedeutete mir nichts, es war nur Musik. Ich kaufte hin und wieder eine Platte mit aktuellen Hits bei Woolworth, die ich dann zwei Monate lang rauf- und runterdudeln ließ, bis sie mir zu den Ohren heraushing. Das einzige Album, das ich wirklich sehr gerne mochte – eigentlich sogar nachgerade liebte – und immer wieder hören konnte, das war »Snow« des amerikanischen Singer-Songwriters Ayksen Brahoon, das ich wegen des Covers (eine einsame, unbelaubte junge Birke in einer ansonsten leeren Schneelandschaft) und des Preises (eine Mark zwanzig) vom Grabbeltisch genommen hatte. Der Mann war in den Staaten so etwas wie ein Held, aber hierzulande kannte ihn niemand, doch dieses spezielle Album hatte er, sich selbst an der Akustikgitarre begleitend, im Jahr 1976 in einer Hütte in den Rockys komponiert, getextet und aufgenommen, als es ihn und ein paar andere Leute dort für eine Woche eingeschneit hatte. Ich mochte die melancholischen Songs, die klugen Texte (die ich mithilfe meines »Langenscheidt Englisch-Deutsch-Deutsch-Englisch« übersetzt hatte) und die eigenwillige Dynamik sehr, aber alle, denen ich das Album vorspielte, fanden es einfach nur langweilig. Wenn schon melancholisch, musste es von Angelo Branduardi, Barclay James Harvest, Mike Oldfield, Kate Bush oder Tangerine Dream sein, sonst hörten sie überhaupt nicht hin. In der Teestube Tee-In, die einige meiner Mitschülerinnen stark frequentierten und in der ich so etwas wie ein Rendezvous mit Stefanie Jungbluth gehabt hatte, lief nur so was. Der Besitzer, ein etwas schmutzig wirkender Typ, der irgendein Studium abgebrochen hatte, stellte immer das Cover der Schallplatte, die er gerade aufgelegt hatte, in einen speziellen Aufsteller auf dem Tresen. Dabei grinste er in Richtung der Mädchen, und einige grinsten eigenartigerweise zurück.
Als der Entwurf für mein Bandlogo okay war – lodernde 3D-Buchstaben, die sich auf einer Kreiskalotte anordneten, vermutlich würden wir also Heavy Metal machen müssen –, lehnte ich mich zurück, betrachtete meine Arbeit und war sehr zufrieden. Erst in diesem Augenblick fiel mir auf, dass es ungewöhnlich still in der Klasse war, und ich schaute mich um. Die Jungs starrten alle wie gebannt nach vorne, und die Mädchen starrten entweder auch nach vorne, oder sie starrten die starrenden Jungs an. Also sah ich ebenfalls zum Lehrerpult, und da stand sie: Tabea Folkers (den Namen erfuhr ich erst später, ich hatte ja verpasst, wie sie hereingekommen war und sich vorgestellt hatte). Sie hatte haselnussfarbenes rückenlanges Haar, das glänzte und schimmerte, beinahe metallisch, aber ohne sie dadurch kühl wirken zu lassen, ganz im Gegenteil. Ihre Augen waren dunkelblau, zugleich jedoch groß und warm, und alles an ihrem Körper war von einer einschüchternden Zartheit, die aber keine Fragilität war. Noch nie hatte ich ein so zauberhaftes Mädchen gesehen, also schloss ich mich umgehend den Starrern an – es war sowieso unmöglich, wegzusehen, und es machte mich sofort seltsam glücklich, einfach mitzuglotzen. Kein Zweifel, der allererste Song von The Disease würde sich um diese junge Frau drehen. Ich kannte ihren Namen noch nicht, aber ganz egal, wie er lautete – er wäre unser erster Songtitel. Oder Angel With Dark Blue Eyes, so was.
Sie hatte die Hände vor dem Bauch gefaltet (diese Hände!) und lächelte, und jetzt sagte sie: »Meine Eltern sind Diplomaten. Deshalb ziehen wir in einem halben Jahr wieder um. Nach Tel Aviv, das ist eine Stadt in Israel.« Sie pausierte, ein kurzer Anflug von Traurigkeit huschte über ihr Gesicht, wobei ich den dringenden Wunsch verspürte, sie in die Arme zu nehmen und jedes kleine bisschen Traurigkeit aus ihrem zauberhaften Gesicht wegzuküssen, und es wäre mir völlig egal gewesen, ob ich mich damit lächerlich gemacht hätte. »Und ich bedauere es jetzt schon, so wunderbare Menschen nach so kurzer Zeit schon wieder verlassen zu müssen. Ich bin ganz sicher, dass wir alle sehr, sehr gute Freunde werden.« Dabei schaute sie mich an, ganz sicher. Ich spürte, wie meine Ohrläppchen erglühten, und auch die allerletzte Zelle meines Körpers begann damit, sich nach diesem unglaublichen Mädchen zu verzehren.
Keiner von uns wäre im Leben auf die Idee gekommen, solche Worte an irgendeine elfte Schulklasse zu richten oder gar an diese spezielle hier. Wunderbare Menschen, von wegen. Wir waren narzisstisches, egoistisches und sozialneidisches Lumpenpack, zerfressen von der Postpubertät, permanent geil bis in die Zehennägel und in kleinen Cliquen organisiert, die zwar vorgaben, aus Freunden zu bestehen, eigentlich aber nur der gegenseitigen Kontrolle dienten. Die Elf-Eff des Paul-Besser-Gymnasiums war die Hölle. Eine Hölle, in die soeben ein Engel eingezogen war.
Und keiner lachte, was die übliche Reaktion auf eine solche Äußerung gewesen wäre. Alle starrten weiterhin, und das schweigend, völlig konsterniert oder katatonisch oder, wie ich bemerkte, während ich eine Spur Eifersucht aufkommen spürte, ebenso verzaubert wie ich. Tabea nickte und strahlte, sah sich kurz um und hielt dann auf den Platz neben Melanie Paulsen zu. Niemand von uns hätte sich freiwillig dorthin gesetzt. Melanie Paulsen hatte die Form zweier aufeinandergestapelter Kürbisse, sie roch intensiv nach Schweiß und litt außerdem unter chronischem Asthma, weshalb sie alle paar Minuten grausige Hustenanfälle bekam, von denen wiederum mir der Schweiß ausbrach. Ich wollte aufspringen und den dunkelblauäugig-rotbraunhaarigen Engel auf den freien Platz neben mir aufmerksam machen, aber da saß sie schon und lächelte Melanie Paulsen an, die mit offenem Mund zurückglotzte und ihr Glück nicht fassen konnte. Sie war die Einzige in der Klasse, die keiner Clique angehörte. Es gab keine Cliquen für solche Leute. In Melanies Gesicht zog erstmals ein Lächeln ein, das dort so lange wohnte, wie Tabea Folkers in unsere Klasse ging.
Bis zu Tabeas Auftauchen an unserer Schule und in unserer Klasse hatten wir uns immer wieder von Christiane Buchholz anhören müssen, dass sie – im Gegensatz zu sämtlichen Mitschülerinnen – eines Tages als Model Karriere machen würde, und wir hatten ihr das widerspruchslos abgekauft, bis Tabea kam, die uns – und allen voran Christiane Buchholz – verdeutlichte, dass uns nur der richtige Vergleich gefehlt hatte, um diesen kleinen Selbstbetrug zu entlarven. Vielleicht würde es Christiane Buchholz noch in einen zweitklassigen Versandhauskatalog schaffen oder in diese Werbezeitungen, die am Wochenende in den Briefkästen lagen, aber sicher nicht auf die Titelseite eines internationalen Magazins. Dort gehörte Tabea hin, die allerdings keinerlei Ambitionen in dieser Richtung hatte. Tabea machte sich nichts aus ihrem Aussehen, und wie viele sehr schöne Menschen hielt sie sich selbst nicht für besonders attraktiv. Oder diese Eigenschaft für keine besondere, eines von beidem. Oder beides. Wie sich herausstellte, war sie auch noch hochbegabt, weshalb sie zwei Jahre jünger als der Durchschnitt unserer Klasse war und trotzdem in allen Fächern Bestnoten hatte, und ich war anderthalb Jahre älter als der Schnitt, weil ich in der Achten eine meinem Desinteresse an Lernfortschritten geschuldete Ehrenrunde gedreht hatte. Trotzdem hatte ich es bis in die E-Phase geschafft, also den Übergang zum Kurssystem der Sekundarstufe II und damit die Voraussetzung für das Abitur. Wie ich das genau fertiggebracht hatte, das war mir ein Rätsel, aber das galt für mindestens zwei von den vier Sabines, die wir in der Klasse hatten, ebenso und außerdem für gut die Hälfte der männlichen Schüler. Wir waren stinkfaule Prokrastineure, wir erledigten nur das Minimum, und das auch erst nach der zehnten Aufforderung, und trotzdem hatten sich fast alle Schüler, mit denen ich seit der achten unterrichtet wurde, bis in die elfte gerettet. Und jetzt kam Tabea mit ihrer erfrischenden, engelhaften, direkten Offenheit, und was sie mit uns machte, das grenzte an ein Wunder: Kurz vor der Auflösung, die mit dem Beginn der letzten vier Semester der Oberstufe einhergehen würde, formte sie aus uns innerhalb von wenigen Tagen eine verdammte Klassengemeinschaft. Sogar Melanie Paulsen, die es nicht einmal in Jens Brinkmanns Kirchenmusikgruppe geschafft hätte, gehörte plötzlich dazu. Und selbst Christiane Buchholz akzeptierte das, wenn auch zähneknirschend, und es dauerte eine Weile, bis sie mit dem Schicksal Frieden schloss (sie wurde später Moderatorin bei einem lokalen TV-Sender, heiratete einen Kollegen, der wegen seiner Aufdringlichkeit weiblichen Mitarbeitern gegenüber gefeuert wurde, und starb mit dreißig Jahren an Leukämie, wie ich aus der Zeitung erfuhr).
Es war ein Wunder.
Aber das eigentliche, das größte Wunder stand mir bevor.
Sie war seit acht Wochen in unserer Klasse, und sie schien alle gleich zu behandeln, was bedeutete: alle gleich nett. Sie ließ uns an Ausstrahlung, Großherzigkeit und Wärme allesamt gleichermaßen teilhaben, sie bevorzugte niemanden und lehnte niemanden ab, aber sie ließ sich auch nicht in Beschlag nehmen, und sie wurde von niemandem die beste Freundin. Sie kam auf alle Geburtstagsfeiern, zu denen sie eingeladen wurde, und sie wurde selbstverständlich zu allen Geburtstagsfeiern eingeladen (Melanie Paulsen feierte ihren Geburtstag zum ersten Mal in ihrem Leben mit Leuten, die nicht zu ihrer Familie gehörten, und gleich dreißig davon, denn natürlich kamen wir auch alle, nachdem sich herumgesprochen hatte, dass Tabea hingehen würde), aber sie kam alleine und ging alleine, und sie blieb jedes Mal bis exakt um zehn, keine Minute länger, was sie, wie sie erklärte, tat, um niemandem das Gefühl zu geben, von ihr bevorzugt zu werden (was wir alle schlicht zum Niederknien fanden – keiner von uns dachte so). Sie flirtete nicht, reagierte aber auch nicht ablehnend, wenn sie angeflirtet wurde, und alle Jungs waren in Tabea verliebt, wahrscheinlich auch einige Mädchen. Ich beobachtete sie und träumte von ihr, weil von ihr zu träumen die höchste meiner Möglichkeiten darstellte, wie ich meinte, und sowieso keiner bei ihr landete; ich versuchte es lieber gar nicht erst, zumal ich nicht sehr gut mit Enttäuschungen zurechtkam. Allerdings war es auch enttäuschend, in der erreichbaren Nähe einer so unfassbaren, wundervollen, anbetungswürdigen, strahlenden jungen Frau zu sein – ein Erlebnis, von dem ich damals schon ganz sicher war, dass es sich nie in meinem Leben (und dem meiner Mitschüler) wiederholen würde, und keinen Versuch zu unternehmen, diese Nähe auf null zu maximieren. Immerhin durfte ich mich freuen, wenn ich wieder eine Bauchlandung beobachten konnte, wenn es auch sehr nette, gleichsam weiche Bauchlandungen waren, denn Tabea ließ niemanden ins offene Messer laufen. Sie erklärte – und dabei strahlte sie gewinnend –, dass sie kein Herz brechen wollen würde, so kurz vor ihrer Abreise nach Israel (dabei war bis dahin noch mehr als ein Vierteljahr Zeit), und vor allem nicht ihr eigenes, nicht schon wieder. Sie sagte das auch zu Birger Fläming (der eigentlich mit Sabine Höch ging, der schlanken Schönheit aus der 10b) und sogar zu Michael Steineke, der kurz vor dem Abitur stand, in zwei Kinofilmen Nebenrollen gespielt hatte und manchmal für die Foto-Lovestory in der Bravo angefordert wurde, wenn der Typ »großer, extrem geiler Bruder« besetzt werden musste. Von Micha Steineke hieß es, er hätte seine Jungfräulichkeit sage und schreibe bereits mit neun verloren, er hätte seitdem außerdem über hundert Freundinnen gehabt und Affären mit einem halben Dutzend von den jüngeren Müttern seiner Klassenkameraden. Ich ging davon aus, dass die Geschichten überwiegend stimmten, denn er sah aus, wie er eben aussah, und trotzdem schüttelte Tabea Folkers lächelnd den Kopf, als er sie auf dem Schulhof abfing. Er hatte sich ihr ganz klassisch in den Weg gestellt, eine Hand an der Wand des Schulhauses, um ihr den Weg zu versperren, und mit der anderen die Kippe verdeckend. Noch tage-, nein wochenlang war nichts anderes Gesprächsstoff an der Schule als das Gesicht von Micha Steineke, als er von Tabea eine überaus freundliche, aber endgültige Abfuhr bekam.
•
Das meistens eher mäßig besuchte Tee-In erlebte seine kurze Hochzeit, als es von Tabea Folkers mit ihrer Anwesenheit geehrt wurde, zwei- oder dreimal die Woche, weshalb es in diesem Herbst manchmal schwer war, in dem sowieso nicht sehr großen und eigentlich auch nicht besonders schönen Laden nachmittags noch einen Platz zu bekommen. Im Tee-In gab es ungefähr zehn Milliarden Teesorten, die in braunen Gläsern in den Regalen hinter dem Tresen aufgereiht waren, aber die meisten Gäste tranken Vanilletee, Wildkirschtee oder Erdbeertee. Außerdem gab es zwei Sorten Limonade, die beide nach Spülwasser schmeckten, und wer die Gefahr suchte, kaufte sich einen der untertassengroßen Kekse, die der Besitzer angeblich selbst buk. In den Regalen an den anderen Wänden lagen zerfledderte Bücher oder Gesellschaftsspiele in mehrfach geflickten Kartons, die selten jemand herausnahm. Die – überwiegend weiblichen – Schüler, die hierherkamen, tranken Wildkirschtee aus kratzigen braunen Steinguttässchen und redeten über die Sachen, die auf dem Schulhof passierten oder in der Bravo oder der Pop/Rocky standen.
Weil ich nichts verpassen wollte und das Gefühl hatte, mich in einem Zeitabschnitt zu befinden, der etwas Großes, Unwiederbringliches für mich bereithielt oder wenigstens etwas, dem ich unbedingt beiwohnen müsste, um später davon erzählen oder zehren zu können, ging ich ebenfalls recht regelmäßig in die kleine Teestube in einer Nebenstraße im Norden von Neukölln – Tabea kam montags und mittwochs und manchmal freitags. Ich hatte sowieso wenig anderes zu tun, und ich hatte noch genug von meinem Konfirmationsgeld übrig, um mir ab und zu eine Tasse Tee zu gönnen, die mir meistens nicht schmeckte – ich wählte jedes Mal eine andere Sorte, aber glücklich machte mich keine. Ich kam längst nicht als Einziger auf die Idee, aus Tabeagründen in die Teestube zu dackeln, und so fanden sich an den wenigen freien Tischen immer wieder zufällig zusammengestoppelte Jungsrunden aus Schülern unserer Schule. Wir saßen da und glotzten in unsere Limonadengläser oder auf die flackernden Teelichte unter den Steingutstövchen und warteten auf die Ankunft von Tabea Folkers, die sich meistens an die Tische setzte, an denen schon Mädchen saßen, aber auch vorher jeden kurz begrüßte, den sie erkannte. Die anderen Jungs suchten während der kurzen Begrüßungen ihr Gesicht nach minimalen Anzeichen für Annäherungschancen ab, doch sie machte immer das gleiche Gesicht: freundlich, verbindlich, vereinnahmend, unbestimmt. Die dramaturgisch und stilistisch eher anspruchslosen Gespräche an den Jungstischen vor ihrer Ankunft drehten sich um das bevorstehende Kurssystem, um Musik, Fußball und die wenigen Kneipen in der Gegend, die gute Flipper hatten, Jugendliche einließen und nicht darauf bestanden, dass man einmal pro Viertelstunde ein neues Getränk bestellte. Ich war damals leidenschaftlicher Flipperspieler, und ich liebte das laute Knallen, mit dem die Geräte ein Freispiel verkündeten: Man bekam durch das Geräusch das Gefühl, etwas Großes geschafft zu haben.
An diesem Mittwochnachmittag im Oktober war ich früh dort und hatte nahezu freie Platzwahl. An einem Tisch saßen zwei Mädchen, die ich nicht kannte, und spielten das Malefiz-Spiel, an einem anderen hockte eine Sabine aus unserer Klasse und schrieb in ein Schulheft. Ich setzte mich an einen der beiden winzigen Tische, die an den Fenstern standen und jeweils nur zwei Plätze hatten, und bestellte einen Whisky-Tee. »Der schmeckt eigentlich nicht«, sagte der Besitzer und zog die Augenbrauen zusammen. »Ist auch kein Alkohol drin, falls du darauf spekulierst. Nur Whiskyaroma.« Ich bestand trotzdem darauf, und der Besitzer hatte recht – der Whisky-Tee schmeckte einfach grausig, außerdem ziemlich bitter und grundsätzlich falsch, allerdings verfügte ich über keinerlei Erfahrungen mit echtem Whisky. Ich verrührte so viel Kandis in der kratzigen Tasse, wie der rasch abkühlende Tee aufnehmen konnte, und lauschte der Musik, die nicht aus den Hitlisten war. Dann erkannte ich den Sänger. Ich sah zum Tresen, da steckte ein Cover in der Halterung, auf dem deutlich der Name Ayksen Brahoon zu lesen war, aber es war nicht »Snow«, das gerade lief, sondern sein zwei oder drei Jahre altes Album »Judges On Vacation«, das es in den USA in die Album-Top-Ten geschafft hatte, hierzulande aber auf keinem einzigen Radiosender zu hören gewesen war. Brahoon hatte sich auf dieser Platte vor allem mit den Ungerechtigkeiten im amerikanischen Justizsystem befasst. Ich fühlte mich plötzlich sehr gut, wie auserwählt, und ich suchte den Blick des Besitzers in der eigenartigen Hoffnung, in ihm, den ich eigentlich unsympathisch fand, eine Art Bruder im Geiste entdecken zu können. Aber sein Blick galt der Tür – durch die soeben Tabea kam. Sie blieb stehen, um den Raum wahrzunehmen, sah zu dem Tisch mit den beiden Malefiz-Spielerinnen, dann zu der einen Sabine, die ihrerseits aufblickte, hoffnungsvoll, erwartungsvoll, Haltung annehmend, und anschließend schaute sie mich an. Sie schien einen Moment zu grübeln, unsicher zu sein, was ich an ihr noch nie gesehen hatte, und in diesem Augenblick geschah etwas, fielen Würfel, veränderte sich das Schicksal der Welt. Ein Lächeln flammte auf, sie hielt meinen Blick, zog die Jacke aus, hängte sie an die Garderobe, ohne hinzusehen, und kam auf meinen Tisch zu. Meine Kopfhaut begann zu vibrieren.
»Hallo, Alexander«, sagte sie. Es war ganz anders als die übliche Standardbegrüßung für alle.
Weil sie mich meinen musste, denn ich war definitiv der einzige Alexander in ihrer Blickrichtung, erwiderte ich: »Hallo.« Ich spürte gleichzeitig, wie mir der Schweiß im Nacken ausbrach.
»Wir haben uns noch nie richtig unterhalten. Darf ich mich zu dir setzen?« Ihre linke Hand griff nach der Lehne des freien Stuhls, am anderen Handgelenk trug sie eine schmale goldene Uhr. Tabea war Linkshänderin. Das in diesem Moment zu bemerken, über sie zu wissen, kam einer Offenbarung nahe.
»Ich trinke Whisky-Tee«, brabbelte ich, weil die Botschaft, dass sich Tabea Folkers – die Tabea Folkers – zu mir setzen wollte, anscheinend vor meiner Stirn hängen blieb, wo sie auf Einlass und Verarbeitung wartete, und ich ja irgendwas antworten musste, obwohl es keine Antwort war, was ich da von mir gab.
»Whisky-Tee? Der schmeckt scheußlich. Habe ich auch mal probiert.« Sie zog den freien Stuhl ein Stückchen vom Tisch weg. »Darf ich?«
Du darfst nicht, du musst. Das wollte ich sagen, obwohl ich Angst davor hatte, beim Am-Tisch-mit-Tabea-Folkers-Sitzen zu versagen. Aber ich bekam nur den Mund auf, mehr schaffte ich körperlich nicht. Tabea lächelte so hinreißend, wie die Sonne im Frühling scheint, und setzte sich einfach, wahrscheinlich war sie solches Verhalten ihr gegenüber gewöhnt. Sie sah zum Tresen, musterte das Plattencover, das da ausgestellt wurde, lauschte einen Moment lang, sah mich an. »Schöne Stimme«, sagte sie, was auch stimmte – Brahoon hatte eine bemerkenswerte, sanfte Bariton-Stimme, und er konnte wirklich singen. Sie blickte abermals zum Tresen, dann wieder zu mir. »Aber der Name ist komisch. Kennst du das?«
Ich nickte und grinste dabei vermutlich ziemlich debil. »Von dem Sänger ist meine Lieblingsplatte«, erklärte ich.
»Ich dachte, du würdest eher auf Heavy Metal stehen. Ich habe deine Zeichnungen gesehen. Vor ein paar Wochen, als ich neu in die Klasse gekommen bin.«
Ich war nicht dazu in der Lage, darauf zu antworten. Sie hatte es gesehen. Wahrgenommen. Aufgenommen.
Sie sah abermals kurz zum Tresen. »Wie spricht man diesen Namen aus?«
»Äjksinn Brah-Huhn«, sagte ich leise. Und dann noch einmal lauter. Dabei dachte ich: Sie fragt das nur, um nett zu sein. Sie ist hochbegabt, sie ist auf der ganzen Welt zu Hause. Sie weiß es. Warum will sie besonders nett zu mir sein?
»Ayksen Brahoon«, wiederholte sie nickend. »Nicht schlecht.« Plötzlich stand der Teestubenbesitzer neben uns, legte eine Hand auf Tabeas Stuhllehne, sehr dicht an ihrem Rücken, fast dort, wo der flache Kragen ihrer Bluse die Haut unter dem Halsansatz frei ließ, und er grinste eigentümlich. Der nur ein paar Minuten alte Wunsch, mich mit ihm zu verbrüdern, schlug in Sekundenbruchteilen ins Gegenteil um.
»Was darf es sein, meine Hübsche?«, säuselte er.
»Was hatte ich zuletzt, Peter?« Das klang ein bisschen, als würde sie mit einem Angestellten sprechen. Jemandem, der bei ihr angestellt war.
Er schien das nicht wahrzunehmen, kräuselte die Stirn, aber es war klar, dass er für diese Antwort nicht wirklich nachdenken musste. »Pflaumentee, meine ich.«
»Der war scheußlich.«
Peter – Peter! – nickte. Ich glaubte nicht, dass er sich von irgendeinem anderen Gast mit dem Vornamen ansprechen ließ. »Diese aromatisierten Früchtetees sind selten wirklich gut. Aber ich habe was ganz Besonderes. Gerade reingekommen. Ein echter Geheimtipp. Nennt sich Roibos-Tee, aus Südafrika. Den musst du mal probieren.«
»Muss ich?« Tabea lehnte sich zurück und strahlte Peter an, der seinerseits förmlich zerfloss.
»Du musst unbedingt«, erwiderte er.
»Dann nehme ich den.«
Peter nickte, machte aber keine Anstalten, zum Tresen zu gehen, um dort herumzuwerkeln, ein Set zusammenzustellen, ein Stövchen mit einer neuen Kerze auszustatten, Biskuits aus der Metallschachtel zu kramen. Stattdessen musterte er mich, als wäre das hier ein Bewerbungsgespräch und ich ein besonders ungeeigneter Kandidat, der nur noch nicht gemerkt hatte, dass es keine Chancen für ihn gab.
»Wir waren mitten im Gespräch, Peter«, sagte Tabea freundlich und auf eine Art selbstbewusst, die sonst nur Erwachsene verströmten.
Der Teestubenbesitzer erstarrte. »Verstehe«, murmelte er dann und verschwand.
Wir redeten. Wir redeten vor allem über Musik, und nachdem ich von meiner Idee mit The Disease erzählt hatte, was Tabea herzlich zum Lachen brachte, bekam ich die Gelegenheit, haarklein zu erläutern, warum »Snow« ein so bahnbrechendes, ergreifendes Album wäre, ich nannte jeden Songtitel und zitierte jeweils ein paar Textzeilen, und ich durfte endlich jemandem erklären, warum ich »Frozen Water« so genial fand, dieses Stück, das vordergründig von den drei Aggregatzuständen handelte, eigentlich aber die Phasen einer zwischenmenschlichen Beziehung, einer Liebesbeziehung zerlegte (wovon ich keine Ahnung hatte, denn ich war bisher nur zweimal kurz mit Mädchen »gegangen«, ohne dass es dabei mehr Annäherung als etwas Knutscherei gegeben hätte, dafür aber viel gegenseitiges und sehr peinliches Sich-Anschweigen. Immerhin wusste ich inzwischen, warum alle für ihre Rendezvous ins Kino gingen – da musste man nämlich nicht miteinander sprechen; Mädchen und Jungs hatten einfach noch nicht dieselben Themen). Ich erzählte davon, dass Brahoon damals, als er in dieser Berghütte – die die Ausmaße einer Zehlendorfer Villa gehabt haben muss – eingeschneit worden war, mit der jungen und bildschönen Schauspielerin Anna Lyrrad eine Beziehung gehabt hatte, weshalb sie ihn auch in die Berge begleitet hatte und bei »Downhill« leise im Hintergrund zu hören war. Anna Lyrrad, die später in der Liebeskomödie »From The Clouds« weltweite Erfolge in der Rolle eines unfassbar schönen, aber fürchterlich tollpatschigen Engels feierte, eines Engels, der vom Himmel geschickt wurde, um einen notorischen Atheisten vor dessen sehr frühem Tod von der Existenz des Himmels zu überzeugen, was natürlich in einer total romantischen Liebesbeziehung endete, nachdem sich herausgestellt hatte, dass der Mann doch nicht früh sterben würde, weil sich Gott – Gott! – geirrt hatte. Als der Film herauskam, verliebten sich alle in Anna Lyrrad, und ich war ein bisschen stolz darauf, dass es dieser Musiker, den hier keiner kannte und den ich ein bisschen verehrte, geschafft hatte, diese Frau – die natürlich gegen Tabea Folkers nie bestanden hätte – zu erobern. Die Affäre der beiden endete anderthalb Jahre nach »Snow« mit einem wilden Streit in einem New Yorker Restaurant, in dem dabei einiges zu Bruch ging. Dieser Streit, den ein paar Paparazzi fotografisch dokumentieren konnten, hatte es hierzulande sogar in die Presse geschafft. Dann erzählte ich noch davon, dass Brahoons damaliger Chauffeur, der das Auto in die Rockys gesteuert hatte, William Sparker hieß und inzwischen für die Demokraten als Gouverneur von Kalifornien kandidierte. Ich stellte beim Erzählen fest, dass mein Interesse für den Musiker, für dieses Album und seine Geschichte doch etwas weiter ging.
Tabea hörte mir zu, fragte gelegentlich zwischen, und sie lächelte. Der Laden füllte sich, junge Menschen kamen an unseren Tisch und gingen wieder, wobei sie irritiert dreinschauten, wir bestellten Tee nach, und Tabea hörte mir zu und lächelte weiter. Und ich redete und erzählte, und ich wollte unbedingt, dass das hier niemals endete. Aber das Tee-In hatte merkwürdige Öffnungszeiten, davon abgesehen musste ich noch zum Training (ich versuchte mich damals in einem Basketballverein, weil Basketball die einzige Sportart war, in der ich mich nicht idiotisch anstellte und sogar einen körperlichen Vorteil hatte), also wurde es irgendwann Zeit.
»Darf ich dich zwei Sachen fragen?«, fragte ich todesmutig, nachdem uns ein mürrischer Tee-In-Besitzer-Peter abkassiert hatte, ohne dabei auch nur in meine Richtung zu schauen.
»Gerne auch mehr«, antwortete sie mit großer Selbstverständlichkeit und stützte den Kopf in eine Hand. Wie sie mich dabei ansah, das werde ich niemals vergessen. Ihre dunkel-kobaltblauen Augen füllten mein gesamtes Sichtfeld.
»Also die erste.« Ich räusperte mich, zwinkerte. »Warum eine Schule in Neukölln? Ich meine, du als Diplomatentochter. Ihr habt doch überall Spezialschulen, oder? Und Privatlehrer?« Ich stellte diese Frage besonders langsam, weil ich Angst vor der zweiten Frage hatte.
Sie nickte. »Ich wollte das so. Eine ganz normale Schule, wenigstens für ein paar Monate. In Tel Aviv« – ihr Gesicht verfinsterte sich kurz – »muss ich dann wieder auf eine Oberschule nur für Kinder deutscher Unternehmer und Politiker. Das ist grausig. Die sind alle schrecklich arrogant und schnöselig und halten sich für was Besseres. Sie schmeißen mit Geld um sich und wissen überhaupt nichts. Und sie interessieren sich nicht die Bohne für das Land, in dem sie gerade sind.«
Ich nickte mitfühlend. Sie musterte mich. Wir schwiegen. Dann sagte sie: »Und die zweite Frage?«
Ich nickte wieder. Jetzt oder nie. Ich atmete tief ein und wieder aus und sah die Tischplatte an, in die Pennäler ihre Initialen und Herzchen und Bandnamen geritzt hatten. »Warum ich?«, fragte ich leise. Diese Frage hatte so viele Implikationen und setzte nicht wenig voraus, aber ich war ganz sicher, dass an diesem Nachmittag in dieser etwas muffigen, aber nicht gänzlich ungemütlichen kleinen Teestube in Neukölln etwas passiert war. Und ich musste aus dieser Sicherheit Gewissheit machen. Ich wollte es verstehen, mit in den Abend nehmen, in die Nacht, in mein Leben. Ich wusste, dass ich ganz okay aussah, obwohl ich zu schlank für meine Größe war, wie ich meinte, ich wusste, dass ich witzig und in der richtigen Situation sogar klug sein konnte, dass ich niemandem peinlich war, aber sie hatte Birger Fläming und Micha Steineke abblitzen lassen, und sogar dieser steinalte Teestubentyp – Peter war mindestens dreißig – war auf sie scharf. Sie war eine junge Frau, die absolut jeden haben konnte.
Ihre Wangen legten für die Dauer eines Wimpernschlags eine sehr, sehr leichte Röte auf. Tabea Folkers blinzelte, hob den Kopf von der Hand und sah mich mit diesen wunderbaren Augen an.
»Ich kam in diese Klasse und habe dich zeichnen sehen«, sagte sie, während Hitze in mir aufstieg. »Ich habe eigentlich nichts sonst gesehen, nur dich und deinen Strubbelkopf, wie du dasitzt und die Welt um dich herum vergessen hast und malst. Dann, aber erst nach einer Weile, hast du mich angeschaut. Da hat es klick gemacht. Ich konnte nichts dagegen tun.«
Ich sagte nichts, spürte aber, wie meine Tränendrüsen die Tätigkeit aufnahmen, für die sie bestimmt waren. Meine Hände begannen zu zittern. Seltsam, wie sich unfassbare Freude zeigen kann.
»Ich will eigentlich wirklich nichts mit jemandem anfangen, weil es einfach gleich wieder vorbei sein wird. Aber dann hast du hier gesessen, mit deinem Whiskytee.« Sie zuckte die Schultern und strahlte mich an. »Ich musste mich entscheiden. Es war einfach so.«
Und dann legte sie ihre rechte Hand auf meine linke Hand. Alle im Tee-In hielten den Atem an, das konnte ich deutlich spüren. Die Welt verlangsamte sich, die Welt fokussierte sich, da waren nur noch Alex Bengt und Tabea Folkers und sonst nichts. Ich drehte meine Hand um, so dass die Handflächen aufeinanderlagen. Ihre Hand schloss sich um meine, ich tat das Gleiche, und dann konnte ich nicht anders – ich sah mich um. Es war still im Tee-In, bis auf »Never Ever Marry A Lawyer« von Ayksen Brahoon, denn Peter hatte »Judges On Vacation« immer wieder nur umgedreht, das machte er manchmal so. Alle sahen zu unserem Tisch, wirklich alle, und sämtliche Gespräche waren verstummt. Münder waren aufgerissen, Teetässchen hingen mitten in der Handbewegung in der Luft. Tabea grinste. »Wenn wir uns jetzt noch küssen, drehen sie durch«, sagte sie leise, und ich nickte und fühlte mich, als hätte ich die Weltmeisterschaft in irgendwas gewonnen.
»Lass uns das also lieber draußen tun«, schlug ich vor.
Sie schüttelte den Kopf. »Nein«, sagte sie. »Jetzt und hier und sofort. Ich habe schon zu lange gewartet.«
Und dann küssten wir uns.
Das war vor einundvierzig Jahren. Es fühlt sich an, als wäre es gestern passiert.
Hochgeschwindigkeitszug
Anfang der Achtziger wurde in Frankreich der TGV in Betrieb genommen, der train à grande vitesse, direkt übersetzt »Zug mit hoher Geschwindigkeit« oder »Hochgeschwindigkeitszug«. Der legendäre TGV wurde in Europa zum Pionier der sehr schnellen Fahrt mit etwas, das längst nicht mehr die Bezeichnung »Eisenbahn« verdiente, aber der Begriff hielt sich auch Jahrzehnte später noch. Die Japaner hatten mit ihrem Shinkansen-Streckennetz und den dazugehörigen Fahrzeugen eigentlich schon seit Jahren etwas Besseres, aber für die Europäer ging es erst mit dem TGV richtig los, dem später auch der deutsche ICE folgte.
Als ich – es war im Physikunterricht, meine ich – davon hörte, dass die französischen Züge mit fast 350 km/h zwischen Paris und Lyon unterwegs wären, einer Geschwindigkeit, die das Doppelte der damals üblichen Höchstgeschwindigkeit von Mittelklasseautos darstellte (die damals noch nicht standardmäßig mit Gurten ausgestattet waren und bei Kollisionen mit größeren Autos quasi verdampften), ließ mich der Gedanke nicht los, dass diese irre schnellen, irre langen und irre schweren Kolosse, in denen Hunderte von Menschen saßen, immer ganz schön früh abgebremst werden mussten, um rechtzeitig zum Stillstand zu kommen. Tatsächlich haben die TGVs auch heute noch einen Bremsweg von mehr als drei Kilometern, wenn sie mit Höchstgeschwindigkeit unterwegs sind. Das ist zwar nur halb so viel wie der Anhalteweg von dreihundert Meter langen Supertankern, aber bei denen sitzen ja auch nur wenige Menschen an Bord, und am Ende des Bremswegs lauert kein Bahnhof voll mit Leuten, sondern ein leerer Strand, eine felsige Küste, ein Riff oder so was. Seitdem ich zum ersten Mal davon gehört hatte, dass die mehreren Hundert Tonnen Stahl dreitausend verdammte Meter brauchten, um anzuhalten (eine Strecke, für die man bei normaler Geschwindigkeit zu Fuß eine gute halbe Stunde benötigt), hatte ich Angst um die Menschen darin und in den Kopfbahnhöfen am Ende der Strecken.
Und jetzt fuhr ich selbst in einem. Zumindest metaphorisch. Es würde noch über zwei Jahrzehnte dauern, bis ich tatsächlich mal in einem TGV sitzen würde, aber mit Tabea Folkers zusammen zu sein, und, scheiße, wir waren zusammen, das fühlte sich genauso an, glaubte ich zumindest. Die drei Monate, die dem Nachmittag im Tee-In folgten, waren wie eine ultrarasante Fahrt durch eine unfassbare Landschaft, wunderschön und abwechslungsreich und gleichzeitig entspannt und spannend, und ich versuchte atemlos, in mich aufzunehmen, festzuhalten, zu genießen und niemals zu vergessen, was dabei alles geschah, mir jeden Mikromoment zu merken, jede Geste, jede Mimik, jede Berührung. Ich gewöhnte mich sogar daran, dass ständig junge Männer in unseren Zug einstiegen und behaupteten, mein Platz wäre eigentlich ihrer. Mit der Zeit konnte ich diesem Umstand mit gelassenem Humor begegnen, denn die Sicherheit in mir, dass Tabea zu mir gehörte, wurde mit jedem Tag größer. Aber wir kamen dem Ziel auch immer näher. Unser Zug raste durch die Landschaft, es wurde minütlich wärmer, die Sonne schien intensiver, man konnte das Meer schon riechen, aber all das bedeutete auch, dass sich die Reise dem Ende entgegenneigte, dass jemand die Bremse ziehen und wir mit kreischenden Radreifen zum Stehen kommen würden, an jenem Endbahnhof, der »Trennung« hieß: Alexander Bengt in Berlin-Neukölln und Tabea Folkers in Tel Aviv, für mindestens acht Jahre, weil ihre Eltern ihr Studium nur finanzieren würden, wenn sie in deren Nähe bliebe, und diese Nähe hieße für die nächsten Jahre: Israel. Dreitausend Kilometer entfernt von hier. Selbst der TGV würde dafür fast zehn Stunden brauchen, aber es gab keine Gleise zwischen Berlin und dem Nahen Osten.
Und trotzdem wollten wir es nicht wahrhaben. Wir waren im Rausch und blendeten alles aus, wir pressten unsere Nasen an die Scheiben und lachten über die vorbeiflitzenden Lichter und über das zu Schlieren verschwimmende Wiesengrün, wir wurden zu einem Teil der Geschwindigkeit, und ich wünschte mir insgeheim, der Zug würde einfach nicht anhalten, sondern mit Höchstgeschwindigkeit und völlig ungebremst ins Bahnhofsgebäude krachen, um alldem wenigstens ein schnelles, endgültiges Ende zu bereiten. Die Alternative, nämlich die Vorstellung, ohne Tabea zu sein, war vollständig unerträglich, aber eigentlich war der Gedanke nicht einmal denkbar. Manchmal lag ich nachts wach und starrte an meine Zimmerdecke und überlegte, wie ich es verhindern könnte, doch mir fiel nichts ein, und ich brachte mir bei wegzudenken. Ich dachte stattdessen an uns, dafür musste ich mir nichts beibringen, das tat ich sowieso ständig. Tabea und ich, wir waren nicht einfach nur Tabea und ich, sondern etwas völlig Unbeschreibliches, eine neue Entität, eine höhere Stufe des Seins. Ich war verblüfft und überrascht, was alles möglich war, was aus einem werden konnte. Und was ich geworden war, was wir geworden waren, das war schlicht fantastisch.
Tabeas Familie bewohnte zwei gemietete Etagen einer Villa in der Nähe vom Schlachtensee. Es war ein schönes, geräumiges, helles Haus mit hohen Decken, Säulen am Eingang, einem gewaltigen Garten und direktem Blick auf die Rehwiese, eine Art Park in dieser Gegend, in der es Nobelrestaurants gab und vor jedem Grundstück mindestens ein Mercedes oder BMW stand, manchmal aber auch ein Rolls Royce oder noch was Teureres. Es gelang mir während dieser drei Monate allerdings nicht, herauszubekommen, was Tabeas Eltern genau im diplomatischen Dienst machten, warum sie zu dieser Zeit in West-Berlin waren und was sie anschließend in Tel Aviv taten. Irgendwann war es mir egal, und meistens waren sie auch nicht da. Tabeas älterer Bruder Rafael, der fast genauso schön wie sie war und so eigentümlich lächeln konnte, dass man nicht wusste, ob man sich gruseln oder freuen sollte, war ebenfalls ständig unterwegs, meistens in den Discos am Ku’damm oder in den Kneipen am Savignyplatz oder der Kantstraße. Er übernachtete bei den Frauen, die er dort kennenlernte, beinahe täglich einer anderen. Gegen Rafael Folkers war Micha Steineke ein blutiger Amateur.
Tabeas Mutter Sofie ähnelte Tabea sehr (oder umgekehrt); sie war nur ungefähr fünfundzwanzig Jahre älter, also um die vierzig, was man ihr aber kaum ansah. Tatsächlich konnte man die beiden aus einiger Entfernung leicht verwechseln, Mama Folkers war nur ein paar Zentimeter kleiner, und je näher man ihr kam, umso mehr der fröhlichen Lachfältchen wurden um ihre Augen herum erkennbar, doch echte Zeichen ihres Alters fehlten. Zwei, drei Jahre später erst kam mir der Gedanke, dass Tabea deshalb also auch in zwanzig, dreißig, vielleicht sogar in unvorstellbaren vierzig Jahren immer noch so wunderbar sein würde wie jetzt, wovon allerdings jemand anderes profitieren würde, und dieser Gedanke machte mich für eine Weile völlig fertig, obwohl ich da schon seit mehreren Dutzend Monaten nichts mehr von ihr gehört und beinahe jede Hoffnung längst aufgegeben hatte.
Tabeas Vater passte nicht so recht ins Bild. Er ähnelte Bud Spencer, war ein bisschen grobschlächtig, polternd, gerne sehr laut und alles andere als elegant, eher ein Bär als ein Tiger (Mama Folkers, Rafael und Tabea verglich ich gedanklich mit Gazellen), aber er war unfassbar freundlich und der vermutlich klügste Mensch, den ich bis dahin getroffen hatte – bei unseren wenigen Treffen verwickelte er mich in Gespräche, die mich einerseits stark herausforderten (er war sehr an meiner Meinung interessiert, meinte ich, obwohl ich meine Meinung für belanglos hielt), mir aber andererseits das Gefühl gaben, sekündlich mehr zu lernen als in einer ganzen Woche am verdammten Paul-Besser-Gymnasium. Er kannte sich mit Kunst aus, mit Mathematik, mit Literatur (die mich zu interessieren begann, und Frank Folkers kannte ein paar berühmte Schriftsteller persönlich), mit Astronomie und natürlich mit Politik. Die vier Folkers zusammen aber stellten alles in den Schatten, was ich kannte oder mir vorzustellen in der Lage war. Schöne, glückliche Menschen, die einander respektierten, die sich gegenseitig das Leben leicht und angenehm zu machen versuchten, sah man von der klitzekleinen Tatsache ab, dass sie im Begriff waren, Tabeas und mein Glück nachhaltig und endgültig zu pulverisieren. Und, okay, Frank, Sofie und Rafael waren hart im Urteil über andere, sie konnten exzellent lästern, was sie außerdem ziemlich gerne und häufig taten, doch nie im direkten Umgang, da blieben sie jederzeit erstklassig höflich.
Sie waren elitär.
»Sie wird in knapp zwei Jahren volljährig«, sagte ich zu Frank Folkers, als wir an einem Abend Ende Mai auf der Veranda der Villa saßen, während Mutter Folkers und Tabea für uns kochten, was nicht der Normalfall war, denn meistens schien der Vater zu kochen (sie waren also auch noch fortschrittlich, nicht zu fassen). Ich wagte nicht, ihn dabei anzusehen, nahm meine Cola und nippte daran, und ich spürte, wie meine Hände zitterten. In solchen Momenten war mir die Geschwindigkeit des Tabea-Alexander-TGV und die Aussichtslosigkeit unserer Fahrt besonders bewusst. Der Zielbahnhof war schon am Horizont zu sehen.
»Ja«, sagte er, und ich konnte spüren, dass er nickte. »Theoretisch könnten wir sie hierlassen, ihr eine kleine Wohnung suchen, und ihr könntet zusammenbleiben.« Er legte mir eine Hand auf die Schulter, und mein Blutpumpmuskel verdoppelte seine Frequenz, weil Hoffnung in mir aufkam. »Es bricht mir das Herz, Alex«, fuhr er dann fort, und ich fiel in mir zusammen, weil genau das, was er von sich behauptete, augenblicklich bei mir geschah. »Sie war lange nicht mehr so glücklich. Aber es geht nicht. Du musst mir das glauben. Wir müssen sie in unserer Nähe behalten. Wir müssen sogar Rafael bei uns behalten, obwohl er fast mit dem Studium fertig ist und sehr gut alleine zurechtkommt.« Folkers lachte kurz auf, legte den Kopf in den Nacken und sah nach oben, wo sich Rafael über das Balkongeländer gelehnt hatte und rauchte. Er hob eine Hand, lächelte sein teuflisches Lächeln und zwinkerte mir dabei zu. »Wir müssen als Familie zusammenbleiben, noch ein paar Jahre. Ich kann dir das nicht erklären. Es muss so sein. Es hat mit dem zu tun, was wir machen.« Papa Folkers schwieg und griff nach seinem Weinglas, trank einen Schluck und setzte es wieder ab. »Außerdem«, sagte er dann und legte mir die Hand dabei auf den Unterarm. »Wenn du selbst eine sechzehnjährige Tochter hättest – du kämst im Traum nicht auf die Idee, sie alleine in dieser verrückten Stadt zu lassen und selbst ein paar tausend Kilometer weit wegzuziehen.«
Ich konnte nur nicken. Ich konnte mir zwar nicht vorstellen, wie es wäre, eine sechzehnjährige Tochter zu haben oder überhaupt Kinder oder eine richtige Familie (also eine wie diese hier), aber ich verstand trotzdem, und es gab kein Argument dagegen. Doch ich hatte es wenigstens probieren müssen.
Tabea kam auf die Veranda und brachte einen großen Teller mit Bruschetta – geröstetem Weißbrot mit Tomaten- und Zwiebelstücken, etwas Olivenöl und diesem Kraut, von dem ich vorher noch nie gehört hatte, Basilikum. Ich liebte Bruschetta. Bei uns gab es Kartoffeln und Braten und Leberwurstbrot und Pichelsteiner Suppe, aber die Folkers waren in jeder Hinsicht anders. Ich nahm vorsichtig eine Scheibe und dachte in diesem Moment mit kristallklarer Deutlichkeit: Das wird enden. Es ist eine Episode. Du wirst wieder zurückstürzen, und es wird nichts bleiben als die Erinnerung daran, und auch die wird irgendwann verschwinden. Das ist nicht dein Leben, das ist nur ein Ausflug, eine Ferienreise. Es ist ein Film, bei dem du vorübergehend Schauspieler und Zuschauer bist, aber bald bist du beides nicht mehr.
»Du weinst ja, Alex«, sagte Tabea und beugte sich zu mir herab, legte eine Wange an meine Wange, küsste mich dann. Das war hier ganz selbstverständlich möglich. Meine Mutter regte sich schon auf, wenn sie auf der Straße eindeutig verheiratete Leute sah, die sich küssten. Ihrer Überzeugung nach gehörte jede Intimität ins Private, nirgendwohin sonst. Ich hatte Tabea während der ganzen Zeit ein einziges Mal zu mir mit nach Hause genommen, um es ihr zu zeigen, um ihr zu beweisen, dass stimmte, was ich erzählte, und sie hatte mich kein zweites Mal darum gebeten. Hier, in der Villa, in Tabeas großzügigem Zimmer mit diesem riesigen Doppelbett, hier durften wir sogar Sex haben, selbst wenn ein Elternteil im Haus war und wissen musste, was wir taten. Ich hatte hier meinen allerersten Sex gehabt, meinen zweiten und meinen ungefähr hundertsten, meistens allerdings, wenn wir alleine waren. Denn obwohl es niemanden zu stören schien, was wir taten, fühlte es sich im leeren Haus deutlich besser an. Es fühlte sich natürlich immer großartig an. Ich hatte keinen Vergleich, aber ich wollte auch keinen Vergleich. Tabea hatte mir leichthin alle Ängste vor dem ersten Mal genommen, alle dummen Gedanken über Durchhaltevermögen, Länge, Größe, Anstellwinkel, Beschaffenheit, Aussehen und Leistungsvermögen meiner primären Ausstattung, sie hatte all den Blödsinn einfach fortgewischt, den die Jungs meines Alters von sich gegeben hatten, und aus dieser sensationellen, wunderbaren Sache eine großartige Selbstverständlichkeit für mich gemacht, von der ich allerdings ebenso wusste, dass sie enden würde. Und wie. Und wann. Nein. Wegdenken. Augen zu und im TGV bleiben.
»Schon in Ordnung«, sagte ich. Das war zwar ungefähr die zweitgrößte Lüge der Menschheit, direkt nach der, dort draußen sei irgendwo ein Gott, der über uns wacht, aber zuweilen sind alle glücklicher, wenn man die offensichtliche Lüge nicht hinterfragt.
Manchmal gingen wir in ihrer Gegend spazieren, was mich an meine frühe Kindheit denken ließ, als wir hin und wieder zum Kleinen Wannsee gefahren waren, um dort an den riesigen Grundstücken mit den prächtigen Villen entlangzuschlendern und meinem Vater zu lauschen, der sich über den Reichtum und die Ungerechtigkeit aufregte, weshalb er gelegentlich – er nannte das »meine kleine Rache« – eine seiner fast aufgerauchten, noch glühenden Zigarettenkippen über die hohen Zäune schnippte. Ich ging dann eine Zeit lang rückwärts, um zu sehen, ob das Gebäude auf dem Grundstück in Flammen aufgehen würde, aber das geschah natürlich nicht – es geschah einfach überhaupt nichts, die Kippen verglimmten nur. Die Häuser, an denen Tabea und ich auf dem Weg zum Schlachtensee vorbeigingen, in dem wir uns ein paarmal (auch vom Sex kurz vorher) abkühlten, sahen ganz ähnlich aus. Ich wusste, dass es im Vergleich zu dem, was ich hier sah, durchaus noch krasse Steigerungen gab, dass Menschen anderswo auf der Welt auf riesigen Anwesen lebten, mit vielen Angestellten und einem mächtigen Fuhrpark und Helikopterlandeplatz, aber schon das hier fand ich irgendwie absurd. Und, da stimmte ich meinem Vater gedanklich zu, auch irgendwie ungerecht. Andererseits … ich schüttelte den Kopf, weil ich den Gedanken dann doch wieder für falsch hielt, und ich konnte mich letztlich für keine Position entscheiden. Es war nicht ungerecht, wenn einige mehr hatten als andere, selbst wenn der Unterschied extrem war; das hatte mit Gerechtigkeit nichts zu tun. Es war das falsche Wort dafür.
»Was ist?«, fragte Tabea, die neben mir ging, aber etwas zu mir gedreht, weil sie sich angewöhnt hatte, meinen rechten Oberarm beidhändig zu umfassen, wenn wir zu Fuß unterwegs waren. Ich liebte das sehr. Es war bei längeren Wegen ein bisschen unbequem, doch es war zugleich ein wunderbares Zeichen der Nähe, des Niemals-loslassen-Wollens, das mich überaus rührte.
»Ich habe an meinen Papa gedacht. Wir sind nicht weit von hier früher spazieren gegangen, weil er sich so gerne über den Reichtum anderer aufgeregt hat. Er fand das ungerecht.«