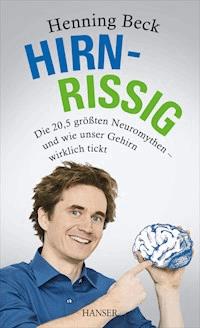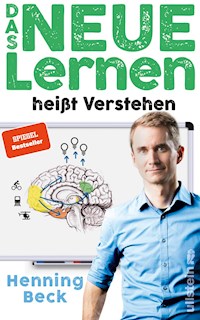Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2017
Die Anforderungen an unser Gehirn sind höher als je zuvor. Wir werden von Informationen bombardiert, mailen, chatten und surfen gleichzeitig. Und es scheint, als sei unser Gehirn nicht für das digitale Zeitalter gemacht. Es ist permanent abgelenkt, ungenau und vergesslich. Für genau diese Schwächen jedoch sollten wir ihm dankbar sein! Denn die Hirnforschung zeigt: Erst durch die Irrtümer des Gehirns sind wir kreativ – etwas, was Künstliche Intelligenz noch in 100 Jahren nicht erreichen wird. Dieser Ratgeber ist ein neurobiologischer Mutmacher, der auf ungewöhnlichem Weg zu besserer Konzentration, größerer Entscheidungsstärke und mehr Kreativität verhilft.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 396
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Die Anforderungen an unser Gehirn sind höher als je zuvor. Wir werden von Informationen bombardiert, mailen, chatten und surfen gleichzeitig. Und es scheint, als sei unser Gehirn nicht für das digitale Zeitalter gemacht. Es ist permanent abgelenkt, ungenau und vergesslich. Für genau diese Schwächen jedoch sollten wir ihm dankbar sein! Denn erst durch die Irrtümer des Gehirns, so zeigt Hirnforscher Henning Beck, sind wir kreativ – etwas, was Künstliche Intelligenz noch in 100 Jahren nicht erreichen wird. Beck wirft einen Blick hinter die Kulissen der fehlerhaftesten biologischen Struktur der Welt – unseres Gehirns. Er zeigt, wo genau seine Schwächen liegen, und hält ein überraschendes Plädoyer für den Irrtum: Nicht effizientes Denken sollten wir anstreben, sondern die kluge Organisation von Wissen. Wie das geht? Mit Pausen zum Beispiel und cleverem Vergessen. Ein neurobiologischer Mutmacher, der auf ungewöhnlichem Weg zu besserer Konzentration, größerer Entscheidungsstärke und mehr Kreativität verhilft.
Hanser E-Book
Henning Beck
IRREN ist NÜTZLICH
Warum die Schwächen des Gehirns unsere Stärken sind
Carl Hanser Verlag
INHALT
EINLEITUNG
1 VERGESSEN
Warum Sie sich an dieses Buch nicht erinnern werden – und gerade dadurch das Wichtigste behalten
2 LERNEN
Warum wir schlecht auswendig lernen, dafür aber die Welt verstehen
3 GEDÄCHTNIS
Warum eine falsche Erinnerung besser ist als gar keine
4 BLACKOUT
Warum wir unter Druck versagen – und wie die Geheimformel gegen Lampenfieber lautet
5 ZEIT
Warum wir sie immer falsch einschätzen – und dadurch wichtige Erinnerungen bilden
6 LANGEWEILE
Warum wir nicht abschalten können – und wie aus Tagträumen Muße wird
7 ABLENKUNG
Warum wir uns so leicht stören lassen – und welche Störungen uns kreativer machen
8 MATHEMATIK
Warum das Gehirn ohne Zahlen am besten rechnet
9 ENTSCHEIDUNGEN
Warum wir zu viel wagen – und dennoch klug entscheiden
10 AUSWAHL
Warum die Wahl eine Qual ist – und wir trotzdem das Richtige aussuchen
11 DENKSCHABLONEN
Wie uns Vorurteile helfen, wo sie uns schaden – und wie wir Stereotypenfallen vermeiden
12 MOTIVATION
Warum der innere Schweinehund uns bremst – und wie wir uns und andere antreiben
13 KREATIVITÄT
Warum uns auf Knopfdruck nichts Neues einfällt – und wir dennoch immer neu denken
14 PERFEKTIONISMUS
Warum wir Fehler brauchen, um besser zu werden
ANMERKUNGEN
EINLEITUNG
Dies ist kein Buch, das Ihnen zeigt, wie toll das Gehirn funktioniert. Zumindest nicht auf den ersten Blick. Dies ist auch kein Buch, in dem Sie lesen können, wie perfekt das Gehirn arbeitet. Das tut es nämlich nicht.
Und wenn Sie nach dieser Lektüre mit Ihrem Gehirn noch schneller und konzentrierter denken wollen, muss ich dem gleich zu Beginn eine Absage erteilen: Auch das wird nicht passieren, denn das Gehirn ist alles andere als präzise oder flott im Rechnen. Es ist ein verträumter Schussel, oft abgelenkt und unkonzentriert, nie zu hundert Prozent verlässlich, es verrechnet sich, irrt ständig und vergisst mehr, als es behält. Kurzum: Es ist ein etwa 1,5 Kilo schwerer Fehler. Sie alle tragen diesen schlampigen Zeitgenossen ständig im Kopf mit sich herum – und ich gratuliere herzlich dazu.
Nachdem ich nun einen Großteil der Leserschaft verschreckt haben dürfte, gibt es eigentlich nur noch einen Grund, dieses Buch weiterzulesen: weil es Ihnen zeigt, dass es gerade das Nichtperfekte, das Fehlerhafte, das scheinbar Ineffiziente ist, was Ihr Gehirn so einzigartig und so erfolgreich macht.
Jeder kennt es aus dem eigenen Leben: Das Gehirn macht Fehler – manchmal größere, manchmal kleinere; es vergeht kein Tag, an dem nicht auch Ihr Gehirn irgendwelchen Unsinn baut, sich verrechnet oder irrt. Sie schätzen die Zeit falsch ein, haben vergessen, was Sie gerade erst gelesen haben oder lassen sich von Ihrem Handy ablenken. Und gerade das ist eine prima Sache. Denn es sind die vermeintlichen Schwächen und Ungenauigkeiten, die Ihr Gehirn so anpassungsfähig, dynamisch und kreativ machen.
Wer denkt, dass ich da etwas übertreibe, hier eine kleine Kostprobe Ihrer geistigen Leistungsfähigkeit:
Was ist tausend plus zehn?
Plus tausend?
Dann plus fünfzig?
Plus tausend?
Plus dreißig?
Plus tausend?
Und nochmal plus zehn?
Kurz nachdenken, überlegen … sind es fünftausend? Natürlich nicht, es sind viertausendeinhundert. Gut gemacht! An alle, die auf eine andere Zahl gekommen sind, kein Problem, Ihr Gehirn vertauscht schnell mal ein paar Dezimalstellen und rutscht zwischen den Ziffern hin und her. So kann selbst einfaches Addieren kompliziert werden. Wie oft steht in der nächsten Zeile der Buchstabe M?
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
Genug gesummt, gar nicht so einfach, auf die richtige Lösung zu kommen. Hier sieht man schon: Das Gehirn scheint gar nicht darauf ausgerichtet zu sein, maschinengleich Informationen zu verarbeiten. Im Gegenteil, es verzettelt sich regelmäßig.
»Aus Fehlern wird man klug, drum ist einer nicht genug«, sagte mein Chemielehrer. Dann zündete er das Silberacetylid an und sprengte ein Loch in den Schulhof. Merke: Nicht immer ist Trial and Error das Mittel der Wahl. Manchmal aber eben doch – mein Nachbar zeigt, wie es geht. Der ist wirklich eine außergewöhnliche Persönlichkeit, mittlerweile gute zwei Jahre alt und schon ein richtig cleverer Kerl. Er beherrscht Dinge, die jeden Supercomputer zur Verzweiflung bringen: Ohne Probleme erkennt er das Gesicht seiner Mutter in einer Menschenmenge und sich selbst im Spiegel; nach einmaligem Spielen mit einem Auto weiß er, was ein Auto ist; er identifiziert Rauchmelder an der Decke und findet Kartoffeln lecker – Aufgaben, die kein heutiger Computer in endlicher Zeit lösen kann. Dabei macht der Kleine ständig Fehler: Bis vor kurzem konnte er noch nicht mal sicher laufen, seine Bewegungen sind tapsig, seine Sprache bruchstückhaft, und er schläft mehr als die Hälfte des Tages, ist in dieser Zeit also komplett funktionsuntüchtig. Jeder Ingenieur würde die Hände über dem Kopf zusammenschlagen: »Was für eine Fehlkonstruktion. Zwei Jahre, und es läuft immer noch nicht rund.« Wie ein Windows-Betriebssystem.
Trotzdem macht mein Nachbar gewaltige Fortschritte. Tag für Tag – in einem Tempo, mit dem keine Rechenmaschine Schritt halten kann. Jeder Fehler, jede Ungenauigkeit ist Ansporn, es das nächste Mal anders und damit vielleicht ein kleines bisschen besser zu machen. Sein Gehirn ist alles andere als perfekt – und das wird es auch niemals sein. Im Laufe der Zeit wird es sich zwar immer besser an seine Umgebung anpassen, aber vollendet und fertig wird es nie, sondern sich immer die Fähigkeit zum Irrtum bewahren. Denn nur, wer Fehler in sein Handeln einbaut, wird irgendwann auch Neues entwickeln. Wer hingegen immer versucht, möglichst »richtig« zu denken, bewegt sich auf dem Niveau eines Computers: effizient, präzise und schnell – dafür auch unkreativ, langweilig und vorhersehbar.
Stattdessen bauen wir auch im Erwachsenenalter noch lauter geistigen Mist. Wir vergessen Namen und Gesichter genauso, wie, ob wir die Tür abgeschlossen haben. Wir lassen uns bei der Arbeit leicht von einer WhatsApp-Nachricht ablenken oder verlieren in der E-Mail-Flut des Tages den Überblick. Uns liegen Namen auf der Zunge und fallen uns doch nicht ein. Wir schätzen die Zeit genauso falsch ein wie Wahrscheinlichkeiten oder Zahlen. Wir tun uns schwer damit, Entscheidungen zu treffen, wenn die Auswahl groß ist. Wir haben genau dann einen Blackout, wenn wir vor Publikum einen Vortrag halten müssen. Wir können nach einem anstrengenden Tag nur schwer abschalten und lernen unter Druck am schlechtesten.
Auf der anderen Seite gibt es kein Organ, kein System, geschweige denn einen Computer, der in der Lage ist, komplizierte Aufgaben so spielerisch zu lösen, wie wir es tun: 35 × 27 = ? Schwierig ohne Taschenrechner. Einen Helene-Fischer-Song erkennen? Kein Problem. Die Rechenaufgabe, so simpel sie ist, können wir kaum im Kopf lösen, doch ein Lied, das Gesicht eines lieben Verwandten oder auch dessen Stimme erkennen wir sofort. Und das, obwohl es vom Rechenaufwand her ungleich aufwendiger ist, einen bestimmten Sänger auf der Bühne zu erkennen.
Es scheint, als würde unser Gehirn das besonders schlecht können, was wir in unserer gegenwärtigen technisierten und digitalen Welt vermeintlich benötigen. Wir wollen Optimierung und Genauigkeit, sprich: Perfektion. Und unser Gehirn? Macht das Gegenteil und entzieht sich diesem Anspruch. Viele stellen sich vor, wie schön es wäre, wenn eine fehlerfreie Rechenmaschine in unserem Kopf arbeiten würde. Wie konzentriert, effizient und schnell könnte man damit seine Aufgaben lösen. Und in der Tat: Computer machen keine Fehler – und wenn sie es tun, dann stürzen sie ab. Gehirne stürzen hingegen nicht ab (außer, man hilft von außen nach, aber das ist eine andere Geschichte …). Und das liegt daran, dass sie nach einem völlig anderen Verfahren arbeiten. Es ist der Irrtum, die Ungenauigkeit im Denken, die uns den Computern überlegen macht. Allen Schreckensvisionen, dass die Computer schon in wenigen Jahrzehnten die Weltherrschaft an sich reißen und uns in den geistigen Schatten stellen werden, erteilt die Biologie an dieser Stelle eine klare Absage. Das scheint dem Trend der Digitalisierung, dem Zauberwort unserer modernen Welt, zu widersprechen: Schulklassen wie Unternehmen sollen vernetzt, Daten ausgetauscht und effizient ausgewertet werden. »Klassenzimmer der Zukunft«, »Big Data Analysen«, »Industrie 4.0« – kein Lebensbereich, der sich nicht mit der Rechenpower der Computerwelt modernisieren möchte. Doch die großen Ideen der Welt werden auch in Zukunft nicht digital, sondern analog gedacht. Von Gehirnen, nicht von Smartphones. Computer lernen Dinge – wir verstehen sie. Computer befolgen Regeln – wir können sie ändern.
Computer mögen uns in Schach oder Go schlagen, das ist nicht verwunderlich, weder kreativ noch besorgniserregend. Ich würde mir erst ernsthafte Sorgen machen, wenn ein Computer anfängt, Fehler zu machen, und anschließend verkündet: »Schach? Och nö, keine Lust mehr, ist langweilig. Ich zocke jetzt mal eine Runde World of Warcraft!« Solange das nicht passiert, bleibt das menschliche Gehirn immer noch das Maß aller Dinge. Gerade weil es so vermeintlich schlecht funktioniert.
In diesem Buch möchte ich Ihnen zeigen, was hinter den Kulissen der vermutlich fehlerhaftesten Denkstruktur der Welt (Ihrem Gehirn) passiert. Wie es Irrtümer nutzt, damit es sich in sozialen Situationen bestmöglich zurechtfindet, auf neue Ideen kommt und Wissen erzeugt. Ja, dabei macht es manchmal Fehler, doch das Paradoxe dabei ist: In unseren Irrtümern und Unkonzentriertheiten steckt unsere wahre Denkpower. Die meisten der vermeintlichen Denknachteile bergen einen gewaltigen Vorteil. Dass wir uns an Namen nicht sofort erinnern können, ist wichtig, damit wir überhaupt dynamische Erinnerungen aufbauen können. Dass wir uns so leicht ablenken lassen, nützt uns, um kreativ zu denken. Und dass wir mitunter zu spät zu einer Verabredung kommen, weil wir die Zeit falsch einschätzen, ist eine klasse Sache, denn würde unsere innere Uhr exakt gehen, könnten wir nicht so schnell von Erinnerung zu Erinnerung springen, wir wären gefangen in einem statischen Gedächtnis.
Nun ist dies kein Buch, das ausschließlich unsere geistigen Schwächen preisen soll. Nicht jeder Fehler hat ja etwas Gutes. Doch wer erkennt, warum ein Gehirn manchmal nicht wie auf Knopfdruck funktioniert, der hat schon den entscheidenden Schritt gemacht, diese Schwäche zu verstehen. Das hilft uns, im richtigen Moment konzentrierter zu sein, kreative Ideen zuzulassen oder Erinnerungen besser zu behalten. Das Gehirn ist wahrscheinlich das beste Beispiel dafür, wie man aus seinen Schwächen Stärken machen kann.
P.S.: Ach ja, wie jedes Produkt des Gehirns unterliegt auch dieses Buch biologischen Schwankungen und ist daher nicht fehlerfrei. Bestimmt haben sich hier und da kleine Tipp-, Schreib- oder Zeichenfehler eingeschlichen. Doch nach dieser Lektüre werden Sie wissen, warum das nichts Schlimmes, sondern etwas Gutes ist. Solange die Dosis stimmt. Apropos Dosis, es waren 27 M’s, die hintereinanderstanden. Und wer das beim ersten Mal Zählen ohne Fehler hinbekommen hat, der hat wirklich ein ziemlich fehlerfreies Gehirn. Das kann ja manchmal auch nicht schlecht sein.
Kapitel 1
VERGESSEN
Warum Sie sich an dieses Buch nicht erinnern werden – und gerade dadurch das Wichtigste behalten
Nicht erschrecken, aber gleich zu Beginn dieses Buches erwartet Sie ein kleiner Test. Schließlich möchte ich sicherstellen, dass Sie, verehrte Leserin, lieber Leser, auch aufmerksam bei der Sache sind: Wie lauteten die ersten drei Wörter auf der vorherigen Seite? Na gut, das ist nicht ganz so einfach, kein Problem. Dann eben: Wie lauten die ersten drei Worte der Einleitung? Wenn Ihnen auch das noch zu schwer ist: Wie lautet der Titel dieses Buches? Das kriegen Sie hin. Und falls Sie mit »Irren ist menschlich« antworten sollten, beweisen Sie zumindest, wie mächtig Sprachroutinen sind.
Ein bisschen erstaunlich ist es dennoch. Sie haben alle Sinne geschärft und lesen konzentriert (das hoffe ich zumindest). Und dann das: Was genau man vor zwei, drei Seiten gelesen hat, fällt einem nur nach intensivem Nachdenken oder gar nicht ein. Manchmal schweifen die Gedanken ab, manchmal denken Sie über das gerade Gelesene so intensiv nach, dass Sie das Vorherige vergessen. Das wird Ihnen im Verlaufe dieses Buches noch häufiger so ergehen – und zwar egal, wie sehr ich mich bemühe, den Text so mitreißend wie nur möglich zu gestalten. Als Autor freut man sich natürlich immer, wenn die Leserschaft auch behält, was man im Schweiße seines Angesichts in die Tastatur gehackt hat. Doch als Neurowissenschaftler ist mir gleichzeitig bewusst, dass nur die allerwenigsten Menschen wirklich abspeichern, was sie gelesen haben. Kaum einer wird sich am Ende dieses Buches an exakt jedes Wort erinnern (wem das passiert, der möge sich bitte bei mir melden, Hilfe sowie das Komitee des Guinnessbuchs sind unterwegs). Was die wichtigste Botschaft jedes Kapitels ist, bleibt jedoch hängen. Hoffentlich. Kaufen Sie sich ansonsten gerne das Buch noch einmal, um es, frisch ausgepackt und nach Druckerschwärze duftend, von vorne zu lesen. Auch das würde mich sehr freuen.
Offenbar scheint sich das Gehirn permanent in einem Modus des Vergessens zu befinden. Wer schon mal eine längere Strecke mit dem Auto gefahren ist, weiß, wovon ich spreche: Man fährt so fröhlich vor sich hin, um nach einer Stunde innezuhalten und sich zu fragen: Wo bin ich hier eigentlich? Als hätte man einen geistigen Autopiloten aktiviert, der unsere Erinnerungen blockiert. Wer braucht da noch ein selbstfahrendes Google-Auto, wenn unser Gehirn schon längst die Kunst des autonomen Fahrens beherrscht? Dass wir uns beim Durch-die-Landschaft-Fahren an vieles nicht erinnern, kann zwei Gründe haben: Erstens, die Gegend um uns herum ist wirklich langweilig (wer schon mal auf der A24 unterwegs war, weiß, was ich meine). Zweitens, das Gehirn hat entschieden, dass die meisten Informationen der vergangenen 60 Minuten erstmal vergessen werden sollen. Letzteres ist die Standardeinstellung unseres Denkorgans.
Beim Autofahren ist das meist nicht so schlimm. Doch das Gehirn merkt sich auch in anderen Situationen viele Sachen nicht. Was war die Topmeldung der Tagesschau am gestrigen Abend? Worüber haben Sie gestern als letztes vor dem Einschlafen nachgegrübelt? Haben Sie die Tür wirklich abgeschlossen? Fragen über Fragen, die das Gehirn gar nicht beantworten will. Was für ein unfassbar schlampiges Organ! Ständig am Vergessen, Verdrängen und Verschusseln. Doch warum ist das so? Warum merkt sich das Gehirn nicht viel mehr und löscht so vieles?
Denn ob banale Alltagsdinge oder vermeintlich wichtige Sachen, alles wird vom Gehirn nach dem gleichen Mechanismus entsorgt. In Zeiten des medialen Overkills gewöhnt man sich ein solches Kurzzeitdenken geradezu an, werden wir doch permanent von Informationen und neuen Nachrichten belästigt: Zeitungsartikel, die man nur überfliegt und nicht behält. News, die man in einer Smartphone-App nur wegwischt und gleich vergisst. E-Mails, die in der Nachrichtenflut untergehen. Nie war es so einfach, an neues Wissen zu gelangen, und noch nie scheint es so kompliziert gewesen zu sein, das Wichtige auch zu behalten. Doch was passiert eigentlich in unserem Gehirn, wenn wir gerade Erlebtes wieder vergessen? Und was kann man tun, um die wichtigen Dinge nicht gleich wieder aus dem Gedächtnis zu verlieren?
Ein Umkleidezimmer für Erinnerungen
Zunächst einmal muss ich Sie beruhigen: Keine Sorge, wenn Sie sich nicht daran erinnern, was vor zwei Seiten in diesem Buch stand. Ihr Gehirn hat nämlich gar nicht die Aufgabe, möglichst viel Wissen abzuspeichern – viel wichtiger ist es, zur richtigen Zeit das Richtige zu vergessen beziehungsweise aus dem Bewusstsein zu entsorgen. Erinnerungen sind nichts Statisches, nichts, was das Gehirn einmal fest abgespeichert hat, um anschließend wieder darauf zuzugreifen. Erinnerungen sind lebendig und werden ständig verändert. Nur dadurch hat das Gehirn überhaupt die Möglichkeit, neues Wissen aufzubauen.
Damit das so bleibt, ist das Gehirn Experte darin, Sachen zu beseitigen, damit sie uns nicht weiter stören. Das können Sinneswahrnehmungen sein genauso wie Erinnerungen, neue Informationen oder Eindrücke. Um ein flexibles und anpassungsfähiges Gedächtnis zu bilden, muss das Gehirn also den allermeisten Informationsmüll eliminieren. Nur, was wichtig ist, kommt ins Bewusstsein, damit man sich später daran erinnern kann.
Nun ist das Gehirn zwar ein sehr leistungsfähiges und dynamisches Organ, hätte demnach prinzipiell alle Möglichkeiten, viel mehr abzuspeichern, als es das tut – aber gleichzeitig ist es auch genauso faul. Deswegen teilt es sich seine Kräfte ein. Eintreffende Informationen werden aus diesem Grund nicht sofort dauerhaft gespeichert, sondern befinden sich zunächst auf Probe im Gehirn.
Das kennt man aus dem Alltag, auch dort muss sich manches erst bewähren, bevor es dauerhaft genutzt wird. Stellen Sie sich vor, Sie möchten sich eine neue Hose kaufen, dann greifen Sie ja auch nicht sofort zu dem Exemplar, das Sie im Schaufenster sehen. Erst müssen Sie die Hose testen. Sie gehen also in die Umkleide und probieren sie an. Dabei achten Sie auf zwei Dinge: Sitzt sie gut? Und passt sie zu Ihrem Style?
So macht es auch das Gehirn. Nun gut, nicht ganz genau so, schließlich haben wir nicht nur Klamotten im Kopf. Aber das Prinzip ist ähnlich: Bevor wir uns an etwas langfristig (also noch nach mehreren Stunden oder Tagen) erinnern, muss es eine Testphase überstehen. Unser geistiges Umkleidezimmer ist dabei der Hippocampus, eine bananenförmige Struktur in der Mitte zwischen unseren Großhirnhälften. Weil der erste Neuroanatom, der diese Struktur beschrieb, glaubte, ein Seepferdchen darin zu erkennen, hat er sie Hippocampus (lat. für Seepferdchen) genannt. Ich habe allerdings keine Ahnung, was der Kollege damals genommen hat, ich habe darin jedenfalls noch nie ein Seepferdchen erkannt, auch keine Schlange, keinen Aal oder anderes Meeresgetier. Der Hippocampus liegt vielmehr wie ein bananenförmiges C direkt neben der Hirnmitte. Pro Hirnhälfte haben wir einen Hippocampus, der uns dabei hilft, neue Erinnerungen kurzzeitig zu speichern.
Alles, was irgendwann dauerhaft erinnert werden soll, wird also im Hippocampus »anprobiert«. Ganz genau so, wie Sie bei der Hose auf deren Passform achten, wird auch im Gehirn entschieden, ob eine mögliche Erinnerung gut zum bisherigen Erfahrungsschatz passt. Im Hippocampus wird die entsprechende Information daher vorübergehend aufbewahrt; das können wenige Sekunden sein (und wenn man in dieser kritischen Zeit einen Schlag auf den Kopf kriegt, ist auch die Kurzzeiterinnerung weg) oder einige Stunden. Spätestens im Schlaf werden sie jedoch im Hippocampus wieder hervorgeholt und überprüft, ob sie sich für eine langfristige Speicherung eignen. Das entscheidende Kriterium dafür ist die Neuartigkeit: Nur wenn uns etwas wirklich Neues widerfährt, das einen Nutzen verspricht und sich von den bisherigen Erfahrungen deutlich unterscheidet, wird es »gekauft«, pardon, gespeichert. Das kostet zwar auch, nämlich etwas Energie, die die Nervenzellen aufwenden müssen, um ihre Verbindungen untereinander für eine langfristige Erinnerung anzupassen. Und genau deswegen geht das Gehirn auch sparsam mit dem Erinnern um. Nur das Wichtigste wird behalten, das allermeiste vergessen – selbst, wenn wir es ständig sehen.
Ein Biss in den Apfel – rechts oder links?
Welche Form hat das Apple-Logo? Sie wissen schon: der angebissene Apfel, schwarz auf weißem Grund. Doch ist der Biss rechts oder links? Hat der Apfel ein Blatt oder einen Stiel, und wenn ja, zeigen diese nach rechts oder links? Hat der Apfel sonst noch irgendwelche Wölbungen oder Ausbuchtungen?
Das Apple-Logo mutet vertraut an, doch in einer Untersuchung an der University of California in Los Angeles konnte nur einer der 85 Testteilnehmer das Logo auf Anhieb richtig zeichnen (dabei befanden sich die Probanden im Mutterland des Konzerns) – und weniger als die Hälfte konnte das Logo aus einer Auswahl an leicht verfremdeten Logos identifizieren1. Kein Wunder, dass Plagiatsfirmen leichtes Spiel haben. Dennoch ein Tipp an alle Mallorca-Urlauber, die ein vermeintliches Schnäppchen in einer Strandboutique machen: »Gucchi« schreibt man nicht mit »ch«.
Je öfter wir mit etwas konfrontiert werden, desto mehr schwächt sich unsere Erinnerung dafür ab. Nicht nur Apple-Logos filtern wir im Laufe der Zeit raus, in Studien können Testteilnehmer auch die wichtige Lage von Feuerlöschern2, die Anordnung von Computertastaturen3 oder die genauen Eigenheiten von Verkehrsschildern4 kaum behalten. Oder wissen Sie, wie viele Menschen auf einem Spielstraßenschild abgebildet sind? Unser Gehirn ist nämlich keine Erinnerungsmaschine, die darauf ausgelegt ist, Details abzuspeichern, sondern eben jene Kleinigkeiten zu vergessen, besser gesagt: zu opfern für das Wohl, das große Ganze zu erkennen.
Aktives Vergessen
So weit, so gut. Unser geistiger Filter sortiert sich wiederholende Sinneseindrücke aus und schickt sie ins Unterbewusstsein. Kleinigkeiten spielen für das Gehirn keine Rolle, werden übersehen und der Erkenntnis des Gesamtzusammenhangs preisgegeben. Doch manchmal will man sich ja doch etwas merken und hat es sogleich wieder vergessen: was man zum Beispiel gerade in einem Zeitungsartikel gelesen hat. Man liest so vor sich hin, um am Ende festzustellen, dass man die vielen Informationen nicht ansatzweise behalten konnte. Oder am Ende einer Nachrichtensendung, wenn man versucht, alle Meldungen nochmal vor dem geistigen Auge ablaufen zu lassen (keine leichte Aufgabe übrigens). Offenbar wendet das Gehirn seinen Filter auch auf zweifelsfrei sinnvolle Informationen an.
Doch das ist kein Nachteil, sondern die eigentliche Stärke des Gehirns. Schließlich ist es für uns nicht relevant, dass wir uns an alle Details unseres Lebens erinnern können. Viel wichtiger ist es, die großen Muster, auch in der Nachrichten- und Informationsflut, zu erkennen. Um genau dieses Wesentliche unserer Vergangenheit zu betonen, müssen wir vergessen – und zwar ganz gezielt und kontrolliert.
Erinnern Sie sich beispielsweise an Ihre Einschulung? Sicher haben Sie ein, zwei markante Bilder im Kopf, zum Beispiel wie Sie Ihre Schultüte bekommen haben oder zum ersten Mal in der Schulklasse saßen. Das war’s dann aber auch. Denn das scheinbar unwichtige Drumherum wird von Ihrem Gehirn aktiv gelöscht, je mehr Sie sich daran erinnern. Der Grund dafür ist, dass es für das Gehirn gar nicht wichtig ist, sich an alle Einzelheiten und Details zu erinnern, solange die wichtigste Botschaft stimmt (beispielsweise: Die Einschulung war ein klasse Tag). So zeigt sich im Labor, dass das Gehirn aktiv die Regionen unterdrückt, die für unwichtige oder nebensächliche Gedächtnisinhalte zuständig sind und die Haupterinnerung stören5. Im Laufe der Zeit verschwinden die Details immer mehr, die wichtige Botschaft der Vergangenheit wird dadurch aber geschärft.
Statt dass uns die Feinheiten unserer Erinnerung einfach so wegdämmern, löscht das Gehirn also aktiv diese Aktivitätsmuster aus, opfert sie gewissermaßen zum Wohl einer etwas knapperen, dafür umso schärferen Erinnerung an das Hauptereignis. Wenn Sie sich also den Detailreichtum Ihrer Vergangenheit bewahren wollen, dann versuchen Sie, sich so wenig wie möglich an diese zu erinnern. Dann haben Sie zwar auch nix davon, denn wenn Sie nicht daran denken, bringt Ihnen auch die tollste Erinnerung nichts. Aber immerhin können Sie sich damit trösten, dass Sie die Erinnerungsdetails noch nicht aktiv vergessen haben und sie immer noch in Ihrem Kopf sind.
Ein geistiges Lesezeichen
So wichtig das aktive Vergessen ist, um das Wesentliche zu betonen, so wichtig ist es auch, dieses Wesentliche für später zu markieren. Denn auch wenn man nicht mehr so genau weiß, was gestern Abend in den Nachrichten lief, ist deren Informationsgehalt nicht vergessen. Man kann sich nur nicht daran erinnern, das ist ein Unterschied.
Was heißt das nun? Wir wissen nicht immer sofort, wenn wir etwas Neues sehen oder hören, ob es später mal wichtig wird. Deswegen muss das Gehirn solche neuen Informationen für den späteren Gebrauch kennzeichnen, damit es diese anschließend leichter hervorholen kann – mit einem geistigen Lesezeichen, wenn man so will. So ähnlich wie man es von seiner Wohnung kennt. Auch dort fliegen Dinge herum, die auf den ersten Blick nicht so wichtig sind, die man nicht mehr braucht. Die könnte man gleich wegschmeißen, aber vielleicht benötigt man sie in Zukunft ja doch nochmal … Also besser aufheben. Deswegen sammeln wir Dinge in Kisten und Kartons und stapeln sie im Keller. Wir wissen dann nicht mehr so genau, wo sich was befindet (haben es scheinbar vergessen). Aber wenn sich in Zukunft eine günstige Gelegenheit ergibt, kramen wir die alten Sachen wieder hervor.
Das gilt so ähnlich für Erinnerungen. Zwar speichert unser Gehirn nicht alles in geistigen Kartons, es wendet aber eine ähnliche Technik an, um potenziell wichtige Informationen für die Zukunft zu kennzeichnen. Daraufhin kann die Information erstmal aus dem Bewusstsein entfernt werden. Um das zu überprüfen, wurde in einer Studie das Merkverhalten von Testpersonen untersucht6. Zunächst mussten sich die Probanden Bilder von Werkzeugen und Tieren anschauen. Wenige Minuten später bekamen sie wieder Bilder von Werkzeugen oder Tieren zu sehen, diesmal jedoch erhielten sie einen kleinen Stromstoß, wenn sie nur die Tiere betrachteten. Kein Wunder, dass sie sich später besser an die Tierbilder mit Elektroschock erinnerten. Doch auch noch am nächsten Tag konnten sie viele Tierbilder aufzählen, die sie schon vor dem Stromstoß gesehen hatten. Als hätte der nachträgliche Elektroschock dafür gesorgt, dass die Probanden zuvor gemachte Erinnerungen besser hervorkramen konnten. Wie praktisch, endlich eine wissenschaftlich belegte Methode, mit der man seinem Gedächtnis auf die Sprünge helfen kann: Elektroschocks zur rechten Zeit wirken wahre Wunder.
Bevor Sie nun den nächsten Selbstverteidigungsladen stürmen, um vermeintliche Gedächtnisstützen zu erwerben, halten Sie inne! Denn eine solch radikale Methode ist sicher nur die zweitbeste Lösung. Viel wichtiger: Auch wenn wir Dinge aus der Vergangenheit scheinbar nicht mehr wissen, kann unser Gehirn sie noch hervorholen – dann, wenn sie wichtig werden. Nur die wenigsten Informationen sind dauerhaft gelöscht, sondern befinden sich vielmehr in einem Wartezustand. Die vermeintliche Schwäche des Gehirns (dass es nämlich so viele Dinge sofort ausblendet und scheinbar vergisst) entpuppt sich als seine Stärke, denn so schlägt es zwei Fliegen mit einer Klappe: Zum einen wird es nicht sofort von zu vielen Informationen erschlagen. Und zum zweiten kann es später flexibel auswählen, welche der Informationen wirklich erinnert wird. Würde das Gehirn sofort die Entscheidung treffen, ob und in welchem Zusammenhang es etwas Neues dauerhaft speichern soll, wäre es viel zu träge. Denn neues Wissen können wir nur aufbauen, wenn Erinnerungen instabil sind.
Die geistige Steuererklärung
Es klingt paradox, doch gerade weil ein Gehirn so schlecht darin ist, Dinge akkurat zu speichern, kann es überhaupt neues Wissen erzeugen. Damit widerspricht die Organisation unseres Gedächtnisses fundamental unserer alltäglichen Erfahrung. Wenn wir im wirklichen Leben etwas organisieren wollen, dann ordnen wir es an einem bestimmten Ort. Unsere Steuerunterlagen heften wir in einem Ordner ab, den stellen wir in ein Regal, dann finden wir ihn später leichter wieder. Die Rechnung eines Geschäftsessens kommt ins Fach »Überflüssige Ausgaben« (je nachdem, wie erfolgreich der Deal war), so schaffen wir Ordnung, umgehen das Chaos auf unserem Schreibtisch und arbeiten produktiv.
So könnte es auch das Gehirn machen, sauber, ordentlich, effizient. Macht es aber nicht. Denn dadurch würde es vielleicht seine Vergesslichkeit bekämpfen, aber seine große Stärke verlieren: Informationen dynamisch zu kombinieren. Wer zu früh sortiert, hat es später schwerer, die Dinge in einen anderen Zusammenhang zu stellen. Dabei ist es genau das, was ein Gehirn von einem Computer unterscheidet: Es speichert nicht nur stumpfsinnig Daten ab, sondern macht aus ihnen auf kreative Weise Neues.
Wenn man also dem Gehirn auftragen würde, eine geistige Steuererklärung anzufertigen, würde es niemals die Rechnungsbelege fein sortieren, sondern erstmal alle auf einen Haufen werfen und dort auf unterschiedlichste Weise markieren. Mit der Rechnung für ein Geschäftsessen könnte man später ja unterschiedliche Dinge anfangen: Man könnte überprüfen, ob ein Restaurant vielleicht zu teuer war, wann man genau gegessen oder was dem Kollegen besonders gut geschmeckt hat. Eine solche flexible Einordnung gelingt jedoch nur, wenn man sich nicht zu frühzeitig auf die spätere Verwendung einer Information festlegt. In der Rückschau entscheidet sich dann, was man mit einer Information machen will.
Der Nutzen wackliger Erinnerungen
Das mutet komisch an, lässt sich aber sogar im Laborversuch bestätigen7. Dazu mussten sich Probanden zunächst eine Wörterliste mit Begriffen aus vier verschiedenen Kategorien (Möbel, Transportmittel, Gemüse und Tiere) einprägen. Kurz darauf lernten sie, eine Tastenkombination auswendig zu tippen. Was die Teilnehmer nicht wussten: Die Tastenreihenfolge entsprach dem Muster der Begriffsreihenfolge (ein Möbelstück korrespondierte dabei mit Taste 1, ein Transportmittel mit Taste 2, ein Gemüse mit Taste 3 und ein Tier mit Taste 4). Die Wörterliste und die Tastenkombination ähnelten sich also in der zugrunde liegenden Struktur. Kein Wunder, dass die Probanden eine Tastenkombination besonders schnell lernten, wenn das Tastenschema mit dem vorherigen Wörterschema übereinstimmte. Interessant war jedoch, dass man in einem Folgetest zwölf Stunden später die Tastenkombination umso besser beherrschte, je mehr man die Wörterliste vergessen hatte. Als wäre das Wörterschema »copy & paste« auf das Tastenschema übertragen worden.
Die aktuelle wissenschaftliche Hypothese dazu kennen Sie bereits: Je instabiler wir etwas gespeichert haben, desto leichter können wir es mit anderen Dingen kombinieren. Jede Information, die noch nicht in unserem Gedächtnis gefestigt ist, befindet sich in einem besonderen Zustand: Sie kann sich mit anderen Eindrücken und Informationen austauschen und den Lerneffekt beeinflussen. Wohlgemerkt, instabil und wacklig muss die Erinnerung sein, man kann sie in diesem Zustand also auch leichter verlieren.
Um neues Wissen anzusammeln, müssen wir deswegen manchmal konkrete Details vergessen. Das ist auch gar nicht schlimm, denn erstens würde die schiere Menge an eintreffenden Detailinformationen auch das beste Gehirn irgendwann überfordern. Und zweitens sind Details gar nicht so wichtig. Wir merken uns Muster, die abstrakten Zusammenhänge, die Geschichten dahinter – nicht die Kleinigkeiten, die es für das Gehirn häufig nur unübersichtlich machen. Vergessen ist also ein Mittel zum Zweck.
Geistig verdauen
Allerdings, auch das wird aus aktuellen Untersuchungen klar: Damit das Gehirn diese Funktion erfüllen kann, braucht es vor allem eines: Pausen. Und gerade das ist ein Problem in der heutigen Zeit, in der wir nur allzu leicht von Nachrichten, News, Telefonaten und E-Mails zugeschüttet werden. Sobald unser Gehirn eine neue Information erhalten hat, konkurriert sie schon mit einer neueren. So wird es für uns schwierig, die einzelnen Erinnerungen so zu gewichten (und zu vergessen), dass wir damit neues Wissen aufbauen können.
Deswegen, ganz wichtig an dieser Stelle: Überfordern Sie nicht Ihr Filter- und Vergessenssystem im Gehirn, sondern gönnen Sie ihm in regelmäßigen Abständen Pausen und Erholung. Wir lernen nämlich nicht, wenn wir denken, dass wir lernen, sondern in den Pausen dazwischen. Sportler werden ja auch nicht besser, wenn sie trainieren, sondern wenn sie sich vom Training erholen und sich ihr Körper daraufhin anpasst.
Wenn ich morgens beim Frühstück eine Zeitung gelesen habe, lese ich anschließend im Zug nicht gleich die aktuellsten News auf meinem Smartphone. Sondern ich warte. Und langweile mich ein bisschen. Das erfordert Mut, denn wer heutzutage beim Pendeln in der S-Bahn nicht auf sein Smartphone schaut, fühlt sich wie ein Kommunikationsfossil aus den 1990er Jahren, ausgegrenzt von der modernen Apple- und Android-Welt. Doch ich weiß, es lohnt sich, in diesem Moment mitleidige Blicke von Fünfzehnjährigen zu ernten, die gerade einen neuen Candy-Crush-Rekord auf ihrem Handy erspielt haben.
Ich weiß, dass ich mich nicht mehr an alle Details aus den morgendlichen Zeitungsartikeln erinnere. Doch so ähnlich wie mein Magen-Darm-Trakt gerade das Frühstücksmüsli verdaut und in seine Einzelteile zerlegt, damit mein Körper daraus später neue Zellen, möglichst viele Muskeln und am besten wenig Fettgewebe bilden kann, so zerlegt auch mein Gehirn in diesem Moment die Informationen des Morgens. Mein Müsli kann ich im Bauch nicht mehr schmecken, ebenso sind nicht alle Zeitungsmeldungen geistig präsent. Aber sie wirken auf mein Gehirn ein. Und je nachdem, wie mein Tag verläuft, kramt es später die eine oder andere Nachricht wieder hervor, kombiniert sie mit dem Moment, und ich kann mit meinem Wissen prahlen (was ich sehr gerne tue). Doch das gelingt nur dann, wenn ich ausreichend Informationspausen lasse und geistig verdaue.
Vergessen, um zu behalten
Sie sehen nun, warum wir so viele Dinge in unserem Leben (scheinbar) vergessen: Entweder, sie sind so gleichförmig, dass sie vom gehirneigenen Informationsfilter aussortiert werden. Oder sie sind so wichtig, dass sie erstmal ungeordnet im Unterbewusstsein schlummern, damit sie später flexibel mit anderen Informationen kombiniert werden können. Strenggenommen haben Sie diese Dinge dann nicht vergessen, Sie können sich im Moment nur nicht daran erinnern. Doch unterschätzen Sie nicht, wie sehr Ihr Gehirn auch ohne Ihr bewusstes Zutun weiterarbeitet, um Zusammenhänge und Muster in Ihrem Leben zu erkennen. Vielleicht erinnern Sie sich nicht mehr an jedes Detail des Gesprächs mit Ihrem Chef, doch die wirklich wichtigen holt das Gehirn später hervor, wenn Sie sie brauchen.
Das funktioniert jedoch nur, wenn Sie Ihr Gehirn nicht einem Informations-Overkill aussetzen und permanent mit neuen Nachrichten bombardieren. Dann wird es in der Tat nicht mehr auf den Inhalt der Nachricht achten können, sondern nur noch darauf, wie sehr sich diese ändert (klingelt, vibriert, summt oder sonst irgendwie auf ihrem Bildschirm aufpoppt). Dann wird auch Ihr Gehirn irgendwann die Schwellenwerte der Filtermechanismen so hoch setzen, dass vieles gar nicht erst bewusst erlebt wird. Das können Sie leicht umgehen, indem Sie bewusst Pausen einsetzen, um Ihrem Gehirn Zeit zum Nachdenken zu geben.
Und jetzt: Pause!
Wissen Sie noch, mit welchen drei Wörtern die vorletzte Seite begann? Müssen Sie nicht, ist nicht so wichtig, denn die Details zu vergessen, hat im Gehirn Methode. Nur so schafft es das Kunststück, Zusammenhänge zu erkennen. So wie in diesem Kapitel: Solange Sie behalten, dass es keine Schwäche des Gehirns ist, wenn es sich manchmal nicht mehr erinnert, sondern ein cleverer Trick, um im Dickicht der Informationen die wichtigsten später auszuwählen und neu zu kombinieren, haben Sie das Wichtigste verstanden. Das Gehirn ist keine Erinnerungsmaschine, kein Ordnungsfanatiker, der pedantisch darauf achtet, ja nichts zu vergessen und alles fein säuberlich zu sortieren. Das Gehirn ist vielmehr ein Schussel, der ständig mit den Gedanken hin und her springt. Aber genau diese Gedankensprünge machen uns kreativ und unabhängig.
Auch wenn Sie in wenigen Minuten viele Details der letzten Seiten vergessen haben werden, merken Sie sich bitte den großen Zusammenhang: dass es die Pausen sind, die es Ihrem Gehirn ermöglichen, Informationen zu ordnen und für den späteren Gebrauch zu markieren. Legen Sie dieses Buch jetzt also getrost für ein paar Minuten beiseite, entspannen Sie sich ein bisschen, lassen Sie die Information setzen, bevor Sie weiterlesen. Denn Sie wissen ja jetzt: Auch wenn Sie sich die Kapitel nicht genau merken können, Ihr Gehirn markiert das Wichtigste für später.
Kapitel 2
LERNEN
Warum wir schlecht auswendig lernen, dafür aber die Welt verstehen
Wissen ist Macht, heißt es allenthalben – und die Mächtigsten haben folglich auch am meisten Wissen. Meistens zumindest. Wissen fällt leider nicht vom Himmel, sondern muss sich unser Gehirn erarbeiten, es muss lernen. Auch das ist gar nicht so einfach. Überprüfen Sie deswegen doch gleich an Ort und Stelle, wie gut Ihnen das gelingt, und lernen Sie folgende Liste auswendig:
Ingwer
Rosine
Rad
Erdbeere
Nacht
Igel
Salat
Trauben
Nudeln
Uhr
Erholung
Traum
Zebra
Lutscher
Irrgarten
Chamäleon
Himbeere
Lesen Sie die Wörterliste ruhig öfters durch, damit Sie sie auch wirklich draufhaben. Wenn Sie möchten, wenden Sie Tricks an, arbeiten Sie mit Bildern, Eselsbrücken, Geschichten. Lesen Sie dann weiter. Und nicht vergessen: nicht vergessen! Auch wenn das vorige Kapitel schon gezeigt hat, wie schwierig das ist und dass das Gehirn sehr gerne was aus der Erinnerung streicht.
Lernen ist nicht alles
Lernen hat ein ziemlich schlechtes Image. Das zeigt schon die deutsche Sprache, in der man nicht nur lernt, sondern den Lernstoff gleich einpaukt, büffelt, ochst, sich einbimst, durchkaut oder sich dafür »auf den Hosenboden setzt«. Viele verbinden Lernen mit einer unangenehmen Zeit auf der Schulbank oder in einem Fortbildungskurs, mit Anstrengung, Frust, Notenkampf und nervigen Prüfungen. Da wird das Leben eingeteilt in eine Zeit, in der man lernt, und in Freizeit, in der man die Schulaufgaben oder Seminararbeiten erledigt hat und endlich machen kann, was einem Spaß macht. Lernen ist hart, ermüdend und unlustig, die lernfreie Zeit spaßig, erholsam und vergnüglich. Fast scheint es, als müsse man fürs Lernen eine geschützte Umgebung schaffen, damit man es überhaupt noch tut: Wer sich weiterbildet, geht in einen Kurs oder einen Workshop, und wenn der vorbei ist, hat man »genug gelernt«. Prüfung am Ende, Zeugnis kassieren – Punkt.
Leider lässt das Lernen einen nicht los. Ständig müssen wir uns irgendwie weiterbilden, es nimmt einfach kein Ende. »Lernen ist wie Rudern gegen den Strom. Sobald man aufhört, treibt man zurück«, las ich kürzlich in meinem Poesiealbum. Geschrieben von meinem damals siebenjährigen Kumpel, der schon vor über zwanzig Jahren wusste, dass seine Schul- und Lernzeit niemals enden würde. Denn heute ist »lebenslanges Lernen« angesagt. Gelernt werden muss offenbar überall und ständig, in der Schule, der Uni, im Beruf – zum Glück haben wir ein Gehirn, dass das alles mitmacht.
Oder doch nicht? Schließlich ist es oft gar nicht so einfach, sich Informationen anzueignen und abzuspeichern. Beim Lernen hat das Gehirn nämlich drei Schwächen: Zum einen lernt es unter Druck nicht besonders gut. Wer sich schon mal auf eine wichtige Prüfung vorbereitet hat, weiß, wie kompliziert das werden kann. Zum Zweiten lernen wir Daten, Fakten und Informationen äußerst schlecht – sie werden schnell uninteressant für das Gehirn. Oder erinnern Sie sich noch an die ersten drei Reichskanzler der Weimarer Republik, die zweite binomische Formel oder den Unterschied zwischen prädikativ und adverbial? Gelernt haben Sie das sehr wahrscheinlich irgendwann einmal – aber dann wieder vergessen. Womit wir bei der dritten Lernschwäche des Gehirns wären: Wer etwas lernt, kann es wieder ver-lernen. Lernen ist schließlich keine Einbahnstraße des Wissens in unser Gehirn.
Auch wenn es auf den ersten Blick so scheint, als wäre der Lernvorgang ein mühsames Geschäft, sprachlich despektiert und eine zähe Angelegenheit, ist das Gehirn doch ein Großmeister in dieser Disziplin. Lernen ist unsere evolutionäre Nische – das, was wir außergewöhnlich gut können und uns überlegen macht. Vögel fliegen. Fische schwimmen. Menschen lernen. Aber anders, als wir meistens denken. Denn keine Frage: Wir haben vermeintliche Schwächen im Lernen (Lernstress lässt uns leicht verkrampfen, wir speichern Fakten schlecht ab …) – doch wenn man genauer hinschaut, erkennt man, dass das nur der Preis dafür ist, dass wir die besten Lerner der ganzen Welt sind. Sogar mehr als das: Schließlich lernen wir nicht nur, sondern wir verstehen die Welt. Das ist die große Stärke menschlichen Denkens, und dafür lohnt es sich, ein paar Schwächen in Kauf zu nehmen. Wer diese erkennt, weiß auch, wie wir neues Wissen am besten aufnehmen (wie wir am besten »lernen«) – und Computern dauerhaft überlegen bleiben.
Das Nervenzellen-Orchester
Bevor wir auf die Schwächen (und Stärken) unseres Lernens zu sprechen kommen, werfen wir am besten einen kurzen Blick hinter die Kulissen eines lernenden Gehirns: Was passiert da, wenn wir Neues lernen? Oder noch grundlegender gefragt: Was ist eine Information, ein Gedanke im Kopf, der gelernt werden muss?
In einem Computer ist die Sache relativ klar: Wenn ich dort etwas abspeichern will, brauche ich zum einen etwas, was ich auch abspeichern kann. Das nennt man Daten, also elektronisch zu verarbeitende Zeichen. Diese muss der Computer irgendwo hintun, damit er sie auch wiederfindet. Er ordnet einem Datenpaket also einen Ort zu und kann dann gezielt darauf zugreifen. Wenn er beides hat (Daten und Ort), kann er diese Kombination als Information verarbeiten. So ähnlich wie in einer Bibliothek. Dort haben Sie auch Bücher mit (Schrift-)Zeichen, die stellen Sie in ein Regal, damit Sie sie wiederfinden. Wenn Sie auf eine Information zugreifen wollen, brauchen Sie auch hier beides: Sie müssen wissen, wo das Buch steht, und die Zeichen im Buch verarbeiten.
Im Gehirn ist das anders, denn dort gibt es weder Zeichen (also Daten) noch einen festen Ort, an dem diese Daten abgelegt werden. Wenn ich sage: »Denken Sie an Ihre Großmutter!«, dann ist jetzt in diesem Moment nicht irgendeine »Großmutter-Nervenzelle« in Ihrem Gehirn angesprungen (wie man einige Zeit lang in der Hirnforschung vermutete), sondern Ihr Nervennetzwerk hat einen ganz charakteristischen Zustand angenommen. Und genau in diesem Zustand, der Art und Weise, wie sich die Nervenzellen gegenseitig aktivieren, ist die Information versteckt. Das ist ein bisschen abstrakt, doch vereinfachend können Sie das mit einem sehr, sehr großen Orchester vergleichen: Auch dort gibt es einzelne Musiker, die ihren Aktivitätszustand individuell ändern können (lauter oder leiser, höher oder tiefer spielen). Wenn Sie von außen auf ein stummes Orchester mit inaktiven Musikern schauen, haben Sie keine Ahnung, welche Lieder das Orchester spielen kann. Genauso haben Sie keine Ahnung, was ein Gehirn denken kann, wenn Sie von außen das Nervennetzwerk betrachten. Im Orchester entsteht die Musik, wenn die Musiker miteinander spielen und sich dafür synchronisieren. Die Musik ist nicht irgendwo im Orchester, sondern sie steckt in der Aktivität der einzelnen Musiker. Wenn Sie nur eine einzige Bratsche hören, wissen Sie zwar etwas vom Zustand eines einzelnen Musikers, haben aber keine Ahnung, wie das Gesamtstück klingt, denn dafür muss man wissen, wie die anderen Musiker zur gleichen Zeit aktiv sind. Auch das würde aber noch nicht reichen, denn dann wüsste man nur von einem bestimmten Tongefüge zu einer konkreten Zeit – die Musik kommt erst zustande, wenn man den zeitlichen Verlauf berücksichtigt. Die Information (also in diesem Fall die Melodie des Musikstücks) ist also zwischen den Musikern versteckt.
So ähnlich, wie sich Musiker orchestrieren, stimmen sich auch Nervenzellen untereinander ab. Ein Orchester erzeugt durch dieses Zusammenspiel ein Musikstück, bei Nervenzellen entsteht durch deren Synchronisation der Informationsgehalt eines Gedankens. Doch auch im Gehirn ist ein Gedanke nicht irgendwo im Netzwerk verborgen, sondern es ist die Art und Weise, wie das Netzwerk zusammenspielt. Damit das besonders gut klappt, sind Nervenzellen über gemeinsame Kontaktstellen (die Synapsen) miteinander verbunden, denn nur so bekommen die Neuronen mit, was die anderen so treiben. Im Orchester hört jeder Musiker auch, was die anderen spielen, und nur so können sich die Musiker untereinander abstimmen. Im Großhirn sind Nervenzellen mit vielen anderen Tausend Nervenzellen verbunden und dadurch natürlich in der Lage, weitaus komplexere Aktivitätszustände zu erzeugen als ein Orchester. Und genau in diesen Aktivitätszuständen steckt der Informationsgehalt: Im Orchester ist es die Musik, im Gehirn ein Gedanke.
Diese Art der Informationsverarbeitung bringt einige entscheidende Vorteile. Genauso wie ein und dasselbe Orchester komplett verschiedene Musikstücke spielen kann, indem sich die Musiker auf eine neue Art synchronisieren, kann auch das identische Nervennetzwerk völlig unterschiedliche Gedanken hervorbringen, indem es einfach anders aktiviert wird. Außerdem ist eine Information (sei es eine Melodie des Orchesters oder ein Bild im Kopf) nicht notwendigerweise in einem konkreten Aktivitätszustand codiert, sondern auch in der Änderung eines Zustandes. So kann die Stimmung eines Musikstückes davon beeinflusst werden, ob die Musiker immer leiser oder lauter werden – genauso kann die Information eines Gehirnzustandes darin versteckt sein, wie sich die Neuronen in ihrer Aktivität ändern, nicht nur, wie sie gerade sind.
Hier sieht man schon: Die Zahl möglicher Aktivitätsmuster wird unfassbar groß. Zu fragen, wie viele Gedanken wir denken können, ist daher etwa so sinnvoll wie die Frage, wie viele Lieder ein Orchester spielen kann.
Etwas anderes wird hier auch deutlich: In einem Computer wird die Information irgendwo abgelegt. Wenn der Rechner aus ist, ist die Information immer noch da (gespeichert in Form von elektrischen Ladungen), und ich kann sie wieder abrufen, wenn ich den Computer erneut einschalte. Wenn ich ein Gehirn ausknipse, dann ist Schluss mit lustig. Denn die Informationen des Gehirns sind nicht physisch irgendwo gespeichert, sondern immer nur ein flüchtiger Zustand des Netzwerks. Zu Lebzeiten ergibt sich deswegen ein Gedanke, ein Informationsinhalt, immer aus dem vorherigen – als wäre jeder Gedankenzustand schon das Startsignal für den nächsten Gedanken. Gedanken entstehen also niemals aus dem Nichts.
Das Lernen liegt dazwischen
So anschaulich die Orchester-Metapher ist, möchte ich nicht einen gewaltigen Unterschied zum Gehirn verschweigen: Dort gibt es keinen Dirigenten. Niemand steht vor den Nervenzellen und erklärt ihnen, wie sie ihre Nachbarn aktivieren sollen. Und dennoch schaffen sie es, sich äußerst präzise in ihren Aktivitäten abzustimmen und neue Muster zu erzeugen.
Das hat auch Konsequenzen dafür, wie ein solches Nervennetzwerk lernt. Während vor einem Orchester der Dirigent den Takt vorgibt und die Musiker synchronisiert, müssen Nervenzellen einen anderen Weg finden. Schließlich ist die Information ähnlich wie die Melodie eines Orchesters angelegt: in der Fähigkeit der Nervenzellen zusammenzuspielen.
Wenn ein Orchester eine neue Melodie lernt, müssen die Musiker zwei Dinge bewerkstelligen: Zum einen müssen sie ihre eigene Spielfertigkeit verbessern (also beispielsweise eine neue Kombination von Fingergriffen anwenden). Zum anderen, und das ist noch wichtiger, müssen sie genau wissen, wann, was und wie sie spielen sollen. Das wissen sie aber nur, wenn sie auf den Einsatz des Dirigenten warten und darauf achten, wie die anderen spielen. Wenn ein Orchester also ein neues Stück übt, dann verbessern die Musiker ihr Zusammenspiel – und am Ende ist das Musikstück auch genau in dieser neuen Fähigkeit des Zusammenspiels »gespeichert«. Um sie abzurufen, muss dann die konkrete Dynamik der Musiker erzeugt werden, die zum Musikstück führt. Im Gehirn ist eine Information ebenfalls im Zusammenspiel der Nervenzellen codiert, und wenn Nervenzellen »üben«, dann verändern auch sie die Abstimmung untereinander, damit das Zusammenspiel das nächste Mal leichter ausgelöst werden kann. Damit ein Nervennetzwerk lernt, muss es also seine Kontaktstellen und damit seine Architektur verändern.
Weil es im Gehirn keinen Dirigenten gibt, müssen sich die Nervenzellen ausschließlich auf die Abstimmung mit ihren Nachbarzellen verlassen. Die dabei ablaufenden zellbiologischen Vorgänge sind sehr gut bekannt. Vereinfacht gesagt folgen die Veränderungen der Nervenzellenkontaktstellen beim Lernen einem grundlegenden Prinzip: Oft benutzte Kontakte werden verstärkt, selten verwendete abgebaut. Wenn also eine wichtige Information im Gehirn auftaucht (also das Zusammenspiel der Nervenzellen auf eine ganz charakteristische Weise stattfindet), müssen sich die Nervenzellen dieses Zusammenspiel irgendwie »merken«. Sie tun das, indem sie ihre Kontakte untereinander so anpassen, dass die Information (der Aktivitätszustand) das nächste Mal leichter abgerufen werden kann. Wenn im konkreten Fall einige Synapsen besonders stark aktiviert wurden, werden dort Umbaumaßnahmen an der Zelle ergriffen, damit die Synapse das nächste Mal noch besser aktiviert werden kann. Umgekehrt können nicht benötigte Synapsen im Laufe der Zeit aufgrund von mangelnder struktureller Unterstützung abgebaut werden. Das spart Energie, sodass ein denkendes Gehirn mit 20 Watt Leistung auskommt (zum Vergleich: Ein Backofen braucht hundertmal so viel Energie, um am Ende bloß ein paar Brötchen aufzubacken, Öfen sind offensichtlich nicht sehr clever).
Auf diese Weise lernt das System: Es verändert seine Struktur so, dass ein Aktivitätszustand leichter erzeugt werden kann. Insofern werden Informationen doch im Nervennetzwerk gespeichert, nämlich »zwischen« den Nervenzellen, in ihrer Architektur und Verbindung. Das ist aber nur die halbe Miete, denn um die Information auch abzurufen, müssen die Nervenzellen wieder aktiviert werden. Das gelingt zwar umso leichter, je besser die Kontakte untereinander sind, aber aus den Kontakten alleine kann man die Information nicht ableiten. Wenn Sie ein Gehirn aufschneiden, sehen Sie nur die Verbindung der Zellen untereinander, aber wie diese funktionieren, sehen Sie nicht. Sie haben keine Ahnung davon, was im Gehirn »gespeichert« ist und welche dynamischen Aktivierungen es auslösen kann.
Unter Stress lernen wir am besten – und am schlechtesten
Dieses neuronale System der Informationsverarbeitung ist extrem leistungsfähig, denn es ist sehr viel anpassungsfähiger als statische Computersysteme, benötigt keine Überwachung (wie einen Dirigenten) und kann sich auf die unterschiedlichsten Umweltbedingungen einstellen. Doch diese Lernform hat auch Schwächen: Weil die Umbauprozesse der Nervenzellen den üblichen biologischen Schwankungen unterliegen, lernen wir nicht immer gleich gut – unter Stress verkrampfen wir zum Beispiel besonders leicht. Jeder, der sich schon mal unter Druck auf eine Prüfung vorbereiten musste, weiß, wie schwierig es ist, mit solchem Lernstress fertigzuwerden. Man kriegt die wichtigen Infos einfach nicht in seinen Kopf rein. Oder wenn sie einmal drin sind, kommen sie im wichtigen Moment (der Prüfung) nicht wieder raus. Doch warum wirkt sich Stress so negativ auf unser Lernen aus?
Zunächst einmal ist Stress nichts, was unser Lernen prinzipiell blockieren würde. Im Gegenteil, eigentlich ist Stress sogar ein Lernbeschleuniger. Unter akuten Stressbedingungen (zum Beispiel, wenn uns etwas erschreckt oder auch positiv überrascht) sorgt zunächst der Botenstoff Noradrenalin im Gehirn dafür, dass genau die Gehirnregionen aktiviert werden, die unsere Aufmerksamkeit verstärken.8 Etwa zwanzig Minuten später wird dieser Vorgang durch das Hormon Cortisol noch unterstützt, das die störende Hintergrundaktivität von Nervenzellen runterfährt.9 So werden wir noch fokussierter und konzentrierter. Ergebnis: Unter akutem Stress sind wir sehr lernfähig. Wenn wir beispielsweise unachtsam über die Straße laufen und fast überfahren werden, dann merken wir uns das für zukünftige Straßenquerungen. Auch wenn wir positiv gestresst sind: Unseren ersten Kuss vergessen wir nicht, obwohl wir ihn nur einmal erlebt haben.