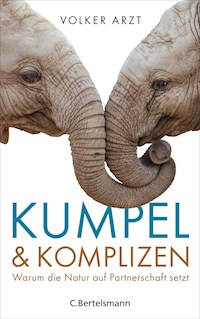
8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: C. Bertelsmann Verlag
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2019
Miteinander statt Konkurrenz – von Win-win-Konstellationen in der Natur
Ist faire Partnerschaft mehr als eine Vision? »Homo homini lupus« - nach dem berühmten Satz von Thomas Hobbes ist der Mensch gegenüber seinem Mitmenschen ein Wolf, nur auf seinen eigenen Vorteil bedacht. Im Tierreich scheinen Aggression und Futterneid, Gier und Grausamkeit die Regel. Und doch lassen sich Wölfe auch von Gemeinsinn leiten. Schimpansen retten fremde Artgenossen. Buckelwale helfen Robben in Not. Selbst im Pflanzenreich gibt es seit jeher Symbiose-Deals, wovon beide Seiten profitieren. Die aktuelle Forschung enthüllt Kooperation als eine wesentliche Triebfeder der Natur. Doch wie verträgt sich das mit Darwins unerbittlichem »Kampf ums Dasein«?
Das Buch wird nach höchsten ökologischen Standards (Cradle to Cradle) hergestellt und wird nicht in Folie eingeschweißt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 443
Ähnliche
Buch
Ist faire Partnerschaft mehr als eine Vision? »Homo homini lupus« – nach dem berühmten Satz von Thomas Hobbes ist der Mensch gegenüber seinem Mitmenschen ein Wolf, nur auf seinen eigenen Vorteil bedacht. Im Tierreich scheint Aggression und Futterneid, Gier und Grausamkeit die Regel. Und doch lassen sich Wölfe auch von Gemeinsinn leiten. Schimpansen retten fremde Artgenossen. Buckelwale helfen Robben in Not. Selbst im Pflanzenreich gibt es seit jeher Symbiose-Deals, wovon beide Seiten profitieren. Die aktuelle Forschung enthüllt Kooperation als eine wesentliche Triebfeder der Natur. Doch wie verträgt sich das mit Darwins unerbittlichem »Kampf ums Dasein«?
Autor
Volker Arzt, geboren 1941, ist Diplomphysiker, erfolgreicher Wissenschaftsjournalist und Autor. Er moderierte u. a. die ZDF-Reihe »Querschnitte« (mit Hoimar von Ditfurth), wurde als Buchautor mit den Bestsellern »Haben Tiere ein Bewusstsein?« (zusammen mit Immanuel Birmelin), »Als Deutschland am Äquator lag« und »Kluge Pflanzen« bekannt. Er erhielt zahlreiche nationale wie internationale Auszeichnungen, u. a. den Europäischen Umweltpreis, den Japan-Preis, der als international wichtigste Auszeichnung des Bildungsfernsehens gilt, und den Green-Screen-Preis für den besten Wissenschaftsfilm.
VOLKER ARZT
KUMPEL
& KOMPLIZEN
Warum die Natur auf Partnerschaft setzt
C. Bertelsmann
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
© 2019 C. Bertelsmann Verlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
Umschlag- und Einbandgestaltung: Büro Jorge Schmidt, München
Einbandabbildung: WWF/Martin Harvey
Bildredaktion: Annette Baur
Herstellung: Inka Hagen
Satz und Innengestaltung: Greiner & Reichel, KölnBildbearbeitung: Helio Repro, München
ISBN 987-3-641-22352-6
www.cbertelsmann.de
INHALT
I. KAPITEL: Die zwei Gesichter der Natur
Der wesentliche Inhalt des Lebens überhaupt
Edel sei der Mensch, hilfreich und gut!
Selbstlose Schimpansen
Hilfsbereite Nager
II. KAPITEL:Was treibt die Evolution?
Charles Darwin und die Taubenzucht
Laufende Fische und fliegende Dinosaurier
Drucksachen aus der Urzeit
Das Sparbuch aus Bethlehem
Die Intelligenz der Schmetterlinge
Automatische Updates
Finger weg vom Chef!
Wer warnt wen?
III. KAPITEL: Die Nächstenliebe der Insekten
Ameisen – gemeinsam geht alles!
Großbaustelle im Baum
Not- und Rettungsdienst
Der Aufstand der Hummeln
IV. KAPITEL: Sich schlagen oder vertragen?
Geselligkeit statt Kampf – ein Gegenmodell
Leben wie Tiere?
Bunte Flechten – und Peter, der Hase
Nachts wie Tiere – tags wie Pflanzen
Einstein und der Oktopus
Zum Wohle der Art?
V. KAPITEL: Die lieben Verwandten
Der Stoff der Vererbung
Der Clan der Elefanten
Einsatz für das Saurierküken
Wanzenmutter mit Kinderschar
Gelöst: das Rätsel der Insektenstaaten
Keine Güte für fremde Gene!
VI. KAPITEL: Von Natur aus egoistisch?
Zwergmungos: Alles frisst – einer wacht
Kooperative Krähen
Blut ist dicker als Wasser
Fehlleistungen der Natur?
Verwandtschaft ist nicht alles
VII. KAPITEL: Wie du mir, so ich dir
Hilfsbereite Vampire
Pfadfinder zum Bienennest
Drama unter der Erde
Jagdpartie mit Muräne
Das Prinzip der Gegenseitigkeit
Putzen und Pflegen
Ein Gespür fürs Geschäft
Vorsicht! Hacker!
VIII. KAPITEL: Die süße Verführung
Wer herrscht in der Unterwelt?
Mykorrhiza – ein globales Handelsgeflecht
Warum nicht betrügen?
Nachrichten über Kabel
Die Leibgarde der Akazien
Sex auf Bestellung
Erfolgsrezept: Werbung und Service
Neue Wege im Marketing
Den Vollmond auf die Erde holen
Verlogene Versprechen
Gotteslästerliche Lebensweise
Hilfreiche Diebe
Horror im Sumpfwald?
In einem Meer aus Stickstoff
Das Knöllchen-Wunder
Gekaufte Mobilität
IX. KAPITEL: Bakterien willkommen!
Der schlechte Ruf
Stinken wie ein Wiedehopf
Das Geheimrezept der Bienenwölfe
Lebendes Licht
Oasen der Tiefseewüste
Eine stinkende Energiequelle
Supermuschel im Atlantik
Wie viele Mikroben bin ich?
Der Einbrecher – dein Kumpel
X. KAPITEL: Kooperation und Intelligenz
Die Wüstenraben im Arava-Tal
Der Geier soll es machen!
Ziehen am gleichen Strang
Elefanten im Seiltest
Keas – die Physiker unter den Vögeln
Wo Technik nicht weiterhilft
Delfine und Orcas – sozial und innovativ
Erkenne dich selbst!
Der Wal im Taschenspiegel
Wollaffe mit Brille
Berechnende Schimpansen
XI. KAPITEL: Der Kitt unserer Gesellschaft
Kooperation ist überall
Prestigegewinn bei Mungos
Das Auge des Gewissens
Klimawandel und Kooperation
Eigennutz contra Klimaschutz – ein Test
XII. KAPITEL: Mitgefühl und Freundschaft
Der dankbare Löwe
Pottwale im Netz
Ein Freund, ein guter Freund …
Mitgefühl unter Fremden
Der Buckelwal, dein Freund und Helfer
Rettung der anderen Art
Mit Instinkt, Gefühl und Verstand
Schimpansen und Bonobos
Make love, not war
Das unerbittliche Gesetz der Natur?
Dank
Literatur
Register
ERSTES KAPITEL
DIE ZWEI GESICHTER DER NATUR
Der wesentliche Inhalt des Lebens überhaupt
Nichts geht mehr. Vollsperrung des Hamburger Flughafens. Kein Start, keine Landung. Stattdessen Alarm und Suchtrupps. Ein albanischer Asylbewerber ist aus dem Abschiebegewahrsam ausgebrochen; ist über einen 2,50 Meter hohen, mit Stacheldraht gesicherten Zaun geklettert. Und so auf das Flughafengelände gelangt. Die Suche bleibt ergebnislos. Eine Stunde später wird der Flugbetrieb wieder aufgenommen.
Na und? So etwas passiert überall und immer wieder. Es ist wahrlich keine weltbewegende Geschichte, die ich da im Hamburger Abendblatt lese. Dass sie mich trotzdem fesselt und schließlich empört, liegt an ihrer Vorgeschichte. Der Albaner hatte offensichtlich Unterstützung von einem Kumpel. Gemeinsam planten sie die Flucht. Sie warteten die Dunkelheit ab und schlichen zum Zaun. Er war das Haupthindernis, das sie nur zu zweit überwinden konnten: Der eine formte also die Hände zu einem Steigbügel, damit sich der andere hochschwingen und auf seine Schultern stellen konnte. Über diese »Räuberleiter« schaffte es der Albaner nach oben. Der nächste Schritt wäre gewesen, seinen Kumpel hochzuziehen, damit sie ihre Flucht fortsetzten. So war es geplant. Doch warum jetzt noch Zeit verschwenden? Und Mühe aufwenden? Der Albaner ließ seinen Kumpel zurück und setzte sich alleine ab. So ein Miststück!, rege ich mich beim Lesen auf. Und dann muss der Zurückgelassene womöglich noch mit einem Verfahren wegen »Gefangenenbefreiung« rechnen.
Ich bin selbst etwas überrascht über meine Empörung. Egoisten gibt es schließlich zuhauf. Und ist es nicht verständlich, ja sogar legitim, die eigene Haut zu retten, bevor man an andere denkt? Vielleicht. Doch was mir bei diesem Fall so aufstößt, ist die Verletzung jeglicher Fairness-Regel. Da nimmt einer die Hilfe seines Partners in Anspruch, nur um ihn dann gleichgültig »in die Pfanne zu hauen«. Es ist diese verweigerte Gegenleistung, die sich so niederträchtig und empörend anfühlt. Zusammenarbeit – wenn sie aus freien Stücken erfolgt – gründet sich auf die Erwartung, dass jeder etwas davon hat; dass keiner den anderen übervorteilt. So das Grundverständnis in allen Gesellschaften. Bei den steinzeitlichen Jäger- und Sammler-Kulturen wie in modernen Demokratien.
Doch faire Kooperation ist bekanntlich nicht die Norm. Das Hamburger Ausbruchsszenario steht als kurioser Einzelfall in einer Reihe fieser Rücksichtslosigkeiten und Betrügereien, die tagtäglich die Medien füllen. Bis hin zu einseitigen Handelsverträgen, ausbeuterischen Tarifabkommen oder betrügerischer Abgasreinigung. Ist faire, gleichberechtigte Zusammenarbeit nur eine Vision, die ständig von der Wirklichkeit unterlaufen wird? Der englische Philosoph Thomas Hobbes prägte schon im 17. Jahrhundert das berühmte Begriffsbild vom »homo homini lupus« – der Mensch sei dem Menschen ein Wolf. Von Natur aus suche er seinen Vorteil; trachte nach Macht und Besitz. Rücksichtslos, auf Kosten seiner Mitmenschen.
Hobbes’ Sichtweise tut nicht nur den Wölfen unrecht – ihr Leben im Rudel ist durchaus von Regeln und Rücksichtnahme geprägt. Sie verkennt auch die unbestreitbare Neigung der Menschen zu spontaner Hilfe. Wer hätte nicht schon die Gastfreundschaft von Fremden genossen? Die Hilfsbereitschaft bei Autopannen? Oft sind es kleine Gesten – wie neulich, als mir ein Afrikaner auf dem Bahnsteig nachrief: »Ist das deins?!«. Er hielt mir mein Handy entgegen, das ich im Zug vergessen hatte. Kleine und große »Heldentaten« werfen ein anderes Licht auf unser menschliches Miteinander. Da ist ein Kind auf die U-Bahn-Gleise gestürzt und wird in letzter Sekunde von einem Fremden gerettet. Da wütet ein brutaler Messerstecher, bevor er von Jugendlichen gestellt und entwaffnet wird. Was haben sie davon? Warum bringen sie sich selbst in Gefahr?
Schon diese wenigen Fälle aus der Rubrik »Vermischtes« zeigen, dass die uralte Frage, ob der Mensch von Natur aus gut oder böse sei, in eine Zwickmühle führt. Zu jedem Beispiel drängt sich sofort ein Gegenbeispiel auf. In unserer Natur ist offenbar beides angelegt. Wir sind sowohl Einzelwesen wie Gruppenwesen, und oft genug kommen sich unsere beiden Naturen ins Gehege: Sollen wir an uns selbst, an den eigenen Vorteil denken oder an die anderen, mit denen wir zusammenleben? An unser Eigeninteresse? Oder an das Gemeinwohl, also an das, was die Gesellschaft braucht, um zu funktionieren? Wobei dieses Entweder-oder erst dadurch zum Dilemma wird, dass wir natürlich Mitglieder dieser Gesellschaft sind und ohne sie schwerlich leben könnten.
Je nach Umständen und Gefühlslage handeln wir egoistisch oder übernehmen, wie es so schön heißt, Verantwortung für das größere Ganze. Wir sind hybride Mischwesen, die beide Antriebsarten in sich tragen, und die Entscheidung für die eine oder andere ist oft erst das Ergebnis innerer Kämpfe. Sollen wir am Montag krankfeiern – die Kollegen werden schon einspringen? Sollen wir ein umweltfreundliches Auto kaufen – wo doch ein SUV mehr hermacht? Soll ich mein Geld korrekt versteuern oder auf die Bahamas transferieren? Der Alltag ist gespickt mit solchen Entscheidungen – oft sind sie fast läppisch unbedeutend, manchmal folgenschwer. Der Widerstreit zwischen Eigennutz und Gemeinsinn ist nicht wegzudenken aus unserem Leben. Der Kampf zwischen Egoismus und Selbstlosigkeit. Zwischen Konkurrenz und Kooperation.
»Dieser Kampf ist der wesentliche Inhalt des Lebens überhaupt«, schreibt Sigmund Freud 1930 in seiner Abhandlung über DasUnbehageninderKultur. Zwischen unserem egoistischen Streben nach Glück und unserem Streben nach Gemeinschaft bestehe ein, womöglich unversöhnlicher, Konflikt. Es sei – so Freud – ein Schicksalsproblem der Menschheit, zwischen diesen gegeneinander arbeitenden Antrieben immer wieder einen Ausgleich zu finden.* Nicht von ungefähr sind auch alle Religionen bemüht, dieses innere Spannungsfeld zu bestellen – mit Vorschriften und Forderungen, wie man mit seinen Mitmenschen umzugehen habe. Bis hin zu so unerfüllbaren Geboten wie »Liebe deine Feinde!«. Offenbar sind wir nicht so, wie wir sein sollten. Und an Ermahnungen fehlt es nicht.
Edel sei der Mensch, hilfreich und gut!
Der moralische Aufruf, mit dem Goethe sein Gedicht DasGöttlichebeginnt, wirkt heute fast rührend antiquiert – in einer Zeit, wo Selbstoptimierung, nationaler Egoismus und Gewinnmaximierung im Mittelpunkt stehen. Gleichzeitig wird kaum jemand bezweifeln, dass wir ein Mehr an Kooperation und Gemeinsinn brauchen, wenn wir unsere großen globalen Probleme meistern wollen: die Klimaerwärmung, die zunehmende Überbevölkerung oder die Erschöpfung der Ressourcen – um nur einige zu nennen. Keine Frage, Goethes Aufruf hat in unseren Tagen mehr Berechtigung denn je.
Doch das – mittlerweile geflügelte – Wort des Dichters gilt nicht drohenden Katastrophen, sondern will die Großartigkeit und Einmaligkeit des Menschen herausstreichen. Nur er sei in der Lage zu solchen Tugenden wie Edelmut, Güte und Hilfsbereitschaft. Schon in den nächsten Zeilen hebt Goethe auf diesen vermeintlichen Unterschied zu allen anderen Lebewesen ab:
Edel sei der Mensch,
hilfreich und gut;
denn das allein
unterscheidet ihn
von allen Wesen,
die wir kennen.
Das heutige Bild von allen Wesen, die wir kennen, sieht deutlich anders aus, als man es vor 240 Jahren zu wissen meinte. Auch Tiere, ja sogar Pflanzen sind zu fairer Zusammenarbeit und gegenseitiger Hilfe fähig. Aber der Weg zu dieser Erkenntnis war kurvenreich und mühsam, und die Forschung ist noch keineswegs abgeschlossen. Auf den ersten Blick scheint in der Welt der Tiere und Pflanzen kein Raum für edle Gesinnung zu sein, für Rücksichtnahme oder Güte. Keine Rose schränkt ihr Wurzelwachstum ein, um auch der Nachbarrose einen gerechten Nährstoff-Anteil zu überlassen. Im Gegenteil. Im unterirdischen Kampf um Mineralien und Wasser kämpfen die Wurzeln um jedes Fleckchen Erde. Langsam und lautlos, aber unbarmherzig. Nicht auszudenken, wenn dieses Ringen um Raum und Ressourcen unter Kampfgetöse ausgefochten würde … Der Lärmpegel unter unseren Füßen wäre der unüberhörbare Beweis für die aggressive, egoistische Natur der Pflanzen.
Oder die Apfelbäume auf der Obstwiese. Sie gehen aktiv gegen ihre Artgenossen vor – noch bevor sie das Licht der Welt erblicken: Sie verstreuen in ihrem Wurzelbereich ein Keimungsgift, um andere Bäume erst gar nicht hochkommen zu lassen. Nicht einmal die eigenen Nachkommen dulden sie in ihrer Nähe. Territorialverhalten also auch bei Pflanzen!
Selbst im Innern von Baumleichen tobt der Kampf um Ressourcen. Baumpilze zersetzen das Holz; jeder auf seinen Vorteil bedacht, durchdringen sie es mit ihren feinen Fäden. Es kommt zu regelrechten Revierkämpfen, und am Ende ist der Baumstamm aufgeteilt in Hoheitsgebiete mit unüberschreitbaren Ländergrenzen. Jeder Pilz erobert sich vom Holz so viel, wie er nur kann – bis ihm ein Konkurrent mit chemischen Giftstoffen Einhalt gebietet. Was sich im Stammquerschnitt als hübsche Landkarte ausnimmt, spiegelt in Wahrheit die Machtverhältnisse gieriger Pilze wider. Keine Frage, auch in der Pilz- und Pflanzenwelt, die uns meist so sanft und friedfertig vorkommt, herrscht Eigennutz pur. Von Edelmut keine Spur! Zumindest nicht auf den ersten Blick.
Landkarte der Pilze: Im Totholz eines Baumstamms kämpfen mehrere Pilzarten um die Vorherrschaft. Bis die Nachbarn ihnen eine Grenze setzen.
Baumann, Karlheinz
Und dann erst das Reich der Tiere. Da konfrontieren uns Naturdokumentationen und YouTube-Szenen mit verstörenden Bildern. Schwer zu ertragen, wenn ein Rehkitz von scharfen Fuchszähnen aufgerissen wird. Wenn Orcas ein Walbaby unter Wasser drücken, bis es ertrunken ist. Oder wenn flauschige Vogelküken vom Habicht gepackt und totgehackt werden. Immerhin müssen wir achselzuckend zugestehen, dass es für Raubtiere widersinnig wäre, beim Beutefang Nachsicht oder Verzicht zu üben. Es käme einer Selbstaufgabe gleich. Raubtiere leben vom Drang zum Töten, und man sollte die Jagd nach Nahrung nicht auf eine Stufe stellen mit Rücksichtslosigkeit oder Aggression gegenüber Artgenossen.
Doch selbst wenn man vom blutigen Beute-Machen absieht – die Natur scheut keine Grausamkeit und keine Grobheit. Sogar die sympathisch-friedlichen Graugänse können sich ausgesprochen fies verhalten. Ein Ganter, dessen Partnerin vom Fuchs gefressen wurde, erfährt weder Trost noch Mitgefühl. Im Gegenteil. Er wird gemobbt und geschnitten; fällt in der Gänse-Kolonie auf den niedrigsten Rang zurück. Und dieser »gesellschaftliche Absturz« bleibt nicht folgenlos. Viele Ganter werden nach einem solchen Verlust apathisch und antriebslos; sie verlieren an Gewicht; bekommen dunkle Ringe unter den Augen, als würden sie trauern. Und ihr absackendes Immunsystem macht sie für Krankheiten und Parasiten empfänglich.
Das Zusammenleben der Tiere scheint geprägt von Eigennutz, Aggression und Futterneid. Welche Amsel würde ihrer Nachbarin einen Regenwurm anbieten – und sei diese noch so hungrig? Welche Robbenmutter würde ein fremdes Waisenbaby säugen – da kann es noch so jämmerlich weinen; es wird mitleidslos weggebissen. Selbst unter Menschenaffen wie Gorillas, die zu den intelligentesten Tieren überhaupt gehören, ist blutiger Eigennutz gang und gäbe. Wenn sie einen fremden Harem übernehmen, töten sie als Erstes die Babys und Kinder, um mit den Müttern möglichst rasch eigene Nachkommen zu zeugen. Nicht unbedingt die edle Art.
Tatsächlich könnte sich der Eindruck aufdrängen, in der Welt der Tiere sei kein Raum für gedeihliche Zusammenarbeit, für gegenseitige Hilfe oder Selbstlosigkeit. Im Gegensatz dazu hätten wir Menschen wenigstens die Option, selbstlos und uneigennützig zu handeln. Auch wenn es moralischer Anstrengung oder strenger Gesetze bedarf. Doch das Bild einer ausnahmslos egoistischen, unbarmherzigen Natur kann nicht die ganze Wahrheit sein. Es gibt zu viele Beobachtungen, die etwas anderes erzählen: Was ist zum Beispiel mit den allseits bekannten »sich aufopfernden« Vogeleltern, die bis zur Erschöpfung Käfer und Insekten jagen, um ihre Jungen satt zu kriegen? Sie passen jedes Kotpäckchen ab, noch bevor es im Nest landet. Und häufig täuschen sie eine Verletzung vor, um einen Räuber vom Nest fernzuhalten. Dann tanzen sie ihm mit Hinkebein und hängendem Flügel vor der Nase herum und gaukeln ihm leichte Beute vor. Sie »verleiten« ihn, wie die Fachleute sagen, damit er die Brut im Nest nicht findet. Fast sieht es aus, als wollten sie den großen Goethe Lügen strafen, als wollten sie demonstrieren, dass nicht nur der Mensch sich edelmütig für andere einsetzen kann.
Nun gut, der Einwand liegt nahe, dass für Eltern und Kinder eben besondere Regeln gelten müssten – schließlich geht es um die eigene Fortpflanzung und die unmittelbaren Nachfahren. Dieser Punkt soll noch ausführlich zur Sprache kommen; denn er wurde zur Initialzündung für eine ganz neue Ära der Biologie – die Soziobiologie.
Selbstlose Schimpansen
Die Fürsorge für die Jungen ist aus der Tierwelt nicht wegzudenken. Und den meisten dürfte es wie mir ergehen: Ich finde es hinreißend, wenn eine Katzenmutter »pflichtbewusst« ihre Jungen säubert, wenn Elefanten einem Baby auf die Beine helfen oder wenn Delfine ihr Neugeborenes für den ersten Atemzug nach oben tragen. Doch auch unter Erwachsenen, unter Artgenossen, die einander fremd sind und nicht zur Familie gehören, kommt es immer wieder zu erstaunlichen Hilfs- und Rettungsaktionen.
Da ist zum Beispiel der fast märchenhaft klingende Bericht vom 4. September 2006 aus der Ostafrikanischen Savanne.** Es geht um einen erwachsenen Elefanten, dem – vermutlich durch illegale Jagd – eine tiefe Speerwunde zugefügt worden war. Die Wildhüter befürchten eine Infektion. Sie rufen einen Tierarzt, der die Wundbehandlung – natürlich unter Betäubung – durchführen soll. Doch kaum steckt der Narkosepfeil in der Haut des Patienten, geschieht das Unerwartete: Ein zweiter Elefant kommt herbeigeeilt, fasst den Pfeil mit seiner Rüsselspitze, zieht ihn heraus und wirft ihn auf den Boden. Dann betastet er behutsam die Einstichstelle. Ein beeindruckendes Hilfsmanöver – auch wenn es die Narkosewirkung nicht mehr verhindern kann: Der getroffene Elefant geht wenig später zu Boden – und seine Wunde wird erfolgreich behandelt.
Auch die Rettungsaktion von Washoe kann sich sehen lassen. Wenn es ein Walhalla für Schimpansen gäbe, Washoe hätte einen Ehrenplatz. Sie ist die vielleicht berühmteste Schimpansin – zumindest aus wissenschaftlicher Perspektive: Sie hat in den 1970er Jahren als erstes nicht-menschliches Wesen eine Gebärdensprache erlernt. Sie konnte ausdrücken, ob sie traurig war oder vergnügt, ob sie raus in den Wald wollte oder lieber Verstecken spielen. Und sie machte kein Hehl aus ihrer Vorliebe für Eiscreme, und dass sie gern gekitzelt würde. Oder umgekehrt: dass sie jetzt ihren Ziehvater Roger kitzeln möchte. Washoe brachte es auf Sätze, die sieben bis acht Zeichen miteinander verbanden, und die Gebärdensprache wurde so natürlich für sie, dass sie die Gesten für Selbstgespräche nutzte – z. B. hoch oben im Baum, wenn sie sich allein wähnte. Und selbstverständlich unterhielt sie sich auch mit ihrer geliebten Puppe in der Taubstummensprache. Jahre später war es dann ihr Adoptivsohn Loulis, an den sie ihre Gesten richtete: Sie brachte ihm von Anfang an die wichtigsten Zeichen bei, und er erlernte kinderleicht diese Muttersprache.
Washoes Sprachvermögen ist so detailgenau dokumentiert, weil sie von frühester Kindheit an von dem Wissenschaftler Dr. Roger Fouts großgezogen und begleitet wurde. Er sah – anders als damals üblich – in der Schimpansin weit mehr als ein Studienobjekt. Die beiden hingen aneinander und mochten sich; sie neckten sich; stritten und versöhnten sich. Roger Fouts musste seine wissenschaftliche Karriere riskieren, um Washoe vor dem damals normalen Schimpansenschicksal zu bewahren: nämlich spätestens wenn sie dem Kindesalter entwachsen und nicht mehr »pflegeleicht« wäre, in der Betonzelle eines medizinischen Versuchslabors zu landen.
Washoe im Gespräch: Die Schimpansin ist ganz bei der Sache, wenn Roger Fouts und seine Mitarbeiterin sie unterrichten.
Central Washington University
Washoe darf auf einer kleinen »Affeninsel« auf dem Gelände der Universität Oklahoma leben – zusammen mit anderen jungen Schimpansen. Ein ausbruchsicherer Ort. Denn Schimpansen können sich weder schwimmend noch paddelnd über Wasser halten. Sie sind zu schwer; gehen unter wie ein Stein. Hinzu kommt, dass die Insel eingezäunt und das Ufer mit Elektrozaun gesichert ist.
Tag für Tag rudert Roger mit seinem Boot auf diese »Gefängnisinsel«, um Gebärdensprache zu unterrichten und mit seinen Schülern zu spielen. Und dabei ist es passiert. An einem Sommertag 1974. Die neue Schimpansin Penny, die gerade erst auf der Insel angekommen war, gerät in Panik und überspringt mit einem gewaltigen Satz den Elektrozaun. Roger hört nur den klatschenden Aufprall aufs Wasser; er ahnt das Schlimmste; rennt Richtung Zaun, so schnell er kann. Doch er ist nicht allein. Vor ihm sprintet Washoe. Ohne anzuhalten, setzt sie ebenfalls in einem mächtigen Sprung über den Zaun. »Gott sei Dank«, erinnert sich Roger Fouts, »landete sie auf dem schmalen, schlammigen Uferstreifen, bevor er steil ins Wasser abfällt.« Penny kämpft wild um sich schlagend um ihr Leben, aber sinkt immer wieder unter. Eine Rettung scheint aussichtslos; die Gefahr selbst zu ertrinken zu groß. Kurz entschlossen hält sich Washoe unten an einem Zaunpfahl fest, wagt sich, so weit sie kann, hinaus auf den glitschigen Uferstreifen und versucht mit der anderen Hand einen von Pennys verzweifelt rudernden Armen zu fassen. Schließlich gelingt es, und sie zieht die Unglückliche ans sichere Ufer.
»Ich rannte, was ich konnte, um das Boot zu holen, und ruderte aus Leibeskräften zu der Stelle außerhalb des Zauns, wo die beiden Mädels eng aneinander gekauert warteten. Penny total unter Schock und starr vor Angst. Ich brachte die beiden zurück auf die Insel, wo Washoe und ich uns lange zu Penny setzten, sie beruhigten und ihr das Fell kraulten.« Dann erst wird Roger bewusst, welch ungeheuerlichen Akt von Altruismus er da gerade erlebt hat. »Washoe hat ihr eigenes Leben riskiert, um eine andere Schimpansin zu retten – eine, die sie gerade mal ein paar Stunden kannte.«***
Hilfsbereite Nager
Das Problem bei solchen Beobachtungen ist ihr »anekdotischer Charakter«, d. h. dass sie zufällig und unerwartet geschehen. Vielleicht handelt es sich um einen Ausnahmefall? Oder es herrschen besondere Bedingungen? Oder die Akteure sind in einer ungewöhnlichen Stimmungslage? Den Beobachtern könnte Vieles entgangen sein. Umso spannender sind wissenschaftliche Tests, die ein Team um Peggy Mason in jüngster Zeit an der Universität von Chicago durchgeführt hat – mit Ratten. Ausgerechnet mit Ratten, die in der breiten Öffentlichkeit ja nicht gerade als Sympathieträger gelten und denen man nicht unbedingt »edle Motive« unterstellen würde. Aber tatsächlich entpuppten sich die Nager von Chicago als unerwartet besorgt, mitfühlend und hilfsbereit – so sehr, dass viele Forscherkollegen erst mal ablehnend reagierten und den Ratten ganz andere Motive unterstellten.
Befreiung aus dem Gefängnis: Unter den Augen von Peggy Mason (rechts) und Inbal Ben-Ami Bartal befreit eine Ratte ihre Artgenossin aus dem »Gefängnis«.
Jiang, Kevin
Die Tests selbst waren denkbar einfach: Als Kandidaten wurden zwei Ratten ausgewählt, die sich seit 14 Tagen einen Käfig teilten und in dieser Zeit aneinander gewöhnen konnten. Käfigkumpel, wenn man so will. Dann die eigentliche Testsituation: Eine der Ratten steckt in einer misslichen Lage. Sie ist in einer engen Röhre aus Plexiglas eingeschlossen. Immerhin hat sie genügend Raum, um sich zu drehen und zu wenden, und die Wände sind mit Löchern und Schlitzen versehen. Die Gefangene ist nicht in Panik. Aber natürlich möchte sie da raus. Die andere Ratte könnte sie tatsächlich befreien. Das Gefängnis hat eine Tür, die nur von außen zu öffnen ist – allerdings muss man dazu viel Geduld und Mühe aufbringen. Der Verriegelungsmechanismus ist kompliziert; um ihn zu lösen, braucht es Kopfstöße und den Einsatz der Pfoten. »Es ist wirklich schwer, die Tür zu öffnen«, sagt Inbal Ben-Ami Bartal, die Kollegin von Peggy Mason. »Wir zeigen ihnen nicht, wie es geht; sie haben keinerlei Vorerfahrung. Aber sie probieren es wieder und wieder. Irgendein innerer Antrieb motiviert sie.«
Auf den Videoaufnahmen**** der Wissenschaftlerinnen sieht es tatsächlich so aus, als sei die freie Ratte höchst beunruhigt. Sie sucht – über die Schlitze und Löcher – schnuppernd den Kontakt mit ihrer eingeschlossenen Kollegin. Sie umkreist das Plexi-Gefängnis; versucht sich immer wieder an der verriegelten Tür. Vergeblich. Das Schloss ist nicht zu knacken. Nach einer Stunde wird der Versuch abgebrochen. Das geht ein paar Tage so. Dann zahlt sich das hartnäckige Fummeln und Probieren doch noch aus. Die Ratte erwischt – wohl per Zufall – den richtigen Dreh: Die Tür springt auf. Die Gefangene verlässt ihre Plexi-Zelle; begrüßt die Retterin. Befreiungsaktion gelungen! Am nächsten Morgen das gleiche Spiel. Doch jetzt geht alles schneller. Die Retterin weiß schon ungefähr, wo sie ansetzen muss, um die Tür aufzuhebeln. Und in den Tagen darauf wird sie zur routinierten Befreierin. Sie kommt, sieht und hilft.
Natürlich könnte alles Zufall sein. Ist es aber nicht. Die Wissenschaftler testeten viele Rattenpaare, die sich einen Käfig teilen, und es zeigte sich immer dasselbe Muster: Die freie Ratte müht sich ab, ihrer gefangenen Genossin zu helfen. Doch genau hier setzten die Zweifel der Kritiker an: Geht es der Ratte wirklich um Hilfe? Will sie wirklich das Los ihrer Kollegin erleichtern? Oder ist sie vielleicht nur an der Abwechslung interessiert – an dem Plexi-Container mit seiner geheimnisvollen Tür?
Da man Ratten nicht einfach befragen kann, muss man ihnen die Antwort auf andere Weise entlocken: Die Wissenschaftler boten dasselbe Plexi-Gefängnis an, jedoch leer, ohne Insassen. Und siehe da, es war so gut wie uninteressant; keine der Ratten mühte sich mit der Türverriegelung ab. Wozu auch? Selbst wenn eine ziemlich echt aussehende Stofftier-Ratte eingesperrt war – niemand machte Anstalten, die Plüsch-Kollegin da raus zu holen. Es scheint also doch um den lebenden Käfigkumpel und seine Befreiung zu gehen.
Aber wie stark ist diese Motivation zur Hilfe? Die Wissenschaftler entwickelten eine wahrhaft süße Idee, wie sie auch hier eine Antwort bekommen könnten. Sie stellten neben das Gefängnis mit Ratte ein zweites Gefängnis mit Schokolade – mit fünf deutlich sichtbaren Schoko-Chips. Eine schwere Wahl, denn nichts geht den Nagern über diese Süßigkeit. Wie würde die Entscheidung jetzt ausfallen? Schoko schnappen – oder Kollegin befreien? An sich selber denken – oder Hilfe leisten?
Das Ergebnis überraschte alle. Die Hälfte der Test-Ratten lässt die Chips links liegen und befreit als Erstes die gefangene Kollegin. Dann erst kommt das Schoko-Gefängnis an die Reihe. Und dort zeigte sich die nächste Überraschung: Die eben befreite Gefangene bekommt einen großzügigen Anteil ab – nicht die Hälfte, aber im Durchschnitt immerhin ein Drittel. Eine wirklich ungewöhnliche Geste unter den futterneidischen Nagern.
Noch ist völlig unklar, welche Beweggründe hinter dieser »Spendieraktion« stecken könnten. Eine Art Trost für die harte Gefängniszeit? Eine Bekräftigung der Verbundenheit? Ein Ausdruck gönnerhafter Überlegenheit? Die Wissenschaftler enthalten sich jeder Spekulation. Aber wer weiß, vielleicht finden sie auch hier noch einen Weg, ihre Ratten zu befragen.
Ratten als selbstlose Retter – in einer Reihe mit Primaten und Elefanten. Die Versuche aus Chicago sind überzeugend. Aber sie lassen offen, woran es letztlich liegt, dass die Tiere sich so füreinander einsetzen. Liegt es an der gemeinsamen Unterbringung, die eine Art persönlicher Freundschaft hat entstehen lassen? Oder spielt der Verwandtschaftsgrad eine Rolle? Würden auch Ratten aus unterschiedlichen Stämmen füreinander einstehen – also Ratten, die verschieden aussehen und verschieden riechen? Die Antworten liegen seit Kurzem vor. Und sie sorgten abermals für Aufsehen und ungläubiges Staunen. Davon später.
Fest steht: Neben all den Rivalitäten unter Artgenossen, ihren Kämpfen um Raum und Nahrung und Dominanz können Tiere auch selbstlos, freundschaftlich und hilfsbereit sein. Auch sie scheinen diese widersprüchlichen Antriebe, die wir von uns selbst kennen, in sich zu tragen. Na und?, möchte man fragen. Wo ist das Problem? Wir teilen den Egoismus mit ihnen, warum nicht auch den Altruismus – das Gegenstück, bei dem nicht das eigene Ich im Mittelpunkt steht, sondern der andere? Was spricht gegen Edelmut, Hilfsbereitschaft und Güte auch im Reich der Tiere?
*Gesammelte Werke 1925–1931, Frankfurt am Main 1948, S. 481 und S. 456.
**L. A. Bates et al.: Do Elephants Show Empathy? In: Journal of Consciousness Studies, 10 (2008), S. 204–225.
***Roger Fouts, Stephen Tukel Mills: Unsere nächsten Verwandten. Von Schimpansen lernen, was es heißt, ein Mensch zu sein. München 1998.
****YouTube – Rats with empathy?
ZWEITES KAPITEL
WAS TREIBT DIE EVOLUTION?
Charles Darwin und die Taubenzucht
Es hat eine lange Tradition, dass wir uns für die einzigen Lebewesen halten, die moralische Werte kennen. Religiöse Menschen berufen sich dabei auf heilige Schriften und göttliche Gebote. Rationale Argumente laufen meist darauf hinaus, dass selbstloses Handeln ein hochgeistiger Prozess sei, den nur das Gehirn des Homo sapiens leisten könne. Und wie – die Frage drängt sich auf – schaffen es dann die Gehirne von Laborratten, von wilden Elefanten, zahmen Menschenaffen und vielen weiteren Tieren, die uns in diesem Buch noch über den Weg laufen werden? Vielleicht hängen wir die geistige Latte für Altruismus nur deshalb so hoch, weil wir uns selbst oft so schwer mit Hilfeleistung, Verzicht oder Rücksichtnahme tun?
Doch es gibt da ein zusätzliches Problem, mit dem sich die Biologen seit anderthalb Jahrhunderten herumschlagen müssen. Genau genommen seit 1859. In diesem Jahr veröffentlichte Charles Darwin sein revolutionäres, über 500 Seiten umfassendes Buch ÜberdieEntstehungderArten. Schon nach einem Tag, am 24. November, war es ausverkauft – und die darin ausgeführte »Evolutionstheorie« hat unser Weltbild von Grund auf verändert. Denn Darwin konnte auf überzeugende Weise »erklären«, was bis dahin keiner menschlichen Vernunft zugänglich schien: Wie hat sich die ganze Vielfalt unterschiedlichster Tiere und Pflanzen auf der Erde entwickelt? Und wie kommt es, dass diese so wunderbar zweckmäßig und vernünftig ausgeführt sind, als hätte sie jemand mit Bedacht entworfen und maßgeschneidert? Darwin zeigte einen natürlichen Mechanismus auf, der zwangsläufig von einfachsten Organismen zu immer »besseren« und komplexeren Lebewesen führt. Dabei erwiesen sich seine Grundgedanken als so überzeugend und erklärungsstark, dass sie bis heute als Fundament der biologischen Wissenschaften gelten.
Charles Darwin: Mit seinem Buch Über die Entstehung der Arten begründete er ein neues, revolutionäres Weltbild. Die Fotografie zeigt ihn als 72-Jährigen.
Public domain, via Wikimedia Commons (Julia Margaret Cameron, Charles Darwin, 1881)
Doch ausgerechnet Darwins so bahnbrechende und erfolgreiche Evolutionstheorie tut sich schwer mit dem Phänomen des Altruismus. Sie bietet keine einleuchtende Erklärung für selbstloses Verhalten oder Hilfsaktionen zugunsten anderer. Und so konnte es nicht ausbleiben, dass das Altruismus-Problem zum Streitpunkt und Zankapfel nachfolgender Biologengenerationen wurde. Oder, um es zurückhaltender auszudrücken: dass es bis heute kontrovers diskutiert wird. Aber worum genau geht es bei diesem Streit? Wo und warum kommen sich Darwin und Altruismus ins Gehege?
Der Gedanke einer unvorstellbar langsamen und lang anhaltenden Entwicklung des Lebens lag zu Darwins Zeiten in der Luft. Dafür sorgten schon die aufregenden Fossilfunde, die einen ganz neuen Wissenschaftszweig, die Paläontologie, ins Leben gerufen hatten. Die versteinerten, Millionen Jahre alten Pflanzen und Tiere ließen keinen Zweifel daran, dass die Erde früher von andersartigen Lebewesen bevölkert war – was so gar nicht mit einem biblischen Schöpfungsbericht zu vereinbaren war, wonach die Tiere in einem einzigen Wurf am 5. Schöpfungstag erschaffen worden waren. Was ist dann mit den riesigen Dinosauriern? Oder den fliegenden Echsen? Wo sind sie geblieben? Und noch schwieriger mit einem göttlichen Schöpfungsakt zu vereinbaren: Viele der versteinerten Kreaturen sind den heutigen zwar ähnlich, zeigen aber auch deutliche Abweichungen. Andere Hufe etwa, andere Größe oder Körperproportionen. Welches Modell zählt nun? In diesem Dilemma erklärten einige Forscher die Fossilien sogar zu missglückten Schöpfungsmodellen, zu »Probeentwürfen« Gottes, die er dann wieder aus dem Verkehr gezogen habe.
Da war es allemal schlüssiger, von einer Veränderung und Entwicklung der Lebewesen auszugehen. Die entscheidende Frage allerdings blieb offen: Welche geheime Kraft könnte bewirken, dass Tiere sich ändern? Und nicht nur das. Sie entwickelten sich offenbar aus einfachsten Ursprüngen – aus primitiven Bodenkrabblern im Meer, wie es die Versteinerungen aus 500 Millionen Jahre alten Erdschichten zeigen. Weitere Fossilien belegen, dass Fische ihre Flossen zu beinähnlichen Fortsätzen formten und schließlich zu vierbeinigen Landbewohnern wurden. Zu Amphibien und Reptilien. Einige legten sich Federn zu – zunächst als Wärmeschutz, dann als tragende Elemente für ihre vorderen Gliedmaßen, was ihnen schließlich den aktiven Vogelflug erlaubte. Andere schafften es immerhin bis ins Geäst der Bäume und hatten, dazu passend, geschickte Greifhände entwickelt: unsere affenähnlichen Vorfahren. Die Geschichte des Lebens zeichnete sich, zumindest in groben Zügen, schon für Darwin ab. Doch wer oder was hat diese Selbstentfaltung vorangetrieben? Wie können sich hirnlose Tiere und Pflanzen aus eigener Kraft formen und verändern – und das offensichtlich zu ihrem Besten? Man kann hinschauen, wo man will: Der Maulwurf hat Schaufelhände. Der Specht einen Hammerschnabel. Der Elefant einen langen Rüssel – wie sonst sollte er nach unten an die Grasbüschel oder ans Wasser kommen? Jedes Tier besitzt den richtigen Körperbau, die notwendigen Sinnesleistungen und das passende Verhalten, um sich optimal in seiner Welt zurechtzufinden. Alles passt. Auf wunderbare Weise.
Charles Darwin war sich bewusst, dass er mit der Entzauberung dieses Wunders eine Revolution auslösen würde. Nicht nur innerhalb der Wissenschaft. Seit Menschengedenken galt die so passend auf ihre Bedürfnisse zugeschnittene Tier- und Pflanzenwelt als augenfälliger Beleg für das Wirken eines allwissenden Weltenlenkers. Und jetzt sollte alles von selbst ablaufen? Ohne Einflussnahme und Lenkung höherer Mächte? Darwin sah voraus, dass er auf heftige Ablehnung stoßen würde. Und dennoch hat er sein Buch nicht im Stil einer Streitschrift verfasst. Seine Art sich auszudrücken wirkt sympathisch – auch heute noch; vielleicht deshalb, weil er immer an der Sache interessiert ist, nie am Rechthaben. Weil er seine Kritiker nicht »abbürstet«, sondern sie ernst nimmt. Er gesteht freimütig, wo sein Wissen noch unvollständig ist und wo er auf spätere Forschergenerationen hofft. In einem Schreiben bekennt er sogar: »Ich denke oft, meine Freunde haben allen Grund, mich zu hassen, weil ich so viel Schlamm aufgewirbelt und ihnen so viele Schwierigkeiten gemacht habe.«
Darwins Evolutionstheorie oder, wie er sie nannte, »Theorie der natürlichen Zuchtwahl« war trotzdem von unerhörter Durchschlagskraft. Ein entscheidender Punkt für diese Breitenwirkung liegt sicher in seinem didaktischen Geschick: Er holt seine Leser da ab, wo sie sich auskennen und mitreden können. Er geht von Alltagsbeobachtungen aus, die jedem geläufig sind. Und das, obwohl es sich um Abläufe handelt, die kein Mensch je erlebt hat, und um Zeitspannen, die jede Vorstellungskraft sprengen. Darwin beginnt seine Überlegungen mit – Tauben! Genauer gesagt: mit Zuchttauben. Er hat sich richtig »eingefuchst« in dieses Thema; wurde Mitglied in mehreren Taubenzuchtvereinen; hat selber Tauben gehalten und gezüchtet. Und er hebt auf die gewaltigen Unterschiede ab, die Hunderte verschiedener Taubenrassen aufweisen: die gewaltigen Kröpfe der Kropftauben, die sie bei der Balz aufblasen; die eindrucksvollen Schwanzfedern der Pfautauben oder die abstehenden Fußfedern bei anderen Rassen. Man glaubt, völlig unterschiedliche Vogelarten vor sich zu haben. Doch alle sind, so betont Darwin, künstlich durch Züchterhand entstanden. Alle gehen auf eine einzige Ursprungsart zurück: Columba livia, die Felsentaube.
Felsentaube: Darwin erkannte, dass Columba livia die »Stammmutter« darstellt, aus der alle Zuchttauben hervorgegangen sind.
fokus-natur.de (Pröhl)
Eine Auswahl an Zuchttauben: Ihr Aussehen kann fast nach Belieben geformt werden – für Darwin ein Beleg für die Kraft der künstlichen Zuchtwahl.
»Tauben«, in: Meyers Konversations-Lexikon, 5. Aufl., Leipzig und Wien 1893–1901
Keine Frage, der Mensch kann durch Züchtung neue Lebewesen schaffen, die es zuvor noch nie auf der Erde gab: heißblütige Rennpferde und kräftige Ackergäule; ergiebige Getreidepflanzen und köstliche Apfelsorten. Wer denkt noch daran, dass wilde Äpfel und wilder Wein scheußlich schmecken? Und es fällt mir – trotz besseren Wissens – immer schwer zu glauben, dass ein Mops, ein Pudel und ein Dobermann alle aus einer einzigen Stammform hervorgegangen sind. Aber so ist es. Und die Technik der Züchtung besteht lediglich darin, in jeder Generation auszuwählen, wer sich fortpflanzen darf und wer nicht. Jedes einzelne Tier hat bekanntlich einen etwas anderen Körperbau oder Charakter, und bei der Züchtung werden nur die Tiere mit günstigen Eigenschaften zur Paarung gebracht – in der Hoffnung, dass sie diese Eigenschaften in die nächste Generation vererben. Wo der Züchter dann erneut seine Auswahl trifft und eine neue Züchtungsrunde einleitet.
Darwin war bekannt, dass in diesem Züchtungsprozess mitunter auch ganz neue Eigenschaften auftauchen, die im Stammbaum der Eltern gar nicht vorkommen. Eine andere Färbung etwa oder eine neue Flugtechnik. Die Gründe dafür kannte er nicht, aber er nahm es als gegebene, immer wieder bestätigte Tatsache hin. Heute wissen wir, dass es Mutationen, also zufällige Änderungen in der DNA sind, die für solche Neuerungen sorgen. Oft haben sie negative Folgen, dann muss der Züchter sie aussortieren. Aber sie können durchaus auch Positives bewirken. Zum Beispiel – um das hier nur anzudeuten – wenn die Mutation in einer Genverdopplung besteht. Jedenfalls hält das Angebot, aus dem der Züchter wählen kann, immer wieder auch unerwartete Neuerungen und Verbesserungen bereit.
Diese naturgegebene Vielfalt verschiedener Eigenschaften nennt Darwin »Variation«. Zusammen mit der »Selektion«, dem Auswahlprozess durch den Züchter, ermögliche sie es, Lebewesen »in fast jeder gewünschten Richtung« zu verändern. Mehr brauche es nicht. Und speziell bei der Taubenzucht werde das Zusammenspiel von Variation und Selektion durch den Umstand erleichtert, dass man die ungünstigen Exemplare als Mahlzeit zubereiten könne. Für Darwin der bekömmliche Nebenaspekt der Taubenzucht!
Trotzdem brauche es auch Geduld. Ein guter Züchter, so informiert Darwin, rechne mit drei Jahren, um ein bestimmtes Federkleid zu erschaffen, und mit sechs, um Kopf und Schnabel wunschgemäß zu formen. Aber was sind schon ein paar Jahre, gemessen an den Jahrmillionen, die der Natur zur Verfügung stehen, um ihre Lebewesen umzuformen und anzupassen?
Darwin führt seine Leser auf vertrautes Gelände, wenn er von der Natur behauptet, sie gehe wie ein gewöhnlicher Tauben- oder Pferdezüchter vor; sie betreibe »natürliche Zuchtwahl« – auf der Basis von Variation und Selektion. Die Variation, die variantenreiche Vielfalt, ist zweifellos auch in der Wildnis gegeben. Kein Tier ist mit seinem Artgenossen identisch. Der eine Löwe hat ein etwas dichteres Fell. Der andere besitzt vielleicht längere Beine oder den besseren Jagdinstinkt. Variation bietet die Natur zuhauf. Einschließlich immer wieder auftretender Mutanten, die vielleicht ein weißes Fell oder eine andere Zahnstellung mitbekommen haben. Aber wie soll Selektion stattfinden? Es gibt keinen Züchter, der in seinem Sinne aussortieren und die Nachkommenschaft in eine bevorzugte Richtung lenken würde. Selektion scheint ausgeschlossen.
Laufende Fische und fliegende Dinosaurier
Genau an diesem Punkt setzt Darwins geniale Überlegung an. Sie ist – zumindest im Nachhinein betrachtet – so einfach und naheliegend, dass jeder – ob Biologe oder nicht – sie sofort nachvollziehen kann: Die Natur betreibt ein permanentes Ausleseverfahren, dem sich kein Geschöpf entziehen kann. Denn alle Lebewesen produzieren weit mehr Nachkommen, als dann tatsächlich durchkommen. Ein Ahornbaum schickt Jahr für Jahr Tausende von Propeller-Samen auf die Reise – ein gigantischer Überschuss, wenn man bedenkt, dass am Ende ein einziges erfolgreiches Samenkorn genügt, um den Mutterbaum zu ersetzen. Oder die sich sprichwörtlich vermehrenden Kaninchen. Ein Weibchen bringt in seinem Leben über 100 Babys zur Welt, obwohl rein rechnerisch schon zwei ausreichen würden, um Vater und Mutter zu ersetzen und damit die Kolonie konstant zu halten. Oder noch drastischer: Ein Kabeljau-Weibchen produziert jährlich 9 Millionen Eier – und das über 20 Jahre lang. Obwohl auch hier zur Bestandserhaltung nicht mehr als zwei »erfolgreiche« Eier nötig wären.
Der gigantische Geburtenüberschuss ist natürlich kein Luxus. Er ist ein Muss – für den Ahornbaum, weil die meisten Samen keinen geeigneten Ort zur Keimung finden. Für Kaninchen, weil fast alle ihre Jungen durch Feinde oder Krankheiten sterben, bevor sie das geschlechtsreife Alter erreichen. Und für den Kabeljau, weil schon die meisten der frei schwimmenden Eier als Futterbissen enden und die Jungfische erst recht begehrte Beute sind – sogar für erwachsene Artgenossen.
Wo viel geboren wird, wird auch viel gestorben. Die Natur sortiert einen Großteil ihrer Geschöpfe wieder aus, bevor sie sich vermehren können. Sie selektiert – ähnlich wie der Züchter, der auch nur wenigen die Fortpflanzung gestattet. Aber halt! Der Züchter handelt ja bewusst und gezielt. Er wählt nach seiner Vorstellung aus, wer zur Weiterzucht geeignet ist und wer nicht. Und die sich selbst überlassene Natur? Ist hier nicht alles vom Zufall abhängig?
Selbstverständlich spielt der Zufall eine Rolle. Es kann einfach Pech sein, als Kaninchen vom Fuchs geholt zu werden. Oder pures Glück, wenn man es bis zur Fortpflanzung bringt. Aber es hängt auch von den individuellen Fähigkeiten ab. Wer besonders schnell und hellhörig ist, wird seinen Feinden eher entkommen. Wer das dichtere Winterfell hat, erfriert nicht so leicht. Und wer das bessere Immunsystem besitzt, wird weniger krank. Ein Kaninchen mit solchen Vorzügen hat größere Chancen, es bis zur Fortpflanzung zu schaffen, und es bekommt – nicht anders als bei der Zucht – die Gelegenheit, seine Fähigkeiten weiter zu vererben. Und in der nächsten Generation wiederholt sich das Spiel. Wer unter den Jungen die richtigen Gene erwischt hat, wird sich dank der ererbten Vorzüge ebenfalls leichter behaupten und durch bessere Fortpflanzungschancen glänzen. Und so fort. Die Natur betreibt einen fortlaufenden Züchtungsprozess, der jede Eigenschaft begünstigt, die direkt oder indirekt zu einer verstärkten Fortpflanzung führt – zu einer erhöhten »Fitness«, wie die Biologen sagen.
Wir sprechen zwar ganz unbekümmert davon, die Katze habe scharfe Krallen, um besser jagen zu können. Oder der Vogel Strauß habe lange Beine, um schneller laufen zu können. Tatsächlich zählt allein die Zahl der Nachkommen – oder korrekter, wie sich noch zeigen wird: die Verbreitung der eigenen Gene. Katzen ohne scharfe Krallen würden weniger Mäuse fangen, wären schlechter ernährt und könnten somit weniger Junge durchbringen. Kurzbeinige Strauße wären langsamer, würden häufiger gefressen und könnten logischerweise weniger Eier legen. Nur diese Konsequenz hat Katzen und Strauße so »vernünftig« ausgestattet und angepasst. Fitness ist alles. Was sie steigert, wird begünstigt; was sie mindert, wird verworfen.
So erklärt Darwin die wunderbaren Anpassungen der Tier- und Pflanzenwelt. Die natürliche Zuchtwahl ist für ihn die formende Kraft der Natur: »Ich vermag keine Grenze für diese Kraft zu sehen, welche jede Form den verwickeltsten Lebensverhältnissen langsam und wunderschön anpasst.« Er sieht die gesamte Geschichte des Lebens als eine schrittweise Anpassung an immer neue Herausforderungen. Da verändern sich die Kontinente und Lebensräume. Atmosphäre und Klima wechseln. Neue Feinde tauchen auf. Und immer ist Anpassung gefragt; immer braucht es neu zu entwickelnde Formen oder Verhaltensweisen, um vom Zuchtprogramm der Natur nicht aussortiert zu werden.
In 4 Milliarden Jahren haben sich so – unter dem Druck der wechselnden Lebensbedingungen – die Organismen weiterentwickelt. Von einfachen Einzellern zu hochkomplexen Lebensformen. Mit leistungsstarken Sinnesorganen und so fantastischen Organsystemen wie Immunabwehr, Blutkreislauf oder Nervensystem. Nichts davon ist vom Himmel gefallen; alles hat sich entwickelt – in kleinen Schritten, angetrieben durch Variation und Selektion.
Drucksachen aus der Urzeit
Darwin musste sich mit dieser Sichtweise noch auf spärliche Fossilienfunde stützen. Aber er glaubte fest daran, dass spätere Forschergenerationen seine Theorie mit neuen Funden untermauern würden. Und so kam es auch. Eine Evolution des Lebens ist heute, auch wenn manche religiöse »Fundamentalisten« es nicht wahrhaben wollen, gesicherter Erkenntnisstand. Alle evolutionären Großereignisse lassen sich fast lückenlos durch Fossilienfunde dokumentieren. Der »Landgang der Fische« zum Beispiel. 375 Millionen Jahre alte Gesteinsschichten in der Arktis gaben Tiktaalik frei, was in der Sprache der Inuit schlicht »großer Süßwasserfisch« bedeutet. Aber Tiktaalik ist viel mehr. Er ist ein Fisch, der nicht nur schwimmen, sondern auch ans Ufer robben konnte. Seine Vorderflossen waren wie Armstummel gebaut – mit Handgelenk und Fingern. Eine Konstruktion, die – vielfach abgewandelt – alle Wirbeltiere an Land beibehielten. Wir haben Tiktaalik einiges zu verdanken.
Ein Fisch namens Tiktaalik: Er robbt auf Stummelflossen an Land. Das 375 Millionen Jahre alte Fossil markiert den Auszug der Wirbeltiere aus dem Wasser.
Public domain, via Wikimedia Commons (National Science Foundation/Zina Deretsky)
Noch besser belegt ist die »Eroberung der Lüfte«. Zu Darwins Zeit war sie nur durch den berühmten Archaeopteryx aus den Solnhofener Plattenkalken dokumentiert – ein Mischwesen zwischen Dinosaurier und Vogel. Heute tauchen aus den chinesischen Fundstätten bei Liaoning immer neue Dinos auf, die regelrechte Schwingen mit Federn trugen – noch nicht zum Fliegen, sondern als Schutz gegen Regen und Kälte. Auch als Unterschlupf für die Jungen. Und womöglich, weil das andere Geschlecht bunte Federschwingen so sexy fand. Daneben finden sich kleinere Exemplare, die vermutlich schon fliegen oder zumindest gleiten konnten. Wie Microraptor. Er versuchte es sogar mit vier Flügeln: mit zwei Armschwingen und zwei Beinschwingen – eine Antriebsart, die offenbar von der Selektion nicht honoriert und wieder verworfen wurde.Die chinesischen Versteinerungen lassen den Unterschied zwischen vogelähnlichen Dinos und dinoähnlichen Vögeln fast verschwinden. Und wer unsere zwitschernden Meisen und krächzenden Raben, die Schwäne und Hühner als überlebende Dinosaurier bezeichnet, bewegt sich auf biologisch sicherem Grund.
Dinosaurier probt das Fliegen: Microraptor besaß vier Schwingen, um »mit Händen und Füßen« durch die Luft zu gleiten – eine Sackgasse der Evolution.
imago (StockTrek Images)
Selbst für die exotische Lebensgeschichte der Wale und ihre »Rückkehr ins Wasser« gibt es mittlerweile eine Fülle von Fossilbelegen, vor allem aus Pakistan und Ägypten. Sie dokumentieren, wie die Natur im Laufe von 10 Millionen Jahren landgängige Paarhufer Schritt für Schritt zu stromlinienförmigen Wassertieren umkonstruierte. Ein frühes Übergangsmodell war zum Beispiel der 3 Meter lange Ambulocetus. Der »gehende Wal« hatte schon Hinterbeine im Flossendesign, während seine Vorderbeine noch zum Fortkommen am Strand taugten. So dachten jedenfalls seine Namensgeber und glaubten, dass er gelegentlich noch ans Ufer gerobbt sei. Eher nicht – meinen dagegen japanische Wissenschaftler. Sein Brustkorb wäre an Land unter dem eigenen Gewicht zusammengebrochen, Ambulocetus trage daher seinen Namen zu Unrecht. Wie dem auch sei, fest steht, dass in der Konstruktionsgeschichte der Wale die hinteren Extremitäten immer weiter schrumpften – bis auf ein paar unsichtbare Knochenreste unter der Haut. Der Grund: Ein torpedoförmiger Körper mit Schwanzflossenantrieb ist für’s Wasser optimal und zahlt sich letztlich in einem Plus an Walbabys aus – allerdings nur, solange diese Babys eine Wassergeburt überstehen. Wer wie Robben, Pinguine oder Schildkröten seine Jungen noch an Land zur Welt bringen muss, ist auf einen Kompromiss zwischen Wasser- und Landantrieb angewiesen. Er muss zumindest noch robben, watscheln oder schlittern können.
Auf dem Weg zum Wal: Fossilfunde zeigen, dass Ambulocetus Vorder- und Hinterbeine besaß. Ob sie ihn an Land noch tragen konnten, ist allerdings fraglich.
Shutterstock (Esteban De Armas)
Fossilien sind so etwas wie Flaschenpostsendungen aus unvorstellbar weit zurückliegenden Zeiten. Schon ihre Entstehung ist ein seltener Zufallstreffer. Denn dafür muss ein verendetes Tier noch vor seiner Zersetzung in Sand oder Sedimente eingebettet und konserviert werden. Und nur in den wenigsten Fällen finden sich diese Zeugnisse heute an der Erdoberfläche und können von Paläontologen freigehämmert werden. Fossilien werden immer den Charakter von Zufallsnachrichten aus der Vergangenheit haben.
Doch seit einigen Jahrzehnten öffnen sich ganz neue Fenster in diese Vergangenheit. Die Genforschung hat sie aufgestoßen. Das große Zuchtprogramm der Natur spiegelt sich Schritt für Schritt in den Erbmolekülen ihrer Geschöpfe wider. Die Genetiker von heute rekonstruieren immer genauer den Ablauf der Evolution; in vielen Fällen wissen sie sogar, welche Mutationen für welche Entwicklungsschritte verantwortlich waren. Sie kennen die spontanen Veränderungen in der DNA, die nötig waren, um die Farbe Rot zu sehen. Oder um Tieren das Wiederkäuen zu ermöglichen. Und selbst die Mutationen, die stufenweise zu einer Vergrößerung unseres eigenen Gehirns führten, sind bekannt. Darwin hätte seine Freude gehabt.
Das Sparbuch aus Bethlehem
Die Fakten sprechen für sich. Die Evolution ist in groben Zügen bekannt; ist Schulstoff und Standardwissen. Und doch, es bleibt eine harte Nuss, sich vorzustellen, wie ein derart einfaches Prinzip von Variation und Selektion so wunderbare, dazu grundverschiedene Tier- und Pflanzenkonstruktionen hervorbringen konnte. Manchmal raunt da etwas in meinem Hinterkopf: Ist das nicht alles zu fantastisch? Kann wirklich alles so planlos und ziellos und von selbst abgelaufen sein? Aber dann muss mein Kopf sich bei den eigenen Schwächen fassen und sich in Erinnerung rufen, dass die Wirklichkeit nicht an Anschaulichkeit geknüpft ist. Weder das Verhalten der Elementarteilchen im Mikrokosmos noch das Geschehen in einem mehrdimensionalen Universum und eben auch nicht der Werdegang des irdischen Lebens. Unser Vorstellungsvermögen ist nicht gemacht für solche Zeitspannen; für Prozesse, die über Millionen und Milliarden Jahre wirken. Und ganz besonders schwer tun wir uns mit Prozessen, deren Wirkung langsam beginnt und dann lawinenartig – exponentiell – anschwillt. Doch mit eben dieser Dynamik arbeitet die Evolution. Günstige Neuerungen setzen sich anfangs kaum merklich durch und gewinnen dann zunehmend rasant die Oberhand.
Wie sehr solche Verläufe unserer Intuition zuwiderlaufen und unsere Vorstellungskraft sprengen, zeigt ein 250 Jahre altes, aber immer noch verblüffendes Gedankenbeispiel des englischen Mathematikers und Geistlichen Richard Price.* Er geht von der etwas skurrilen Annahme aus, Joseph und Maria hätten zur Geburtsfeier ihres Sohnes ein Sparbuch mit 1 Penny eröffnet, und fragt, wie sich diese Anlage wohl mit Zins und Zinseszins entwickelt hätte. Legt man eine dreiprozentige Verzinsung zugrunde, dann hätte sich im Laufe der Zeit sicher ein hübsches Sümmchen angesammelt – so unser Gefühl. Aber was heißt »im Laufe der Zeit«? Als 70 Jahre später die Römer den Tempel von Jerusalem zerstörten, wären aus dem 1 Penny gerade mal 8 geworden. Nicht gerade üppig. Im Jahre 410 wurde Rom von den Westgoten erobert – da wären immerhin schon 1820 € auf dem Bethlehemer Sparbuch (wenn wir den Penny mal großzügig durch einen Eurocent ersetzen). Und dann nimmt der Kontostand richtig Fahrt auf: Im Jahre 800 zur Krönung von Karl dem Großen: üppige 186 Millionen. Und als Kolumbus 1492 Amerika entdeckte, hätte sich der Josephs-Penny bereits auf astronomische 142-tausend Billionen Euro vermehrt. Und das weitere Wachstum bis heute? Es wäre sinnlos, sich diese 24-stellige Zahl vorstellen zu wollen.
Das Geheimnis dieser anfangs so sanften und dann explosiven Vermehrung liegt natürlich darin, dass der Zuwachs umso höher ausfällt, je höher der Bestand ist. Albert Einstein soll auf die Frage nach der stärksten Kraft im Universum augenzwinkernd geantwortet haben: der Zinseszins. Er hätte auch auf die Durchschlagskraft der natürlichen Selektion verweisen können, die nach derselben irritierenden Dynamik abläuft. Zum Beispiel bei Schmetterlingen.
Die Intelligenz der Schmetterlinge
Birkenspanner sind Nachtfalter; tagsüber ruhen sie sich aus. Und das besonders gern auf Birkenstämmen. Ihre Flügel – weiß gefärbt mit dunklen Einsprengseln – heben sich kaum von der Rinde ab, und derart getarnt bleiben sie weitgehend unentdeckt von Rotkehlchen, Meisen oder anderen Fressfeinden. Selbst wir übersehen sie fast immer, wenn sie sich flach an die Birkenstämme schmiegen. Nur ab und zu tauchen auffällige vollschwarze Mutanten auf, die aber rasch entdeckt und weggefressen werden.
Suchbild: Der dunkle Birkenspanner ist auf heller Birkenrinde schon von Weitem zu erkennen und wird entsprechend häufiger gefressen.
Arco Images (NPL/Kim Taylor)
Doch Mitte des 19. Jahrhunderts wurde die Welt der Birkenspanner auf den Kopf gestellt. Die aufkommende Industrialisierung und Luftverschmutzung versah die Birkenstämme mit einem dunklen Überzug – und plötzlich war es vorbei mit der schönen Tarnung. Im Gegenteil: Auf der geschwärzten Rinde saßen die hellen Birkenspanner wie auf dem Präsentierteller. Die Vögel brauchten nur zuzugreifen. Am klügsten aus Sicht der Schmetterlinge wäre wohl gewesen, sich ebenfalls umzufärben, um wieder getarnt zu sein. Und genau das haben sie gemacht – ohne jede Klugheit oder Überlegung. Die Selektion hat es zwangsläufig für sie erledigt. Denn die seltenen Ausnahmefälle schwarzer Birkenspanner waren plötzlich im Vorteil. Sie waren besser geschützt vor den hungrigen Blicken der Vögel; sie hatten die größeren Chancen, sich zu paaren und zu vermehren. Anfangs fiel das kaum ins Gewicht, weil es verschwindend wenige waren. Doch dann kam der Zinseszinseffekt zum Tragen:Je höher der Anteil an Schwarzen wurde, umso höher ihr Zuwachs in der nächsten Generation. Es dauerte gerade mal 50 Jahre, dann hatte sich die schwarze Variante durchgesetzt. In manchen Gegenden Englands zu 98 Prozent. Die Weißen waren so gut wie verschwunden.
Der Clou bei diesem historischen Fall besteht aber darin, dass es eine Art Gegenprobe gibt. Als in den 1970er Jahren strengere Umweltgesetze erlassen wurden und die Luftverschmutzung abnahm, kehrte sich das Verhältnis abermals um: Die heutigen Birkenspanner setzen zu 90 Prozent wieder auf helles Birkenmuster. Clever – als hätte sich das jemand ausgedacht. Das »blinde« Zusammenspiel von Variation und Selektion hat für eine intelligente Anpassung gesorgt. Und das in kürzester Zeit. Was sind schon ein paar Jahrzehnte im Zeitmaß der Evolution!
Jedes Plus in der Fortpflanzung – und sei es nur minimal – wird sich früher oder später durchsetzen und die ganze Population prägen. Und umgekehrt: Schon ein geringfügiges Minus wird dafür sorgen, dass diese Linie anfangs langsam und dann immer schneller aus der Population verschwindet. Sie stirbt aus.
Diese mathematische Konsequenz führt, wie schon erwähnt, automatisch zu der so oft bewunderten Anpassung der Lebewesen. Aber sie sollte auch – und genauso automatisch – zu einem gnadenlosen und unbarmherzigen Konkurrenzkampf unter Artgenossen führen. Wer die anderen egoistisch klein hält, sie schwächt und an der Paarung hindert, verschafft sich selbst einen Fitnessgewinn; er erhöht seine eigenen Fortpflanzungschancen – mit der Folge, dass Egoismus mehr und mehr zum Standardverhalten wird. Der gleiche Mechanismus, der den Katzen zu ihren Krallen und den Walen zu ihrem Torpedokörper verholfen hat, sollte auch »von selbst« zu Eigennutz und Vorteilnahme führen – der Mechanismus der natürlichen Zuchtwahl.
Und in der Tat, es wäre ein Leichtes, die restlichen Seiten mit Reportagen vom »Kampf ums Dasein« zu füllen, wo es um verbitterte Revierkämpfe geht, wo mit Zähnen und Klauen um Höhlen, Nester und Weibchen gefochten wird. Und wer keine scharfen Waffen hat, versucht den Rivalen anderweitig auszustechen. Der Pfau setzt auf den eindrucksvolleren Federschmuck; Buckelwale komponieren möglichst anspruchsvolle Werbegesänge; Laubenvögel messen sich in architektonischen Prunkbauten. Alles, um das »Nachwuchsrennen« für sich zu entscheiden.
Seeelefanten-Bullen kämpfen bis aufs Blut um den Besitz eines Harems. Als Siegprämie winkt eine hohe Zahl an Nachkommen.
Getty Images (Moment/Anne Dirkse)
Automatische Updates
Schon zu Darwins Zeiten war der Begriff vom »struggle for existence«, vom Kampf ums Dasein, ein geflügeltes Wort – auch wenn die Ansichten, was genau darunter zu verstehen sei, auseinandergingen. Viele verstanden ihn als blutigen Streit, in dem schiere Kraft und Größe entscheiden. Wie etwa beim Rivalenkampf unter Hähnen, Hengsten oder Löwen, wo Federn und Fetzen fliegen. Darwin selbst plädiert dafür, den Begriff »in einem weiten und metaphorischen Sinne« zu gebrauchen, auch als Kampf gegen Krankheiten und Klima, gegen extreme Kälte und knappe Nahrung. Oder, so könnte man fortfahren, gegen Ruß und Dreck. Auch die Birkenspanner kämpften ja nicht mit Rüssel und Schuppen; ihr Wettstreit lief gewaltfrei und berührungsfrei ab; sie mussten sich nicht einmal begegnen.
Jedenfalls sorgt der Kampf ums Dasein für ständige Updates in der Natur – egal, wie er geführt wird. Ob als brutale Auseinandersetzung oder sanfte Verdrängung. Das war in der Vergangenheit so und gilt auch für die aktuellen Kämpfe. Man denke nur an den Vormarsch der schwarzen Eichhörnchen, die im 19. Jahrhundert aus Amerika nach England »eingeschleppt« wurden. Sie machen sich daran, unsere einheimischen roten zu verdrängen. In England ist ihnen das fast schon gelungen – ohne dass es zu Raufereien und Beißereien zwischen Rot und Schwarz gekommen wäre. Niemand weiß genau, worauf sich ihre Überlegenheit und ihr Fortpflanzungsvorteil gründen. Vielleicht – so vermuten einige Wissenschaftler – haben sie einfach das bessere Ortsgedächtnis und erinnern sich genauer an ihre Nuss-Verstecke. Im Winter könnte das ein entscheidender Vorteil sein. Und in vielen Wintern zum Niedergang der roten Eichhörnchen führen.
Wesentlich klarer liegen die Verhältnisse beim »Zahn-Update« der Afrikanischen Elefanten. Seit Jahren beobachten die Ranger, dass die Tiere zunehmend kleinere Stoßzähne haben. Und immer öfter fehlen sie ganz. Warum? Mächtige Stoßzähne sollten doch kein Nachteil sein – weder beim Kräftemessen mit Konkurrenten noch beim Graben nach Wasser. Stimmt! Aber sie sind ein erheblicher Nachteil, wenn es darum geht, Elfenbeinjägern zu entkommen. Große Zähne erhöhen das Risiko, vorzeitig zu sterben. Die Weitergabe der entsprechenden Gene entfällt. Ohne es zu wollen, züchten Wilderer die mächtigen Stoßzähne weg, auf die sie so scharf sind. Man könnte auch sagen: Die Elefanten passen sich der neuen Situation an.





























