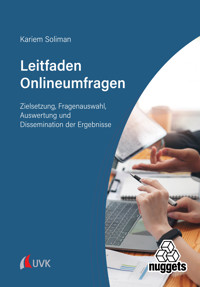
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: UVK
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Serie: nuggets
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2024
Theoretische und praktische Tipps Ganz egal ob in Studium und Forschung, in Verwaltungen oder in Unternehmen - Onlineumfragen helfen dabei, wichtige Erkenntnisse zu gewinnen. Kariem Soliman geht in diesem Leitfaden auf die wesentlichen Aspekte einer Onlineumfrage ein. Von der Zielsetzung über die Fragenauswahl zeigt er den Zusammenhang zur Auswertung als zentralen Aspekt der Veröffentlichung der Ergebnisse auf. Das Buch richtet sich gleichermaßen an Studierende, Wissenschaftler:innen und Praktiker:innen, die im Rahmen ihrer Arbeit auf Onlineumfragen setzen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 99
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Kariem Soliman
Leitfaden Onlineumfragen
Zielsetzung, Fragenauswahl, Auswertung und Dissemination der Ergebnisse
UVK Verlag · München
Umschlagabbildung: © nathaphat ∙ iStockphoto
Autorenportrait: © privat
DOI: https://doi.org/10.24053/9783381119622
© UVK Verlag 2024— Ein Unternehmen der Narr Francke Attempto Verlag GmbH + Co. KGDischingerweg 5 • D-72070 Tübingen
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Alle Informationen in diesem Buch wurden mit großer Sorgfalt erstellt. Fehler können dennoch nicht völlig ausgeschlossen werden. Weder Verlag noch Autor:innen oder Herausgeber:innen übernehmen deshalb eine Gewährleistung für die Korrektheit des Inhaltes und haften nicht für fehlerhafte Angaben und deren Folgen. Diese Publikation enthält gegebenenfalls Links zu externen Inhalten Dritter, auf die weder Verlag noch Autor:innen oder Herausgeber:innen Einfluss haben. Für die Inhalte der verlinkten Seiten sind stets die jeweiligen Anbieter oder Betreibenden der Seiten verantwortlich.
Internet: www.narr.deeMail: [email protected]
ISSN 2941-2730
ISBN 978-3-381-11961-5 (Print)
ISBN 978-3-381-11963-9 (ePub)
Inhalt
1Aufbau und Zielsetzung des Leitfadens
Im Studium oder der Forschung sowie in Verwaltungen, im Bereich der Sozialplanung oder in der Verbandsarbeit können Umfragen zur Erkenntnisgewinnung notwendig sein. Neben den bekannten großen Umfragen sozialwissenschaftlicher Institute, wie beispielsweise dem GESIS-Leibnitz-Institut, existieren zahlreiche privatwirtschaftliche Unternehmen, die regelmäßig Umfragen durchführen. Hierzu zählen u. a. forsa, INSA, Ipsos, Infas u. v. m.
Eine nähere Befassung mit Umfragen hat aus mindestens zwei grundsätzlichen Gründen heraus einen Vorteil: Zum einen lassen sich Umfrageergebnisse besser methodisch nachvollziehen und zum anderen können eigenen Projekte systematischer verfolgt und umgesetzt werden, besonders im Studium oder in der Forschung.
Der vorliegende Leitfaden beleuchtet ausschließlich quantitative Aspekte der Auswertung von Fragebögen. D.h. alle Fragen, die sich auf die Auswahl der Themen und subjektiv-normative Bewertungen von Indikatoren beziehen und in vielen Bereichen der Sozialwissenschaften eine wichtige Rolle für die Erkenntnisgewinnung spielen, können hier nicht betrachtet werden. Der Leitfaden setzt an der Stelle im Befragungsprozess an, an dem die/der Umsetzende bereits über ein Set an relevanten Themen und Fragen verfügt und gewillt ist, diese mittels eines Online-Fragebogens bei der ihm bzw. ihr bekannten Zielgruppe zu erfassen.
Der Leitfaden ist dem Prozess einer Umfrage nachempfunden und gliedert sich in sechs inhaltliche Kapitel, wobei das letzte Kapitel eine Reflexion zu dem gesamten Prozess bietet. In → Kapitel 2 wird das Ziel der Untersuchung und der generelle Aufbau des Fragebogens besprochen, bevor in → Kapitel 3 auf grundlegende statistische Begriffe, insbesondere die unterschiedlichen Skalenniveaus eingegangen wird, welche relevant sind um die Auswahl-Items im Fragebogen bewusst vornehmen zu können (→ Kapitel 4). In → Kapitel 5 wird für verhältnisskalierte Antworttypen gezeigt, wie diese transformiert und zu einem Index zusammengefasst werden können. In → Kapitel 6 werden Beispiele für die Umsetzung in Excel und R dargestellt, welche leicht nachvollzogen werden können und der Prozess des Einlesens und Auswertens der Daten aus Sosci-Survey in Excel und R thematisiert. Hierin inbegriffen ist ein Befehl zur Auswertung von Teildatensätzen, welcher es dem Auswertenden erlaubt, einzelne Variablen nach bestimmten Kriterien darzustellen, z. B. nach dem Alter oder dem Geschlecht, ohne dafür einen Filter im Fragebogen vorab definiert zu haben.
Mit → Kapitel 7 schließt sich der Prozess der Umfrage, indem die Ergebnisse grafisch dargestellt werden. Hierfür werden die grundlegenden Möglichkeiten der grafischen Aufbereitung am Beispiel der Software R aufgezeigt und der Code zur Nachvollziehung anhand eigener Daten angegeben. Besonders die Darstellung von Likert-Skalen kann als Neuerung des Leitfadens angesehen werden, da hierin der Vorteil des Arbeitens mit statistischer Software klar hervorsticht. Zudem münden in diesem Kapitel die Erkenntnisse und Konzepte der vorherigen Kapitel, insbesondere aus → Kapitel 2 und → Kapitel 5, indem die Zuspitzung der Ergebnisse auf eine einzige zentrale Abbildung erfolgt, welche die Information verdichtet darstellt. Im finalen → Kapitel 8 steht ein abschließender Reflexionsprozess an, mit dem im Idealfall auch der Umfrageprozess als Ganzes noch einmal reflektiert wird und Erkenntnisse für künftige Umfragen festgehalten und in Form eines Wissensmanagements (institutionell) nachhaltig verankert werden können.
Wie kann der Leitfaden verwendet werden?
Der Leitfaden kann sowohl vor der Durchführung einer Untersuchung zurate gezogen werden, um sich mit zentralen Konzepten und Fragen auseinanderzusetzen, aber auch je nach Stand der Untersuchung nur für punktuelle Aspekte herangezogen werden. Die einzelnen Kapitel bauen lediglich zeitlich mit Blick auf die praxisbezogene Umsetzung einer Online-Umfrage aufeinander auf sowie an wenigen Stellen, z. B. um Beispielrechnungen zu vertiefen. Für die Leserin oder den Leser resultiert aus dem Aufbau, dass nicht alle zu einem Themenfeld vorgelagerten Kapitel gelesen werden müssen, sondern direkt zu dem jeweils relevanten Kapitel gesprungen werden kann. Hierbei empfiehlt es sich, → Kapitel 1 bis → Kapitel 4 als Grundlage bzw. Wiederholung zu lesen und dann optional die inhaltlichen Vertiefungskapitel zu wählen, die für die eigene Fragestellung aktuell am relevantesten sind.
Beispiel zur Nutzung des Leitfadens | Wollen Sie beispielsweise als Planungsfachkraft für Ihren Sachbericht einen Index bilden und brauchen hierfür eine Anregung, können Sie nach Durchsicht der Kapitel eins bis vier direkt in den → Abschnitt 5.2 wechseln. Wenn Sie mit den statistischen Grundlagen bereits vertraut sind, können Sie auch gleich mit der praktischen Umsetzung eines Index beginnen. Der Leitfaden begleitet Sie bis zu der grafischen Umsetzung, was für das Indexbeispiel anhand des Netzdiagramms (→ Abschnitt 7.2.1.) veranschaulicht wird. Somit bietet der Leitfaden Ihnen – aufbauend auf ihren Interessen und Vorkenntnissen – eine individuelle und flexible Lesart, je nachdem welches der inhaltlichen Themen für Sie relevant ist.
2Ziel einer empirischen Studie und Aufbau eines Fragebogens
2.1Konkrete Fragen an eine Umfrage
Umfragen gehören neben der Beobachtung, dem Experiment, sowie der Dokumentenanalyse zu den vier Erhebungsmethoden, die in den Sozialwissenschaften genutzt werden, um an Primärdaten zu gelangen und stellen sowohl in wissenschaftlichen Erhebungen als auch in der kommunalen Praxis ein zentrales Tool zur ErkenntnisgewinnungErkenntnisgewinnung dar. Eine Umfrage stellt einen langfristigen Prozess dar, der weit über die reine Befragung hinausgeht. Dafür ist entsprechend Zeit einzuplanen. Für eine Umfrage lassen sich folgende Schritte identifizieren, die in einer linearen Bearbeitungsweise erfolgen, wobei jede Prozessebene eigene PfadabhängigkeitenPfadabhängigkeiten schafft, die eine Rückkehr zur vorherige Prozessebene erschweren:
Was?
Ziel der Befragung und den eigenen Ressourcenstand klären.
Welche Arbeitsschritte können durch das Team bearbeitet und welche müssen extern bezogen werden?
Wer? Wie?
Zielgruppe möglichst exakt definieren, z. B. nach Alter, Wohnort, Schulform etc.
Art der Befragung festlegen (Online- vs. Papierform; Leitfadengestütztes Interview vs. Fragebogen, mit überwiegend geschlossenen Fragen)
Umsetzung
Fragebogen entwickeln und technisch, z. B. mittels Software umsetzen.
Durchführung eines Pretests zur Identifizierung und Behebung inhaltlicher und sprachlicher Ungereimtheiten.
Befragung durchführen: Befragungszeitraum festsetzen und ggf. Besonderheiten, wie Ferienzeiten und Schulungszeiträume beachten.
DatenDaten, Auswertung auswerten
Festlegung der Software und wie die grundliegende Frage aus den Daten heraus beantwortet werden können (→ Abschnitt 7).
Rückspiegelung der Ergebnisse an die Teilnehmer:innen der Umfrage sowie an den Auftraggeber und die interessierte Öffentlichkeit. Dies kann in Form von Broschüren, Sachberichten oder Darstellung zentraler Ergebnisse auf der Website oder Social-Media-Kanäle passieren.
Bevor es jedoch um die konkrete Gestaltung eines Fragebogens geht, sollten sich die Person(engruppe), welche mit der Erstellung einer Umfrage betraut wurde(n), z. B. im Rahmen eines vorbereitenden Strategieworkshops die drei nachfolgenden Fragen stellen und diesbezüglich möglichst frühzeitig Einigkeit erzielen:
Wer soll befragt werden?
Zunächst ist es notwendig sich zu vergegenwärtigen, welche Personen(gruppen) zu der Zielgruppe gehören. Die Identifikation dieser Grundgesamtheit kann sehr unterschiedlich ausfallen. So können bei Seniorenbefragungen je nach Definition und Bereich Personen ab 45 Jahren (arbeitsmarktliche Sichtweise), bei Marketingstudien Personen jenseits der 50 und aus gesundheitspolitischer Perspektive Personen ab 70 Jahren gemeint sein. Eine ähnliche Herausforderung ergibt sich bei Jugendbefragungen, welche je nach Institution oder Träger unterschiedlich weit gefasst sein kann. Gemäß dem Jugendrecht werden als „Jugendliche“ jene Personen bezeichnet, die sich altersmäßig in der Zeit zwischen Kindheit und Erwachsensein befinden. Grob definiert also jene Personen, die sich zwischen dem 13. und dem 21. Lebensjahr befinden. Rechtlich gesehen werden als Jugendliche jene Personen bezeichnet, welche zwischen 14 und 18 Jahre alt sind. In konkreten Fällen können die Altersgrenzen jedoch abweichen, so werden beispielsweise in einigen Projekten der Beschäftigungsförderungen auch Personen bis zum 27. Lebensjahr als Jugendliche erfasst. Für die nötige Trennschärfe ist in jedem Fall zu Beginn des Untersuchungsprozesses zu sorgen.
Was soll erfragt werden?
Ist das Wer geklärt, stellt sich die Fragen nach dem Was bzw. dem Wonach der Befragung. Dieser Prozess ist am schwierigsten, denn er stellt das Fundament aller weiteren Schritte der Befragung dar. Es handelt sich hierbei um eine zentrale Weichenstellung für den weiteren Befragungsprozess. Fehler, die an dieser Stelle gemacht werden oder Aspekte, die nicht beachtet werden, können im laufenden Prozess nur unter erheblichen Ressourceneinsatz und in einigen Fällen gar nicht mehr korrigiert werden. Die Pfadabhängigkeit ist an dieser Stelle des Umfrageprojekts bereits sehr hoch. Was erfragt werden soll zu bestimmen, ist alles andere als trivial, da es auf einer Metaebene den roten Faden der Untersuchung darstellt. Das Was ist auch deshalb schwer zu beantworten, weil –analog zu dem Bild eines Trichters- sich alle nachfolgenden Fragen bzw. Items dieser übergeordneten Fragen unterordnen bzw. sich aus dieser ableiten lassen sollten. Zudem bewegt sich die Beantwortung des Was in einem permanenten Spannungsfeld aus AbstraktheitAbstraktheit und GenauigkeitGenauigkeit. Einerseits sollen im Nachgang noch genug potenziell interessierende Fragen gestellt werden können, aber andererseits sollten mit den Fragen keine immer neuen Themenfelder aufgetan werden. Ein adäquates Was im Rahmen einer Jugendbefragung könnte beispielsweise lauten, „Wie zufrieden sind Jugendliche mit dem Leben in der Stadt Erfurt?“ oder „Wie bewerten Jugendliche die Lebensqualität in Ihrem Stadtteil?“.
Beide exemplarische Fragen erfüllen den Anspruch einerseits die Zielgruppe und den Untersuchungsgegenstand einzugrenzen, andererseits lassen sie für den weiteren Umsetzungsprozess genug Spielraum den Begriff „Lebensqualität“ durch konkrete Angebote der Stadt bzw. des Stadtteils zu untersetzen. Beispielsweise könnte aufbauend auf dieser Leitfrage nach Sport-, Kultur- und Freizeitangeboten gefragt werden, ohne den Rahmen, welcher durch die Leitfrage gesetzt wurde, zu verlassen.
Wie soll befragt werden?
Die dritte elementare Leitfrage bezieht sich auf die Methode der Befragung. Neben den beiden Extremvarianten einer rein-qualitativen Befragung und einer rein-quantitativen Befragungen ist es bei Befragungen üblich, eine Variante mit offenen und geschlossenen Antworttypen zu verwenden. Dieser Ansatz wird Mixed-Methods-AnsatzMixed-Methods-Ansatz





























