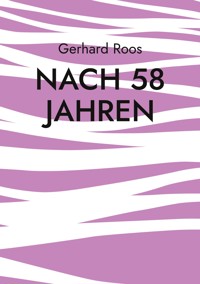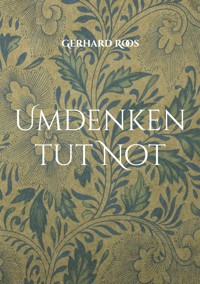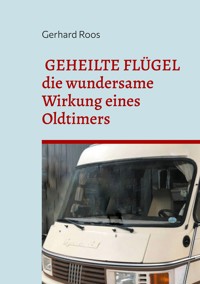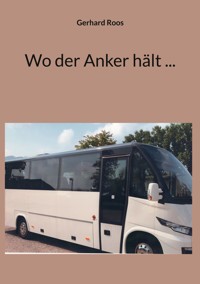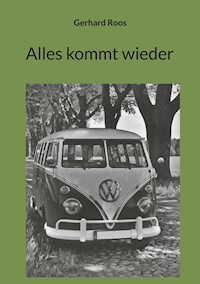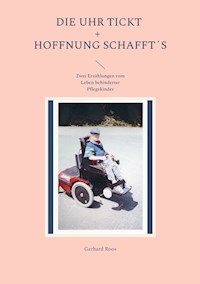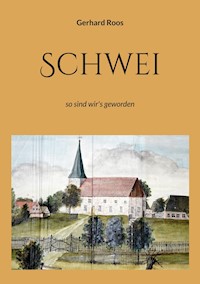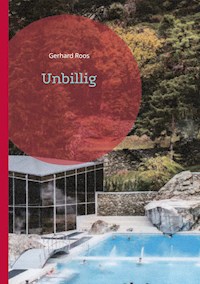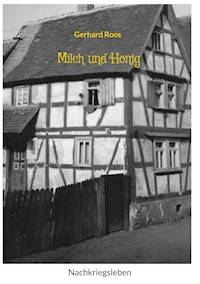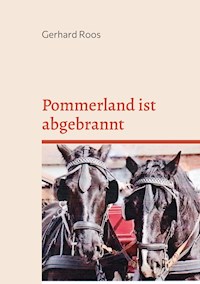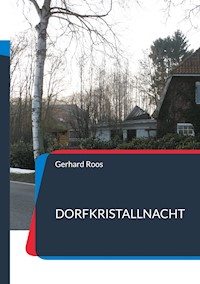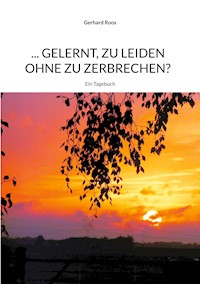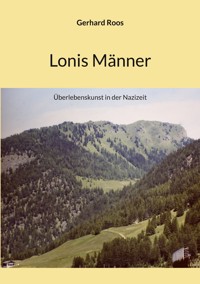
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2023
Völlig freudlos ist Appolonias Jugend nicht, aber durch schwerste Belastungen geprägt. Unterschiedlichste Lebensumstände lassen sie ein Wechselbad aus Freud und Leid erleben, schließlich gar die Gefangenschaft im KZ. Loni behält ihre Kraft und den Lebensmut, in der Nachkriegszeit einen Neuanfang zu schaffen, der dank einiger unerwarteter Begegnungen verblüffend gut wird.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Korbinian
Otto
Enno
Gerold
Tammo und Tymon
Joachim
Werner
Alfred und Ludwig
Korbinian
Peter und Paul
Nachwort
Sönke Müller und seiner Familie dankbar gewidmet
Fast alle Handlungen und Personen sind frei ersonnen. Ähnlichkeiten oder gar Übereinstimmungen mit Lebenden oder Verstorbenen sind außer mit einigen NAZI-, SA- und SS-Bonzen, Wehrmachtskommandeuren sowie KZ-Verantwortlichen zufällig und ungewollt.
Korbinian
Auf beiden Seiten des Tiroler Bächleins oberhalb des Köhlerhofs im engen Seitental des Flusses Lech steigt der dichte Wald steil in die Höhe. Ein gutes Stück Wegs vom Hof entfernt macht das Tal eine scharfe Biegung, hinter der selbst vom höher gelegenen Garten des Hofs aus der weitere Oberlauf des Baches nicht mehr sichtbar ist. Es sei denn, man steigt dem Bachlauf entgegen. Und das machen die Kinder der Bauernfamilie Köhler wie auch die der jungen Witwe des verunglückten Müllers Anton Sailer aus der nun von ihr betriebenen benachbarten Wassermühle recht oft. Außer wenn schweres Wetter hindert. Selbst im dicksten Winter stapfen zumindest die beiden ältesten Buben, der bedächtige neunjährige Korbinian Köhler und sein Bruder, der pfiffige selbstbewusste achtjährige Seppi, gerne zum kleinen Teich unter dem etwa zwei Meter hohen Wasserfall. Ist es länger recht kalt gewesen, kann man dort nämlich aufs Eis.
Oberhalb des Wasserfalls ist ein weiterer größerer Teich. Da hinauf wagt sich ausschließlich die sechsjährige Loni Sailer, aber nur im Sommer. Wie der Name Joseph des zweiten Köhlerbuben zum Seppi wurde, ist auch ihr schöner Name Appolonia schon seit Anbeginn ihres Lebens zur Loni verkürzt worden. Sie ist ein seltsames Kind. Wenn die anderen fröhlich spielen, sitzt sie gerne abseits und beobachtet aufmerksam das muntere Treiben. Ihre Mutter muss nun schon seit über zwei Jahren nicht nur ihre drei Töchter alleine erziehen sondern auch mit teilweise der Hilfe ihrer beiden älteren, Maria und eben Loni, die Mühle in Betrieb halten, um ihre Familie ernähren zu können. Ab und an kommt einer ihrer Brüder aus dem Lechtal herauf, um sie zu unterstützen.
Loni redet nur, wenn es sein muss. Sie ist stark und gesund, marschiert tapfer mit den anderen Schulkindern der beiden Familien im Tal den jeweils dreißigminütigen Trampelpfad zur Dorfschule und ist auch eine gute Schülerin. Aber immer gerne für sich. Ihre Mutter ist infolge der ständigen Anspannung durch Mühle und Familie oft ungeduldig und recht streng, ja bisweilen sogar hart zu ihren Kindern. Am härtesten zur Loni, weil sie deren verschlossene Art nicht begreift, obwohl sie wohl durch ihre Strenge mit dafür verantwortlich ist.
Der einzige, mit dem Loni etwas mehr spricht, ist der neunjährige Korbinian. Seine unbefangene Art, direkt auf sie zuzugehen, dringt durch ihre herbe Schale. Und ihn reizt wohl die nicht ganz normale Art, wie sich Loni gibt. Auf dem Schulweg gehen sie öfter neben einander, und Loni erzählt ihm auf dem Heimweg sogar Einiges vom Schultag.
Der Sommer 1928 ist nicht besonders warm, im Gegenteil. Aber Loni stört das nicht. Fast täglich klettert sie neben dem Wasserfall die zerklüftete Felswand hinauf, mit der sie gar keine Probleme hat, schlüpft aus ihrer einfachen Kleidung und badet ungeachtet der Wasserkälte des Bergbaches nackt in ihrem geliebten Teich. Dann legt sie sich auf einer moosigen Fläche in die Sonne und lässt sich von dieser trocknen. Eben ein urgesundes Naturkind. Ihre Mutter kann sich kaum erklären, warum ihre zweite Tochter stets so adrett und sauber ist, gibt sich aber mit der knappen Erklärung Lonis „im Bach gewaschen“ zufrieden. Wenigstens das, die Schule und die Mithilfe in der Mühle klappen bei diesem Kind. Sonst ist es halt das schwierige.
Korbinian ärgert sich allmählich über sich selbst, denn immer hatte er eine gewisse Scheu, den Anstieg über die Felswand zu wagen und zu sehen, was es Besonderes dort über dem Wasserfall zu sehen und zu erleben gibt. Aber nun reicht es ihm. Am Sonntag, dem 3. Juni 1928 nimmt er allen Mut zusammen, geht alleine bis zum Wasserfall und beginnt die Felswand, die ja gar nicht so hoch ist, zu überklettern. Als er oben über die Kante gestiegen ist, muss er um ein kleines Gebüsch herum. Er will sich davor gerade aufrichten, da sieht er zwischen den Ästen hindurch ein Stückchen entfernt die nackte Loni auf ihrem Moosflecken, wo sie sich gerade zum Trocknen niedergelegt hat.
„Ach, das ist ja schön, dass du hier bist.“ Er geht auf sie zu und bleibt verwundert stehen. „Bist du ein Krüppel? Dir fehlt ja was zwischen deinen Beinen. Wie lässt du denn dein Wasser?“ Nun ist Loni verwundert. „Wovon sprichst du? So sehen wir Geschwister alle aus. Ist das bei dir anders?“ „Warte, ich zeig´s dir.“ Zuerst zieht er seine Lederhose aus, aber dann wie auch sie alle anderen Kleidungsstücke. „Siehst du, dass es bei mir anders ist?“
Beide bestaunen nun andächtig die andere körperliche Ausstattung und kommen schnell dahinter, dass sich eben Buben und Mädels in dieser für sie vorerst überraschenden Weise voneinander unterscheiden. „Traust du dich jetzt mit ins kalte Wasser?“ Diese seltsam kecke Frage trifft Korbinians Stolz. „Natürlich!“ und schon ist er im Teich. Loni ist sofort dabei und gleich entwickelt sich eine Wasserschlacht der beiden nackten Kinder, unbeschwert und fröhlich.
Als sie dann pudelnass nebeneinander in der Sonne liegen, fragt ausgerechnet die sonst so zurückhaltende Loni: „Darf ich dein Ding mal anfassen?“ „Warum nicht?“ Korbinian kennt vor Loni nicht die geringste Scheu. Aber erlebt plötzlich ein ihm bisher unbekanntes Wohlgefühl bei der behutsamen, ja fast zärtlichen Berührung durch die Mädchenhand. Ob das bei Loni auch so ist, wenn er sie streichelt? Ohne zu fragen fasst er behutsam zu. Und sie strahlt ihn an. „Och, tut das gut. Das ist ja richtig angenehm.“
Diese erste kindliche Erkenntnisstunde über das jeweils andere Geschlecht führt zu einer neuen Gewohnheit der Beiden. Oft, wenn sich das unauffällig einrichten lässt, treffen sie sich oberhalb des Wasserfalls, baden und toben ausführlich miteinander und liebkosen einander dann, bis sie getrocknet sind. Als Loni einen mutigen Schritt wagt und eines Tages ihre Mutter auf die Geschlechterunterschiede anspricht – sie hat inzwischen auch bemerkt, dass erwachsene Männer keine solchen Brüste haben wie erwachsene Frauen –, wird sie schroff zurückgewiesen. „Dafür bist du doch noch viel zu jung. Schäm dich für solche Gedanken!“
Dadurch lernen sie und auch Korbinian, dass diese Angelegenheit eine schambesetzte ist und behandeln ihre Treffen am und im Teich als ihr gemeinsames Geheimnis. Immerhin schaffen sie sich geduldig und mit zäher Arbeit einen versteckten Fußsteig, der ihnen den Weg vorbei am rauen Felsen erheblich bequemer macht. Die ergötzliche Zweisamkeit ist beiden diese anstrengende Arbeit wert. So geht das dann zwei Sommer lang. Im Herbst 1929 muss Mutter Sailer aber doch die Mühle aufgeben. Sie ist überfordert. Und nun macht sie den wahrscheinlich größten Fehler ihres Lebens. Sie zieht mit ihren drei Töchtern zu einem Mann, den sie über einen ihrer Brüder kennen gelernt hat, in die Großstadt München. Und wird dessen Ehefrau. Die Kinder aber behalten die österreichische Staatsbürgerschaft.
Otto
Dieser deutsche Bekannte ihres Bruders hatte sich in München angeblich eine Arbeit als „Ordner“ bei Veranstaltungen gesucht. In Wirklichkeit ist dieser Otto Haller ein tätiges Mitglied in einer der größten SA-Staffeln des Deutschen Reichs. SA-Oberführer Süd in München ist derzeit der ehemalige Major August Schneidhuber. Otto wird recht bald wegen seiner Skrupellosigkeit zu der kleinen Truppe der Leibwächter Schneidhubers kommandiert. Anfangs, in den Zwanzigern, geht die SA recht aggressiv gegen alle bekannten Linksparteien vor. Die ständigen Radikalisierungstendenzen in der SA haben laufend heftige Spannungen mit der nationalsozialistischen Parteiführung zur Folge. Aber Schneidhuber bleibt vorerst unangefochten. Im Vorfeld der Reichstagswahl 1930 kommt es dann zu einer ernsten Krise zwischen SA und Parteiführung, die sich aber auf den getreuen Sturmmann Otto Haller nicht auswirkt. Er bleibt seiner Aufgabe als Erz-Nazi und Leibwächter treu.
Privat hat das aber seine Auswirkungen. Zum besseren Nachweis seiner „richtigen“ Gesinnung hat er sich mit dieser Anneliese Sailer eine Frau gesucht, die mit ihren Töchtern dem Ideal der „arischen“ Deutschen genau entspricht. Alle vier haben blonde Haare, die sie in dicke Zöpfe geflochten haben, blaue Augen und schöne, gerade gewachsene Nasen. So schmückt er sich mit dieser Familie im Sinne Hitlers. Und bald ist Anneliese auch wieder guter Hoffnung. Weil auch er flachsblond ist und blaue Augen hat, wird das sicher wieder ein „gutes deutsches“ Kind werden.
Stolz nimmt er seine ganze blonde Familie zu allen denkbaren Veranstaltungen seiner Organisation mit. Zur Unterstreichung der nationalen „Ideal-Passform“ der werdenden Mutter Anneliese und ihrer Töchterchen lässt er für sie ansprechende Dirndl fertigen und bekommt allmählich in München den Ruf des Musterariers. Das ist aber nur die eine, die Sonnenseite seines Daseins. Da gibt es viel mehr dunkle Seiten, die er aber tunlichst aus der öffentlichen Wahrnehmung heraus hält.
Da ist zum Einen eine Schwierigkeit im Umgang mit seiner Frau. Sie hat – erstmalig, wie sie sagt – heftige Probleme mit der Schwangerschaft. Um sich nicht zu stark zu belasten, verweigert sie sich fast ständig ihrem Mann, der dafür zwar Verständnis heuchelt, jedoch diese Schonungsbitten intensiv als Demütigungen empfindet. Ein Machtmensch wie er benötigt Unterwerfung, Erfolge, Anerkennung und Bewunderung. Also müssen andere menschliche Objekte für die Ausübung und den Genuss seiner Überlegenheit herhalten. Wie bei diesem Typen naheliegend, geht es natürlich um die Anerkennung als Mann, also vorwiegend sexuelle Macht.
Als die bisher bereitwillig verfügbare Partnerin fast vollständig ausfällt, greift er zur nächstliegenden Ersatzmöglichkeit, den Töchtern. So beginnt eine für die beiden älteren Mädels schreckliche Zeit des sexuellen Missbrauchs. Er lässt sich zuerst, mal von Maria, mal von Loni, mal von beiden zugleich einfach durch deren Anblick im unbekleideten Zustand erregen und sorgt selbst für Entspannung. Doch bald geht er weiter, und die beiden Mädchen erleiden Entsetzliches.
Da ihnen ihre Mutter früher schon schroff und eindeutig klar gemacht hat, sie wolle von „solchen Sachen“ nichts hören und die Töchter, vor allem die durch ihre Freundschaft mit Korbinian mehr wissende Loni, sollten sich für „solche Gedanken“ schämen, schämen sich nun beide auch für die konkreten Geschehnisse und können sich niemandem anvertrauen. Als dann der kleine Siegfried kerngesund zur Welt gekommen und Anneliese ihrem Mann wieder häufiger verfügbar ist, ändert sich an den Missbrauchsgewohnheiten Ottos auch nichts mehr.
Am dreißigsten Juni und ersten Juli 1934 in den frühen Morgenstunden wird die SA-Führung durch Angehörige des weithin berüchtigten SS-Sturmbannes „Oberbayern“ festgenommen und wenig später von einem eigens dafür aufgestellten Exekutionskommando der „Leibstandarte SS Adolf Hitler“ unter Josef Dietrich größtenteils erschossen. Otto überlebt schwerverletzt, ist aber seither von der Fürsorge und Pflege seiner Frau abhängig. Die hat aber zugleich ein ganz anderes Problem.
Sie hat stark wachsende Erziehungsschwierigkeiten mit ihren beiden älteren Töchtern. Maria, vierzehn Jahre alt und inzwischen heftig im körperlichen Umbruch, entwickelt sich – verdorben durch den Stiefvater – zum SS-Flittchen. Ihr fehlen jegliche Skrupel, sich zu prostituieren, was für ein so junges Mädchen schon ganz unglaublich ist. In der Nähe der Gemeinschaftsräume der SS geht sie erfolgreich und gewinnbringend auf den Strich. Und bringt so viel Geld nach Hause, dass Mutter und Stiefvater schließlich stillschweigend akzeptieren, was sie treibt. Letzterer weiß ja auch warum.
Loni in ihrer nach innen gekehrten Art hingegen wird immer bockiger. Sie verweigert sich sprachlos den Hausaufgaben der Schule, bleibt aber eine Schülerin mit recht guten Noten. Ihre frühere Bereitschaft, zu Hause mitzuhelfen, schwindet. Und wenn sie doch mal den Mund aufmacht, wird sie regelrecht unverschämt. Nach knapp zwei Jahren wendet sich ihre Mutter mit der Bitte um Hilfe für ihren Umgang mit Loni ausgerechnet an die Fürsorge der katholischen Kirche. Dort hat man schnell ein scheinbares Patentrezept zur Hand. Loni soll in ein Erziehungsheim der Kirche eingewiesen werden. Und – wie könnte es anders sein – Anneliese stimmt erleichtert zu. Dieses eine Problem ist sie dann wenigstens los. Der mit seinen Verletzungsfolgen kämpfende und inzwischen auch impotente Mann, die jugendliche Prostituierte und zwei kleinere Kinder im Haus genügen ihr völlig. Ihr Leben ist ohnehin zerstört.
Also kommt Loni in ein Heim. Überraschender Weise ist dieses sehr weit weg von ihrem zu Hause, aber das ist wohl von den Fachleuten der Kirche so gewollt. Die schicken sie in die Nähe von Oldenburg im Oldenburgischen. Wortlos geht sie aus ihrer Familie. Innerlich ist sie mit allem zerbrochen, außer mit den Geschwistern. Aber die will sie mit ihrem Abgang keinesfalls belasten.
Enno
Die Eisenbahnfahrt nach Norddeutschland ist für sie eine seltsame Erfahrung. Sie sind vier Mädels im Alter zwischen zehn und vierzehn Jahren und werden von einer recht alten und ziemlich strengen Nonne begleitet. Die hat aber immerhin das Geschick, den vier Kindern diese Reise nicht langweilig werden zu lassen. Zum Einen kennt sie sich verblüffend gut in den Gegenden aus, durch die sie in den Zügen transportiert werden. So erklärt und beschreibt sie deren Eigenheiten und auch die jeweiligen Bewohner recht lebendig. Manche Geschichten bringen die Kinder gar zum Lachen. Zum Anderen hat sie einige Schulbücher mit und baut geschickt in die langen Fahrtzeiten wiederholt kleine Unterrichtseinheiten ein.
Am Oldenburger Bahnhof wird die kleine Gruppe dann mit einem großen Kraftwagen abgeholt, dessen älterer Fahrer seiner Arbeitskleidung nach entweder landwirtschaftlicher oder gärtnerischer Arbeiter sein dürfte. Er spricht eine seltsame Sprache, die für die Kinder nur teilweise zu verstehen ist. Schwester Emerenzia erklärt, dies sei „Plattdeutsch“, eine Sorte Mundart, die hier noch sehr häufig gesprochen werde. Der Fahrer lacht und sagt mit klarem Hochdeutsch: „Wenn ihr einige Zeit hier gelebt habt, werdet ihr Platt sicherlich gelernt haben. Ihr seid ja noch jung genug. Wir haben schließlich mit eurer Mundart auch unsere Schwierigkeiten.“ Dann biegt er in die Einfahrt eines beeindruckenden Gebäudekomplexes ein.
Entweder war das mal ein Gutshof oder ein Kloster. Jedenfalls sind die Gebäude, wenn auch außen ein bisschen verkommen, hochherrschaftlich mit großen Fenstern, kleinen Erkern und Türmchen sowie allerlei Steinfiguren versehen. Der Fahrer hält mit dem großen Wagen vor der Eingangstreppe, dreht sich zu den Kindern um und erklärt: „So, das ist nun euer neues zu Hause. Und mich seht ihr auch immer einmal, ich bin nämlich hier der Gärtner. Ich heiße übrigens Jan-Gerd Reimers, aber alle Kinder nennen mich nur Jan. Und das könnt ihr auch so machen. Ich wünsche euch nun, dass ihr euch gut eingewöhnen könnt und hier wohl fühlt.“ Dann lässt er die Nonne und die Kinder aussteigen, holt das bescheidene Gepäck hervor und bringt schließlich das Auto in einer verschließbaren Wagenremise unter. Der Wagen gehört also auch zum Heim.
Der Empfang durch den Heimleiter, das ist ein Mönch von etwa fünfzig Lebensjahren, ist unerwartet freundlich, wenngleich er auch sofort von festen Regeln im Haus spricht und ankündigt, die Erzieherinnen und Erzieher hätten den Auftrag, streng auf die Einhaltung dieser Regeln zu achten. Er selbst werde von allen Kindern und Jugendlichen „Vater Georg“ genannt. Solche festen Regeln sind zumindest Loni recht angenehm. In einer geordneten Umwelt fühlt sie sich sicher. Und die Nonne, in deren große Mädchengruppe sie und die mit ihr herbei gereiste Frieda nun eingeordnet werden, wirkt trotz der Ankündigung einer strengen Ordnung vorerst freundlich und zugewandt.
Diese Schwester Renata erklärt den beiden sofort ausführlich, sie sei eigentlich nur für die Älteren dieser Gruppe zuständig. Das seien knapp die Hälfte. In ihren Verantwortungsbereich und einen eigenen Schlafsaal kämen nur diejenigen Mädchen, die bereits ihre Tage hätten. Die, bei denen das noch nicht der Fall sei, wohnten im anderen Saal. Für die sei die Schwester Virginia zuständig, die aber erst in zwei Tagen wiederkomme. Die sei zur Beerdigung ihrer Schwägerin nach Lingen an der Ems gereist.
Die genau vierzehnjährige Frieda, die auffällig heftige Schwierigkeiten mit ständigen Zuckungen im Gesicht und ihrer Hände hat, aber schon während der Bahnreise ein recht helles Köpfchen bewies, fragt nun direkt: „Tage haben wir doch alle. Immer neu nach vierundzwanzig Stunden, oder?“ Und nun zeigt sich, warum Schwester Renata ausgerechnet für die gerade heran reifenden jungen Frauen zuständig ist. Sie erklärt den beiden Neuen sorgfältig, was demnächst auf sie zukommt. Dieses Aufnahmegespräch wird dadurch zu einer sehr liebevollen und informativen Aufklärungsveranstaltung. Für Frieda kommen da ganz viele neue Informationen. Für Loni indessen bringt das infolge ihrer Erfahrungen, teils guten mit Korbinian, teils bösen mit ihrem Stiefvater, wenig Neues über die Anatomie der Geschlechter und wichtige Funktionen der Organe, aber eine völlig neue positive Sicht auf sowohl ihre eigene Sexualität als auch auf die „guter“ Männer, wie Renata das ausdrückt. Und zugleich die notwendige eindrucksvolle Warnung vor ungewollter Schwangerschaft.
Die beiden Neuen kommen nun aber zuerst in den Verantwortungsbereich der Schwester Virginia. Und die kommt wie angekündigt nach zwei Tagen wieder zurück. Erschreckt erleben die beiden nun eine vollständig andere Erziehungsmethode. Extrem streng, ohne jedes Verständnis für die nun insgesamt acht Mädchen und sofort mit Schlägen bei der Hand, wenn nicht alles entsprechend ihrer Anordnungen läuft. Manches an ihrem Umgang mit den Kindern ist Loni von ihrer Mutter reichlich vertraut, obwohl die – immerhin – ihre Regeln nie mit Schlägen durchgesetzt hat. Eher mit starrer Nichtachtung. Also macht sie wieder dicht wie in München, vermeidet damit aber immerhin, geschlagen zu werden, weil sie sich zugleich recht gescheit in die Organisation der Schwester Virginia einfügt.
Da sie angepasster wirkt als sie in Wirklichkeit ist, hat sie bald bei dieser strengen, fast brutalen Schwester ein Stein im Brett. Ihr, der schon als Grundschulkind in der Mühle schwere Arbeit zur Selbstverständlichkeit geworden ist, kann Virginia Aufgaben zuteilen, die so gut keines der anderen Kinder bewältigen kann. Damit organisiert sie sich ein geschontes Dasein.
Innerhalb ihrer Wohngruppe sind die Aufgaben insgesamt recht einfach und von den anderen zumeist jüngeren Mädchen locker auch zu bewältigen. Loni und ein zweites körperlich kräftiges Mädchen, das ein Waisenkind ist, werden deshalb nach einiger Zeit gemeinsam dem Gärtner Jan zugeordnet. Für beide Mädchen ist das regelrecht ein Geschenk. Jan ist nicht nur ein guter Arbeiter und Fachmann, der die im Garten arbeitenden acht Kinder – sechs Buben und die beiden Mädchen – geduldig anleitet und zu begeistertem Arbeiten motiviert, sondern auch noch ein fröhlicher väterlicher Ansprechpartner auch für manche Nöte, die mit der Gartenarbeit gar nichts zu tun haben. So lässt sich das Leben in diesem Heim für Loni im Großen und Ganzen recht gut aushalten. Und auch die erst zehnjährige Kathi fühlt sich im Garten gut aufgehoben.