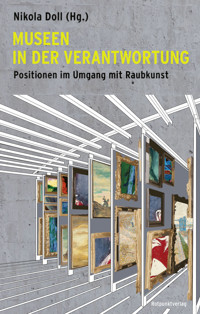
Museen in der Verantwortung E-Book
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Rotpunktverlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2024
Die Debatten um den Nachlass von Hildebrand Gurlitt und die Sammlung E. G. Bührle sowie die Kontroverse um koloniales Raubgut haben gezeigt, dass die Restitution von Kunstwerken und Kulturgütern zu den brisantesten Themen der Gegenwart gehört. Geht es um Raubkunst, ist oft die Rede von »problematischen Eigentumsverhältnissen«, »belasteten Kunstwerken«, »schwierigem Erbe« oder auch von »Werten, um die gestritten werden müsse«. Dabei geht es nicht allein um den materiellen Wert von Kunstwerken oder Vorgänge in der Vergangenheit. Vielmehr bestimmen heutige Sichtweisen auf gewaltsame Ereignisse in der Geschichte den Umgang mit Kunst- und Kulturgütern. Welche Folgen hat Kunstraub aus historischer, rechtshistorischer, juristischer und Museumssicht? Wie können Gedächtnisinstitutionen wie Museen ihre Verantwortung. gestalten? Und welche Rolle haben die Opfer nationalsozialistischer Verfolgung und ihre Nachfahren dabei? Aus unterschiedlichen Perspektiven wird Position zu den aktuellen Fragen bezogen. Fallstudien zeigen exemplarisch auf, wie Verfolgung, Flucht und Raub mit dem Aufbau von Sammlungen und dem Kunsthandel zusammenhängen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 685
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Nikola Doll (Hg.)
Museen in der Verantwortung
Nikola Doll (Hg.)
Museen in der Verantwortung
Positionen im Umgang mit Raubkunst
Rotpunktverlag
Herausgeberin und Verlag danken folgenden Institutionen für die Unterstützung der Produktion dieses Buchs:
Paul Grüninger Stiftung
Stiftung Irene Bollag-Herzheimer
Der Rotpunktverlag wird vom Bundesamt für Kultur mit einem Strukturbeitrag für die Jahre 2021 bis 2024 unterstützt.
© 2024 Rotpunktverlag, Zürich
www.rotpunktverlag.ch
Autorinnenfoto: Annette Koroll
Lektorat: Christiane Schmidt
Korrektorat: Sarah Schroepf
Umschlag: Patrizia Grab
eISBN 978-3-85869-993-0
1. Auflage 2024
Inhalt
Einleitung von Nikola Doll
Das Erbe des Raubs
Fallstudie von Franziska Eschenbach
Die Antiquare Rosenthal und das verweigerte Exil in der Schweiz
Essay von Stefanie Mahrer
Kunsthandel im Kontext
Die politischen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen in der Schweiz während der nationalsozialistischen Herrschaft in Deutschland
Essay von Benno Nietzel
Die Rückerstattung von Kulturgut in der Nachkriegszeit und die Folgen für die Gegenwart
Eine deutsch-schweizerische Verflechtungsgeschichte
Fallstudie von Nina Senger
Das Depositum Hugo Simon (1880–1950)
Essay von Angeli Sachs
Kunst im Kontext
Konzepte der aktuellen Museums- und Ausstellungspraxis im Zusammenhang mit Verfolgung, Raub und Restitution
Essay von Friedrich von Bose
»Nicht-Restitution ist kein neutraler Akt«
Über Museen, Kolonialität und die Notwendigkeit, als Institution Haltung einzunehmen
Fallstudie von Simone-Tamara Nold
Das Depositum Hugo Moser im Kunsthaus Zürich, 1931–1934
Essay von Constantin Goschler
Kunstrestitution in Zusammenhang mit Weltkrieg, Holocaust und Kolonialismus
Essay von Marcel Brülhart
Vom Umgang unserer Rechtsordnungen mit NS-verfolgungsbedingten Verlusten von Kunstwerken
Einordnung und Plädoyer
Essay von Gesa Jeuthe Vietzen und Benjamin Lahusen
Zur Vermutung eines NS-verfolgungsbedingten Entzugs
Ein Problemaufriss aus historischer Perspektive
Essay von Olaf S. Ossmann
Sammlerinnen und Sammler »jüdischer Abstammung«
Ihre Stellung in der Geschichte und in Verfahren um die Rückgabe ihres Eigentums
Essay von Felix Uhlmann
Die Washingtoner Grundsätze und die Erklärung von Terezín
Möglichkeiten und Herausforderungen für das öffentliche Recht
Fallstudie von Joachim Sieber
Das Depositum Curt und Maria Glaser im Kunsthaus Zürich, 1935 bis 1947
Essay von Andrea F. G. Raschèr und Monika Steinmann Meier
Washingtoner Richtlinien
Entwicklungen und Tendenzen in der Schweiz
Anhang
Editorische Notiz
Auswahlliteratur
Dank
Autorinnen und Autoren
Fragengewitter. Installation in der Ausstellung
Gurlitt. Eine Bilanz,
Kunstmuseum Bern, 16. September 2022 bis 15. Januar 2023.
Kunstmuseum Bern, Foto Rolf Siegenthaler.
Einleitung von Nikola Doll
Das Erbe des Raubs
Noch achtzig Jahre später wirkt die Frage nach dem Zusammenhang des Handelns und Sammelns von Kunst in Zusammenhang mit dem Holocaust auf die Gesellschaft ein und ist dabei kein bisschen akademisch. Die Debatten um den Nachlass Hildebrand Gurlitts oder die Sammlung Emil Bührle im Kunsthaus Zürich spiegeln nach wie vor die Relevanz verfolgungsbedingter Verluste sowie das Unbehagen an der Auseinandersetzung mit den Hinterlassenschaften des Nationalsozialismus wider.
Insbesondere wurden die je nach Land unterschiedlich gesetzten Maßstäbe dafür, was im Einzelfall als Raubgut gelten soll, deutlich, und damit das Missverhältnis zwischen dem historischen Ereignis des Verlusts und dessen Beurteilung in der Gegenwart entsprechend nationalen Geschichtsbildern als Problem erkennbar. So ging mit der Annahme des Nachlasses Gurlitt die Frage einher, ob mit der Überführung der unter Raubkunstverdacht stehenden Sammlung in die Schweiz Raubkunst entsprechend der dort geläufigen Definition bewertet werde. In Deutschland galten 2014 verfolgungsbedingte Entzugsvorgänge als Raubkunst, in der Schweiz Konfiszierungen.
Unterschiedliche historische, rechtliche und moralische Wertungen von Verlusten im Zusammenhang mit dem Nationalsozialismus machten in der Diskussion um die Ausstellung der privaten Sammlung Emil Bührle im Kunsthaus Zürich auf die bestehende Kluft zwischen dem Umgang mit Raubkunst in Privatsammlungen und den ethisch-moralischen Verpflichtungen wie dem Bildungsauftrag öffentlich finanzierter Museen aufmerksam. Als die Sammlung im November 2021 im Bau des Architekten Chipperfield eröffnet war, ging es nicht mehr nur um unikale Qualität. Vielmehr sahen sich Museum und Stiftung den Forderungen früherer Eigentümer, gesellschaftspolitischen Ansprüchen und rechtspolitischen Perspektiven ausgesetzt, mithin Verantwortlichkeiten, die Museen nicht mehr alleine betreffen.
Fragen nach dem Verlust und der Aneignung von Kulturgütern, deren Geschichte mit Verfolgung, Genozid und Krieg verbunden ist, zielen mitten auf das heutige Selbstverständnis von Staaten, ihre Geschichtsbilder, auf Autorität und Selbstverständnis von Museen und des von ihnen in Anspruch genommenen Kulturbegriffs. Auch in vielen Kunstmuseen, den Museen mit dem wohl konventionellsten Werkbegriff, sind Werke längst nicht mehr stumme Zeugen einer ästhetischen Künstlergeschichte. Gerade die durch die Erforschung von Raubkunst methodisch reformierte Provenienzforschung hat zu einem neuen Bewusstsein für ihre vielen Bedeutungsebenen geführt. Dennoch haben Kunstwerke, die einst in Gewaltzusammenhängen standen, das Potenzial einer Ohrfeige, das die Historikerin Lorraine Daston 2000 wissenschaftlichen Dingen zugeschrieben hat.1 Geraubte Dinge werden stets den Anspruch des gegenwärtigen Besitzers auf alleinige Deutungshoheit herausfordern, allein, weil mit der Wegnahme Aneignung einherging. Selbst Kunstwerke, bei denen durch eine Restitution das Unrecht und das ursprüngliche Eigentum anerkannt wurde, werden aufgrund ihrer Geschichtlichkeit immer mit dem zurückliegenden Raub verbunden bleiben. In vielen Fällen sind die Spuren des Geschehenen heute noch sichtbar in das Material eingeschrieben.
Schon die Masse der zwischen 1933 bis 1945 geraubten Kunstwerke und Kulturgüter lässt Rückschlüsse auf die Art und das Ziel der Verfolgung aus rassistischen Motiven zu. Kunstwerke machen nur eine kleine, aber bedeutende Gruppe der vom nationalsozialistischen Regime geraubten Vermögenswerte aus. In Deutschland, in den einverleibten und im Zweiten Weltkrieg besetzten Ländern griff die Regierung mit eigens dafür geschaffenen Gesetzen auf Grundstücke, Immobilien, Firmen, Patente, Wertpapiere und Barguthaben sowie auf Kunstwerke, Schmuck, liturgische Objekte, auf ganze Bibliotheken und Archive bis hin zu Alltagsgegenständen unterschiedlichster Natur von Bürgerinnen und Bürgern zu, weil sie Juden waren. Mit der physischen Vernichtung im Holocaust ging die kulturelle Auslöschung einher. Sie ist die Grundlage für eine materielle wie intellektuelle Aneignung von Kunst, zunächst durch das nationalsozialistische Deutschland, dessen Museumsexperten aus beschlagnahmten Kunstsammlungen »Meisterwerke« für staatliche und private Sammlungen auswählten und damit in einen Hochkulturkanon einreihten, von dem Juden als »kulturlos« und »minderwertig« ausgeschlossen waren.
Vor dem Hintergrund der Ereignisse, der historischen Aufarbeitung des Nationalsozialismus in Deutschland respektive der Auseinandersetzungen über die Verflechtungen der Schweiz mit dem nationalsozialistischen Regime mag es überraschen, dass bis heute über Verluste in Zusammenhang mit dem Holocaust gestritten wird. Die Auseinandersetzungen entzünden sich vielmehr an Kunstwerken, in der Regel Gemälden, deren Wert bereits in den dreißiger Jahren gesichert war und durch die Wertschöpfungsketten von Kunsthandel und Museen seit den fünfziger Jahren weiter gestiegen ist.
Unter den Erklärungen, warum das 25 Jahre nach Verabschiedung der elf Grundsätze anlässlich der Washingtoner Konferenz über Vermögenswerte aus der Zeit des Holocaust vom 3. Dezember 1998 so ist, stechen zwei hervor, und sie hängen miteinander zusammen, zum einen die Aneignung von geraubtem Privateigentum und seine Aufwertung als kulturelles Erbe, zum anderen die Scheu vor der Auseinandersetzung mit dieser Problematik, die so auffällig unabgeschlossen wie politisch aufgeladen ist.
Dass das Unbehagen bei nationalsozialistischer Raubkunst nicht Zufall, sondern Ergebnis bewusster Entscheidungen ist, hat die Forschung zu Raub und Restitution gezeigt. Bezeichnend ist etwa, wie der Kunsthändler Hildebrand Gurlitt (1895–1956) gegenüber den Vertretern der Wirtschaftsvereinigung Stahl seine Begegnung mit der französischen Kunst im besetzten Frankreich als eine Zeit der persönlichen Bildung und des beruflichen Fortkommens schilderte: »Sehen Sie, meine Damen und Herren, ich bin in meinem Leben zwei grossen Ereignissen begegnet: dem Expressionismus, mit dem ich aufwuchs, als ich in Dresden als junger Mensch lebte, und der grossen französischen Malerei, die ich später kennen lernte.«2 In derselben Zeit leugneten Gurlitt und seine Frau Helene, im Besitz der Bleistiftzeichnung Das Klavierspiel (um 1840) des Malers Carl Spitzwegs zu sein, die das Finanzamt Leipzig auf der Grundlage von Zwangssteuern eingezogen hatte.3 Heute noch findet sich auf dem Rückkarton des gerahmten Blatts von der Hand Gurlitts ein Hinweis auf die Sammlung Henri Hinrichsen (1868–1942) in Leipzig.4 Für die Rückforderung lag es nach dem Bundesrückerstattungsgesetz in der Verantwortung der Söhne des 1942 in Auschwitz ermordeten Hinrichsen, den Standort der Werke nachzuweisen. Ihre Bemühungen, das Blatt wiederzubekommen, hätten der Mithilfe der am Entzug oder am Verkauf beteiligten Personen beziehungsweise der neuen Besitzer bedurft.
In den oftmals jahrelangen Verfahren zur Rückerstattung oder Entschädigung geraubter Kunst konnte nicht nur die Beteiligung von Experten an Beschlagnahmen, der Verteilung und der Verwertung geraubter Güter in den Hintergrund treten. In den Entschädigungsverfahren wurden mitunter dieselben Personen damit beauftragt, den Wert von Kunstwerken zur Bemessung von Entschädigungssummen erneut zu taxieren. Nach Ende des Holocaust und des Zweiten Weltkriegs hätten die Staaten die Grundlagen für die Rückgabe geraubter Kunst liefern können, Handel und Museen wären durchaus in der Lage gewesen, Hinweise auf Raubgut zu geben. In der Bundesrepublik Deutschland setzte sich jedoch in den fünfziger Jahren eine Schlussstrichmentalität durch, mit der die Diktatur verdrängt und ein kollektives Schuldeingeständnis abgewehrt wurden.
Die Zerstörungen von Museumssammlungen durch die Einziehung von mehr als 20’000 Werken in der sogenannten Aktion »Entartete Kunst« von 1937, durch den Krieg und die Beutenahme der Alliierten trugen dazu bei, dass das Engagement für den physischen Erhalt von Kunstwerken im Nachhinein glaubwürdig eine Opposition gegen den Nationalsozialismus zu begründen vermochte. Mit der Rehabilitierung des als »entartet« diffamierten Expressionismus setzte sich in den Nachkriegsjahren die Sichtweise durch, die Verfolgung der Avantgarden habe im Zentrum nationalsozialistischer Kunstpolitik gestanden. Das Narrativ der Rettung von Kunstwerken diente, je nach Bedarf, der normativen Abgrenzung vom Nationalsozialismus und ab 1949 von der Periode alliierter Fremdbestimmung. Parallel zu dem besonders von den Amerikanern und Briten verfolgten Kurs der reeducation und reorientation wurde ab 1945 ein Kanon deutscher Kunst eingeübt, die im Zeitraum von 1905 bis Anfang der dreißiger Jahre entstanden war. Diese um jüdische und sozialistische Künstler und ihre Werke bereinigte »klassische Moderne« hatte sich spätestens mit der ersten documenta 1955 in Kassel international durchgesetzt.5 Insbesondere durch Ausstellungen im Ausland, wie etwa die Biennalen in Venedig von 1950 und 1952 oder Deutsche Kunst. Meisterwerke des 20. Jahrhunderts im Kunstmuseum Luzern 1953, wurde auch für das Ausland ein symbolischer Schlussstrich unter die Zeit des Neuanfangs und der Besatzungspolitik gezogen. Auch in der Deutschschweiz trugen Ausstellungen in Basel, Bern und Zürich dazu bei, eben jene Entwicklungsgeschichte des französischen Impressionismus, des deutschen Expressionismus und der Abstraktion oftmals durch Neuerwerbungen aus Museums- wie aus Privatbesitz zu konturieren.6
Auch wenn die Museen in der Schweiz in den dreißiger Jahren nur wenig ankauften, führten der Ausverkauf der Moderne durch den deutschen Staat und die Freisetzung von Kunst aufgrund seiner Verfolgungsmaßnahmen zu einer Veränderung des Kunstmarkts und des Gefüges aus Privat- und Museumssammlungen. Mit Ankäufen aus dem Beschlagnahmebestand »entarteter« Kunst hatte das Kunstmuseum Basel 1939 die Grundlage für eine Erweiterung der Sammlung mit Werken des Expressionismus gelegt.7 Auch das Kunstmuseum Bern diskutierte zu diesem Zeitpunkt die »zukünftige Erweiterung der Museumssammlung« um Werke der deutschen und französischen Moderne.8 Erst 1944 mit dem Direktorenwechsel von Conrad von Mandach (1870–1951) zu Max Huggler (1903–1994) positionierte sich nach Basel auch das Kunstmuseum Bern neu. Mit Gründung der Klee-Stiftung, den Deposita der Kunsthändler Max Kaganovich (1891–1978) und George F. Keller (1899–1981) sowie der Anbindung von Privatsammlungen gelang bis Mitte der fünfziger Jahre der Richtungswechsel zur »klassischen Moderne«, der das Museum bis heute ästhetisch und strukturell prägt. Als erste Ausstellung zeigte Huggler 1944 Werke der Sturmkünstler und Ethnographica aus der seit 1937 in Bern hinterstellten Sammlung von Nell Walden (1887–1975).9 An der Rezeption der Sammlung Walden lässt sich nachvollziehen, wie die Legende der verfolgten Moderne über lange Zeit eine Analyse der Zusammenhänge von Kultur- und Verfolgungspolitik verhindert hat. Walden hatte die Sammlung bereits Anfang 1933 in die Schweiz verbracht. Obwohl Nell Walden weder zu den Verfolgten des Nationalsozialismus zählte noch die Kunstwerke von einer Beschlagnahme bedroht waren, firmierte ihre Sammlung bis 2016 als »entartete« Kunst.10
Die moralische Aufladung der Moderne in den Nachkriegsjahren verhinderte bis Anfang der zweitausender Jahre eine kritische Analyse der Zusammenhänge zwischen dem Erwerb von Kunstwerken und der Verfolgungs- und Vernichtungspolitik. Sie hat ein generelles Ungleichgewicht in der Aufarbeitung des nationalsozialistischem Kunstraubs hervorgebracht. Dabei schloss die Aktion »Entartete Kunst« von 1937 die Verdrängung jüdischer Akteure aus dem Kunstbetrieb ab. Und mit der dann Ende 1938 einsetzenden »Verwertung« der »entarteten« Kunst hatte das Regime die »Verwertung« jüdischer Kunstsammlungen gesetzlich systematisiert.11
Die Verbindungen der Schweiz mit dem nationalsozialistischen Deutschland erstreckten sich auf viele Bereiche, den Goldhandel, Vermögensverwaltung, Fluchtgeldtransit, die Beteiligung an der Finanzierung des Außenhandels, der Rüstungsproduktion und Arisierungsmaßnahmen, dem Handel mit Aktien, Diamanten und Kunst.12
Ab 1933 waren die Museen und Banken, teilweise auch die Lager der Kunsthändler in der Schweiz wichtige Aufbewahrungsorte für Kunstbesitz von Verfolgten des nationalsozialistischen Regimes. In den Depositen- oder Leihgabenbüchern im Besitz der Museen finden sich die Namen von ehemals bekannten Sammlerinnen und Sammlern aus Deutschland wie etwa Charlotte Berend-Corinth, Alfred Cassirer, Bruno Cassirer, Curt Glaser, Julius Freund, Th ekla Hess, Ludwig und Estella Katzenellenbogen, Else Lasker-Schüler, Max Liebermann, Robert Neumann und Ilse Neumann, Carl Sachs, Hugo Simon. Nicht alle Leihgeber aus dem Ausland zählten zu den aus rassistischen Motiven Verfolgten des nationalsozialistischen Regimes, wie die Hinterstellungen Eduard von der Heydts zeigen, aber doch signifikant viele.
An den Deposita des französischen Kunsthändlers Kaganovich und des ungarischen Arztes Emil Delmár (1876–1959) im Kunstmuseum Bern werden die Ausweitung der Verfolgung in Europa und die damit einhergehenden Verlagerungen von Kunstwerken wie ganzen Sammlungen greifbar. So folgten die Elfenbeinschnitzereien, Bildwerke des Spätmittelalters und der Renaissance letztlich dem Weg ihres Sammlers ins amerikanische Exil, wo sie sich heute in verschiedenen Sammlungen befinden.13 In Bern verblieb die Skulptur eines Heiligen (1520–1530) aus dem süddeutschen Raum14, die Delmar dem Museum bei Auflösung des Depositums schenkte. In vielen Fällen jedoch waren die in die Schweiz verbrachten Kunstwerke Sicherheiten in der Zeit des unsicheren Lebens im Transit.
Die Unterlagen in Museumsarchiven verleihen diesen heute unsichtbaren historischen Zusammenhängen materielle Präsenz. Anhand der Inventare, Protokolle, Transport- und Versicherungslisten lassen sich Beziehungen und Interessen in Bezug auf die eingelagerten Kunstwerke rekonstruieren. In Briefwechseln werden Angebot und Preisgestaltung verhandelt und damit die konkreten Bedingungen der von Museen in der Regel als Erwerb bezeichneten Aneignung beleuchtet. Diese historischen Quellen sind keine neutralen Zeugnisse. Die Zirkulation von Listen mit Verkaufsangeboten unter Museen, die Kommunikation der Direktoren und Kunsthändler untereinander bei Kauferwägungen halten das strukturelle Machtgefälle zwischen stabilen Institutionen und Gesellschaftsgruppen und denjenigen fest, denen eine vergleichbare Sicherheit fehlte. Die aus der Verfolgung resultierende Verknappung der Zeit führte zu grundsätzlich veränderten Bedingungen: Während die Sammlungskommissionen unter Angeboten vergleichen, Werke zur Ansicht erbitten und den Erwerb abwägen, dringen die Anbieter wie etwa Charlotte Behrend-Corinth, Carl Sachs oder Hugo Simon durchaus mit deutlichen Worten auf Entscheidungen. Die Auswirkungen der verschärften Verfolgung in Deutschland, des Verlusts der Staatsbürgerschaft oder die Besetzung von anvisierten Exilorten infolge des Krieges spiegeln sich in den Verkäufen ebenso wider wie die Aufenthaltsbestimmungen in der Schweiz. Auch wenn die Ursachen für die Verkäufe in die Schweiz verbrachter Kunstwerke außerhalb der Schweizer Landesgrenzen zu suchen sind, zeigen die von 1933 bis 1945 in Museen und Banken eingelagerten Kunstwerke die enge Verflechtung von Verfolgungs- und Museumsgeschichte.
Diese Verbindung kennzeichnet auch das Wort »Fluchtgut«, mit dem die außerhalb des deutschen Herrschaftsgebiets deponierten Kunstwerke 1998 beschrieben wurden.15 Der Begriff entstand mit der Studie zum Transfer von Kulturgütern in und über die Schweiz 1933–1945 und die Frage der Restitution als Differenzierung zum Begriff Raubkunst, der mit Verabschiedung der Washingtoner Erklärung von 1998 in der Schweiz als Konfiszierung gefasst worden war.16 Die Eigenart des Begriffs zeigt sich in seiner Anwendung bei der Bewertung von verfolgungsbedingten Verlusten. Unabhängig davon, ob sich der Eigentümer innerhalb oder außerhalb des deutschen Machtbereichs befunden hatte, wurden Verkäufe als Fluchtgut bewertet.17 Bei diesen an der juristischen Situs-Regel orientierten Bewertungen war der Objektstandort entscheidend, jedoch nicht der Aufenthaltsort des Eigentümers, auch wenn dieser zum Zeitpunkt der Veräußerung Verfolgungsmaßnahmen in Deutschland oder den besetzten Gebieten ausgesetzt war. Das Verfolgungsschicksal wird vielmehr am Objekt, der »flüchtenden Sammlung« verhandelt. In dieser Perspektive sind nicht die Opfer der Verfolgung die Adressaten, sondern die Nutznießer.
Bénédicte Savoy hat am napoleonischen Kunstraub das theoretische Konstrukt der Aneignung von Kulturgütern durch den französischen Staat aufgezeigt, wonach »Meisterwerke der Kunst vom Joch der Tyranneien zu befreien seien und ihre Verschickung nach Frankreich für sie einer Rückkehr ins Leben gleichkomme«.18 Die Vorstellung von einer Befreiung und Demokratisierung bedrohter Kunstwerke in der bürgerlichen Institution Museum bestimmte das institutionelle Sammeln seit dem 19. Jahrhundert.19
In Bezug auf den nationalsozialistischen Kunstraub nimmt die semantische Verschiebung vom Menschen zum Objekt ihren Anfang mit den rechtmäßigen Veräußerungen von Kunstwerken, die im Zuge der Aktion »Entartete Kunst« aus deutschem Museumsbesitz eingezogen worden waren. Sie vollzieht sich parallel zu Verkäufen von Kunst aus dem Besitz von Verfolgten in der Schweiz.20
Der Basler Konservator Georg Schmidt rechtfertigte seine Erwerbungen aus der Beschlagnahmemasse damit, den aus Museumsbesitz »Ausgestossenen« eine »neue Heimat zu bereiten« und die ihnen »zukommende Stimme im Konzert der europäischen Künste wieder zum Gehör zu bringen«.21 Als der Kunstkritiker Paul Westheim, seit 1933 im französischen Exil, Schmidt von Geschäften mit dem Deutschen Reich mit Hinweis auf die politische Dimension abzuhalten versuchte, erweiterte dieser sein Argument des Erhalts kultureller Werte mit Hinweis auf die in Aussicht gestellte Entschädigung der deutschen Museen durch Kunstwerke des 19. Jahrhunderts, die in den Sammlungen von deutschen Emigranten in der Schweiz vorhanden seien: »noch etwas: ich weiss bestimmt, dass der Ertrag der Auktion […] für Ankäufe deutscher Kunst im Ausland verwendet wird. […] Ich weiss auch Diverses, das hierfür im Ausland bereit ist. Vor allem gerettete jüdische Sammlungen, die jetzt verkauft werden müssen von den Besitzern. Hauptsächlich deutsches 19. Jahrhundert: Spitzweg, Leibl, Marées, Thoma.«22
Georg Schmidt traf seine Aussage wenige Wochen nach dem Ankauf von 21 Gemälden aus ehemals deutschem Museumsbesitz anlässlich der Versteigerung der Galerie Theodor Fischer in Luzern am 30. Juni 1939 und direkt vom deutschen Staat.23 Zu der Zeit befanden sich Gemälde von Carl Spitzweg, Wilhelm Leibl, Hans von Marées und Hans Thoma aus dem Besitz von Carl Sachs im Depot des Basler Museums. Sachs, der zusammen mit seiner Frau Margarethe Sachs im Februar 1939 in die Schweiz emigriert war, hatte sich wegen der Einziehung von Vermögenswerten in Deutschland infolge der Flucht zum Verkauf von bereits 1934 in die Schweiz verbrachten Kunstwerken entschieden. Nach Einlagerung im Kunsthaus Zürich waren 21 Gemälde und 174 Papierarbeiten im Mai 1939 zur Ansicht nach Basel verschickt worden.24
Schmidts Rechtfertigung macht deutlich, dass die Unterschiede zwischen kulturpolitisch bedingten und aus Gründen der Verfolgung motivierten Verkäufen hinlänglich bekannt waren. Allein die Bewahrung von Kunst war das höhere Ziel, das vermochte, Menschen in seinen Schatten zu drängen. Mit der Perspektivverschiebung vom Menschen zum Gut, das es zu retten gelte, wird seit Ende des Zweiten Weltkriegs und des Holocaust die Abgrenzung vom nationalsozialistischen Kunst- und Kulturgutraub und seinen Hinterlassenschaften vollzogen.25 Für diesen Vorgang der Entkopplung von Gegenständen und Eigentümern, des Herauslösens und Aneignens unter neuen Vorzeichen hat Bénédicte Savoy den Begriff Translokation geprägt.26
Das Vermögen der Kunstgeschichte, nicht nur Werke, sondern auch Personen in den Zeitläuften verschwinden zu lassen, veranschaulicht das Werkverzeichnis der Gemälde von Alfred Sisley von 1956. In der Provenienzangabe zu dem Gemälde Chaussée de Sèvres (1879), seit 1994 in der Sammlung des Kunstmuseums Bern, findet sich der Name genau desjenigen nicht, in dessen Eigentum sich das Werk am längsten befunden hat: Carl Sachs.
Charles Bonnemaison-Bascale, Paris (Vente Charles Bonnemaison, Hôtel Drouot, Paris, 29 avril 1896, n° 48, adjugé 600 fr.); Charles Viguier, Paris (Vente Charles Viguier, Galerie Georges Petit, Paris, 4 mai 1906, n° 68, adjugé 3820 fr.); Fritz Nathan, Zurich; Mme Hedwig Vatter-Steiger, Berne.27
Carl Sachs hatte das Gemälde vor 1911 erworben, Anfang der dreißiger Jahre dem Kunstmuseum Luzern ausgeliehen und 1934 im Kunsthaus Zürich deponiert. Nach einer kurzen Ausstellung 1939 in den Museen Basel und Luzern wurde das Gemälde im September 1940 auf Vermittlung der Galerie Fischer in Luzern verkauft. 1956 war Sachs aus der Eigentümergeschichte des Gemäldes getilgt worden, nicht hingegen die Werkbeziehungen, die mit dem Holocaust und danach entstanden waren. Diese buchstäbliche Leerstelle markiert die Fortschreibung des mit der Verfolgung etablierten Machtgefälles mit den Methoden der Wissenschaft.
Die Subjektivierung von Kunstwerken, die zu Verfolgten des nationalsozialistischen Regimes gemacht wurden, markiert die Abwendung von Holocaust und damit verbundenen Eigentumsdelikten.
Die Unterscheidung einer Verfolgung aus ästhetischen Gründen von der rassistischen Verfolgung wurde in der Bundesrepublik Deutschland mit Paul Ortwin Raves (1893–1962) Schrift Kunstdiktatur im Dritten Reich von 1949 eingeleitet.28 Demnach bildete die staatliche Einziehung moderner Kunst im Rahmen der Aktion »Entartete Kunst« 1937 den Höhepunkt der Verfolgung von Kunstwerken, Künstlern und Kunstexperten und verdrängte die antisemitische Motivation von Ausstellungsschließungen, Übergriffen auf Galeristen und Sammler sowie von Beschlagnahmen moderner Kunst aus jüdischem Eigentum. Auch der Kunsthistoriker Franz Roh (1890–1965), der 1933 infolge des Gesetzes zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums vom 7. April 1933 seine Stelle an der Universität München verloren hatte und kurze Zeit im Konzentrationslager Dachau interniert gewesen war29, sollte sich der Sichtweise anschließen, dass »man auch hier die Sache treffen wollte (nicht etwa mich, der ich rein arisch und unpolitisch war, also als Person ganz uninteressant bin)«.30
Mit der Verschiebung der Verfolgung von Menschen auf Kunstwerke konnte die materielle und physische Vernichtung ebenjener ausgeblendet werden, denen jedes Gut geraubt worden war. Diese Verlagerung trägt zur Fortschreibung mit dem Holocaust etablierter sozialer, rechtlicher und kultureller Hierarchien bei, welche die Rückerstattungs- und Entschädigungsverfahren der Bundesrepublik Deutschland seit den fünfziger Jahren bestimmt haben. Erst mit Ende des Kalten Kriegs setzte in den neunziger Jahren eine zweite Phase der Restitution nationalsozialistischer Raubkunst ein. Sie führte zur Verabschiedung der Washingtoner Grundsätze im Dezember 1998. Auch das Verhältnis der Schweiz zum Holocaust änderte sich in den neunziger Jahren. Mit der Revision der »nachrichtenlosen Vermögen« wurden die Nachfahren von Opfern des nationalsozialistischen Regimes für die bei Schweizer Banken liegenden Vermögen entschädigt. Von den Entschädigungen für Wertpapiere, Konten und Safes waren Kunstwerke allerdings ausgenommen.31
Den Umgang mit Verlusten aufgrund des nationalsozialistischen Kunstraubs behandelte die Konferenz zu Vermögenswerten aus der Zeit des Holocaust in Washington, D. C., vom 3. Dezember 1998. Vertreterinnen und Vertreter von 44 Nationen und 13 Nichtregierungsorganisationen einigten sich damals auf elf Grundsätze, um geraubte Kunstwerke und ihre ehemaligen Eigentümerinnen und Eigentümer ausfindig zu machen und gemeinsam mit ihnen gerechte und faire Lösungen für den weiteren Umgang mit diesen Objekten zu finden. Dabei sollte insbesondere der lückenhaften Überlieferung der Eigentumsnachweise nach Holocaust und Krieg Genüge getan werden.
Bei der Erklärung von Washington handelt es sich um soft law, um eine Selbstverpflichtung der Signatarstaaten. Der zentrale Gedanke des Ausgleichs zwischen früheren Eigentümern und heutigen Besitzenden wurde von den unterzeichnenden Ländern in der Folge unterschiedlich umgesetzt. Österreich erließ noch 1999 ein Restitutionsgesetz; in Deutschland legten Bund, Länder und Kommunen die aus der Washingtoner Erklärung abzuleitenden Sorgfaltspflichten mit der 1990 verabschiedeten Gemeinsamen Erklärung einschließlich der dazugehörenden Handreichung fest. In der Schweiz hatten sich zehn Kunstmuseen wenige Wochen vor Verabschiedung der Grundsätze für die Recherche von Raubkunst in ihren Sammlungen ausgesprochen.32
Rückblickend zeigt sich, dass sich die Definition von Raub keineswegs aus der Verfolgung ergibt. Sie verändert sich mit zunehmendem Wissen um nationalsozialistische Verfolgungsmaßnahmen und durch die begleitende öffentliche Sensibilisierung. Die Washingtoner Grundsätze wurden auf den Folgekonferenzen von Vilnius (2000) und Terezín (2009) bestätigt.33 Die Erklärung von Terezín dehnte den Gegenstandsbereich von Kunstwerken auf Kulturgüter aus. Erweitert wurde auch der Begriff des Raubs auf Veräußerungen »unter Zwang«, so die deutsche Übersetzung des englischen Originals in der Schweiz,34 respektive »in einer Zwangslage« in der Übersetzung der Bundesrepublik Deutschland.35 Die Abweichung in der Übersetzung belegt die jeweils nationale Auslegung der historischen Ereignisse im Hinblick auf rückerstattungsrelevante Fragen. Mit Bezug auf Lösungen von Raubkunstfällen führt die moralisch-ethische Selbstverpflichtung der Washingtoner Erklärung immer wieder zu Kritik: zu wenig verbindlich aus Sicht der Opfer und ihrer Erben, eine Aushöhlung rechtlicher Grundsätze aus Sicht der Gegner von gerechten und fairen Lösungen. Auch in der Rezeption der Entscheidung des Kunstmuseums Basel im Fall Curt Glaser (2020) oder der Debatte um die Sammlung Bührle in Zürich finden sich rechtsnormativ argumentierende Stimmen36, die den Rechtsanwalt Florian Schmidt-Gabain zu der Frage veranlassten, ob die Washingtoner Grundsätze und der ihnen zugrundeliegende Gedanke relationaler Gerechtigkeit überhaupt verstanden wurden.37
Die Aussage, dass den Folgen des nationalsozialistischen Raubs nicht mit rechtlichen Mitteln beizukommen sei, findet sich bereits in den Diskussionen um den auf Druck der Alliierten verabschiedeten Raubgutbeschluss des Schweizer Bundesrats vom 10. Dezember 1945. In den Sondierungsgesprächen der Justizkommission mit der Schweizerischen Bankiervereinigung im Juli 1945 wurden Fragen des Eingriffes in die Rechtsordnung im Zusammenhang mit den Bemühungen der Alliierten, Raub- und Beutegut ausfindig zu machen, behandelt. Die Vertreter der Bankiervereinigung erfassten den Interessenkonflikt zwischen dem »Verlierer und dem heutigen gutgläubigen Besitzer« und stimmten in der Einschätzung der Unzulänglichkeit einer rechtsnormativen Handhabung von Raubgutfällen in der Schweiz überein. Der zweite Sekretär der Association suisse des banquiers, Dr. Adolf Jann (1911–1983),38 stellte fest: »Nach schweizerischem Recht ist die Lage klar. Die Lösung des ganzen Fragenkomplexes wird jedoch weniger von der juristischen als vielmehr von der politischen Seite aus erfolgen.«39 Ergänzend dazu schreibt Dr. E.[rich?] Müller: »Wenn wir den Verpflichtungen, welche die Schweiz übernommen hat, nachkommen wollen, müssen wir den Verlierer, wenn wir dem Z.G.B. genügen wollen, den heutigen Besitzer schützen.«40
Einigkeit bestand bezüglich der Gutgläubigkeit bei Erwerbungen auf Schweizer Gebiet. Diskutiert wurden Abgrenzungsfälle wie etwa die Annahme von Bösgläubigkeit bei einer Verbindung zum nationalsozialistischen Deutschland: »Wenn der Importeur der Titel bösgläubig ist, dann können die Stücke vindiziert und dem rechtmässigen Eigentümer zurückgegeben werden. Ist der Importeur dagegen gutgläubig, dann ist er in seinem Besitze zu schützen, und es ergeben sich weitere Schwierigkeiten.«41 Diese Abgrenzung hat in Abwägungen um Raubgutveräußerungen außerhalb des deutschen Herrschaftsgebiets ihre Fortsetzung. Als Beispiel sei an dieser Stelle an die Entscheidung der Beratenden Kommission im Zusammenhang mit der Rückgabe NS-verfolgungsbedingt entzogenen Kulturguts insbesondere aus jüdischem Besitz in Deutschland im Fall der Versteigerung von Gemälden aus der Sammlung von Clara Freund und Julius Freund durch die Galerie Fischer im März 1942 erinnert. Die Beratende Kommission NS-Raubgut begründete ihre Restitutionsempfehlung 2005 mit der existenzbedrohenden wirtschaftlichen Situation von Clara Freund im Exil und mit der Erwerbung eines Gemäldes für das Deutsche Reich.42
Die Washingtoner Erklärung von 1998 resultiert nicht zuletzt aus der Einsicht in die Notwendigkeit, dass in Fällen des Raubs zwei Positionen an ein Kunstwerk herangetragen werden, die Sicht der Opfer des Genozids und ihrer Erben sowie die Sicht der Besitzerin oder des Besitzers in der Gegenwart. Dabei ist jedoch auch zu berücksichtigen, dass die Sicht der Besitzenden von in der Vergangenheit etablierten Narrativen, mit denen Verfolgte ausgeschlossen wurden, und von der Umverteilung von Kunstwerten infolge des nationalsozialistischen Raubs beeinflusst ist, die Sicht der Opfer und ihrer Erben hingegen der Verfolgung und dem damit verbundenen Trauma entspringt. Die Erweiterung der Washingtoner Erklärung um »Best Practices« am 5. März 2024 soll dazu beitragen, diese Positionen in eine Balance zu bringen.
Damit wird deutlich, dass die Frage nach der Provenienz, nach den früheren Besitzverhältnissen und Standorten, in Fällen von Raub, Gewalt und Zerstörung unvermeidlich zu einem Konflikt mit dem tradierten Selbstverständnis der Museen und ihrem Auftrag zum Erhalt des kulturellen Erbes führt. Doch lassen sich Gewinn und Verlust nicht einseitig bestimmen. In den Fallstudien zu Hugo Simon und Curt Glaser in diesem Band werden Mäzene vorgestellt, die Werke aus ihren Sammlungen Museen als Leihgaben überließen oder Fördervereine zur Unterstützung knapper Museumskassen gründeten. Nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten verließen sie Deutschland und lösten ihre Sammlung auf. Doch sind es nicht nur die materiellen Verluste, um die es geht. Glaser und Simon haben Kunst- und Sammlungsgeschichte geschrieben, dafür wurden sie geschätzt, und deswegen waren ihre Sammlungen auch im Ausland attraktiv. Wenn wir Museen und Ausstellungen als gesellschaftliche Räume begreifen, kann es nicht allein darum gehen, »Geschichten hinter den Bildern zu erzählen«, denn die Vermittlung von Kunst und ihrer Geschichte ist per definitionem Teil ihrer Raison d’être.43 Es kommt auch darauf an, die eigene Geschichte in Beziehung zu den plan- und gewaltvoll eliminierten Gestalterinnen und Gestaltern einer Geistes- und Kulturgeschichte zu reflektieren.
Zum Buch
Dieses Buch liefert keine definitiven Antworten zum Umgang mit Raubkunst. Die von Ethnologen, Historikern, Juristen, Kunsthistorikerinnen und Kunsthistorikern verfassten Beiträge markieren vielmehr das heute bestehende gesellschafts-, kultur- und rechtspolitische Problemfeld. Sie sollen den Leserinnen und Lesern Orientierung in den interessengeleiteten Debatten um Raubkunst und Restitution geben und sie in die Lage versetzen, sich eine eigene Meinung zu bilden.
Die Essays sind als Positionen zu verstehen, die Impulse für die Auseinandersetzung mit der Restitutionspraxis in der Geschichte und in der Gegenwart geben sollen. Ihnen sind Fallstudien zu Verfolgten des Nationalsozialismus zur Seite gestellt, die wie Curt Glaser und Hugo Simon Kunstwerke in die Schweiz verbrachten oder wie Jacques Rosenthal mit Geschäftssitz in Zürich kein Bleiberecht erhielten. In Verbindung mit den Essays aus verschiedenen Perspektiven können die Geschichten der Flucht helfen, die Schweiz in ihrer ambivalenten Rolle zu verstehen.
Anmerkungen
1
Lorraine Daston, »Introduction. The Coming into Being of Scientific Objects«, in: dies. (Hg.),
Biographies of Scientific Objects
, The University of Chicago Press, Chicago 2000, S. 1–4, S.2.
2
Hildebrand Gurlitt, Rede anlässlich einer Führung der »Herren von Eisen und Stahl«, 2. März 1956, Bundesarchiv Koblenz, N 1826/65, Bl. 479–487.
3
Hans Aldenhoff, Brief an Hildebrand Gurlitt, 12. August 1947, Bundesarchiv Koblenz, N 1826/178, Bl. 461 f.; Walter Hinrichsen, Brief an Hildebrand Gurlitt, 22. September 1947, ebd., Bl. 458; Hildebrand Gurlitt, Brief an Hans Aldenhoff, 25. August 1947, ebd., Bl. 459 f,; Wiedergutmachungsämter von Berlin, Brief an Helene Gurlitt, 5. Dezember 1966, Bundesarchiv Koblenz, N 1826/172, Bl. 173–175.
4
Die Bleistiftzeichnung
Das Klavierspiel
von Carl Spitzweg wurde am 12. Januar 2021 durch das Kunstmuseum Bern und die Bundesrepublik Deutschland restituiert; vgl.
https://gurlitt.kunstmuseumbern.ch/de/collection/item/154418/
(1.2.2024).
5
Zum Modernekonzept der
documenta I
vgl. Birgit Jooss, »Die Amerikanisierung der documenta. Das Museum of Modern Art in Kassel«, in: Raphael Gross, Lars Bang Larsen, Dorlis Blume, Alexia Pooth, Dorothee Wierling und Julia Voss (Hg.),
documenta. Politik und Kunst
, Ausstellungskatalog, Deutsches Historisches Museum, Berlin, Prestel, München 2021, S. 119–123.
6
Kunsthaus Zürich (Hg.),
Expressionisten, Kubisten, Futuristen. Sammlung Nell Walden und Dr. O. Huber
, Ausstellungskatalog, Zürich 1945; Kunsthalle Bern (Hg.),
Europäische Kunst aus Berner Privatbesitz
, Bern 1953.
7
Eva Reifert und Tessa Friederike Rosebrock (Hg.),
Zerrissene Moderne. Die Basler Ankäufe »entarteter Kunst«
, Ausstellungskatalog, Kunstmuseum Basel, Hatje Cantz, Berlin 2022; Georg Kreis,
Einstehen für »entartete Kunst«. Die Basler Ankäufe von 1939/40
, NZZ Libro, Zürich 2017; Gesa Jeuthe, »Die Moderne unter dem Hammer. Zur ›Verwertung‹ der ›entarteten‹ Kunst durch die Luzerner Galerie Fischer 1939«, in: Uwe Fleckner (Hg.),
Angriff auf die Avantgarde. Kunst und Kunstpolitik im Nationalsozialismus, Schriften der Forschungsstelle »Entartete Kunst«,
Bd. 1, De Gruyter, Berlin 2007, S. 189–305.
8
Hans R. Hahnloser, in: Protokoll der 32. Direktionssitzung, 19. Juni 1939, Kunstmuseum Bern, Archiv, A-001-014-003, Bl. 1–2, Bl. 2.
9
Kunstmuseum Bern (Hg.),
Gemälde und Zeichnungen alter Meister, Kunsthandwerk aus Privatbesitz. Der Sturm – Sammlung Nell Walden aus den Jahren 1912–1920
, Ausstellungskatalog, Der Bund, Bern 1944.
10
Matthias Frehner und Daniel Spanke (Hg.),
Moderne Meister. »Entartete Kunst« im Kunstmuseum Bern
, Ausstellungskatalog, Kunstmuseum Bern 2016, Prestel, München 2016.
11
Gesa Jeuthe Vietzen, »Verfolgte und Verführte. Die Aktion ›Entartete Kunst‹ als propagandistisches Kapital«, in: Nikola Doll, Uwe Fleckner und Gesa Jeuthe Vietzen (Hg.),
Kunst, Konflikt, Kollaboration. Hildebrand Gurlitt und die Moderne, Schriften der Forschungsstelle »Entartete Kunst«,
Bd. 14, De Gruyter, Berlin, Boston 2023, S. 95–122.
12
Zu diesen Themen legte die Unabhängige Expertenkommission Schweiz – Zweiter Weltkrieg (UEK) 2002 den »Bergier-Bericht« vor, der 25 Bände und einen Schlussbericht umfasste. Der erste Band behandelt den
Transfer von Kulturgütern in und über die Schweiz
grundlegend und ist bis heute mit der Studie von Thomas Buomberger
Raubkunst – Kunstraub. Die Schweiz und der Handel mit gestohlenen Kulturgütern zur Zeit des Zweiten Weltkriegs
, Orell Füssli, Zürich 1998, die umfassendste Darstellung zum Kulturgütertransfer der Jahre 1933 bis 1945. Vgl. außerdem dazu Esther Tisa Francini, Anja Heuss und Georg Kreis,
Fluchtgut – Raubgut. Der Transfer von Kulturgütern in und über die Schweiz 1933–1945 und die Frage der Restitution
, Chronos, Zürich 2001.
13
Stücke der Sammlung Emil Delmár gelangten als Schenkungen in die Sammlungen des Metropolitan Museum, New York, des Boston Museum of Fine Arts, Cleveland Museum of Art, Dumbarton Oaks, Washington, D.C. Vgl. Andrea Rózsavölgyi, »20 Years in Emigration. Emil Delmar and His Collection«, in: Anna Tüskés, Áron Tóth und Miklós Székely (Hg.),
Hungary in Context. Studies on Art and Architecture
, CentrArt Association, Budapest 2013, S. 239–252.
14
Unbekannt, Süddeutschland,
Heiliger
[Bischof] (um 1520–1530), Holz, geschnitzt, Kunstmuseum Bern. Die Sammlung Delmár war in der Sonderausstellung
Kunst und Kunstgewerbe
(1939–1940) ausgestellt.
15
Tisa Francini, Heuss und Kreis,
Fluchtgut – Raubgut
2001, insbes. S. 23–28. Zur Kritik an der nationalgeschichtlichen Perspektivierung vgl. Thomas Maissen,
Verweigerte Erinnerung. Nachrichtenlose Vermögen und die Schweizer Weltkriegsdebatte 1989–2004
, Verlag Neue Zürcher Zeitung, Zürich 2005, S. 508. Maissen bewertet die Darstellung des Kunstmarkts als »helvetozentrisch«, da sie »wenig Rückschlüsse auf deren relative Bedeutung im NS-Beutezug erlaubte«.
16
Die Bundesrepublik Deutschland definierte mit Bezug auf die Alliierten Rückerstattungsregeln den Begriff des Raubs 2001 als verfolgungsbedingten Entzug; vgl.
Handreichung zur Umsetzung der »Erklärung der Bundesregierung, der Länder und der kommunalen Spitzenverbände zur Auffindung und zur Rückgabe NS-verfolgungsbedingt entzogenen Kulturgutes, insbesondere aus jüdischem Besitz« vom Dezember 1999
, Februar 2001, S. 22 f. Die »Best Practices« präzisieren den Begriff des Raubs insofern, als unter »Nazi-confiscated« und »Nazi-looted« auch Zwangsverkäufe und Verkäufe unter Zwang fallen (Bestimmung B); vgl. U.S. Department of State, »Best Practices for the Washington Conference Principles on Nazi-Confiscated Art«, 5. März 2024,
www.state.gov/best-practices-for-the-washington-conference-principles-on-nazi-confiscated-art
(Zugriff 24.3.2024). Vgl. auch World Jewish Restitution Organization, »Global Report on Implementation of Art Restitution over past 25 Years finds Significant Progress but many Coutries still lagging«, 5. März 2024,
https://wjro.org.il/best-practices-global-art-report/
(Zugriff 8.3.2024).
17
Gunnar Schnabel und Monika Tatzkow,
Nazi Looted Art. Handbuch Kunstrestitution weltweit
, Proprietas, Berlin 2007, S. 405– 407, Fall 72: Max Silberberg Erben vs. Stiftung Sammlung E. G. Bührle; »Empfehlung der Beratenden Kommission NS-Raubgut in der Sache Erben nach Alfred Flechtheim ./. Stiftung Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen«, 21. März 2016,
www.beratende-kommission.de/de/empfehlungen#s-flechtheim-stiftung-kunstsammlung-nordrhein-westfalen
(Zugriff 1.2.2024).
18
Bénédicte Savoy,
Kunstraub. Napoleons Konfiszierungen in Deutschland und die europäischen Folgen
, Böhlau, Wien, Köln, Weimar 2011, S. 17.
19
Nach Rebekka Habermas beruht das Rettungsparadigma im kolonialen Kontext auf der Vorstellung, dass eine andere Gesellschaft geschwächt und nur durch eine Außenposition zu repräsentieren sei; vgl. Rebekka Habermas, »Rettungsparadigma und Bewahrungsfetischismus: oder was die Restitutionsdebatte mit der europäischen Moderne zu tun hat«, in: Thomas Sandkühler, Annika Epple und Jürgen Zimmerer (Hg.),
Geschichtskultur durch Restitution? Ein Kunst-Historikerstreit
, Böhlau, Wien, Köln, Weimar 2021, S. 79–99.
20
Nikola Doll, »Das Narrativ der Rettung. Von der nationalen Avantgarde zur Klassischen Moderne«, in: dies., Fleckner und Jeuthe Vietzen (Hg.),
Kunst, Konflikt, Kollaboration
, S. 207–235.
21
Georg Schmidt, »Ansprache gehalten bei Anlass der Eröffnung der Ausstellung Basler Künstler des 19. und 20. Jahrhunderts aus den Sammlungen des Kunstvereins und der Kunstsammlung und die Neuerwerbungen des Jahres 1939, 19. November 1939«, Privatdruck, Basel 1940, S. 11, 14.
22
Georg Schmidt, Brief an Paul Westheim, 15. Juli 1939, Kunstmuseum Basel, Archiv, Reg 36/4/1 (1), Entartete Kunst IIb, Bl. 77–81, hier Bl. 81.
23
Eva Reifert, »Ein neues Museumsgebäude und eine Weichenstellung für die Sammlung«, in: dies. und Rosebrock (Hg.),
Zerrissene Moderne
, S. 13–18; Kreis,
Einstehen für »entartete Kunst«,
2017, S. 108–136.
24
Zu den Einziehungen von Kunstwerken aus der Sammlung Sachs infolge der Emigration in die Schweiz vgl. Marius Winzeler, »Jüdische Sammler und Mäzene in Breslau. Von der Donation zur Verwertung ihres Kunstbesitzes«, in: Koordinierungsstelle für Kulturgutverluste Magdeburg (Hg.),
Sammeln, Stiften, Fördern
, Magdeburg 2008, S. 131–156, insbes. S. 140–141; Monika Tatzkow und Hans-Joachim Hinz, »Bürger, Opfer und die historische Gerechtigkeit. Das Schicksal jüdischer Kunstsammler in Breslau«, in:
Osteuropa
, Januar/Februar 2006, Bd. 56, Nr. 1/2, S. 155–171,
www.jstor.org/stable/4493297
(Zugriff 12.12.2023); Monika Tatzkow, »Es schwimmen aber ja im Kunsthandel eine Menge Arbeiten […] herum aus den Sammlungen ausgewiesener oder geflohener Leute«, in: Peter Mosimann und Beat Schönenberger,
Fluchtgut – Geschichte,
Recht und Moral. Referate zur gleichnamigen Veranstaltung des Museums Oskar Reinhart in Winterthur vom 28. August 2014
, Stämpfli, Bern 2015, S. 37–51; zu den Verkäufen von Carl Sachs in der Schweiz vgl. Tessa Friederike Rosebrock, »›und wird mir der in der Schweiz befindliche Kunstbesitz genommen, bin ich völlig mittellos.‹ Die Sammlung Carl Sachs in Zürich, Basel und Luzern«, in:
transfer. Zeitschrift für Provenienzforschung und Sammlungsgeschichte / Journal for Provenance Research and the History of Collection
, 2 (2023), DOI:
https://doi.org/10.48640/tf.2023.1.101802
, S. 74–89.
25
Die Annahme, der Angriff habe Kulturgut und nicht Menschen betroffen, findet sich auch in der
Erklärung der Kunstmuseen in der Schweiz
von 1998. In § 5 wird auf den Beitrag der schweizerischen Museen zur Bewahrung von »Kulturgut aus jüdischem Besitz vor dem Angriff der Nationalsozialisten« hingewiesen; vgl. »Erklärung der unterzeichnenden Kunstmuseen der Schweiz in bezug auf Kulturgüter, die während der nationalsozialistischen Herrschaft und des Zweiten Weltkriegs geraubt wurden«, November 1998, Kunstmuseum Bern, Dokumentation.
26
Bénédicte Savoy, Felicity Bodenstein und Merten Lagatz (Hg.),
Translocations. Histories of Dislocated Cultural Assets
, transcript, Bielefeld 2023.
27
François Daulte,
Alfred Sisley. Catalogue raisonné de l’œuvre peint
, Éditions Durand-Ruel, Lausanne 1956, Nr. 321.
28
Paul Ortwin Rave,
Kunstdiktatur im Dritten Reich
, Gebr. Mann, Hamburg 1949.
29
Ulrike Wendland,
Biographisches Handbuch deutschsprachiger Kunsthistoriker im Exil. Leben und Werk der unter dem Nationalsozialismus verfolgten und vertriebenen Wissenschaftler
, Teil 2:
L–Z
, Saur, München 1999.
30
Franz Roh, Brief an Paul Ortwin Rave, 10. Juli 1949, Staatliche Museen Berlin, Zentralarchiv, SMB-ZA, IV/NL Paul Ortwin Rave, 97, o. S., Vgl. Franz Roh,
Entartete Kunst. Kunstbarbarei im Dritten Reich
, Fackelträger, Hannover 1962.
31
Vgl. Maissen,
Verweigerte Erinnerung
, 2005, S. 497, 530 f., 566.
32
»Erklärung der unterzeichnenden Kunstmuseen der Schweiz in bezug auf Kulturgüter, die während der nationalsozialistischen Herrschaft und des Zweiten Weltkriegs geraubt wurden«, Entwurf, November 1998, Kunstmuseum Bern, Dokumentation.
33
Vgl.
Vilnius Forum Declaration
, 5. Oktober 2000,
www.lootedart.com/MFV7EE39608
(Zugriff 1.2.2024);
Terezín Declaration
, 30. Juni 2009,
www.lootedart.com/web_images/pdf2018/1.1.2%20TEREZIN_DECLARATION_FINAL.pdf
(Zugriff 1.2.2024).
34
Terezín Declaration
, 30. Juni 2009, Kapitel »Terezin Declaration on Holocaust Era Assets and Related Issues«, Ziffer 2,
www.lootedart.com/web_images/pdf2018/1.1.2%20TEREZIN_DECLARATION_FINAL.pdf
(Zugriff 1.2.2024); vgl. für den deutschen Text Bundesamt für Kultur,
Erklärung von Terezín
(2009):
www.bak.admin.ch/dam/bak/de/dokumente/raubkunst/publikationen/erklaerung-von-terezin-2009.pdf.download.pdf/Erkl%C3%A4rung%20von%20Terezin_2009.pdf
(Zugriff 1.2.2024).
35
Vgl. »Theresienstädter Erklärung, 30. Juni 2009«, zit. n. Stiftung Deutsches Zentrum Kulturgutverluste. Bei einer Aktualisierung der Website wurde der Text entfernt.
36
Vgl. etwa Brigitta Hauser-Schäublin, »Es zählt allein das Argument der Moral«, in:
Neue Zürcher Zeitung
, 16. November 2020.
37
Florian Schmidt-Gabain, »Die Schweiz braucht eine unabhängige Kommission, die sich Streitfällen um potenzielle Raubkunst annimmt«, in:
St. Galler Tagblatt
, 19. November 2021.
38
Adolf Walter Jann war von 1937 bis 1945 zweiter Sekretär der Associations suisse des Banquiers; 1945 bis 1948 Vizedirektor der UBS Zürich; vgl. Adolf Walter Jann,
Élites suisses. Base de données des élites suisses
,
www2.unil.ch/elitessuisses/personne.php?id=50919
(Zugriff 1.2.2024).
39
Dr. Adolf Walter Jann, in: Protokoll über Sitzung der Juristischen Kommission, 13. Juli 1945, Schweizerisches Bundesarchiv (Hg.),
Quellendokumentation Raubgut. Maßnahmen der Bundesbehörden im Umgang mit geraubten Vermögenswerten 1945–1946
, Bern 1998, Bl. 80–90, hier Bl. 87.
40
Dr. E.[rich] Müller, ebd., Bl. 87.
41
Ders., ebd., Bl. 90.
42
Vgl. Beratende Kommission im Zusammenhang mit der Rückgabe NS-verfolgungsbedingt entzogenen Kulturguts, »Empfehlung in der Sache Erben nach Julius und Clara Freund ./. Bundesrepublik Deutschland«, 5. Januar 2005,
www.beratende-kommission.de/de/empfehlungen#s-freund-bundesrepublik-deutschland
(Zugriff 1.2.2024); Gunnar Schnabel und Monika Tatzkow,
Nazi Looted Art. Handbuch Kunstrestitution weltweit
, S. 456–459.
43
Lea Haller, »Die Kunst entkommt der Geschichte nicht«, in:
Neue Zürcher Zeitung Magazin
, 16. Februar 2022,
www.nzz.ch/geschichte/sammlung-buehrle-ohne-geschichte-gaebe-es-keine-kunst-ld.1815880
(Zugriff 1.2.2024).
Fallstudie von Franziska Eschenbach
Die Antiquare Rosenthal und das verweigerte Exil in der Schweiz
Das 1895 von Jacques Rosenthal (1854–1937) in München gegründete Antiquariat zählte seit Beginn des 20. Jahrhunderts zu den bedeutendsten Deutschlands. Das prachtvolle Wohn- und Geschäftshaus in der Brienner Straße, 1911 erbaut, war in seiner Größe und Ausstattung wohl nur mit dem Antiquariat von Joseph Baer in Frankfurt am Main vergleichbar.1 Die Geschichte der Familie Rosenthal wie die Geschichte ihrer Geschäfte ist durch die antisemitische Politik der Nationalsozialisten massiv beeinflusst worden. Mit dem Verkauf des Münchner Geschäfts im Dezember 1935, dem Verlust des privaten Wohnhauses und der Emigration des Sohnes und Juniorchefs Dr. Erwin Rosenthal (1889–1981) nach Florenz ging auch der Verlust der Kunstsammlung der Familie einher. Als früher Beleg für die Sammlung Rosenthal gilt der von Erwin Rosenthal in kleiner Auflage publizierte Sammlungskatalog aus dem Jahr 1914, der 25 Gemälde, Globen und Pastellarbeiten aus der Sammlung seines Vaters Jacques präsentiert.2
Ein Großteil der Werke gelangte ab 1936 über die Kunsthandlung Julius Böhler und das Auktionshaus von Adolf Weinmüller in den Münchner Kunsthandel. Weitere Werke aus der Sammlung wurden 1941 und 1942 durch den Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg aus der Pariser Wohnung von Erwin Rosenthal geraubt. Jüngste Recherchen im Zuge des Forschungsprojekts zur Rekonstruktion der Sammlung von Jacques und Emma Rosenthal (1857–1941) legten offen, dass neben Deutschland, Italien und Frankreich auch die Schweiz eine bedeutende Rolle als Geschäftssitz, Exilort und Lagerstätte für die Rosenthals hatte.
Erwin Rosenthal baute sich durch eine 1920 in Lugano gegründete Dependance des Antiquariats ein geschäftliches Netzwerk in der Schweiz auf. Dieses nutzte er auch für den Verkauf von Werken seiner privaten Kunstsammlung. Seit kurzem ist bekannt, dass Teile der Sammlung in die Schweiz verlagert, einzelne Werke im Kunstmuseum Luzern deponiert und weitere dem Kunstmuseum Zürich zum Kauf angeboten wurden. Durch die Zusammenführung von Quellen in Schweizer Museen und den Nachlassunterlagen der Familie Rosenthal kann der Weg in die Emigration und der verfolgungsbedingte Verlust der Kunstsammlung genauer nachverfolgt werden.
Das Antiquariat Jacques Rosenthal
Jakob, genannt Jacques, Rosenthal (1854–1937) entstammt einer Familie von Antiquaren: Bereits sein Vater Joseph Rosenthal (1805–1885) handelte in Fellheim mit antiquarischen Büchern und Kunstgegenständen. Das erste Ladengeschäft war 1859 von dem ältesten Sohn Ludwig Rosenthal (1840–1928) gegründet worden. Die jüngeren Brüder Nathan Rosenthal (1849–1921) und Jacques Rosenthal arbeiteten dort zunächst mit, bis sie 1895 eigene Geschäfte in München eröffneten.3 Jacques Rosenthal konnte für die Geschäftsgründung seines Antiquariats in der Karlstraße 10 auf einen Teil des gemeinsamen Warenbestandes von mehr als einer Million Bücher, Handschriften und Grafiken zurückgreifen. Er spezialisierte sich auf mittelalterliche Handschriften und Werke aus der Frühzeit des Buchdrucks. Bis 1934 erschienen 95 Kataloge, die auch in Expertenkreisen als wissenschaftliche Hilfsmittel dienten. Geschäftlicher Erfolg und gesellschaftliche Anerkennung des Antiquars lassen sich nicht nur in dem 1911 errichteten Wohn- und Geschäftshaus in der Brienner Straße in unmittelbarer Nähe zu den Kunsthandlungen von Julius Böhler, Lehmann Bernheimer, Aaron Siegfried Drey und David Heinemann ablesen, sondern auch an den Ehrentiteln des »Königlich Bayerischen« und des »Preussischen Hofantiquars«.4
Antiquariat Jacques Rosenthal, Wohn- und Geschäftshaus in der Brienner Straße 47 (heute 26), München, 1915.
Unbekannter Fotograf, Stadtarchiv München, FS-PK-Str-00231.
Nach einem Studium der Kunstgeschichte in München, Halle an der Saale und Berlin und der 1912 abgeschlossenen Promotion über »Die Anfänge der Holzschnitt-Illustration in Ulm« trat Erwin Rosenthal in das väterliche Geschäft ein. Im selben Jahr heiratete er Margherita Olschki (1892–1979), die Tochter des Florentiner Buchantiquars und Verlegers Leo S. Olschki (1861–1940), und verband damit zwei führende europäische Antiquariatsfamilien.5 Das Paar wohnte in den ersten Jahren in der Wohnung im Elternhaus in der Brienner Straße 47. Im Jahr 1926 zogen Erwin und Margherita Rosenthal mit ihren fünf Kindern in die ehemalige »Rosipal-Villa« in der Königinstraße 28 am Englischen Garten.6
Jacques Rosenthal mit seinem Sohn Erwin und den Enkeln Albrecht und Felix Rosenthal, 1918/19.
Unbekannter Fotograf, Stadtarchiv München, NL-ROS-0472-41.
Emma Rosenthal, geb. Guggenheimer, mit ihrer Schwiegertochter, Margherita Rosenthal, geb. Olschki, und den Enkelinnen Gabriella und Nicoletta Rosenthal, 1918/19.
Unbekannter Fotograf, Stadtarchiv München, NL-ROS-0472-43.
1920 eröffnete er eine Kunstgalerie in der Bendlerstraße 17 (heute Stauffenbergstraße) in Berlin, die zunächst von dem Kunsthistoriker und früheren Kommilitonen Karl Schwarz (1885–1962) geführt wurde, der 1933 das Jüdische Museum in Berlin gründen sollte.7 Zu den bedeutendsten Ereignissen der Galerie gehörte die Ausstellung der Zeichnungen und Aquarelle von Lovis Corinth im Herbst 1922.8 Bereits 1925 wurde die Galerie liquidiert und der Bestand an Gemälden, Zeichnungen und druckgrafischen Blättern dem Münchner Stammhaus zugeführt.9
Die Galerie L’Art Ancien in Lugano und Zürich
Zeitgleich sondierte Erwin Rosenthal die Geschäftsmöglichkeiten in der Schweiz. In Folge der wirtschaftlichen Sanktionen nach dem Ersten Weltkrieg waren Exporte aus Deutschland insbesondere nach Frankreich und England stark reguliert. Im internationalen Kunst- und Antiquariatshandel waren Paris und London jedoch wichtige Geschäftszentren. Eine Niederlassung in der Schweiz bot deutschen Händlern die Möglichkeit, den eingeschränkten Wirtschaftsverkehr in Deutschland und die Exportbeschränkungen zu umgehen. Besonders der Schweizer Antiquariatshandel erfuhr – gemäß dem Verbund der Buchantiquare und Kupferstichhändler in der Schweiz – ab 1919 durch zahlreiche Neugründungen eine große Belebung. Erwähnt seien die Gründungen der Galerie Gutekunst & Klipstein 1919 in Bern, der Dependance des Wiener Antiquariats Gilhofer und Ranschburg 1924 in Luzern sowie des Antiquariats von August Laube 1922 in Zürich.10
Die Schweizer Behörden beobachteten die steigende Zahl von Firmengründungen von Ausländern kritisch. Bereits im Juli 1919 hielt der Bundesrat fest: »Die Zahl der auf Schweizerboden neu entstehenden Aktiengesellschaften, die mit der Schweiz in der Hauptsache nur durch den Sitz verbunden sind und effektiv einem fremden Wirtschaftsgebiete angehören, wächst von Jahr zu Jahr. Damit nimmt auch die wirtschaftliche Überfremdung zu, unter der die Schweiz leidet.«11 Um dieser »wirtschaftlichen Überfremdung« entgegenzuwirken, modifizierte die Schweiz 1919 das Aktienrecht. Fortan musste die Mehrheit der Verwaltungsräte von Aktiengesellschaften in der Schweiz wohnhaft und von Schweizer Nationalität sein.12
In seinen Erinnerungen schilderte Erwin Rosenthal die Hintergründe, die 1920 zur Gründung des Antiquariats L’Art Ancien in Lugano führten: »Die Schwerpunkte unserer Firma waren immer schon Paris und London. Sie mussten es wieder werden. Die Wege hierzu waren jedoch vielfach versperrt. Ja, England ging so weit, gewisse Beziehungen zu verbieten. Wir suchten nach einer Zwischenlösung. Als die beste erkannte ich die Schweiz. Diese aber hatte strenge Gesetze ausgearbeitet, die eine fremde Niederlassung fast unmöglich machten. Ich versuchte daher, einen in der Schweiz ansässigen Kollegen zu finden, der ein Antiquariat gründen durfte und möglichst nicht in Zürich, das zu erobern ausgeschlossen war.«13
Die für die Firmengründung notwendige Unterstützung erhielt Rosenthal von dem polnischen Baron Kurd von Hardt (1889–1958), der seit 1919 eine Niederlassungsbewilligung besaß. In der Rolle des possidente, presidente et consigliere delegato eröffnete Kurd von Hardt im März 1920 die Aktiengesellschaft L’Art Ancien. Libraire & Maison d’Antiquité, die neben Manuskripten, Inkunabeln und Druckwerken auch Gemälde anbot.14 Erwin Rosenthal tauchte dagegen namentlich nur als Teilhaber im Handelsregister auf.15 Nach dem Ausscheiden von Hardt 1923, wurde Erwin Rosenthal offiziell Inhaber der Aktiengesellschaft. Vorsitzender des Verwaltungsrats war dagegen Ugo Schmidli.16 1929 wurde das Antiquariat nach Zürich verlegt, wo es bis zu seiner Liquidation 1987 seinen Geschäftssitz behielt.17
Erwin Rosenthal trat als Geschäftsführer von L’Art Ancien nicht öffentlich in Erscheinung. Von 1921 bis zu seinem Ausscheiden 1937/38 leitete Arthur Spaeth (†1944) das Geschäft.18 1929 trat der aus Wien stammende Buchhändler Alfred Frauendorfer (1809–1971) in das Antiquariat ein und übernahm nach eigenen Angaben spätestens 1941 die Leitung, die er bis zu seinem Tod 1971 innehatte.19 Danach führte Erwin Rosenthals Sohn Felix (1917–2009) das Antiquariat bis zur Liquidierung im Jahr 1987. Da die Geschäftsbücher nicht erhalten sind, können keine präzisen Aussagen über die wirtschaftliche Entwicklung der Schweizer Filiale getroffen werden.20 Die regelmäßige Veröffentlichung von Verkaufskatalogen setzte 1931 ein.21 Sie belegen den Handel mit naturwissenschaftlichen und medizinischen Schriften unter Arthur Spaeth, dokumentieren aber auch, wie sich L’Art Ancien unter Alfred Frauendorfer ab den fünfziger Jahren zu einem Umschlagplatz für Grafik und Zeichnungen des 20. Jahrhunderts entwickelte, was die Kataloge zu den grafischen Werken von Max Pechstein, Lovis Corinth und Ludwig Kirchner zeigen.22
Entwicklung des Münchner Stammhauses unter dem Einfluss der Weltwirtschaftskrise und der Machtergreifung der NSDAP
Der Ausbruch der Weltwirtschaftskrise im Oktober 1929 traf das Antiquariat Jacques Rosenthal schwer. Da es einen Großteil seines Umsatzes durch das Auslandsgeschäft bestritt, führte der eingebrochene Absatzmarkt in Amerika zu herben Verlusten. Die Sorgen sind in einem Memorandum von Erwin Rosenthal spürbar: »Es ist bis zur Stunde unübersehbar, wie sich auf weiter hinaus die Wirtschaftskatastrophe der Vereinigten Staaten innerhalb unseres Handelszweiges auswirken wird.«23 Zudem hatte Jacques Rosenthal im ersten Halbjahr 1929 für den Ankauf von zwei hochkarätigen Handschriften, die an die französische Bibliothèque Nationale und die Zentralbibliothek Zürich weiterverkauft werden sollten, einen Kredit in Höhe von 200’000 Reichsmark aufgenommen. Die beiden Bibliotheken sprangen jedoch vor dem Verkaufsabschluss ab, sodass die Handschriften mit Verlusten verkauft werden mussten, um den Kredit zu bedienen.24
Die Folgen der Weltwirtschaftskrise sollten für den Münchner Antiquariatsbuchhandel ab 1931 besonders spürbar werden.25 Das zeigt sich an den Umsätzen des Antiquariats Jacques Rosenthal. Während die Inlandsumsätze 1928 noch 125’786 Reichsmark betrugen, sanken sie 1931 auf 44’363 Reichsmark. Im Jahr 1934 belief sich der Umsatz bei Inlandsverkäufen nur noch auf 25’144 Reichsmark, knapp einem Fünftel der Inlandsumsätze von 1928. Wieweit die Boykottaufrufe des Frühjahrs 1933 für diesen Rückgang ursächlich waren, konnte bisher nicht ermittelt werden. Das Auslandsgeschäft, das die Inlandsumsätze stets um ein Vielfaches übertroffen hatte, brach völlig ein. Während 1928 noch 690’865 Reichsmark durch Auslandsverkäufe erzielt wurden, reduzierte sich der Umsatz 1931 auf 290’692 Reichsmark. 1934, ein Jahr nach dem nationalsozialistischen Regierungsantritt, konnten nur noch 34’865 Reichsmark durch Auslandsgeschäfte eingenommen werden. Dies entspricht einem Einbruch des Auslandsgeschäfts im Zeitraum von 1928 bis 1934 von 95 Prozent.26 Die Zahlen veranschaulichen eine sukzessive Verschlechterung der wirtschaftlichen Situation des Antiquariats ab 1929, die durch den Regierungsantritt der NSDAP am 30. Januar 1933 und die folgende antisemitische Rassenpolitik wesentlich verstärkt wurde.
Bereits am 1. April 1933 hatte das Regime zum Boykott jüdischer Gewerbetreibender aufgerufen. Das Antiquariat Jacques Rosenthal eröffnete an diesem Tag die Ausstellung mittelalterlicher Handschriften aus der Sammlung von Alfred Chester Beatty (1875–1968). Am Eingang postierten sich SA-Wachen und verwehrten den Besuchern den Eintritt, sodass ein Zugang zur Ausstellung nur über den Hinterhof möglich war.27
Besorgt über den Geschäftseinbruch, wandte sich Jacques Rosenthal im August 1933 an seinen Sohn: »Geschäftlich gibt es immer weniger zu berichten, denn es wird immer stiller und flauer, trotz der Haupt-Fremdensaison. Wir spüren eben doch den Boycott, der gegen die jüdischen Geschäfte immer weiter geht. Wie wir da unseren Verpflichtungen gegen Staat und Stadt nachkommen sollen und wie wir die Gehälter für unser Personal auftreiben können, ist äusserst schwer zu sagen.«28
Angesichts der finanziellen Schwierigkeiten wurde bereits zu diesem Zeitpunkt der Verkauf des Hauses in der Brienner Straße in Erwägung gezogen, wie ein Brief von Erwin Rosenthal an seinen Vater im September 1933 belegt: »Merkwürdigerweise sind alle Leute, die mir noch vor Monaten den Hausbesitz zu erhalten geraten haben, vielmehr heute dafür, dass man eine Verkaufsgelegenheit nutzen soll. Die endgiltige Verbriefung der Arcisstrasse wird Anfang der nächsten Woche vor sich gehen. […] Ich kann letzterhand, selbst wenn die Summe eine günstige wäre, immer noch nein sagen.«29
Erwin Rosenthal beobachtete die Grundstücksverkäufe in der Nachbarschaft offenbar genau. Womöglich bezieht sich sein Schreiben auf den Verkauf des Pringsheim Palais in der Arcisstraße 12, das im August 1933 unter Druck von Alfred (1850–1941) und Hedwig Pringsheim (1855–1942) an die NSDAP verkauft wurde. Die Partei wollte das Gelände in ein Parteiviertel umwandeln und auf dem Grundstück den Verwaltungsbau errichten.30
Noch im Sommer 1934 sprach sich Jacques Rosenthal gegen einen Verkauf des Hauses aus; er hoffte, durch den Verkauf von Teilen seiner Kunstsammlung die Bankschulden begleichen zu können.31 So bot man im Sommer 1934 ein kleinformatiges Renaissancegemälde, das damals Vittorio Crivelli zugeschrieben wurde und 1931 auf einen Wert von 40’000 Reichsmark geschätzt wurde, der Münchner Kunsthandlung Julius Böhler zum Verkauf an.32 Im November 1935 nahm die Schweizer Dependance Böhlers, die Kunsthandel AG Luzern, das Gemälde in Kommission. Ein Verkauf kam jedoch nicht zustande, und das Gemälde wurde im Dezember 1936 an Rosenthal zurückgegeben.33 Ähnlich verhielt es sich mit einer Terrakottabüste aus dem 15. Jahrhundert, die erfolglos bei der Kunsthandlung Mensing & Fils in Amsterdam ausgestellt worden war und im Oktober 1934 an die Galerie von Robert Frank nach London spediert wurde.34 Auch auf dem Londoner Markt konnte die Büste nicht verkauft werden. Letztlich muss die Terrakottabüste wieder nach München zurückgekehrt sein, denn Böhler nimmt sie im Januar 1936 mit weiteren 24 Objekten in Kommission.35
Vor dem Hintergrund solcher Verkaufsabsichten wurde die Beziehung zu dem Schweizer Kunsthistoriker Dr. Walter Hugelshofer (1899–1987) wichtig, der 1933 als Direktor des Kunstmuseums Luzern antrat. Jacques Rosenthal bewilligte bereits im Sommer 1933, Gemälde aus seiner Kunstsammlung für eine Eröffnungsausstellung nach Luzern zu überführen, sofern zuvor Preise für die Werke festgesetzt würden.36 Im August 1933 wurden sieben Gemälde von München nach Luzern an das Kunstmuseum geschickt.37 Anhand des Depositenbuchs des Kunstmuseums Luzern konnten diese Werke erstmals identifiziert werden.38
Zur Bedeutung von Leihgaben im Kunstmuseum Luzern ab 1933
Die Eröffnungsausstellung des Kunstmuseums Luzern nimmt eine Schlüsselrolle für Leihgaben jüdischer Sammler aus Deutschland an Schweizer Museen ein.39 Von Dezember 1933 bis März 1934 kamen neben Werken aus der Sammlung von Jacques und Emma Rosenthal weitere Leihgaben aus deutschen Sammlungen, deren Eigentümer das nationalsozialistische Regime als Juden verfolgte, in die Ausstellung. Die mit 38 Stück umfassendste Leihgabe kam vom Berliner Kaufmannsehepaar Robert (1875–1937) und Ilse Neumann (1887–1940);40 mindestens fünfzehn Werke umfasste die Leihgabe des Berliner Kaufmanns Julius Freund (1869–1941);41 jeweils ein wertvolles Gemälde von Lovis Corinth, Camille Pissaro und Paul Gauguin lieferte Frau Hedwig Fischer aus Berlin ein;42 weitere siebzehn Werke gehörten dem Berliner Justizrat Max Loebinger.43 Es ist auffällig, dass die Namen der deutschen Leihgeber im Unterschied zu Schweizer Institutionen, Kunsthändlern und Sammlern im Ausstellungskatalog nicht genannt werden.44
Die Eröffnungsausstellung des Kunstmuseums Luzern war umstritten. Der Museumskonservator Dr. Paul Hilber (1890–1949) monierte die fehlende thematische Eingrenzung und ebenso, dass viele Objekte zwar im Katalog genannt, aber aus Platzgründen nicht präsentiert würden, sowie den Verkaufscharakter. »Übrigens weiss der Eingeweihte gut genug, wo die stillen Absichten dieser vielen Leihgaben liegen. Ich kenne verschiedene Leihgeber, die deutlich gewillt sind, die hier ausgestellten Werke abzustoßen. Das braucht ja im Katalog gar nicht gesagt zu werden, der richtige Interessent findet den Weg schon von aussen herum.«45
Die Kritik Hilbers an Hugelshofers Verkaufsabsichten und seiner Leihgabenpraxis führten schließlich dazu, dass dieser sich zunehmend aus dem Ausstellungswesen des Kunstmuseums Luzern zurückzog.46 Doch gerade das enge Netzwerk an Geschäftsbeziehungen und die Möglichkeit der »Verwertung« der Leihgaben waren vermutlich ausschlaggebend für Jacques Rosenthal gewesen. Die Hoffnung, die deponierten Werke von Luzern aus besser verkaufen zu können, waren wohl der Grund, dass die Leihgaben nach Ausstellungsende nicht nach München zurückkehrten.
So bittet Jacques Rosenthal im März 1935 seinen Sohn, Fotografien der Luzerner Objekte zu schicken, da er die Gelegenheit habe, sie dem amerikanischen »Zeitungskönig« und passionierten Kunstsammler William Randolph Hearst (1863–1951) anzubieten.47 Erst Mitte November 1937, wenige Wochen nach seinem Tod am 5. Oktober 1937, wurden die Werke aus dem Depositenbuch des Kunstmuseums Luzern ausgetragen.48 Nach bisherigem Kenntnisstand wurden fünf der sieben Leihgaben bis 1940 von dem aus München emigrierten Kunsthändler Francis (Franz) Drey (1886–1952) in London zum Verkauf angeboten.49
Hausverkauf, Berufsverbot im Deutschen Reich, Orientierung in die Schweiz
Nachdem der Verkauf von Teilen der Kunstsammlung nicht den angestrebten finanziellen Spielraum schaffte und auch der Geschäftsumsatz nicht gesteigert werden konnte, schien der Verkauf der Münchner Immobilie unausweichlich zu sein. Im Januar 1935 stellte Jacques Rosenthal fest: »Das Geschäft ist leider furchtbar gering, während die Ausgaben ins Ungemessene wachsen.«50 Bereits im Mai 1934 hatte er das Antiquariat in eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung umgewandelt, um die Immobilie dem Geschäftskapital zu entziehen.51
Im März 1935 konnte ein Kaufvertrag für das Gebäude mit der Witwen- und Waisenkasse aufgesetzt werden, dessen endgültiger Abschluss aber scheiterte. Vielmehr setzte sich die Deutsche Arbeitsfront (DAF) im Juli 1935 als Käuferin durch.52 Im selben Monat musste auch ein befreundeter jüdischer Kunsthändler sein Haus verkaufen, wie Jacques Rosenthal berichtet: »In aller Kürze möchte ich dir mitteilen, dass G. R. Drey [Geheimrat Siegfried Drey (1859–1936)] sein Haus am Maximiliansplatz an die Handelskammer verkauft hat und sehr froh darüber ist, da er Geld bekommt und seine lästigen und teuren Geschäftsschulden bei seiner Bank tilgen kann.«53 Während der Kaufvertrag mit der Witwen- und Waisenkasse noch Jacques und Emma Rosenthal zugestand, die Wohnung im dritten Stock bis September 1936 als Mieter nutzen zu dürfen, musste man nun nicht nur die Geschäftsräume des Antiquariats, sondern auch die Privaträume verlassen.54 Wesentlich bescheidenere neue Geschäftsräume fanden sich nach überstürzter Suche in der Konradstraße 16. Das Ehepaar Rosenthal lebte ab September 1935 im Palast Hotel Regina am Maximiliansplatz in München.
Wenige Wochen nach dem Verlassen des Wohn- und Geschäftshauses in der Brienner Straße erhielt Erwin Rosenthal, wie mehr als vierzig weitere jüdische Gewerbetreibende in München, das Rundschreiben des Präsidenten der Reichskammer der bildenden Künste vom 29. August 1935, mit dem ihm die Mitgliedschaft in der Reichskammer verwehrt wurde.55 Erwin Rosenthal besitze demnach nicht die »erforderliche Eignung und Zuverlässigkeit«, an der »Förderung deutscher Kultur in Verantwortung gegenüber Volk und Reich mitzuwirken«. Mit demselben Schreiben wurden die Adressaten zur »Auflösung und Umgruppierung«, mithin der Liquidierung des Geschäfts innerhalb von vier Wochen, aufgefordert. Das Rundschreiben ist ein früher Beleg dafür, dass die jüdischen Kunsthändlerinnen und Kunsthändler in München bereits vor der systematischen »Arisierung« jüdischer Unternehmen, die spätestens 1937 einsetzte, aus dem Wirtschaftsleben verdrängt wurden.56
Wenige Tage nach Erhalt des Schreibens erhob Erwin Rosenthal Einspruch gegen diese Anordnung. Er führte neben den Auslandsumsätzen, deren Devisengewinne nicht zuletzt für die deutsche Wirtschaft förderlich seien, auch den umfangreichen Geschäftsbestand an: »Eine Auflösung innerhalb von vier Wochen würde bedeuten, dass ich meinen Lagerbestand von etwa 500’000 Bänden, darunter etwa 4000 Drucke des 15. Jahrhunderts und Hunderte von mittelalterlichen Manuskripten einfach verschleudern muss.«57 Da das Antiquariat jahrelang zu den umsatzstärksten Geschäften des Münchner Kunsthandels gezählt hatte, wurde die Frist für die sofortige Liquidation erst einmal auf unbestimmte Zeit verschoben. Dies brachte Erwin Rosenthal jedoch keine Sicherheit für seine geschäftliche Existenz, wie aus einem Memorandum, das er vermutlich zum Jahresende 1935 verfasste, hervorgeht:
Auf eine kurze Darlegung unserer Situation hin wurde dem Geschäftsführer ein neuer Bescheid zuteil, wonach der Vollzug der Verfügung von 29. August ausgesetzt und Nachprüfung der Angelegenheit zugesagt wurde. Dieses Schreiben enthält nur einen schwachen Trost. Im Grunde verschärft es beinahe die Situation: Denn nun schwebt zwar das Damaskusschwert [sic] der Liquidation wie bisher, und dazu ist der Zustand vollkommener Unsicherheit getreten. Klar gesagt: Man weiß nun überhaupt nicht, wann der eventuelle Termin, welcher die Liquidation endgültig macht, gesetzt wird. Aus dieser absoluten Unsicherheit heraus, welche ein gesundes, zielsicheres Arbeiten nie und nimmermehr gewährleistet, kann zumindest nur eine einzige Folgerung gezogen werden: die sofortige Einleitung der Liquidation.58
Ab Herbst 1935 organisierte Erwin Rosenthal den Versand von Büchern, Handschriften, Gemälden, Globen und Zeichnungen ins Ausland. Im Oktober 1935 wurden mehr als 250 Bücher und Musikalien an das Antiquariat von Paul Braus-Riggenbach in Basel spediert.59 Im Januar 1936 folgte der Versand von Handschriften, Miniaturen und Einblattdrucken im Wert von 16’000 Reichsmark an Leo S. Olschki (1861–1940) in Genf, den Schwiegervater Erwin Rosenthals.60 Die Privatbibliothek Erwin Rosenthals gelangte mit Unterstützung von Hans Koch nach Zürich, wo sie laut dem Bericht der Unabhängigen Expertenkommission Schweiz – Zweiter Weltkrieg (UEK) 1939 durch das Antiquariat Gilhofer und Ranschburg verkauft wurde.61 Erwin Rosenthal verfolgte damit nicht nur die Absicht, Objekte in Sicherheit zu bringen, sondern auch die strengen Ausfuhrbestimmungen des Deutschen Reichs zu umgehen. Ein Brief Rosenthals an seinen Mitarbeiter Ludwig Nussbaum deutet die Rolle der Schweiz als gleichsam neutralisierender Zwischenmarkt an: »Der Blaeu ist wie ich sehe, offenbar nach Mailand und nicht nach Zürich an Hoepli geschickt worden. Wieso das? Da wird es ungeheure Zollschwierigkeiten geben. Man kann nach Frankreich und Italien kaum mehr direkte Sendungen schicken. […] Die Leute wollen, dass möglichst alle Sendungen durch schweizerische Kommissionäre laufen.«62
Infolge des Berufsverbots wurde das Antiquariat Rosenthal am 28. Dezember 1935 an den Mitarbeiter Hans Koch verkauft. Im Herbst 1935 hatte Erwin Rosenthal dafür die Geschäftsanteile seines Vaters übernommen und konnte nun als alleiniger Geschäftsführer über das Unternehmen verfügen. Der Kaufvertrag wurde von beiden Parteien in der Schweiz unterschrieben. Eine Zusatzvereinbarung regelte, dass künftige Auseinandersetzungen nicht vor einem deutschen, sondern vor einem Schweizer Schiedsgericht zu klären seien. Der Vertrag lässt die Vermutung zu, dass Erwin Rosenthal nicht die Absicht hatte, das Geschäft vollständig aus der Hand zu geben: So war der Lagerbestand, der sich bereits im Ausland befand oder für das Ausland bestimmt war, von der Übernahme durch Koch ausgeschlossen. Außerdem verpflichtete sich Hans Koch, Jacques und Emma Rosenthal am Gewinn des Münchner Geschäfts zu beteiligen.63 Mit diesen Zahlungen sollte der Lebensunterhalt der in Deutschland verbliebenen Eltern gesichert werden.
Ende 1935 hatte Erwin Rosenthal durch den Transfer von Warenbeständen die Grundlage geschaffen, um aus der Schweiz heraus weiter als Antiquar arbeiten zu können. Für eine Wohnung in Zürich hatte er sich bereits im Juni 1935 angemeldet.64
Die Differenz zwischen der hohen Zahl von zollfreien Ansichtssendungen und den geringen Beträgen, die an die Reichshauptbank abgeführt wurden, war unterdessen von den Behörden wahrgenommen worden, wie ein Schreiben vom Juli 1936 belegt:





























