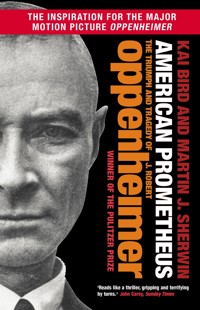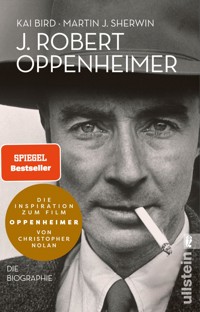
14,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ullstein eBooks
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2023
Das Buch zum Kino-Highlight im Sommer 2023 Oppenheimer wird eines der großen Kino-Highlights im Sommer 2023 sein. Das biografische Thriller-Drama über den »Vater der Atombombe« J. Robert Oppenheimer wartet mit einem beeindruckenden Hollywood-Cast auf: Oscar-Preisträger Casey Affleck, Emily Blunt, Matt Damon, Cillian Murpy, Gary Oldman und viele andere sind dabei. Der Film, bei dem Christopher Nolan für Regie und Drehbuch verantwortlich zeichnet, basiert auf dem gleichnamigen Sachbuch von Kai Bird und Martin J. Sherwin. Die Pulitzerpreis-gekrönte Biografie zeigt die Ambivalenzen eines Forschers, der sich zwischen Erkenntnisdrang und ethischer Verantwortung entscheiden muss.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
Oppenheimer
Die Autoren
Kai Bird (im Bild links), geboren 1951, arbeitet weltweilt als Journalist. Er ist Kolumnist und Mitherausgeber von The Nation und Autor zahlreicher biographischer Bücher.
Martin J. Sherwin (im Bild rechts) ist emeritierter Professor für angelsächsische Geschichte und würde mit dem American History Book Prize ausgezeichnet. Mitherausgeber von The Nation.
Kai Bird und Martin J. Sherwin
Oppenheimer
Die Biographie
Aus dem Amerikanischen von Klaus Binder
Ullstein
Besuchen Sie uns im Internet:www.ullstein.de
Für die deutsche Ausgabe von den Autoren gekürzte Fassung.Die Originalausgabe erschien 2005 unter dem Titel: American Prometheus. The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer bei Alfred A. Knopf/Random House Inc., New York
© Kai Bird und Martin J. Sherwin, 2005© der deutschsprachigen AusgabeUllstein Buchverlage GmbH, Berlin 2009Alle Rechte vorbehalten.Wir behalten uns die Nutzung unserer Inhalte für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG ausdrücklich vor.Lektorat: Knud von HarbouUmschlaggestaltung: zero-media.net, München, nach einer Vorlage von Morian & Bayer-Eynck, CoesfeldTitelabbildung: Alfred Eisenstaedt/The LIFE Picture Collection/ShutterstockAutorenfoto: © Claudio VazquezE-Book Konvertierung powered by pepyrusISBN: 9783843729475
Emojis werden bereitgestellt von openmoji.org unter der Lizenz CC BY-SA 4.0.
Auf einigen Lesegeräten erzeugt das Öffnen dieses E-Books in der aktuellen Formatversion EPUB3 einen Warnhinweis, der auf ein nicht unterstütztes Dateiformat hinweist und vor Darstellungs- und Systemfehlern warnt. Das Öffnen dieses E-Books stellt demgegenüber auf sämtlichen Lesegeräten keine Gefahr dar und ist unbedenklich. Bitte ignorieren Sie etwaige Warnhinweise und wenden sich bei Fragen vertrauensvoll an unseren Verlag! Wir wünschen viel Lesevergnügen.
Hinweis zu UrheberrechtenSämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken, deshalb ist die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Ullstein Buchverlage GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
Inhalt
Titelei
Die Autoren / Das Buch
Titelseite
Impressum
Vorwort
Prolog
TEIL EINS
1. »In jedem neuen Gedanken sah er etwas vollkommen Schönes«
2. »Jeder im Gefängnis seines Selbst«
3.»Geht mir gar nicht gut zurzeit«
4. »Ich finde die Arbeit hart, Gott sei Dank, & fast angenehm«
5. »Ich bin Oppenheimer«
6. »Oppie«
7. »Die Nim Nim Boys«
TEIL ZWEI
8. »1936 änderten sich meine Interessen«
9. »Ich schnitt es einfach aus und schickte es ein«
10. »Eine ganz entscheidende Woche«
11. »Ich werde eine Frau heiraten, die du kennst, Steve«
12. »Wir wollten den New Deal nach links ziehen«
13. »Coordinator of Rapid Rupture«
14. »Die Affäre Chevalier«
TEIL DREI
15. »Er war sehr patriotisch geworden«
16. »Zu viel Geheimnistuerei«
17. »Oppenheimer sagt die Wahrheit«
18. »Selbstmord, Motiv unbekannt«
19. »Möchtest du sie nicht adoptieren?«
20. »Bohr war Gott und Oppie sein Prophet«
21. »Die Auswirkungen des ›Gadget‹ auf die Zivilisation«
22. »Jetzt sind wir alle Schweinehunde«
TEIL VIER
23. »Diese armen kleinen Menschen«
24. »Ich glaube, ich habe Blut an meinen Händen«
25. »Man könnte New York zerstören«
26. »Oppie hatte einen schwachen Moment, aber jetzt ist er immun«
27. »Ein Hotel für Intellektuelle«
28. »Er wusste selbst nicht mehr, warum er das getan hatte«
29. »Dass sie Dinge nach ihm geworfen hat«
30.»Er ließ nie erkennen, was er dachte«
31.»Finstere Worte über Oppie«
32.»Das Tier im Dschungel«
TEIL FÜNF
33.»Sieht ziemlich schlecht aus, was?«
34.»Das Verfahren war eine ausgemachte Posse«
35.»Ein Fall von Hysterie«
36. »Ein schwarzer Fleck auf dem blanken Schild unseres Landes«
37.»Ich kann das warme Blut an meinen Händen noch immer fühlen«
38.»Wie im Never-Never-Land«
39.»Es hätte am Tag nach Trinity geschehen müssen«
Epilog: »Es gibt nur einen Robert«
Schlussbemerkung:»Mein langer Ausritt mit Oppie«
Anhang
Bilder
Abkürzungen
Bibliographie
Social Media
Vorablesen.de
Cover
Titelseite
Inhalt
Vorwort
Widmung
Für Susan Goldmark und Susan Sherwinund im Gedenken anAngus CameronundJean MayerMotto
Prometheische Menschen unserer Tage haben den Olymp erneut überfallen und der Menschheit diesmal die Donnerkeile des Zeus mitgebracht.
Scientific Weekly, September 1945
Prometheus aber formte aus Wasser und Erde Menschen und gab ihnen das Feuer, das er verborgen vor Zeus in einem Narthexstengel versteckt hatte. Sowie Zeus es aber gemerkt hatte, trug er Hephaistos auf, seinen Leib an das Kaukasos-Gebirge zu nageln … An diesem also festgenagelt, war Prometheus eine Zahl von vielen Jahren gefesselt. Jeden Tag aber flog ein Adler heran und weidete sich an den Lappen seiner Leber, die in der Nacht wieder zunahm.
Apollodor, Bibliotheke. Götter- und Heldensagen,1. Buch, 45 (hg. u. übers. v. Paul Dräger, Düsseldorf und Zürich 2006)
Vorwort
1953, vier Tage vor Weihnachten, geriet J. Robert Oppenheimers Leben – seine Karriere, sein Ruf und sein Selbstwertgefühl – völlig durcheinander: »Ich kann einfach nicht glauben, was mir da geschieht!« Mit diesem Stoßseufzer ließ er sich zum Haus seines Anwalts in Georgetown, Washington D.C., fahren. Dort hatte er binnen weniger Stunden eine folgenschwere Entscheidung zu fällen. Sollte er seinen Beratervertrag mit der US-Regierung kündigen? Oder doch besser die Vorwürfe anfechten, die ein Brief enthielt, den Lewis Strauss, der Vorsitzende der Atomic Energy Commission (AEC), ihm an frühen Nachmittag unerwartet übergeben hatte? Nach einer erneuten Überprüfung seines Lebenslaufes und seiner politischen Ansichten, hieß es in diesem Schreiben, könne man nicht umhin, ihn als Sicherheitsrisiko zu betrachten. Vierunddreißig Punkte umfasste die Liste der gegen ihn erhobenen Vorwürfe.
Seit dem Abwurf der Atombomben über Hiroshima und Nagasaki fühlte sich Oppenheimer von der vagen Ahnung verfolgt, dass etwas dunkel Unheilvolles vor ihm liege. Ende der 1940er Jahre hatte er, der zum angesehensten Naturwissenschaftler und politischen Berater seiner Generation, ja zu einer Ikone der amerikanischen Gesellschaft geworden war, Henry James’ Erzählung »Das Tier im Dschungel« gelesen. Als im Nachkriegsamerika der Antikommunismus immer höhere Wellen schlug, schwante Oppenheimer, dass auch ihm eine bedrohliche Bestie nachstellte. Und er hatte allen Grund, sich als Gejagter zu fühlen: Da waren die Vorladungen vor die Rotenhatz-Komitees des Senats, FBI-Tonbandmitschnitte seiner Telefonate im Büro und in seiner Wohnung, Anwürfe in der Presse wegen seiner politischen Vergangenheit und seiner aktuellen politischen Positionen. Sein Widerstand gegen eine Sicherheitspolitik, die sich vor allem auf strategisches Bombardieren gegnerischer Städte mit Atomwaffen stützte, hatte ihm in Washington mächtige Feinde geschaffen, unter anderen J. Edgar Hoover und Lewis Strauss. Die beiden machten sich daran, seine bereits mehrfach durchleuchtete politische Vergangenheit noch einmal ans Licht der Öffentlichkeit zu zerren.
Darum beriet er sich an jenem Abend mit Anne und Herbert Marks. Marks war nicht nur sein Anwalt, sondern auch einer seiner engsten Freunde. Anne, die Oppenheimers Sekretärin in Los Alamos gewesen war, spürte seine Verzweiflung. Nach längeren Diskussionen entstand ein Brief an »Dear Lewis«, in dem Oppenheimer erklärte, ein Rücktritt käme »unter den gegebenen Umständen« dem Eingeständnis gleich, die gegen ihn erhobenen Vorwürfe bestünden zu Recht, so als sei er »nicht geeignet, dieser Regierung zu dienen, der ich zwölf Jahre lang gedient habe«. Ein Rücktritt komme also nicht in Frage. Das war der Anfang vom Ende seiner Tätigkeit als politischer Berater; vor diesem Hintergrund ist es nicht ohne Ironie, dass die anschließende demütigende Anhörung Oppenheimers Ruhm noch steigerte. Er selbst aber war danach ein gebrochener Mann.
Oppenheimers Weg von New York nach Los Alamos und schließlich nach Princeton war begleitet von den Triumphen und Auseinandersetzungen seiner Zeit: Quantenrevolution in der Physik, Kampf um soziale Gerechtigkeit, Zweiter Weltkrieg und anschließender Kalter Krieg. Ein Weg, auf den ihn seine außerordentliche Intelligenz, seine Eltern, seine Lehrer an der Ethical Culture School, die Erfahrungen seiner Jugend und Studentenzeit geführt hatten. Sein beruflicher Aufstieg begann in Deutschland in den 1920er Jahren mit dem Studium der gerade entstehenden Quantenphysik. In der 1930er Jahren baute er an der University of California in Berkeley das in den Vereinigten Staaten führende Zentrum quantenphysikalischer Forschung auf. Gleichzeitig brachten ihn die Erfahrungen der Großen Depression und des in Europa aufkommenden Faschismus dazu, sich mit Freunden – darunter viele Sympathisanten oder Mitglieder der Kommunistischen Partei der Vereinigten Staaten (KP) – am Kampf um soziale Gerechtigkeit und für Rassengleichheit zu beteiligen. Diese Jahre gehörten zu den schönsten seines Lebens. Dass sie Ende der 1940er, Anfang der 1950er Jahre so ohne weiteres ausgeschlachtet werden konnten, um Oppenheimer politisch mundtot zu machen, zeigt, wie anfällig demokratische Prinzipien sind und wie sorgfältig sie geschützt werden müssen.
Das demütigende Verfahren, dem Oppenheimer 1953/54 unterzogen wurde, war – auf dem Höhepunkt der McCarthy-Ära – kein Einzelfall. Einzigartig aber war der Mann, über den gerichtet wurde: Amerikas Prometheus, der Vater der Atombombe, der seinem Land in Kriegszeiten das Feuer der Sonne handhabbar gemacht hatte. Und als ihm dies gelungen war, hatte er sehr bedacht von den Gefahren der Atomenergie gesprochen, hoffnungsvoll von deren Nutzen und, immer verzweifelter, die Vorschläge kritisiert, die Verteidigung der Vereinigten Staaten vor allem auf Atomwaffen zu stützen. An dieser strategischen Neuorientierung waren auch Kollegen aus der Wissenschaft beteiligt. Ihnen und dem militärischen Establishment hielt er die Frage entgegen: »Was sollen wir von einer Kultur halten, die Ethik stets als essentiellen Teil des menschlichen Lebens betrachtet hat, die dann [aber] über die Möglichkeit, nahezu alles Leben auszulöschen, nicht anders sprechen zu können meint als in Begriffen der Sachlogik und der Spieltheorie?«
Ende der 1940er Jahre verschlechterten sich die amerikanisch-sowjetischen Beziehungen kontinuierlich. Und Oppenheimers Drängen, sicherheitspolitische Fragen auch unter moralisch-ethischen Gesichtspunkten zu diskutieren – und zwar öffentlich –, beunruhigte das militärisch-sicherheitspolitische Establishment in Washington. Mit dem Einzug der Republikaner ins Weiße Haus gelangten 1953 Verfechter der massiven atomaren Vergeltung in einflussreiche Positionen. Lewis Strauss und seine Verbündeten waren entschlossen, den Mann zum Schweigen zu bringen, der, wie sie fürchteten, ihre Positionen mit überzeugenden Argumenten erschüttern konnte. Mit ihrem Angriff auf Oppenheimers politische und wissenschaftliche Standpunkte – auf alle Werte, die sein Leben bestimmt hatten – brachten seine Gegner viele Aspekte seines Charakters ans Licht: seinen Ehrgeiz und seine Unsicherheiten, Brillanz und Naivität, Entschlusskraft und Zögerlichkeit, seinen Stoizismus und seine Impulsivität. Rund tausend eng bedruckte Seiten umfasst In the Matter of J. Robert Oppenheimer, das amtliche Wortprotokoll seiner Anhörung vor dem Personnel Security Hearing Board, das die AEC eingesetzt hatte. Strauss ließ es als Rechtfertigung des von ihm inszenierten Verfahrens veröffentlichen, aber es zeigt, dass es seinen Gegnern nicht gelungen ist, den psychischen Panzer zu durchdringen, hinter dem dieser Mann sich und seine inneren Zerrissenheiten seit früher Jugend versteckt hatte. Dieses Buch verfolgt den Weg Robert Oppenheimers von seiner Kindheit in New York zu Beginn des 20. Jahrhunderts bis zu seinem Tod 1967, um der rätselhaften Persönlichkeit hinter jenem Schutzschild auf die Spur zu kommen.
Grundlage dieses Buches sind mehrere Tausend Zeugnisse, zusammengetragen aus Archiven und privaten Beständen im In- und Ausland. Dazu gehören Oppenheimers umfangreicher Nachlass in der Library of Congress und auch das einige Tausend Seiten umfassende Dossier des FBI, Ergebnis einer fünfundzwanzigjährigen Bespitzelung. Die Leser werden Oppenheimers Worte »hören« können, wie sie vom FBI aufgezeichnet und transkribiert worden sind; nur wenige Männer des öffentlichen Lebens wurden einer derartigen Überwachung unterzogen. Hinzu kommen Gespräche, die wir mit insgesamt fast einhundert Personen geführt haben: mit Oppenheimers engen Freunden, Verwandten und Kollegen. Viele unserer in den 1970er und 1980er Jahren befragten Gesprächspartner sind inzwischen verstorben. Doch mit ihren Berichten haben sie beigetragen zu einem facettenreichen Bild des Mannes, der uns ins Atomzeitalter geführt und dann darum gekämpft hat, die Gefahr eines Atomkriegs zu bannen – ein Kampf, den wir auch heute noch zu führen haben.
Oppenheimers Geschichte zeigt uns, dass die Identität des amerikanischen Volkes mit den Fragen rund um die Atomtechnik eng verknüpft bleibt. E.L. Doctorow hat das in The Nation (22. März 1986) beschrieben: »Seit 1945 ist die Bombe in unserem Bewusstsein. Erst bestimmte sie unsere Verteidigung, dann unsere Diplomatie, nun ist sie Teil unserer Wirtschaft. Wie könnten wir davon ausgehen, dass etwas so Übermächtiges nach vierzig Jahren nicht zu einem Teil unserer Identität geworden ist? Der große Golem, den wir gegen unsere Feinde geschaffen haben, ist unsere Kultur, unsere Bombenkultur – ihre Logik, ihr Glaube, ihre Vision.« Mutig versuchte Oppenheimer, uns von dieser »Bombenkultur« abzubringen, er wollte die atomare Bedrohung eindämmen, an deren Entstehung er entscheidend mitgewirkt hatte. So entstand der Plan einer internationalen Kontrolle der Atomenergie, bekannt geworden als Acheson-Lilienthal-Report – Oppenheimer war an dessen Konzeption und Formulierung maßgeblich beteiligt. Das Dokument ist ein einzigartiges Beispiel für Vernunft im Atomzeitalter.
Der Plan scheiterte an der Politik des Kalten Krieges. Die Vereinigten Staaten setzten – wie eine noch immer wachsende Zahl von Staaten – in den kommenden Jahrzehnten auf die Bombe. Mit dem Ende des Kalten Krieges schien die Gefahr nuklearer Vernichtung zunächst gebannt. Inzwischen wissen wir, dass die Gefahr eines Atomkriegs und des nuklearen Terrorismus im 21. Jahrhundert möglicherweise noch drängender ist als je zuvor.
Insbesondere nach den Ereignissen des 11. September 2001 ist es wichtig, sich an den Vater der Atombombe zu erinnern. Schon zu Beginn des Atomzeitalters hat er davor gewarnt, dass eben die Waffe, die unterschiedslos alle bedroht, Amerika selbst verwundbar macht. 1946 wurde er in einer Anhörung des Senats gefragt, ob es möglich sei, dass »drei oder vier Männer Teile einer [Atom-]Bombe nach New York schmuggeln und die Stadt in die Luft jagen können«. Seine Antwort: »Natürlich geht das, solche Leute könnten ganz New York zerstören.« Ein entsetzter Senator fragte nach: »Welches Instrument würden Sie einsetzen, um eine irgendwo in der Stadt versteckte Atombombe zu entdecken?« Mit der für ihn typischen, bitteren Ironie antwortete Oppenheimer: »Einen Schraubenzieher« – mit dem man alle Kofferschlösser öffnen müsse. Für Oppenheimer gab es nur einen Schutz vor Atomwaffen: sie abzuschaffen.
Oppenheimers Warnung verhallte, letztendlich wurde er zum Schweigen gebracht. Der rebellische griechische Halbgott Prometheus stahl Zeus das Feuer und brachte es den Menschen: Oppenheimer brachte uns das atomare Feuer. Als er jedoch nach Möglichkeiten suchte, es zu beherrschen, als er versuchte, uns vor dessen fürchterlichen Gefahren zu warnen, erhoben sich die Mächtigen – wie weiland der zornige Zeus –, um den modernen Prometheus zu strafen. Ward Evans, der als Einziger in der AEC-Anhörungskommission Oppenheimer nicht als Sicherheitsrisiko betrachtet wissen wollte, bezeichnete die Verweigerung der Unbedenklichkeitsbescheinigung für den Physiker als »schwarzen Fleck auf dem blanken Schild unseres Landes«.
Prolog
Verdammt, ich liebe dieses Land nun mal.
J. Robert Oppenheimer
Böses Wetter und bittere Kälte herrschten am 25. Februar 1967 in Princeton, New Jersey. Und trotzdem waren, wie die New York Times am nächsten Tag berichtete, sechshundert Freunde und Kollegen gekommen – Nobelpreisträger, Politiker, Generäle, Wissenschaftler, Dichter, Romanschriftsteller, Komponisten, Bekannte aus allen Lebensabschnitten –, um gemeinsam des Lebens von J. Robert Oppenheimer zu gedenken und seinen Tod zu betrauern. Manche hatten ihn als liebenswerten Lehrer kennengelernt und nannten ihn »Oppie«. Andere sahen in ihm vor allem den großen Physiker, den Mann, der 1945 zum »Vater der Atombombe« geworden war, einen nationalen Helden, einen vorbildlichen Wissenschaftler, der für seine Regierung gearbeitet und sie beraten hatte. Alle erinnerten sie sich mit großer Verbitterung, wie ihn die republikanische Regierung unter Präsident Dwight D. Eisenhower 1954 zum Sicherheitsrisiko erklärt und damit zum prominentesten Opfer des amerikanischen Kreuzzugs gegen den Kommunismus gemacht hatte.
Unter den anwesenden Nobelpreisträgern befanden sich weltbekannte Physiker wie Isidor I. Rabi, Eugene Wigner, Julian Schwinger, Tsung Dao Lee und Edwin McMillan. Auch Albert Einsteins Tochter Margot war gekommen, um den Mann zu ehren, der am Institute for Advanced Study (IAS) der »Chef« ihres Vaters gewesen war. Robert Serber war gekommen – ein Student Oppenheimers in den 1930er Jahren in Berkeley, langjähriger Mitarbeiter in Los Alamos und ein enger Freund –, Hans Bethe, der große Physiker der Cornell University, der den Nobelpreis erhielt, weil er aufgedeckt hatte, was im Inneren der Sonne vor sich geht. Irva Denham Green, eine Nachbarin von der unberührten Karibikinsel St. John, an deren Strand die Oppenheimers ein Cottage gebaut hatten, ihre Zuflucht nach Roberts Demütigung 1954, saß direkt neben den großen Männern der amerikanischen Außenpolitik: dem Rechtsanwalt und langjährigen Präsidentenberater John J. McCloy, General Leslie R. Groves, dem militärischen Leiter des Manhattan-Projekts, Marineminister Paul Nitze, dem Historiker und Pulitzerpreisträger Arthur Schlesinger Jr. sowie Senator Clifford Case aus New Jersey. Als Vertreter des Weißen Hauses hatte Präsident Lyndon B. Johnson seinen wissenschaftlichen Berater Donald F. Hornig geschickt, einen langjährigen Mitarbeiter in Los Alamos, der am »Trinity-Test« teilgenommen hatte, der ersten Atombombenexplosion am 16. Juli 1945. Auch Literaten und Künstler waren gekommen: der Dichter Stephen Spender, der Romanautor John O’Hara, der Komponist Nicholas Nabokov und George Balanchine, der Direktor des New York City Ballet. Oppenheimers Witwe Katherine »Kitty« Puening Oppenheimer saß in der ersten Reihe der Alexander Hall der Princeton University, neben ihr die zweiundzwanzigjährige Tochter Toni und der fünfundzwanzigjährige Sohn Peter sowie Roberts jüngerer Bruder Frank, dessen Karriere als Physiker ebenso in den Strudel des McCarthyismus geraten und zerstört worden war.
Igor Strawinskis Requiem Canticles erklang, ein Werk, das Robert Oppenheimer im Herbst zuvor in diesem Saal zum ersten Mal gehört und bewundert hatte. Dann sprach als Erster Hans Bethe, der Oppenheimer seit dreißig Jahren kannte: »Mehr als irgendein anderer hat er die theoretische Physik in Amerika groß gemacht. … Er war eine Führungspersönlichkeit … aber kein Herrscher, diktierte nicht, was zu tun war. Er brachte uns dazu, unser Bestes zu geben, verhielt sich wie ein guter Gastgeber zu seinen Gästen.« In Los Alamos, im vermeintlichen Wettlauf mit den Deutschen um den Bau der Bombe, hatte Oppenheimer Tausende von Mitarbeitern unter sich; auf einer unwirtlichen Hochebene in dieser Bergwelt war ein Labor aus dem Boden gestampft worden, wo er Wissenschaftler unterschiedlicher Herkunft zu einem effizienten Team zusammengeschweißt hatte. Ohne Oppenheimer, das wussten Bethe und die anderen Mitarbeiter von Los Alamos, wäre das erste »Gadget«, das sie in New Mexico konstruiert hatten, nicht rechtzeitig fertig geworden, um im Krieg noch eingesetzt zu werden.
Henry DeWolf Smyth, Physiker und Nachbar in Princeton, war der zweite Redner. 1954 hatte er als einziges der fünf Mitglieder der AEC dafür gestimmt, Oppenheimer das Vertrauen auszusprechen. Auch Smyth war in der vorangegangenen Anhörung befragt worden, und er hatte begriffen, welche Farce diese Veranstaltung war: »Ein solcher Fehler lässt sich nicht wiedergutmachen, ein solcher Schandfleck unserer Geschichte nicht wieder entfernen. … Wir bedauern, dass ihm das große Werk, das er für sein Land vollbrachte, so schäbig vergolten wurde …«1
Als Letzter ergriff George Kennan das Wort, langjähriger Diplomat und Botschafter, Vater der amerikanischen Containmentpolitik und Oppenheimers Kollege am IAS. Niemand habe ihn, so Kennan, nachdrücklicher auf die unabsehbaren Gefahren des Atomzeitalters hingewiesen als Oppenheimer. Und als er selbst wegen seiner Kritik an der atomaren Aufrüstungspolitik zum politischen Außenseiter in Washington geworden sei, habe ihn niemand so unterstützt wie Oppenheimer; er habe seine Arbeit verteidigt, ihm sogar Zuflucht am Institut gewährt. »Auf niemandem sonst lasteten jemals und derart grausam die Dilemmata, die daraus entstanden waren, dass die Menschen eine Macht über die Natur erlangt hatten, die in völligem Missverhältnis zu ihrer moralischen Stärke steht. Niemand schätzte die Gefahren realistischer ein, die der Menschheit aus dieser wachsenden Disparität erwachsen. Nie aber hat diese Sorge seinen Glauben an den Wert von Erkenntnis, sei es wissenschaftlich oder humanitär, erschüttert. Und es gab auch niemanden, der leidenschaftlicher dazu beitragen wollte, die Katastrophen abzuwenden, die mit der Entwicklung von Massenvernichtungswaffen zu befürchten standen. Es war das Interesse der Menschheit, das er dabei im Sinn hatte; aber er tat dies zugleich immer als Amerikaner. Er glaubte nämlich, dass sich dieses Ziel mit den Mitteln der nationalen Gemeinschaft, der er angehörte, am besten erreichen ließe. Als man ihm in der dunklen Zeit Anfang der fünfziger Jahre von vielen Seiten Schwierigkeiten machte, als er schikaniert wurde und im Mittelpunkt der Auseinandersetzungen stand, machte ich ihn darauf aufmerksam, dass er in mindestens hundert akademischen Zentren im Ausland willkommen wäre, und fragte ihn, warum er noch nicht daran gedacht habe, die USA zu verlassen. Er antwortete mir mit Tränen in den Augen: ›Verdammt, ich liebe dieses Land nun mal.‹«2
Ein theoretischer Physiker, eine charismatische Führungsfigur, ein Ästhet, der die Mehrdeutigkeit kultivierte: Robert Oppenheimer war ein Mann der Widersprüche. Noch Jahrzehnte nach seinem Tod ranken sich Kontroversen, Mythen und Geheimnisse um sein Leben. Wissenschaftler wie Dr. Hideki Yukawa, Japans erster Nobelpreisträger, sahen in Oppenheimer »ein Symbol für die Tragödie des modernen Atomphysikers«. Liberale verehrten ihn als prominentesten Märtyrer der McCarthy’schen Hexenjagd, als Symbol für die gewissenlosen Animositäten der Rechten. Seinen politischen Feinden galt er weiterhin als heimlicher Kommunist und ausgemachter Lügner.
Tatsächlich war er eine über die Maßen menschliche Figur, so begabt wie vielschichtig, brillant und naiv zugleich. Er war, so sein Freund Rabi, nicht nur »sehr klug, sondern auch sehr töricht«. Auch dem Physiker Freeman Dyson blieben die tiefen und quälenden inneren Widersprüche Oppenheimers nicht verborgen. Er habe sein Leben der Wissenschaft und dem rationalen Denken geweiht. Doch mit seiner Entscheidung, an der Herstellung einer Waffe mitzuarbeiten, die ganze Völker auslöschen könne, habe er einen »faustischen Handel« abgeschlossen, »und natürlich haben wir noch immer damit zu leben«. Wie Faust wollte auch Oppenheimer diesen Handel rückgängig machen – und gerade das ließ ihn scheitern. Er, der maßgeblich daran beteiligt war, die Gewalt der Atomkraft freizusetzen, galt, als er seine Landsleute anschließend vor deren Gefahren warnte, der Regierung als Sicherheitsrisiko. Seine Freunde wiederum verglichen seine öffentliche Demütigung mit dem Prozess, der einem anderen Wissenschaftler, nämlich Galileo Galilei, im Jahr 1633 von der mittelalterlichen Kirche gemacht worden war. Andere sahen das hässliche Gespenst des Antisemitismus am Werk und riefen in Erinnerung, was Hauptmann Alfred Dreyfus in den 1890er Jahren in Frankreich zu erleiden hatte.3 Doch wenn wir den Menschen Robert Oppenheimer, seine wissenschaftlichen Leistungen und die einzigartige Rolle als Architekt des Atomzeitalters verstehen wollen, helfen solche Vergleiche wenig. Wir müssen uns sein Leben genauer anschauen.
TEIL EINS
1. »In jedem neuen Gedanken sah er etwas vollkommen Schönes«
Ich war ein gehorsamer, grässlich guter Junge.
J. Robert Oppenheimer
Im ersten Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts löste die Wissenschaft die zweite amerikanische Revolution aus. Eine Nation, die im Pferdesattel groß geworden war, durchlief in kürzester Zeit eine gewaltige Veränderung. Verbrennungsmotor, bemannte Fliegerei und eine Menge anderer Erfindungen krempelten das Leben der Menschen um. Gleichzeitig und von der Öffentlichkeit zunächst eher unbemerkt, arbeitete eine Gruppe von Wissenschaftlern aber an einer noch tiefer greifenden Revolution. Überall in der Welt waren theoretische Physiker dabei, unser bisheriges Verständnis von Raum und Zeit umzustoßen. 1896 entdeckte der französische Physiker Henri Becquerel die Radioaktivität. Max Planck, Marie und Pierre Curie und andere vertieften das Wissen über die Natur des Atoms. Und 1905 schließlich veröffentlichte Albert Einstein seine Spezielle Relativitätstheorie. Auf einmal hatte sich auch das Universum verändert. Bald wurden Naturwissenschaftler überall als neue Heroen gefeiert, denn sie versprachen, eine Renaissance der Rationalität, des Wohlstands und gesellschaftlicher Aufstiegschancen für alle einzuleiten. Reformbewegungen stellten die alte Ordnung der Vereinigten Staaten in Frage. Theodore Roosevelt nutzte die einschüchternde Kanzel des Weißen Hauses, um seinem Volk zu predigen, dass eine gute Regierung im Bündnis mit Wissenschaft und angewandter Technologie die Nation in eine neue Ära der Aufklärung und des Fortschritts führen könne.
In diese Zeit großer Verheißungen wurde J. Robert Oppenheimer geboren: am 22. April 1904. Seine Familie war aus Deutschland eingewandert, lebte in erster und zweiter Generation in den Vereinigten Staaten von Amerika, und alle mühten sich, richtige Amerikaner zu werden. Die in New York lebenden Oppenheimers waren Juden, gehörten aber keiner Synagoge an. Nicht weil sie ihr Judentum ablehnten, vielmehr wollten sie ihre Identität aus einem typisch amerikanischen Ableger des Judentums konstituieren. Ihr Bezugspunkt war die Society for Ethical Culture, die dem Rationalismus und einer progressiven Spielart des weltlichen Humanismus verpflichtet war. Mit deren Hilfe hofften sie, die Schwierigkeiten bewältigen zu können, mit denen alle Einwanderer in Amerika zu kämpfen hatten. Für Robert Oppenheimer aber wurde diese Orientierung zur Quelle einer lebenslangen Ambivalenz gegenüber seiner jüdischen Herkunft.
Wie der Name schon sagt, war Ethical Culture keine Religion, sondern eine Lebensweise, in der soziale Gerechtigkeit mehr zählte als persönlicher Erfolg. Sicher war es kein Zufall, dass der Junge, der einmal zum Begründer des Atomzeitalters werden sollte, in einer Umgebung aufwuchs, die unabhängigem Denken und empirischer Forschung, mit einem Wort: der Wissenschaft, obersten Rang einräumte. Zugleich könnte man es als Ironie der Geschichte bezeichnen, dass ein Leben, das sozialer Gerechtigkeit, Rationalität und Wissenschaft geweiht war, zur Metapher für den Tod tausender Menschen unter einer pilzförmigen Wolke wurde.
Robert Oppenheimers Vater Julius wurde am 12. Mai 1871 in Hanau geboren. Dessen Vater wiederum, Benjamin Pinhas Oppenheimer, war Bauer und Getreidehändler gewesen, aufgewachsen in einem »fast noch mittelalterlichen deutschen Dorf« – wie Robert später berichtete.4 Julius hatte zwei Brüder und drei Schwestern. Zwei angeheiratete Vettern Benjamins, Sigmund und Solomon Rothfeld, entschlossen sich 1870, nach New York auszuwandern. Nach einigen Jahren gründeten die beiden jungen Männer mit einem weiteren Verwandten namens J.H. Stern eine kleine Importfirma für Anzugfutterstoffe. Das Geschäft profitierte von der in New York aufblühenden Konfektionsschneiderei und lief ausgezeichnet. Ende der 1880er Jahre ließen die Rothfelds ihren Vetter Benjamin wissen, dass in ihrem Unternehmen noch Platz sei für seine Söhne.
Im Frühjahr 1888, einige Jahre nach seinem älteren Bruder Emil, kam Julius in New York an. Der große, schlanke, linkische junge Mann, der zwar kein Geld in die Firma einbrachte, auch kein Wort Englisch sprach, gleichwohl entschlossen war, etwas aus sich zu machen, sollte im Lager der Firma Stoffballen sortieren. Er hatte ein Auge für Farben und erwarb sich rasch den Ruf, einer der besten Kenner von Stoffen in der Stadt zu sein. Die Firma von Emil und Julius überstand die Rezession von 1893, und um die Jahrhundertwende war Julius Oppenheimer Teilhaber von Rothfeld, Stern & Company. Er kleidete sich entsprechend, trug stets ein weißes Hemd mit hohem Kragen, eine konservative Krawatte und einen dunklen Geschäftsanzug. Seine Manieren waren so makellos wie seine Kleidung. Mit dreißig sprach er bemerkenswert gut Englisch und kannte sich gut in amerikanischer und europäischer Geschichte aus. Er liebte die Kunst und verbrachte seine freie Zeit am Wochenende in den zahlreichen Kunstgalerien New Yorks.
Wahrscheinlich bei einer solchen Gelegenheit machte er die Bekanntschaft der jungen Malerin Ella Friedman, einer brünetten, »außerordentlich hübschen« Frau mit feinen Gesichtszügen, »ausdrucksvollen graublauen Augen und langen schwarzen Wimpern«, einer schlanken Figur – und einer von Geburt an deformierten rechten Hand.5 Um sie zu verbergen, trug Ella stets langärmlige Blusen oder Kleider und Handschuhe aus Sämischleder. Im rechten Handschuh war eine einfache Prothese mit einem künstlichen Daumen an einer Feder eingebaut.6 Julius verliebte sich sofort in sie. Die Friedmans, bayerische Juden, hatten sich in den 1840er Jahren in Baltimore niedergelassen, wo Ella 1869 zur Welt gekommen war. Ein Freund der Familie beschrieb sie als »freundlich, fein … als außerordentlich empfindsame und höfliche junge Frau, die ständig darum besorgt war, wie sie den Menschen in ihrer Umgebung Gutes tun und diese glücklich machen konnte«.7 Mit Anfang zwanzig verbrachte sie ein Jahr in Paris, um die frühimpressionistischen Maler zu studieren. Nach ihrer Rückkehr unterrichtete sie Kunst am Barnard College. Als sie Julius kennenlernte, war ihre Malkunst so weit gediehen, dass sie bereits Schüler hatte und über ihr eigenes Dachatelier in einem New Yorker Mietshaus verfügte.
Am 23. März 1903 heirateten Julius und Ella und zogen in das aus Naturstein erbaute, mit einem spitzen Giebel verzierte Haus Nr.250, West 94th Street. Ein Jahr später, es war der kälteste Frühling seit Menschengedenken, brachte die vierunddreißigjährige Ella nach einer komplikationsreichen Schwangerschaft einen Sohn zur Welt. Julius wusste bereits den Namen seines Erstgeborenen: Robert; der Entschluss, dem ein »J.« für Julius voranzusetzen, fiel, einer Familienlegende zufolge, erst im letzten Moment. Dass der Sohn den Vaternamen bekam, ist nur insofern bemerkenswert, als es nach der europäisch-jüdischen Tradition mehr als unüblich war, Neugeborene nach einem lebenden Verwandten zu benennen. Zum Rufnamen wurde Robert, und dieser behauptete später, die Initiale am Anfang stünde für gar nichts. Offenbar spielten jüdische Traditionen bei den Oppenheimers kaum eine Rolle.8
Kurz nach Roberts Geburt zog Julius Oppenheimer mit seiner Familie in eine geräumige Wohnung im elften Stock des Hauses Nr.155 Riverside Drive an der West 88th Street, mit Blick auf den Hudson River.9 Die Wohnung, die das ganze Stockwerk einnahm, war nicht nur mit kostbaren europäischen Möbeln ausgestattet, mit der Zeit legten sich die Oppenheimers auch eine bemerkenswerte Sammlung spätimpressionistischer und fauvistischer Gemälde zu, die Ella ausgesucht hatte.10
An den Wochenenden unternahm die Familie Ausflüge aufs Land, den Packard fuhr ein Chauffeur in grauer Uniform. Als Robert elf oder zwölf Jahre alt war, erwarb der Vater ein großes Sommerhaus in Bay Shore, Long Island. Hier lernte Robert segeln: Am Pier unterhalb des Hauses lag ein dreizehn Meter langes Segelboot, auf den Namen Lorelei getauft, eine Luxusjacht mit allen denkbaren Annehmlichkeiten. Die Eltern, so Harold F. Cherniss, liebten ihren Sohn »abgöttisch«: »Er bekam alles, was er wollte; man kann sagen, er ist im Luxus aufgewachsen.« Dennoch, darin sind sich alle Jugendfreunde einig, sei Robert »äußerst großzügig« gewesen, »keineswegs ein verwöhntes Kind«. 1914, als in Europa der Erste Weltkrieg ausbrach, war Julius Oppenheimer ein reicher Geschäftsmann mit einem Vermögen von einigen Hunderttausend Dollar – nach heutigem Geldwert also ein Multimillionär. Nach allem, was wir wissen, führten die Oppenheimers eine glückliche Ehe.
1909 nahm Julius den gerade erst fünf Jahre alten Robert mit auf die erste von fünf Reisen über den Atlantik: Der Besuch galt Großvater Benjamin in Deutschland. Zwei Jahre später fuhren sie erneut zum Großvater, und diesmal hinterließ der nun Fünfundsiebzigjährige einen unauslöschlichen Eindruck bei seinem Enkel: »Ganz offensichtlich war das Lesen eine der größten Freuden in seinem Leben, dabei hatte er so gut wie keine Schulbildung.«11 Als Großvater Benjamin den Enkel eines Tages mit Holzklötzen spielen sah, schenkte er ihm eine Architekturenzyklopädie. Auch eine Steinsammlung bekam er, »überhaupt nichts Besonderes«, so Roberts Erinnerung, eine Schachtel mit zwei Dutzend deutsch beschrifteten Exemplaren: »Von da an wurde ich, auf völlig kindliche Art und Weise, ein leidenschaftlicher Mineraliensammler.« Nach New York zurückgekehrt, überredete er seinen Vater, mit ihm in den Palisades, New Jersey, auf Steinjagd zu gehen. Bald war die Wohnung am Riverside Drive vollgestopft mit Roberts Steinen, jeder einzelne sauber mit dem wissenschaftlichen Namen beschriftet. Julius förderte das Hobby seines Sohnes und überhäufte ihn mit einschlägiger Literatur. Wie Oppenheimer später erzählte, interessierten ihn nicht die geologischen Ursprünge seiner Steine, allein die Struktur der Kristalle und ihr polarisiertes Licht hätten ihn fasziniert.12
Drei Leidenschaften waren es, die Robert zwischen seinem siebten und zwölften Lebensjahr völlig gefangennahmen: die Mineralien, das Lesen und Schreiben von Gedichten und das Bauen mit Holzbausteinen. Und dies »nicht weil ich Schulfreunde mit ähnlichen Interessen hatte oder weil das etwas mit der Schule zu tun hatte, nein, einfach so«.13 Mit zwölf schrieb er auf der Schreibmaschine der Familie Briefe an bekannte Geologen über die Felsformationen, die er im Central Park studiert hatte. Das trug ihm die Mitgliedschaft im New Yorker Mineralogical Club und die Einladung ein, dort einen Vortrag zu halten, den Robert, als sich das ungläubige Staunen über sein Alter gelegt hatte, mit einiger Scheu absolvierte und der ihm herzlichen Beifall eintrug.
Julius Oppenheimer fand nichts dabei, diese für ein Kind ungewöhnlichen Interessen zu fördern: Ella und er hielten den Sohn, wie sich Kusine Babette Oppenheimer erinnerte, für ein »Genie«: »Sie beteten ihn an, sorgten sich um ihn und beschützten ihn. Sie gaben ihm alle Möglichkeiten, seine Neigungen zu entwickeln, und alle Zeit, die er dafür brauchte.« Das Mikroskop, das er vom Vater geschenkt bekam, wurde zu Roberts Lieblingsspielzeug. Sein Vater, sagte er, »war einer der tolerantesten und humansten Menschen, die es gibt. Das Wichtigste, was man für andere tun könne, sei seiner Auffassung nach, sie selbst herausfinden zu lassen, was sie wollten.« Und Robert wusste, was er wollte. Von früher Jugend an lebte er in der Welt der Bücher und der Wissenschaft. »Er war ein Träumer«, so Babette Oppenheimer, »und hatte kein Interesse an den wilden Spielen seiner Altersgenossen … wurde oft gehänselt und ausgelacht, weil er nicht wie die anderen war.« Als er älter wurde, machte sich sogar seine Mutter Sorgen darum, dass ihr Sohn so wenig Interesse daran zeigte, mit Kindern seines Alters zusammen zu sein. »Sie hätte gern gehabt, dass ich mehr wie die anderen Jungen würde, hatte aber wenig Erfolg damit.«14
1912, Robert war jetzt acht Jahre alt, bekam Ella Oppenheimer einen zweiten Sohn, Frank Friedman, dem sie nun immer mehr von ihrer Aufmerksamkeit widmete. Acht Jahre lagen zwischen den Brüdern, und so gab es wenig Anlässe zu Geschwisterrivalitäten. Oppenheimer meinte später, er sei für Frank nicht nur der ältere Bruder gewesen, sondern auch »eine Art Vater, weil zwischen uns ein so großer Altersunterschied bestand«. Franks frühe Kindheit war mindestens so behütet wie die von Robert. Und, so erinnerte er sich: »Wenn wir uns für irgendetwas begeisterten, unterstützten uns unsere Eltern dabei.« Als sich Frank auf der Oberschule für Chaucer interessierte, schenkte ihm der Vater eine Werkausgabe von 1721. Und als er den Wunsch äußerte, Flöte spielen zu lernen, engagierten seine Eltern George Barère als Privatlehrer, einen der größten Flötisten Amerikas. Beide Jungen wurden sehr verwöhnt, doch nur Robert, der Erstgeborene, entwickelte einen gewissen Dünkel, wie er später einräumte: »Ein unangenehmes Ego, mit dem ich Kinder wie Erwachsene beleidigt haben muss, die unglücklicherweise mit mir zu tun bekamen.«15
Im September 1911, bald nach der Rückkehr von seinem zweiten Besuch beim Großvater in Deutschland, kam Robert auf eine Privatschule ganz besonderer Art. Seit einigen Jahren schon war Julius Oppenheimer aktives Mitglied der Society for Ethical Culture. Deren Leiter und Gründer, Dr. Felix Adler, hatte Ella und ihn getraut, und 1907 wurde Julius zum Kurator der Gesellschaft ernannt.16 So verstand es sich von selbst, dass die Söhne die Schule der Society am Central Park West besuchten. Deren Motto hieß »Deed, not Creed« (Taten, keine Glaubensbekenntnisse).17 Die Society for Ethical Culture, 1876 gegründet, verpflichtete ihre Mitglieder zu sozialem Engagement und humanitärer Gesinnung: »Jeder Mensch muss für sein Leben und Schicksal Verantwortung übernehmen.«18 Felix Adler und ein Kreis begabter Lehrer nahmen nachhaltigen Einfluss auf Roberts emotionale und intellektuelle Entwicklung.
Felix Adler war 1857 im Alter von sechs Jahren mit seiner Familie aus Deutschland nach New York eingewandert.19 Sein Vater, Rabbi Samuel Adler, war bereits in Deutschland eine führende Gestalt der jüdischen Reformbewegung gewesen, in Amerika leitete er die Synagoge Emanu-El, die größte Reformgemeinde in Amerika. Felix hätte leicht Nachfolger seines Vaters werden können, aber er kehrte als junger Mann zum Studium nach Deutschland zurück und lernte dabei radikal neue Ideen kennen, in deren Mittelpunkt die Universalität Gottes und die Verantwortung der Menschen für die Gesellschaft standen. Er las Charles Darwin, Karl Marx und eine Reihe deutscher Philosophen, darunter Julius Wellhausen, der den traditionellen Glauben ablehnte, die Tora sei von Gott inspiriert. Adler hielt, in die väterliche Gemeinde zurückgekehrt, eine Predigt über das »Judentum der Zukunft«: Um im modernen Zeitalter zu überleben, müsse das Judentum seinen »engen Ausschließlichkeitsgeist« aufgeben. Anstatt sich über ihre biblische Identität als »auserwähltes Volk« zu definieren, sollten Juden sich durch soziales Engagement und durch Taten hervortun, die den arbeitenden Klassen zugutekämen. Innerhalb von drei Jahren brachte Adler etwa vierhundert Mitglieder der Synagoge Emanu-El dazu, aus der jüdischen Gemeinde auszutreten. Von Joseph Seligman und anderen wohlhabenden deutsch-jüdischen Geschäftsleuten finanziell unterstützt, gründete er die Society for Ethical Culture. Deren Mitglieder versammelten sich sonntags früh, um Adlers Vorträge und Lesungen zu hören. Es wurde auch Orgel gespielt, Gebete oder andere religiöse Zeremonien fanden jedoch nicht statt. Seit 1910 traf sich die Gesellschaft in einem prächtig ausgestatteten Versammlungssaal in der West 64th Street.
Die Ethical-Culture-Bewegung hat ihre Ursprünge im Deutschland des 19. Jahrhunderts, wo das jüdische Bürgertum, um seine Integration in die Gesellschaft zu erleichtern, zunächst das Judentum zu reformieren suchte.20 Solche Ideen brachte Adler, der in Heidelberg studiert hatte, mit nach Amerika, und angesichts des dort zunehmenden Antisemitismus fielen Adlers radikale Vorstellungen von jüdischer Identität bei den reichen jüdischen Geschäftsleuten in New York auf fruchtbaren Boden. In der weltweiten Verbreitung einer intellektuellen Kultur sah Adler die einzig mögliche Antwort auf den Antisemitismus. Den Zionismus dagegen kritisierte er als Rückzug in jüdischen Partikularismus, als »aktuelles Beispiel für die [jüdische] Tendenz zur Absonderung«. Die Zukunft der Juden liege in Amerika, nicht in Palästina: »Ich richte meinen Blick fest auf die frische Morgenröte über den Alleghenies und den Rockies, nicht auf das Abendrot, das, so schön es auch sein mag, über den Hügeln Jerusalems brütet.«21
Um seine Weltanschauung in die Praxis umzusetzen, gründete Adler 1880 die Workingman’s School, eine kostenlose Lehranstalt für Arbeiterkinder. 1890 hatte sie so viele Schüler, dass sich Adler gezwungen sah, das bislang von der Society for Ethical Culture getragene Budget durch zahlende Schüler aufzustocken. Weil damals viele private Eliteschulen keine Juden zuließen, forderten reiche jüdische Geschäftsleute die Zulassung auch ihrer Kinder zur Workingman’s School. 1895 wurde die Schule um eine Oberschule erweitert und die Einrichtung in Ethical Culture School umbenannt. (Jahrzehnte später wechselte der Name noch einmal in Ethical Culture Fieldston School.) 1911, als Robert Oppenheimer dort eingeschult wurde, waren nur noch etwa zehn Prozent der Schüler Arbeiterkinder; die liberale und soziale Orientierung aber blieb erhalten. Den Kindern der relativ begüterten Förderer der Society for Ethical Culture wurde beigebracht, dass sie – als Avantgarde eines modernen ethischen Evangeliums – an der Reform der Gesellschaft mitzuwirken hätten.
Natürlich lassen sich Roberts politische Neigungen auf die fortschrittliche Erziehung zurückführen, die er in Felix Adlers Schule genossen hat. In seiner Kindheit wie auch während seiner schulischen Laufbahn war er von Männern und Frauen umgeben, die sich als Katalysatoren einer besseren Welt betrachteten. In den Jahren bis zum Ende des Ersten Weltkriegs setzten sich Mitglieder der Society for Ethical Culture für politisch brisante Themen ein: Verbesserung der Rassenbeziehungen, Rechte der Gewerkschaften, bürgerliche Freiheiten und Umweltschutz. 1909 etwa gehörten prominente Mitglieder der Society – Dr. Henry Moskowitz, John Lovejoy Elliott, Anna Garlin Spencer und William Salter – zu den Gründern der National Association for the Advancement of Colored People (NAACP). Auch bei den Textilarbeiterstreiks der Jahre 1910 bis 1915 spielte Moskowitz eine wichtige Rolle; Mitglieder der Society waren unter den Gründern des National Civil Liberties Bureau, eines Vorläufers der American Civil Liberties Union. Klassenkämpferische Vorstellungen allerdings lehnten sie ab, sie suchten pragmatische Lösungen für die Veränderung der Gesellschaft und beteiligten sich aktiv an entsprechenden Initiativen. Ihre Grundüberzeugung war, dass eine bessere Welt harte Arbeit, Durchhaltevermögen und politische Organisation verlangte. 1921, in dem Jahr, in dem Robert seine Abschlussprüfungen ablegte, rief Adler die Absolventen der Ethical Culture School dazu auf, »ethische Vorstellungskraft zu entwickeln und die Dinge nicht so zu sehen, wie sie sind, sondern so, wie sie sein könnten«.22
Wie viele Amerikaner deutscher Herkunft war auch Adler erschüttert und innerlich zerrissen, als Amerika in den Ersten Weltkrieg hineingezogen wurde. Als ein deutsches U-Boot das britische Passagierschiff Lusitania versenkte, trat er für die Bewaffnung amerikanischer Handelsschiffe ein. Obwohl er gegen den Kriegseintritt der USA war, drängte Adler seine Gemeinde, als Wilson im April 1917 Deutschland den Krieg erklärte, in »ungeteilter Loyalität« zu den Vereinigten Staaten zu stehen, ließ zugleich aber verlauten, dass seiner Ansicht nach Deutschland nicht die alleinige Schuld am Krieg trage.23 Er war kein Anhänger der Monarchie in Deutschland und begrüßte bei Kriegsende den Zusammenbruch des Kaiserreichs und der österreichisch-ungarischen Monarchie. Zugleich erklärte der engagierte Gegner des Kolonialismus öffentlich, die Siegermächte verhielten sich scheinheilig, wenn sie in den Friedensverhandlungen die Kolonialreiche der Briten und Franzosen vergrößerten. Natürlich wurde er sofort prodeutscher Gefühle beschuldigt. Auch Julius Oppenheimer, der Kurator der Society war und Adler sehr bewunderte, wusste nicht so recht, wie er sich als Deutschamerikaner zum Krieg verhalten sollte. Was der junge Robert über den Krieg dachte, ist nicht bekannt. Sein Ethiklehrer John Lovejoy Elliott jedenfalls lehnte den Kriegseintritt der Vereinigten Staaten entschieden ab.
Der 1868 in Illinois geborene Elliott stammte aus einer Familie von Freidenkern und Gegnern der Sklaverei. In persönlicher wie politischer Hinsicht war er ein furchtloser Mensch. Als 1938 in Wien zwei führende Mitglieder der Society von der Gestapo verhaftet wurden, reiste er, damals immerhin siebzig Jahre alt, nach Berlin und verhandelte mehrere Monate lang mit der Gestapo über ihre Freilassung. Nachdem er eine beträchtliche Bestechungssumme gezahlt hatte, gelang es ihm, die beiden Männer aus NS-Deutschland herauszuholen. Dieser brillante Menschenfreund, dieser »geistsprühende Heilige«, hat die Brüder Oppenheimer jahrelang in Ethik unterrichtet.24 Er tat dies im Stil des sokratischen Dialogs; die Schüler wurden aufgefordert, frei und offen über soziale und politische Themen zu diskutieren: über die »Negerfrage, die Ethik von Krieg und Frieden, ökonomische Ungleichheit und die Beziehung der Geschlechter«.25 In Roberts letztem Schuljahr ging es ausführlich um die Rolle des Staates. Auch ein »Kurzer Katechismus der politischen Ethik« samt einem Abschnitt zur »Ethik der Loyalität und des Verrats« gehörte zum Lehrplan.26 Diese ungewöhnliche Schulung in sozialen und weltpolitischen Fragen fiel bei Robert auf fruchtbaren Boden und sollte in den kommenden Jahrzehnten reiche Früchte hervorbringen.
Oppenheimer äußerte sich zwiespältig über seine Kindheit und Schulzeit; »gehorsam« sei er gewesen, »ein grässlich guter Junge«: »Ich wurde in meiner Jugend nicht darauf vorbereitet, dass die Welt voller Bitternis und Grausamkeit ist.« Sein behütetes Elternhaus habe ihm »keine normale und gesunde Möglichkeit« geboten, »ein Scheißkerl zu werden«.27 Aber es sorgte dafür, dass er zu einem robusten und zähen Menschen von fast stoischer Ruhe wurde, was ihm selbst vielleicht gar nicht so bewusst war.
Als Robert vierzehn Jahre alt war, schickte Julius Oppenheimer seinen Sohn in ein Sommerlager: Er sollte einmal aus dem Haus kommen und sich mit Gleichaltrigen zusammentun. Für die meisten Jungen war Camp Koenig ein Paradies in den Bergen, wo sie viel Spaß miteinander hatten. Für Robert war es jedoch eine Qual. Er hasste Sport, ging lieber spazieren und sammelte Steine. Sein Wesen machte ihn zur Zielscheibe jener Grausamkeiten, an denen sich heranwachsende Jungen ergötzen, wenn sie an schüchterne, empfindsame, andersartige Altersgenossen geraten. Man verpasste ihm den Spitznamen »Cutie«, und er wurde erbarmungslos gehänselt. Aber Robert war nicht der Junge, der sich wehrte. Doch er fand auch einen Freund, und der erinnerte sich, dass Robert in diesem Sommer völlig fasziniert George Eliots Middlemarch las, die so gescheite wie einfühlsame Geschichte einer Frau, die nach Resonanz für ihr sich entwickelndes Gefühlsleben sucht.28 Dann schrieb er dummerweise in einem Brief an die Eltern, er sei froh, ins Sommerlager gefahren zu sein, denn die Jungen dort weihten ihn in die Tatsachen des Lebens ein. Daraufhin statteten die Oppenheimers dem Lager kurzerhand einen Besuch ab, und wenig später kündigte der pädagogische Leiter an, er werde hart durchgreifen, wenn er zotige Geschichten höre. Natürlich wurde Robert der Petzerei verdächtigt. Eines Nachts schleppten ihn einige Jungs ins Kühlhaus des Lagers, zogen ihn aus und verprügelten ihn. Und damit nicht genug: Sie beschmierten ihn an Gesäß und Genitalien mit grüner Farbe und sperrten ihn dann, nackt wie er war, ins Kühlhaus – eine ganze Nacht lang. Herbert Smith sagte später, Robert sei regelrecht gefoltert worden.29 Doch er ertrug diese Demütigung mit stoischer Gelassenheit. Weder ließ er sich abholen noch beschwerte er sich. »Ich weiß nicht, wie Robert die restliche Zeit überstand«, so Herbert Smith, »die meisten Jungen hätten das nicht überstanden, Robert schon. Es muss die Hölle für ihn gewesen sein.« Viele seiner Freunde sollten auch später davon sprechen, dass sich unter Roberts zerbrechlicher und empfindlicher äußeren Schale eine stoische Persönlichkeit, ein unbeirrbarer Stolz und eine unerschütterliche Entschlossenheit verbargen – Eigenschaften, die sein ganzes Leben lang immer wieder hervortraten.
In der Schule hingegen wurde Robert in seiner intellektuellen, anspruchsvollen Art von Lehrern gefördert, die Adler im Umfeld der Reformpädagogik sorgfältig aussuchte. Die Griechisch- und Lateinlehrerin Alberta Newton empfand es als reine Freude, Robert zu unterrichten: »In jedem neuen Gedanken sah er etwas vollkommen Schönes.«30 Er las Platon und Homer im griechischen Original, Cäsar, Vergil und Horaz auf Lateinisch. Stets war Robert ein hervorragender Schüler. Schon in der dritten Klasse experimentierte er im Labor, und mit zehn, in der fünften Klasse also, lernte er Physik und Chemie. Er stürzte sich mit solchem Eifer auf die Naturwissenschaften, dass sich der Kurator des American Museum of Natural History bereit erklärte, ihm Privatunterricht zu geben. Robert übersprang mehrere Klassen und galt als frühreif – vielleicht zu frühreif. Als er neun war, soll er zu einer älteren Kusine gesagt haben: »Frag mich etwas auf Latein, und ich antworte dir auf Griechisch.«31
Viele seiner Kameraden empfanden ihn als sehr verschlossen; einer von ihnen sagte: »Wir waren viel zusammen, sind uns aber nie nahegekommen. Er war meistens völlig versunken in das, was ihn gerade beschäftigte.« Ein anderer sagte, Robert habe wortkarg im Unterricht gesessen, »als ob er nicht genug zu essen oder zu trinken bekommen hätte«. »Linkisch« sei er gewesen, »er wusste einfach nicht, wie er sich anderen Kindern gegenüber verhalten sollte.«32
Roberts Klassenlehrer in der Oberstufe war Herbert Winslow Smith, der Englisch unterrichtete, seit er 1917 in Harvard seine Masterprüfung abgelegt hatte. Er war hochbegabt und hätte alle Chancen gehabt zu promovieren, doch kaum hatte er das Lehramt übernommen, begeisterte ihn die Arbeit der Society for Ethical Culture so sehr, dass er nicht mehr nach Cambridge zurückkehrte. Er widmete sein ganzes Berufsleben der Schule, wurde schließlich auch zu ihrem Leiter. Breitschultrig und athletisch gebaut, war er dennoch ein sanfter, den Schülern zugewandter Lehrer, der stets herauszufinden verstand, was einen Schüler am meisten interessierte, und dies dann mit dem Thema verband, das gerade behandelt wurde. Nach dem Unterricht drängten sich die Schüler häufig um sein Pult und versuchten, aus ihrem Lehrer noch ein bisschen mehr herauszuholen. Roberts primäres Interesse galt zweifellos den Naturwissenschaften, aber Smith gelang es, ihn auch für die Literatur zu erwärmen; Robert, so sagte er, hatte einen »wundervollen Prosastil«. Als Robert einen unterhaltsamen Aufsatz über Sauerstoff verfasste, kommentierte er diesen mit den Worten: »Ich glaube, deine Berufung ist es, naturwissenschaftlicher Autor zu werden.«33
Seinen Durchbruch erlebte Robert als Elftklässler, im Physikunterricht bei Augustus Klock. »Er war einfach wunderbar«, erzählte Oppenheimer später, »nach dem ersten Jahr war ich so begeistert, dass ich dafür sorgte, den ganzen Sommer über mit ihm arbeiten zu können. Wir bauten die Geräte auf für das nächste Jahr, in dem ich dann Chemie wählte. Wir müssen fünf Tage die Woche zusammen gewesen sein, manchmal haben wir zur Belohnung einen Ausflug unternommen und mineralhaltige Steine gesammelt.«34 Er begann, mit Elektrolyten und Stromleitern zu experimentieren. »Chemie hat mir großen Spaß gemacht … Im Unterschied zur Physik fängt die Chemie mitten in den Dingen an, und bald hat man eine Verbindung zwischen dem, was man sieht, und überraschend vielen Ideen, die man aus der Physik kennt, die dort aber weniger zugänglich sind.« Robert war Klock stets dankbar dafür, dass er ihn auf die naturwissenschaftliche Schiene gesetzt hatte. »Er liebte diese holprige, zufällige Art, in der man wirklich etwas herausfindet, und die Begeisterung, die er bei jungen Leuten wecken konnte.«
Mit sechzehn oder siebzehn hatte er nur einen wirklichen Freund, Francis Fergusson aus New Mexico, der die Schule mit einem Stipendium besuchte. Im letzten Schuljahr waren die beiden in einer Klasse. Im Herbst 1919 hätten sie sich kennengelernt, und schon damals sei Robert alles zugefallen: »Er spielte nur so herum und war stets dabei, irgendetwas zu finden, mit dem er sich beschäftigen konnte.« Neben Kursen in Geschichte, englischer Literatur, Mathematik und Physik schrieb sich Robert noch in Griechisch, Latein, Französisch und Deutsch ein. »Er hatte überall Einsen.« Bei der Abiturfeier hielt er die Rede.35
Sport mochte Robert wie gesagt nicht sonderlich, er wanderte lieber und sammelte Steine, und vor allem: Er ging Segeln. Er war ein wagemutiger und geschickter Segler, der das Äußerste aus einem Boot herausholte. Schon als Junge hatte er sich auf kleineren Booten das Segeln beigebracht, und als er siebzehn wurde, kaufte Julius Oppenheimer seinem Sohn eine Neunmeterschaluppe. Er taufte sie auf den Namen Trimethy, nach der chemischen Verbindung Trimethylen(dioxid). Vor allem, wenn die sommerlichen Stürme aufkamen, segelte er gerne hinaus, jagte sein Boot gegen die Strömung durch die Meerenge bei Fire Island, hinaus auf den Atlantik. Während sein jüngerer Bruder Frank im Cockpit kauerte, stand Robert aufrecht, die Ruderpinne zwischen den Beinen, und schrie ausgelassen in den Wind, bis er das Boot zurück in die Great South Bay von Long Island lavierte. Mehr als einmal sah sich Julius Oppenheimer veranlasst, mit einem Motorboot nach der Trimethy zu suchen, und schalt Robert dafür, dass er sich und andere in Gefahr brachte.36 Der blieb unbeeindruckt, hatte er doch absolutes Vertrauen in seine Fähigkeit, Wind und See zu beherrschen. Seine Freunde sahen ein solches Verhalten, das im Widerspruch zu Roberts Introvertiertheit stand, wenn nicht als Tollkühnheit, so als Zeichen seiner inneren Unruhe an. Er hatte einen unwiderstehlichen Drang, mit der Gefahr zu spielen. Nie habe er, so Fergusson, seinen ersten Segeltörn mit Robert vergessen, beide seien sie damals gerade siebzehn geworden: »Es war ein windiger, ziemlich kalter Frühlingstag, der Wind sorgte für sanfte Wellen in der Bucht, und es regnete leicht. Ich war ein bisschen ängstlich, denn ich wusste nicht, ob er es schaffen würde. Aber er schaffte es, er war schon ein recht tüchtiger Segler. Seine Mutter schaute aus dem Fenster im oberen Stockwerk und bekam vermutlich Zustände. Er hatte sie überredet, ihn hinausfahren zu lassen. Sie machte sich Sorgen, hielt aber durch. Natürlich waren wir völlig durchnässt, aber ich war tief beeindruckt.«
Im Frühjahr 1921 machte Robert seinen Abschluss an der Ethical Culture School, und im Sommer reisten Julius und Ella Oppenheimer mit ihren Söhnen nach Deutschland. Ein paar Wochen ging Robert seine eigenen Wege und besuchte alte Bergwerke bei Joachimsthal im Erzgebirge (wo die Deutschen zwei Jahrzehnte später Uran für ihr Atombombenprojekt abbauten). Er zeltete in der Wildnis und kam mit einem Koffer voller Gesteinsproben zurück sowie mit einer Ruhr-Infektion, an der er fast gestorben wäre.37 Die Rückreise nach Amerika musste er auf einer Krankentrage antreten, und er war so lange ans Bett gefesselt, dass er sich nicht, wie geplant, zum Herbst in Harvard immatrikulieren konnte. Seine Eltern bestanden darauf, dass er sich zu Hause von der Ruhr und einer daran anschließenden Kolitis erholte. Die Folgen dieser Dickdarmentzündung plagten ihn sein Leben lang, und seine Vorliebe für scharf gewürzte Speisen machte seine Beschwerden eher noch schlimmer. Er war auch kein geduldiger Patient. Den ganzen Winter war er in der New Yorker Wohnung eingesperrt und konnte sich ausgesprochen ruppig verhalten, indem er sich beispielsweise in seinem Zimmer einschloss und die mütterliche Pflege brüsk zurückwies.
Im Frühjahr 1922 hielt Julius Oppenheimer seinen Sohn für so weit wiederhergestellt, dass dieser das Haus verlassen durfte. Er bat Herbert Smith, Robert in diesem Sommer auf eine Reise in den Südwesten der Vereinigten Staaten mitzunehmen. Der Lehrer hatte im Sommer zuvor mit einem anderen Schüler eine ähnliche Tour unternommen, und Julius hoffte, ein solches Westernabenteuer würde Robert wieder richtig auf die Beine bringen. Smith sagte zu; vollkommen verblüfft aber war er über die Bitte, die ihm Robert kurz vor der Abreise vortrug: Er möge ihn doch unter dem Namen »Smith« mitreisen lassen, als seinen jüngeren Bruder. Smith lehnte dies rundweg ab; er dachte, Robert wolle nicht als Jude identifiziert werden.38 Auch Klassenkamerad Fergusson überlegte später, ob sein Freund sich »wegen seines Jüdischseins, seines Reichtums und seiner Beziehungen im Osten vielleicht unsicher fühlte und nach New Mexico reisen wollte, um all das hinter sich zu lassen«. Ähnlich glaubte auch die Mitschülerin Jeanette Mirsky, Robert habe Probleme mit seinem Jüdischsein gehabt: »Die hatten wir alle.«39 Ein paar Jahre später in Harvard konnte Robert jedoch offenbar ganz entspannt mit seiner jüdischen Herkunft umgehen; zu einem Freund schottisch-irischer Abstammung sagte er: »Na ja, von uns kam keiner auf der Mayflower hier an.«
Im Südwesten angekommen, zogen Robert und Smith langsam über die Mesas (Hochebenen) New Mexicos. In Albuquerque wohnten sie bei Fergusson und seiner Familie. Robert fühlte sich dort sehr wohl, und der Besuch war schließlich die Basis einer lebenslangen Freundschaft. Fergusson stellte Robert dem gleichaltrigen Paul Horgan vor, damals ein etwas altkluger Junge, später aber ein erfolgreicher Schriftsteller. Noch besser als Horgan gefiel Robert dessen jüngere Schwester Rosemary. Auch Horgan sollte, wie Fergusson, nach Harvard gehen; und die drei hingen auch dort eng aneinander, Horgan nannte sie das »Trio der Universalgelehrten«.40
Von Albuquerque aus nahm Smith Robert und dessen Freunde Paul und Francis mit nach Los Pinos, einer knapp vierzig Kilometer nordöstlich von Santa Fe gelegenen Ferienranch, die von der damals achtundzwanzigjährigen Katherine Chaves Page geführt wurde. Diese charmante und sehr energische junge Frau wurde eine lebenslange Freundin Roberts. Damals aber war er völlig vernarrt in Katherine. Im Jahr zuvor war sie schwer erkrankt und hatte in ihrer Todesangst den Angloamerikaner Winthrop Page geheiratet, der so alt war wie ihr Vater. Doch sie überlebte und wurde wieder gesund. Page, ein Geschäftsmann aus Chicago, kam allerdings selten in die Pecos, wo Katherine »wie eine Prinzessin« über die Farm herrschte, die ihr Vater, ein Hidalgo, aufgebaut hatte. Robert, in glücklichem Überschwang, sah sich als ihr »Favorit«. Er »brachte ihr Blumen und überhäufte sie mit Komplimenten, wenn er sie sah«.41 Tatsächlich wurden die beiden sehr gute Freunde.
Katherine brachte Robert in diesem Sommer das Reiten bei, und bald hatte sie ihn so weit, dass er zu fünf-, sechstägigen Ausritten aufbrechen konnte, auf denen er die wilde, unberührte Landschaft erkundete. Bald ritt er ebenso wagemutig, wie er segelte. Smith war erstaunt über die Zähigkeit und Ausdauer, die sein Zögling beim Reiten zeigte. Immerhin kannte er den Jungen seit dessen vierzehntem Lebensjahr und hatte ihn stets als zart und verletzlich erlebt. Doch als er nun sah, wie sich Robert in der wilden Bergwelt bewegte, unter spartanischen Bedingungen lebte, kein Risiko scheute, fragte er sich, ob die chronische Kolitis nicht vielleicht psychosomatische Ursachen hatte. Sie habe sich stets bemerkbar gemacht, wenn Robert »geringschätzige« Äußerungen über Juden zu Ohren kamen. Vielleicht, so überlegte Smith, hatte er es sich zur Gewohnheit gemacht, belastende Dinge »unter den Teppich zu kehren« – ein psychischer Mechanismus, der Robert, »wenn es hart auf hart ging, in Schwierigkeiten brachte«. Smith hielt viel von Sigmund Freuds damals neuen Theorien über die kindliche Entwicklung und schloss aus den entspannten Gesprächen am Lagerfeuer, dass Robert ödipale Probleme haben müsse: »Ich habe nie auch nur die leiseste Kritik an seiner Mutter gehört, wohl aber an seinem Vater.« Eines Abends am Lagerfeuer erzählte Robert seinem Lehrer von jenem Zwischenfall im Kühlhaus des Sommercamps. Dieser sei natürlich eine Folge der Überreaktion seines Vaters auf seinen Brief gewesen, in dem er berichtet hatte, im Lager werde so viel über Sexuelles geredet. Dem Heranwachsenden sei auch das Textilgeschäft seines Vaters nicht mehr geheuer gewesen, das er wohl als typisch jüdisches Gewerbe betrachtet habe. Eine kleine Episode während ihrer Reise hatte ihn darauf gebracht: Er habe Robert beim Packen gebeten, ihm eine Jacke zusammenzulegen, damit er sie in seinen Koffer legen könne: »Er sah mich scharf an und sagte: ›Ach ja, der Sohn eines Schneiders wird schon wissen, wie das geht, nicht wahr?‹«42
Solche Ausbrüche gab es hin und wieder, insgesamt aber glaubte Smith, dass Robert während der gemeinsamen Zeit auf Los Pinos reifer geworden, sein Selbstvertrauen gewachsen sei. Daran habe auch Katherine Page großen Anteil gehabt; die Freundschaft habe Robert viel bedeutet. Dass Katharine und ihre aristokratischen Hidalgo-Freunde den unsicheren Jungen aus New York in ihren Kreis aufnahmen, war so etwas wie ein Wendepunkt in Roberts Entwicklung: die erste Begegnung mit Menschen, deren Leben außerhalb des warmen Schoßes der Ethical Culture Community stattfand.
Eines Tages unternahmen er, Katherine und einige andere aus Los Pinos einen langen Ausritt. Von Packpferden begleitet, starteten sie in Frijoles, einem westlich des Rio Grande gelegenen Dorf, und ritten nach Süden, durch das Valle Grande, einen Cañon in der Jemez Caldera, einem schüsselförmigen, zwanzig Kilometer breiten Vulkankrater, bis hinauf auf das über dreitausend Meter hoch gelegene Pajarito-Plateau. Von dort ging es weiter, Richtung Nordosten, in einem weiteren Cañon, der nach einer Pappelart, die am Bach im Tal wuchs, Los Alamos genannt wurde. Damals gab es dort im Umkreis von vielen Kilometern nur ein einziges bewohntes Anwesen, die Los Alamos Ranch School, eine spartanische Jungenschule.
Los Alamos war, so der Physiker Emilio Segrè später, eine »schöne und wilde Gegend«, dichte Kiefern- und Zypressenwälder, unterbrochen von kleinen Weideflächen.43 Die Landschule lag auf einer über drei Kilometer langen Mesa, im Norden und Süden von tiefen Cañons begrenzt. Als Robert die Schule 1922 zum ersten Mal besuchte, lebten dort nur fünfundzwanzig Schüler, die meisten von ihnen Söhne neureicher Automobilproduzenten aus Detroit. Sie trugen das ganze Jahr hindurch kurze Hosen und schliefen in ungeheizten Schlafveranden. Jeder Junge war für ein Pferd verantwortlich, häufig ritten sie ins nahe Jemez-Gebirge.44 Robert bewunderte diese Einrichtung, die so ganz anders war als die Ethical Culture School, und in den kommenden Jahren ritt er häufig hinauf in die einsame Mesa.
In diesem Sommer verliebte sich Robert in die Schönheit dieser Landschaft, in die Berge und Wüsten New Mexicos. Einige Monate später, wieder in New York, hörte er, dass Smith eine erneute Reise ins »Hopiland« plane, und schrieb ihm: »Natürlich bin ich wahnsinnig neidisch. Ich sehe Sie aus den Bergen in die Wüste hinunterreiten um die Stunde, da Gewitter und Sonnenuntergänge den ganzen Himmel einnehmen; ich sehe Sie in den Pecos … und im Mondlicht auf Grass Mountain.«45
2. »Jeder im Gefängnis seines Selbst«
Die Vorstellung, dass ich einen geraden, klaren Weg nehmen würde, war falsch.
J. Robert Oppenheimer
Im September 1922 schrieb sich Robert Oppenheimer in Harvard ein; ein ihm angebotenes Stipendium schlug er aus: Er komme ohne dieses Geld zurecht.46 In Standish Hall bekam er ein Einzelzimmer mit Blick auf den Charles River. Der Neunzehnjährige war ein gutaussehender junger Mann, dabei hatte seine äußere Erscheinung in jedem Zug etwas Außergewöhnliches. Eine zarte blasse Haut spannte sich über hohen Wangenknochen. Die Augen waren hell, von blassestem Blau, die Augenbrauen wiederum glänzend schwarz. Seine schwarzen, struppig krausen Haare trug er lang, die Seiten aber waren kurzgeschnitten, und so wirkte er größer als seine schlaksigen eins siebenundsiebzig. Er war ein Leichtgewicht, wog nie mehr als 53 Kilo, erschien geradezu mager. Seine gerade römische Nase, die dünnen Lippen, die großen, fast spitzen Ohren unterstrichen seine Zartgliedrigkeit noch. Er sprach in grammatisch korrekten Sätzen und auf jene höfliche, etwas überladene europäische Art, die ihm die Mutter beigebracht hatte. Und während er sprach, vollführten seine schmalen Hände mit den langen Fingern eigentümlich gewundene Bewegungen. Kurz, eine leicht bizarre und zugleich faszinierende Erscheinung.47
Drei Jahre blieb er in Cambridge, und wiederum machte er, so wie er sich in dieser Zeit verhielt, den Eindruck eines strebsamen, unreifen und im Umgang mit Menschen unbeholfenen jungen Mannes. Sosehr die Zeit in New Mexico ihn anderen gegenüber geöffnet hatte, so deutlich fiel er in Cambridge wieder in seine frühere Introvertiertheit zurück. Seine Talente entwickelten sich prächtig, im sozialen Leben aber machte er kaum Fortschritte. Harvard war ein intellektueller Basar voller geistiger Freuden. Aber er fand dort nicht die behutsame Führung wie in seiner Ethical Culture School. Allein auf sich gestellt zog er sich wieder in den Schutzraum zurück, den ihm sein kraftvoller Intellekt bot. Sein exzentrisches Wesen musste einfach auffallen, und er tat nichts, um diesen Eindruck zu mildern. Häufig ernährte er sich nur von Schokolade, Artischocken und Bier. »Schwarz und Hellbraun«, das war sein Mittagessen – Toast, dick mit Erdnussbutter bestrichen und obendrauf Schokoladensirup. Viele seiner Kommilitonen hielten ihn für schüchtern. Zum Glück waren auch Francis Fergusson und Paul Horgan in Harvard, zwei Seelenverwandte hatte er also. Neue Freundschaften schloss er nur wenige; Jeffries Wyman, ein Student aus der Bostoner Oberschicht, der als Graduierter Biologie studierte, war einer der neuen Freunde. Und wie er sich erinnerte, fiel es Robert »sehr schwer, sich sozial anzupassen, und ich glaube, er war oft unglücklich«.48
Robert, der introvertierte Intellektuelle, wurde von so melancholischen Autoren wie Tschechow und Katherine Mansfield angezogen, seine Lieblingsfigur war Shakespeares Hamlet. Jahre später erinnerte sich Horgan, dass Robert »als junger Mann Anfälle von Schwermut und tiefer Depression hatte, manchmal war er ein, zwei Tage hintereinander völlig unansprechbar. Ich habe das ein- oder zweimal miterlebt, ich war sehr besorgt, wusste einfach nicht, woher das kam.«49
Im Frühjahr des ersten Studienjahrs schloss Robert Freundschaft mit Frederick Bernheim, der die Ethical Culture School ein Jahr nach Robert abgeschlossen hatte und nun einen Vorbereitungskurs für das Medizinstudium absolvierte. Beide interessierten sich für die Naturwissenschaften, und da Fergusson mit einem Rhodes-Stipendium nach England ging, wurde Bernheim bald zu Roberts engstem Freund. Anders als die meisten College-Studenten, die in der Regel viele Bekanntschaften haben, pflegte Robert wenige, aber intensive Freundschaften.
Im September 1923, zu Beginn ihres zweiten Jahres am College, beschlossen er und Bernheim, zwei nebeneinanderliegende Zimmer in der Mount Auburn Street 60 zu mieten, einem alten Haus in der Nähe der Redaktion des Harvard Crimson