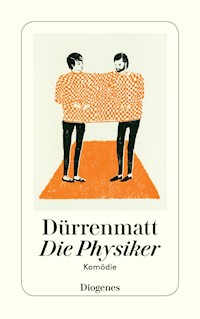Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: v. Hase & Koehler
- Kategorie: Poesie und Drama
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2023
Die vorliegende Studie von Simonetta Sanna legt eine spannende Psychotopografie Venedigs aus dem Blickwinkel des preußischen Offiziers Otto Ferdinand Dubislav von Pirch (1799–1832) vor. Als Topograf und Verfasser von Reisebeschreibungen widmete er sich der Lagunenstadt mit »der ganzen Seele voll Aufmerksamkeit«. Er lässt die Leserinnen und Leser an der reichen Palette seiner Sinneswahrnehmungen teilhaben, so intensiv, dass das fremde Ambiente zu vollem Leben zu erwachen scheint. Auch zukunftsweisende ethische und ästhetische Zusammenhänge fing er ein, Bilder, die in der Imagination bis heute fortwirken. Mit Caragoli (1832–1834) hat Otto von Pirch ein originelles Kapitel in der langen Geschichte der Venedig-Darstellungen geschrieben.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 154
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Simonetta Sanna
Otto von Pirchs Caragoli (1832)
Ein preußischer Offizier in Venedig
v. Hase & Koehler
Erste Auflage 2023
© v. Hase & Koehler ist ein Imprintder Velbrück GmbH, Weilerswist-Metternich 2023
Satz: Gaja Busch, Berlin
Coverlayout: Helmi Schwarz-Seibt, Leverkusen,Abbildung unter Verwendung einer Mischtechnik von© Franco Masia, Markusplatz in der Dämmerung
Printed in Germany
ISBN 978-3-7758-1424-9
eISBN 978-3-7758-1428-7
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
I. Einleitung: Otto von Pirch, Offiziersleben, Reisebücher und andere Schriften
Caragoli
II. Venedig: Psychotopografie der urbs ludens
Der Raum, die Räume
Die Zeit
Die Venezianerinnen
III. Psychotopografie des erzählenden Ich: die heimische Fremde
Anmerkungen
Bibliografie
Namensregister
Vorwort
Ein Werk vermag gelegentlich aufgrund seiner Bedeutung, aber auch der besonderen Anlagen, der wachen Intelligenz und der menschlichen Aufgeschlossenheit seines Autors zu bestechen. Umso erstaunlicher ist es, all diese Eigenschaften in einem nahezu unbekannten Autor anzutreffen wie Otto Ferdinand Dubislav von Pirch, dem Berufsoffizier und Verfasser einiger Reisebücher, so eines Berichts Reise in Serbien im Spätherbst 1829 (2 Bde., Berlin 1830) und Caragoli (3 Bde., Berlin 1832/34). Wenngleich letztere seine Erkundungen des habsburgischen Ungarn und Italien, der österreichisch-türkischen Militärgrenze von Slawonien und Kroatien beschreiben, geht der Titel auf seinen Venedig-Aufenthalt zurück, wie der Autor in der Zueignung an einen ungenannten Freund erklärt: »Ich habe diesen Mittheilungen den Namen der kleinen venezianischen Muscheln gegeben, welche, leicht aufgefunden und aneinandergereiht, ihren Werth von dem Lichte erhalten, in welchem Du sie betrachtest.« Die Venedig gewidmeten Seiten, die fast das ganze zweite Buch einnehmen, stehen im Mittelpunkt der folgenden Ausführungen. Goethe meinte wahrlich zu Recht, dass von »Venedig schon viel erzählt und gedruckt« worden ist. Dennoch stellen Pirchs Mitteilungen ein originelles Kapitel der langen Geschichte der literarischen Vermittlungen zur Lagunenstadt dar, in der er sich zwischen dem 24. Januar und dem 18. Februar 1830 aufhielt.
Der preußische Offizier, der mit 32 Jahren starb, nahm Venedig nicht nur differenziert wahr, sondern wusste zukunftsweisende ethische und ästhetische Zusammenhänge einzufangen. Zudem erlaubt Caragoli gleichsam die psychologischen Dispositionen dieses jungen Deutschen zu erfassen, der sich mit einer fremden und in seiner Fremdheit einzigartigen Stadt konfrontiert sah. Namentlich die mehr als zweihundert Seiten zu Venedig vermitteln dem Leser die eindrucksvolle ›Psycho-Topografie‹ bzw. die ›geo-poetische‹ Mappatur – Begriffe, die im Folgenden erläutert werden sollen – eines Autors, bei dem die Bestandanalyse der inneren Verfasstheit mit einer außergewöhnlichen Öffnung gegenüber seiner Umwelt einherging. Die vielen Gesichter der Dogenstadt ermöglichten dem Autor, die reiche Palette seiner Sinneswahrnehmungen und mit ihnen das fremde Ambiente zu vollem Leben erwachen zu lassen, zumal der Autor, der gewöhnlich seinen Verpflichtungen nachkam, die Fähigkeit besaß, sich der Erfahrung der Stadt ungeteilt hinzugeben: An die Stelle starrer erwartungskonformer Demarkationen setzte er die rege Vermittlung der Gegensätze. Dergestalt vermied es Pirch, dass sich die Eindrücke, wie oft bei fremdländischen Reisenden »um sie selbst, um die Vorzüge ihres Landes« drehten. Da sie auf diesem Wege »nie zu einem freien Vergleich, zur Auffassung einer Eigenthümlichkeit des fremden Landes« gelangten, war das Ergebnis, dass ihnen »alles Fremde fremd« blieb, wie der Offizier gleich im Vorwort zu Caragoli mitteilt. Der preußische Adlige nahm sich indes die Freiheit, der fremden Welt in sich und außer sich »die ganze Seele voll Aufmerksamkeit zu widmen«, zumal die Differenziertheit seiner Selbstbeobachtung der seines Weltverständnisses zu entsprechen versprach.
Otto von Pirchs Erfahrungsmodus ist heute umso bestrickender, als sich die Voraussetzungen einer lebenszugewandten Wahrnehmungs-, Denk-, Urteils- und Handlungsweise nicht grundsätzlich gewandelt haben, sondern weiterhin in der Durchdringung des eigenen komplexen Selbst und der Aufgeschlossenheit gegenüber der Vielfältigkeit der Umwelt bestehen. Eben dieser Kontakt zu den eigenen Wahrnehmungen, die auf das leibliche, erfahrende, bewusste und sich erinnernde Subjekt bezogen bleiben, ermöglichte es dem Autor, sich selbst und die Grundsätze des Eigenen bzw. des »bei uns«, wie er es nannte, infrage zu stellen und sich dem Fremden und Befremdenden zu öffnen. Allgemeiner gefasst, vermitteln Pirchs Reisebeschreibungen die Einsicht, dass der Bewegungs- und Handlungsraum der eindeutigen Zugehörigkeit allemal kleiner und einförmiger ist als der Freiraum des Dahinter, das unumschränkte Ausland und die Fremde.
Nicht von ungefähr verband der preußische Offizier seine Titelwahl mit einem Hinweis auf die Perspektive, genauer noch: auf das Licht, von dem aus man die titelgebenden spiralförmigen caragoli-Muscheln betrachtete, mit einem im Schlusssatz des Vorworts an den Leser gerichteten Wunsch: »Möge es ein freundliches sein.« Die Mitteilungen zu Venedig entwerfen wunschgemäß einen Erwartungshorizont, wie er ihnen in den Augen des Autors angemessen war, und mithin das Bild eines Lesers, den er sich geneigt wünscht, den Gegenstand durch die eigene Lektüreerfahrung sinnlich und reflexiv zu durchdringen. Scheint das Venedigerlebnis von Otto Ferdinand Dubislav von Pirch auf den ersten Blick unmittelbar einsichtig, so erweist es sich bei näherem Zusehen als frische und ungehemmte Variation des sapienti sat, der Einsichtigen, die aus dem Vollen der Erfahrung schöpfen, aber auch der longissima via, des unendlichen Weges, der zu dieser Weisheit führt. Der Leseakt bleibt an die Selbstverortung des Lesers in Innen- und Außenwelt gebunden. Das Ziel besteht offenbar in der Reise selbst. Insofern dient auch unsere Lektüre einzig als Vorlage, die den Leser dazu ermutigen will, sein eigenes ›freundliches Licht‹ auf Caragoli zu entwickeln.1
Simonetta Sanna
Berlin, Februar 2023
I.
Einleitung
Otto Ferdinand Dubislav von Pirch, Offiziersleben, Reisebücher und andere Schriften
»Nur die ergangenen Gedanken haben Wert.«(Friedrich Nietzsche, Götzen-Dämmerung)
Aus der Perspektive der deutschen Literatur macht der berühmte Heinrich, großer Dichter und missglückter Berufsoffizier, die Differenz, sonst würde die Militäraristokratie derer von Pirch, die bis auf das XIII. Jahrhundert zurückgeht, womöglich bekannter sein als die derer von Kleist. Einst in Böhmen ansässig, folgen die von Pirscha, später von Pirch, dem Deutschen Ritter-Orden nach Norden. Jasbon von Pirch, der 1376 nach Pommern kam, war dessen Heermeister, während sein Sohn Gützlaff schon Generalissimus des kaiserlichen Kriegsheeres war. Seitdem hatten die von Pirch Zugang zum Hof, einige der jüngeren als Pagen.
Generäle sind die Brüder des Urgroßvaters von Otto Ferdinand Dubislav, Georg Ernst von Pirch, und einige seiner Söhne, darunter Johann Ernst, der in französische Dienste trat, 1783 mit seinem Regiment nach Amerika übersetzen sollte, aber überraschend bei Cádiz verstarb. Von den neun Söhnen des Großvaters, Franz Otto, haben sechs die militärische Laufbahn eingeschlagen. Unter ihnen der Vater des Autors von Caragoli, Generalleutnant Christoph Wilhelm Rüdiger, und dessen Brüder Georg Dubislav Ludwig und Otto Karl Lorenz, dem sämtliche Militärschulen Preußens unterstanden. Auf den Namen Dubislav hörten mehrere der Vorfahren.
In Jahre 1807 heiratete Christoph Wilhelm Rüdiger Amalie Elisabethe Isabelle Louise von Lynker, Tochter von Heinrich Ferdinand Christian Freiherr von Lynker, dem Geheimrat und späteren Kanzler in fürstlich schwarzburgischen Diensten. Aus der Ehe gingen zwei Söhne und drei Töchter hervor, von denen allerdings nur eine Tochter und eben Otto Ferdinand Dubislav von Pirch (1799–1832, von nun an einfach Otto von Pirch) überlebten. Der Sohn kam am 1. Mai 1799 in Bayreuth zur Welt, wo sein Vater Kapitän eines Infanterie-Regimentes war.2
Schon als Kind genoss er eine gute Erziehung bei angesehenen Pädagogen. Beachtenswerter könnte jedoch eine andere Begebenheit sein: die Bekanntschaft mit Jean Paul (eigentlich Johann Paul Friedrich Richter), dem in einem protestantischen Landpfarrhaus aufgewachsenen Schriftsteller von überschwänglicher Fantasie und ansteckendem Humor, der 1804 mit seiner Frau und seinen beiden Kindern in Bayreuth wohnte. Als schöner kluger Junge gewinnt der Schriftsteller Otto Ferdinand Dubislav lieb, sodass dieser in Jean Pauls Haus seine freien Stunden mit dessen Kindern verlebte.
1807 zieht die Familie nach Potsdam und später nach Berlin um. Hier wird Otto von Pirch das renommierte Gymnasium Regium Joachimicum, die 1607 gegründete Fürstenschule für begabte Knaben, besuchen. Er war zu jung, um an den antinapoleonischen Kriegen teilzunehmen. Doch als der Imperator erneut die europäischen Monarchien bedrängte, stürzte sich der kaum sechzehnjährige Sprössling derer von Pirch in die Schlacht, zunächst als Volontär bei der Garde du Corps und nach kurzer Frist beim 2. Dragoner-Regiment. Er brillierte bei Ligny und Belle-Alliance, sodass ihm der König entweder das Ritterkreuz oder eine Offiziersstelle anbot.
Der spätere Autor von Caragoli entschied sich für Letztere und diente beim 6. Infanterie-Regiment und beim 1. Regiment Garde zu Fuß. Zunächst aber kehrte er zum Studium zurück, weitete seine Kenntnisse der europäischen Sprachen aus und las insbesondere französische Autoren, von dem Historiker Jean de Joinville bis zu den Schriftstellern Jean Racine und Alphonse de Lamartine, deren Werke er auch gern rezitierte.3 Drei Jahre lang besuchte er die allgemeine Kriegsschule, in der er militärische Wissenschaften, Technik, Geschichte und Kriegsstrategie studierte, namentlich der Artillerie, ohne dabei die humanistischen Disziplinen zu vernachlässigen. 1820 kehrte er für ein Jahr zum praktischen Dienst zurück, wurde aber ab 1821 als Spezialist in Geodäsie, d.h. in der Ausmessung und Abbildung der Erdoberfläche, ins topografische Bureau des Generalstabs zu Berlin versetzt.
In dieser Funktion wurde er 1826 in den Distrikt Posen (Poznań) nach Polen entsandt, um im Dreieck von Lubiatowo, Obstrowieczno und der Abtei von Gostyn topografische Reliefs vorzunehmen. Daraus ging ein erster Reisebericht mit dem Titel Reise-Erinnerungen aus dem Jahre 1826 hervor, der posthum im dritten Band von Caragoli (1834) publiziert worden ist. Otto von Pirch war erst 27 Jahre alt, und doch weisen die Aufzeichnungen schon die Eigenschaften auf, die ihm vom Verfasser seiner Kurzbiografie im dritten Band zuerkannt worden sind: »Scharfsinn, Beobachtungsgabe, Gegenwart des Geistes« (C3: XIII): »Was vorzugsweise verdient herausgehoben zu werden, weiß er in solchen Zügen darzustellen, daß man gleichsam mit mittelbarer Gegenwart des Gegenstandes getäuscht wird« (XIV), worüber – wie wir sehen werden – »die Caragoli selbst einen hinreichenden Beweis« (XII) lieferten.
Im Jahre 1829 ersuchte Pirch um Erlaubnis, an dem Feldzug gegen die Türken teilzunehmen, doch wurde sie ihm verweigert, da dies nur den älteren Offizieren zustand. Also erbat er einen achtmonatigen Urlaub, um die habsburgischen Staaten und die Schweiz zu bereisen (C3: XII). Hatte er früher das Gebiet um das Fichtelgebirge, die Rheingegend und die Alpen um Salzburg und Tirol namentlich seiner wissenschaftlichen Studien wegen durchwandert, so hegte er jetzt andere Absichten. Seine neue abenteuerliche Reiseroute war eine davon, und sie ging in zwei Reisebücher ein: in Reise in Serbien im Spätherbst 1829, die 1830 publiziert wurde, und eben Caragoli, deren erste zwei Bände 1832 (der dritte erst posthum, 1834) erschienen sind. Welche Beziehung verband die beiden Werke?
Der erste Band von Caragoli handelte unter anderem von Pirchs Aufenthalt in Semlin (Zemun) im Jahre 1829, wobei er die Stadt als »Hauptübergang aus dem gebildeten Europa ins türkische Reich«, zugleich als »Hauptberührungspunkt beider Theile« (C1: 161) bezeichnete. Doch fügte er hinzu, gleichsam en passant: »Laß uns gleich einen Punkt aufsuchen, wo wir Belgrad ins Auge fassen können« (162), zumal ihn Serbien außerordentlich interessierte:
Sobald man aus der Stadt an den Donaurand getreten ist, sieht man die weiße Türkenfeste vor sich; die höher liegende Burg ist uns zugekehrt, vor der eigentlichen Stadt sieht man nur den Theil, der sich unten an der Save hinzieht. Was so oft unsere Einbildungskraft beschäftigte, die Moscheen, die schlanken Minarets steigen nun vor uns auf, wir horchen, ob wir nicht die Stimme des Muezzin vernehmen, der die Stunde des Gebets abruft, und suchen mit Hülfe des Fernglases die edeln Gestalten in ihrer reichen und malerischen Kleidung zu entdecken, die uns schon längst in Bildern und Masken vorüberzogen. Aber die Entfernung ist zu groß. – Du fragst, warum wir nicht hinüber eilen, um einige Tage in dem fremden Lande, in der alten, denkwürdigen Feste zu verweilen und alles genau in Augenschein zu nehmen, vielleicht eine Audienz beim Pascha zu erlangen, wenigstens einen Blick auf die dicht verhüllten Frauengemächer zu werfen und einen Begriff von orientalischer Pracht mit in die Heimath zurück zu nehmen? – Das alles ist aber nicht so leicht, als es uns von fern her erscheint. (C1: 163)
Das Faszinosum des ›fremden Landes‹ ist groß – und doch schien der Offizier resigniert zu haben: »Wenden wir uns also nach Semlin zurück« (165). Er hat wohl geglaubt, sich – trotz der Leserfrage – der Notwendigkeit beugen zu müssen. Auch erweckt er den Eindruck, als sei nichts Ungewöhnliches geschehen, zumal er die Reise erst im September begonnen hatte und ihm noch viele Abenteuer bevorstanden. Dann aber gibt er unterwartet das Wort an einen sehr romantischen Freund weiter, dessen Notizen aus dem Tagebuche (172) er sich angeblich verschafft hatte und der seinerseits von sich behauptete:
Im Grunde freute ich mich auf die Contumaz, so im Widerspruche ist der menschliche Geist befangen. Denn schon seit früher Jugend, seit der Zeit, wo mein Gemüth sich romantisch auszubilden begann, war es mein geheimer, immer lebhafter werdenden Wunsch, einmal, wo möglich als höchst bedeutender verkannter Staatsmann, im Gefängnis zu schmachten; und es schien mir keine Aufgabe stolzer und schöner, als auch in Ketten frei zu sein. (C1: 172–173)
Was nun folgt ist, Seite für Seite (172–192), eine lange Beschreibung der forcierten Isolierung dieses Freundes, dem demnächst ein Zimmer für »distinguierte Personen« (C1: 177) zugestanden werden wird, im Quarantänezentrum von Semlin:
Wir traten in das Viereck ein, das Thor schloß sich hinter uns, und wir waren in dem Fegefeuer zwischen böse und gut, zwischen vermischt und rein, schwebend zwischen dem gebildeten und rohen Theil von Europa, zwischen dem Morgen- und Abendlande. (C1: 174)
Der Widersprüche gibt es genug, doch dabei belässt es Pirch nicht. Denn in der Anstalt lernt der Freund seinerseits einen jungen Türken kennen. Dieser spricht überraschenderweise ein »kostbares wienerisches Juden-Deutsch« (C1: 180) und entpuppt sich auch bald als Sohn jüdischer Eltern aus Wien. Acht Jahre in türkischer Gefangenschaft hatte er hinter sich und hatte dabei viele Abenteuer erlebt. Von seinen Erzählungen überwältigt, plante Pirchs besagter Freund, die Memoiren eines Contumazirenden, oder Mechmet Mendelssohn Weid, so der ironische Titel,4 zu publizieren, wobei für ihn »die Schilderung der Personen mit denen er zu thun hatte, die nationellen Eigenthümlichkeiten der Bewohner […] den bei weitem interessantesten Theil seiner Mittheilungen aus[machten]« (C1: 183).
So weit, so gut. Die im September einsetzende Reisebeschreibung von Otto von Pirch wird auf alle Fälle unterbrochen. Und an irgendeinem Tag im Dezember setzt der Offizier seinen Bericht fort. Was hat er inzwischen gemacht? Wo war er verblieben? In den Aufzeichnungen schwieg sich Pirch aus, wenngleich die spärlichen Angaben ante quem und post quem des Semlin-Besuches den Leser misstrauisch machen sollten. Sollte der Erzähler der dreifachen Erzählung bzw. der zweifachen Binnenhandlung mit je einem alter ego des Haupterzählers einen guten Sinn für Humor bewiesen und es auf eine mise en abyme im Vorgriff auf eine Tagebucheintrag von André Gides vom Sommer 1893 abgesehen haben: »Es gefällt mir sehr, wenn der Gegenstand eines Kunstwerks im Spektrum seiner Charaktere ein weiteres Mal umgesetzt ist – ähnlich dem Verfahren, ein Wappen in seinem Feld wiederum abzubilden (mettre en abyme)«?5
Denn tatsächlich hat sich Otto von Pirch alles andere als den Schwierigkeiten ergeben und auf den Besuch des fremden Landes, das schon »so oft [seine] Einbildungskraft beschäftigte«, verzichtet: Er hat die Reise nach Serbien auf sich genommen und am 8. Oktober Belgrad erreicht. Der Autor berichtete davon, freilich nicht in Caragoli – wo er den Leser mittels eines fingierten Tagebuchs auf die falsche Fährte zu führen bzw. hinzuhalten vermochte, sondern in den zwei Bänden seiner Reise in Serbien im Spätherbst 1829, an deren Stil er hatte feilen können. Erst hier bekennt der Offizier: »Auf einer Reise durch Ungarn nach Italien begriffen, erfuhr ich in Pesth den Friedensschluß von Adrianopel. Der lange gehegte Wunsch, Serbien kennen zu lernen, wurde nun ausführbarer.«6 Der Friede zwischen der Türkei und Russland, schon damals Serbiens Verbündete, hat das Ende des Krieges von 1828–1829 herbeigeführt, an dem der junge Preuße hatte teilnehmen wollen. So kam es, dass ihm endlich der zur Reise nötige Passierschein erlassen werden konnte. Seine Motivation hatte sich in der Zwischenzeit seit der erst verweigerten und dann doch gewährten Erlaubnis wenig verändert. Sie war noch immer sehr hochgesteckt. Einerseits interessierte Pirch ein Abstecher in ein Land, das – im Vergleich zu den anderen durch das Ottomanische Reich eroberten Regionen – nicht nur über eine relative kulturelle und ökonomische Selbstständigkeit verfügte, sondern auch durch seine Kultur beeindruckte:
Einzelne Aufsätze, dann die Volkslieder, hatten mein Interesse für das Land eingeflößt. Je mehr ich darüber las, desto bedeutender erscheint mir auch in politischer Hinsicht die Stellung Serbiens, desto wahrscheinlicher sein einst großer Einfluß auf die Angelegenheiten der Türkei, desto mehr der Mühe wert hielt ich es, Land und Bewohner genauer kennen zu lernen. Ich gestehe gern, daß mir der Gedanke, wie wenig bekannt das Innere dieses Landes und seine Verhältnisse sei, ein Reiz mehr war, die Hindernisse und Mühseligkeiten zu überwinden. (RS1, 1–2)
Doch das sind noch nicht alle Gründe des Interesses. Überdies hatte Pirch von der Anwesenheit Vuk Stefanović Karadžićs in Semlin erfahren. Der bedeutende Sprachreformer, Ethnologe, Dichter, Übersetzer und Diplomat unterhielt nicht nur zahlreiche Kontakte zur deutschen Gelehrtenwelt. Mit seiner Volkslied-Edition war er zudem um die Propagierung der serbischen Volkslieder, die Pirch wie gesagt liebte,7 und um die serbische Sprachreform bemüht. Er war Autor eines Wörterbuchs des Serbischen – eine Sprache, die der Offizier in ihren Grundlinien bekannt war – und einer Grammatik, die Jacob Grimm ins Deutsche übersetzte. Kurz gesagt, die Würfel waren gefallen. Der preußische Adlige machte sich auf die Reise in ein Land, welches weder die grand tour noch die Bildungsreise des gehobenen Bürgertums je in Betracht gezogen hatten. In seinen vorausweisenden Reisenotizen konnte er von den antiken Traditionen eines Volkes und seinem konstitutionellen Fürsten berichten, Miloš Obrenović, dem Begründer der serbischen Herrscherdynastie der Obrenovići, der Analphabet war und dennoch zu einem erfolgreichen Förderer der serbischen Eigenstaatlichkeit wurde. Der Offizier jedenfalls war offen und flexibel genug, sowohl dem Volk als auch dem Herrscher in ihrer Eigentümlichkeit zu begegnen, um ein Lieblingswort von Franz Kafka zu benutzen, der ein beharrlicher Verteidiger der Besonderheit eines jeden Individuums war.
Die wesentliche Absicht des Serbienbuches – auf die er selbst verwies – war jedoch: Otto von Pirch war sich der Bedeutung, die dem Balkan für das künftige europäische Gleichgewicht zukommen könnte, bewusst.8