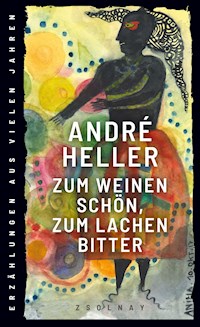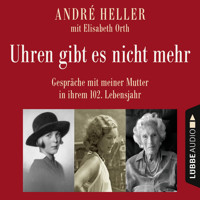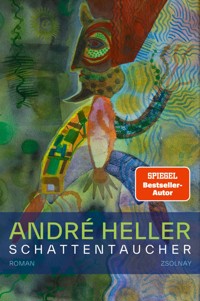
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Paul Zsolnay Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2024
Die Wiederentdeckung des Debütromans von André Heller – über Wien und den Klavierstimmer Ferdinand Alt
„,Ich kenn’ Sie‘, sagte der Mann, ,Sie sind der Herr Alt, Ferdinand oder so. Ihr Vater war ein Meschiggener, aber sehr tüchtig … Ihre Mutter war die berühmteste Tänzerin bei den Hakoah-Festen …‘“
Nächtliche Streifzüge, erotische Ausflüge, Träume und Phantasien – ein Roman aus 61 Beschreibungen, die in der Gegenwart beginnen und immer tiefer in die Kindheit des Klavierstimmers Ferdinand Alt zurückreichen. André Heller benutzt sie, um Stück für Stück eine Ansicht seiner Heimatstadt Wien und zugleich ein Bildnis seines Titelhelden zusammenzusetzen. Ein wundersames Spiel aus Anekdotischem und Autobiographischem.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 163
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über das Buch
»,Ich kenn’ Sie‹, sagte der Mann, ,Sie sind der Herr Alt, Ferdinand oder so. Ihr Vater war ein Meschiggener, aber sehr tüchtig … Ihre Mutter war die berühmteste Tänzerin bei den Hakoah-Festen …‹«Nächtliche Streifzüge, erotische Ausflüge, Träume und Phantasien — ein Roman aus 61 Beschreibungen, die in der Gegenwart beginnen und immer tiefer in die Kindheit des Klavierstimmers Ferdinand Alt zurückreichen. André Heller benutzt sie, um Stück für Stück eine Ansicht seiner Heimatstadt Wien und zugleich ein Bildnis seines Titelhelden zusammenzusetzen. Ein wundersames Spiel aus Anekdotischem und Autobiographischem.
André Heller
Schattentaucher
61 Beschreibungen aus dem Leben des Ferdinand Alt
Roman
Mit einem Text von Josef Winkler
Paul Zsolnay Verlag
Für Kiwi, Lucky und Lily, später einmal
1
»Ich kenn’ Sie«, sagte der Mann, »Sie sind der Herr Alt, Ferdinand oder so. Ihr Vater war ein Meschiggener, aber sehr tüchtig. Hab’ mit ihm Geschäfte gemacht, keine großen, keine schlechten. Ihre Mutter war die berühmteste Tänzerin bei den Hakoah-Festen, sie und der Teddy Herzog. Was ich erzähl’, spielt vor dem Krieg, nachher hat’s ka Tanzen mehr gegeben, hat sich ausgetanzt. Wann sind Sie geboren?«
»1944 in Bolivien«, antwortete Ferdinand, den dieser Überfall an seinem Stammtisch im Café Stern nicht im Geringsten störte.
»Bolivien. In der Zeit hat man als Jude froh sein müssen, wenn man überhaupt geboren wurde. Ein heißes Land, Bolivien. Mit lauter Schwindlern. Und jetzt sind die Nazis auch noch dort.«
»Kennen Sie Südamerika?«, fragte Ferdinand.
»Nicht direkt. Aber Hitze verdirbt den Charakter, überall, auch in Israel. Man wird müd’, faul, blöd, und wenn man bemerkt, dass man viel Zeit verloren hat, versucht man, durch Gaunereien aufzuholen. Hände weg von der Hitze! Österreich, das is’ a Land, immer hat man an kühlen Kopf. Wenn ich so jung wär’ wie Sie, wär’ ich längst Millionär. Das Geld liegt doch auf der Straße. Was is’ Ihr Beruf?«
»Klavierstimmer, eigentlich Komponist.«
»Eigentlich«, wiederholte der Mann. »A Meschiggener wie sein Vater. Warum machen Sie nicht Import-Export? So wie Sie ausschauen, wird man Ihnen vertrauen. A ehrliches Gesicht ist das beste Grundkapital. Komponieren können Sie nebenbei. Der Verdi war, glaub’ ich, auch hauptberuflich Weinhändler.«
»Das stimmt nicht«, sagte Ferdinand, »ist aber ein hübscher Gedanke.«
»Na also«, sagte der Mann. »Wenn Sie bis heute nicht berühmt sind, und, unter uns, ich hab’ noch nie von Ihnen als Komponist gehört, und ich les’ alle Zeitungen, dann gründen Sie eine Firma. Mit meinen Verbindungen haben Sie bald ein Imperium. Und die Musik, das arrangiert sich dann. Jeder von uns hat eine verschleppte Kränk.«
»Eine was?«, fragte Ferdinand.
»Eine verschleppte Kränk. Eine Sehnsucht, die einen traurig macht. Etwas, das hätte sein sollen, aber nicht hat sollen sein.«
»Sie sind ja wahnsinnig«, kam es aus Ferdinand.
»Man weiß doch, wozu man berufen ist.«
»Man weiß ganz genau einen Tinnef«, seufzte der Mann, dessen gelbe Wildlederhandschuhe wie kleine Kometen vor dem dunklen Gilet seines Anzugs hin- und herzogen. »Hätt’ ich mir gedacht, dass mir Frau und Tochter sterben, binnen einer Nacht, nicht im KZ, nicht auf der Flucht, nein, im zweiten Sommer nach dem Schrecken. Gerade wie wir wieder gelernt haben zu lachen. Simon, wirst du sorgen können für dich selbst? Warum, Rosel, hab’ ich gefragt, warum redest du so was? Weil es die Ewigkeit für uns auf Erden nicht gibt, hat sie geantwortet. Aber Rosel, noch ist mehr als ein halbes Leben vor uns, und es kann nur besser werden als das, was war.
Sicher, du hast recht, Simon. Und in derselben Nacht, wie ich geschlafen hab’, hat sie sich und unser Kind vergiftet. Kein Brief, keine Erklärung. Einen Tinnef wissen wir, lieber Freund.«
»Wer sind Sie?«, sagte Ferdinand, »was wollen Sie von mir?«
»Ich bin sozusagen ein Vorschlag. Wissen Sie, was der Baal Schem Tov geschrieben hat?«
»Nein«, sagte Ferdinand und schob ihm einen Sessel hin.
»Ein König baute einst einen großen und herrlichen Palast mit tausend Gemächern«, erzählte der Mann, während er sich niedersetzte, »aber nur ein Tor war geöffnet. Und als der Bau vollendet war, wurde verkündet, es sollten alle Fürsten erscheinen vor dem König, der in dem letzten der Gemächer throne. Aber als sie eintraten, da waren Türen offen nach allen Seiten, von denen führten gewundene Gänge in die Fernen. Und da waren wieder Türen und wieder Gänge, und kein Ende stand vor dem verwirrten Auge. Da kam der Sohn des Königs und sah, dass alles nur eine Spiegelung war, und sah seinen Vater sitzen in der Halle vor seinem Angesicht.
Das Geheimnis der Gnade ist nicht zu deuten, lieber Freund. Zwischen Suchen und Finden liegt ein ganzes Menschenleben und vielleicht tausendfache Wiederkehr der bangen, wandernden Seele. Und doch ist der Flug des Augenblicks langsamer als die Erfüllung. Denn Gott will gesucht sein, und wie könnte er nicht gefunden sein wollen?
Die Andacht bedeutet nicht den Zweck, sondern das Ziel. Es gibt aber nur ein Ziel, das nicht lügt, das sich in keinem neuen Weg verfängt, in das alle Wege münden, vor dem kein Abweg ewig flüchten kann: die Erlösung. Das schreibt der Baal Schem Tov. Und nun zu meinem Vorschlag. Ich biete tausend Schilling die Stunde, wenn Sie mir manchmal zuhören.«
»Wie kommen Sie denn darauf?«, entgegnete Ferdinand.
»Weil es so weit ist«, flüsterte der Mann.
»Wie weit?«
»So weit, dass ich so einsam bin«, sagte der Mann.
2
Ferdinand empfand das Bedürfnis, eines jener erotischen Kabaretts zu besuchen, die dem sogenannten Nachtleben der Wiener Innenstadt den letzten Schliff vollendeter Trostlosigkeit gaben. Er tat dies gelegentlich als Medizin gegen seine Verstörungen, denn ein Aufenthalt von wenigen Minuten dort genügte ihm schon, um sich wieder wohler zu fühlen. Er musste lediglich seine eigene Verfassung an jener des Lokals messen und konnte sicher sein, dass der Vergleich stets zu seinen Gunsten ausfallen würde.
Er setzte sich in solchen Fällen nicht einmal nieder, erkaufte sich lediglich mit einem hohen Trinkgeld vom Oberkellner die Erlaubnis, mit einem Glas trockenen Sherrys in der Hand zwischen den Tischen herumzuspazieren und alles ausführlich zu betrachten.
Auf der kleinen, rot ausgeschlagenen Bühne produzierte sich jetzt ein spindeldürres Männchen, indem es Fratzen schnitt, quiekte, die Tonleiter hinauf- und hinunterräusperte, sich mit der linken Hand an den Haaren in die Luft ziehen wollte, während die rechte und beide Beine schuhplattelten. Alle fünf Takte unterbrach es sich mit einem großartigen Erschrecken, als sei ihm ein schwerer Stein auf den Rücken gefallen, und schwankte für Augenblicke, um zur hämischen Säule zu erstarren, die ihre Auflösung in einem »soldi, soldi« brüllenden, purzelbaumschlagenden Veitstänzer fand.
All dies war als komische Nummer gedacht, aber in seiner tatsächlichen Wirkung jener traurigen Spannung vergleichbar, die sich einstellt, wenn man Gelegenheit hat, einen gefährlichen chirurgischen Eingriff an einem guten Bekannten zu beobachten. Ferdinand war es von Kindheit an unerträglich gewesen, anderer Leute Misserfolge beizuwohnen. Sooft ein Schauspieler den Text vergaß oder sich jemand mit hochrotem Kopf bei einer Lüge ertappt wusste, brach ihm der Schweiß aus. Ja, selbst die Ablehnung eines ihm wildfremden Tanzbewerbers durch eine ihm ebenso fremde Dame empfand er als beinahe persönliche Schmach oder zumindest als etwas, das durch unerklärliche Zusammenhänge in seine Verantwortung fiel.
Die etwa drei Meter von ihm entfernte Figur war nun dazu übergegangen, Tiere zu imitieren; die ersten beiden mochten Löwe und Lamm sein, verkamen aber alsbald zu winselnden Lemuren. Die Vorführung nahm den Charakter einer Zeremonie an, und Ferdinand dachte unwillkürlich an die Geschichte jenes Turiner Installateurgehilfen, der eine junge Nonne missbraucht und erwürgt hatte und am darauffolgenden Tag mit falschen Papieren nach Holland geflohen war, wo er fortan, um nicht als Mörder in Betracht zu kommen, seine beiden Arme an den Körper bandagierte und unter ärmellosen Hemden und Sakkos verbarg, wobei er gleichzeitig eine Fußgeschicklichkeit sondergleichen entwickelte, die es ihm ermöglichte, als Fußmaler und Fußgeiger in erstklassigen Varietés Ruhm zu erwerben, bis eine eifersüchtige Geliebte den Schwindel aufdeckte und er sich erhängte.
Einen Menschen dieser Art wähnte Ferdinand nun in dem Artisten vor sich, einen, der eine schwere Schuld dadurch unfreiwillig zu erkennen gab, dass er besonders auffällig von ihr abzulenken versuchte.
Blechinstrumente intonierten verhalten einen Tango, Tücher schienen auf alles und jeden zu fallen, die Bewegungen der Kellner verlangsamend, die Konturen der Gäste bauschend. Ferdinand suchte in unmittelbarer Umgebung nach einem Griff, ähnlich Taumelnden in der Straßenbahn bei unvorhergesehenen Bremsungen, aber dann musste er laut lachen, weil er bemerkte, wie er sich mit aller Kraft in sein eigenes Stürzen gelehnt hatte, als sei es aus unverrückbarem Marmor.
3
Nachts begegnete man Menschen, die raumergreifender waren, die die Leere der Straßen zu nutzen wussten. Hüpfende und sich drehende Erwachsene gab es da, Zickzackläufer, die den Mond ansangen, allesamt beflügelt vom Alkohol oder jener äußersten, hysterisch machenden Schlaflosigkeit, die vollkommen Ungeliebten häufig zuteilwird. Manchmal durchdrangen flanierende Schatten einander, bildeten für Bruchteile von Sekunden eindimensionale siamesische Zwillingswesen und schufen sich, unbemerkt von ihren einsamen Besitzern, eine wohltuende Nähe zu ihresgleichen. Ferdinand gehörte allerdings nicht zu den Ignoranten der Schattenkunde, widmete ihr vielmehr beträchtliche Zeit, lenkte seine Umrisse behutsam in jene schöner Damen, bestieg die auf gepflasterten Böden großer Plätze geworfenen, verzerrten Schatten von bronzenen Feldherren, Künstlern, Erfindern und Herrschern, ritt auf ihnen und bürstete dabei in Gedanken ihr schwarzes Fell, bis er müde wurde. Dreimal hatte er sich schon, vom hellen Lärm der Vögel geweckt, auf einer Bank des Wiener Volksgartens gefunden, wo er, eng und zärtlich an den Schatten der steinernen Kaiserin Elisabeth geschmiegt, in tiefen Schlaf geglitten war. Er wusste auch um einen geheimen, mit Holznägeln ausgeschlagenen Ort unter der Albrechtsrampe, der als eine Art Schattendepot Verwendung fand.
Stirbt etwas in der Stadt, ein Bauwerk, ein Gegenstand, eine Person, ein Tier oder eine Pflanze, so schleicht sich der Schatten des Verstorbenen zu diesem Platz der Hinterlassenschaft, um Zeugnis für seinen Verursacher zu geben. Diejenigen, die auf den Straßen einem trauernden Schatten begegnen, nennt man nach der Art ihres Verhaltens »Schüttelpassanten«. Ihre Zahl schätzte Ferdinand auf einige Hunderttausend. Aus Angst, für Narren gehalten zu werden, trachteten sie, das Erlebte sich und anderen zu verheimlichen.
4
Die steinernen Pferde der Reiterstandbilder und mythischen Denkmalszenen waren nach Ferdinands Meinung eine der Attraktionen des unbeachteten oder vergessenen Wien. In Zeiten entstanden, da Pferde die den Menschen vertrautesten und alltäglichsten aller nützlichen und schönen Tiere waren, wirkten sie heute und wohl schon seit langem als Mahnung an den beinahe vollzogenen Untergang ihrer Gattung und schlossen in diese auch jene an die drohende Vernichtung des Menschengeschlechtes.
Als den Untersatz von Macht- und Rechthabern hatten Künstler sie einst geschaffen. Als in einer wilden Gebärde vermeintlich für immer Gefangene, verwunschen, mitten im Sturz dem Aufprall entsagen zu müssen. Oder mit geblähten Nüstern und himmelwärts schlagendem Schweif dreihundertfünfundsechzig Tage und Nächte im Jahr zu scheuen vor etwas, das nur die Gedanken ihres Bildhauers kannten.
Weiten und schmaleren Plätzen gaben sie einen Mittelpunkt, Palästen und Amtsgebäuden symmetrische Kontur, pathetischen Brunnen groteske Wasserkavallerie.
In seltenen Fällen standen sie direkt auf ebener Erde, wo sie stets größer wirkten und unnahbarer als auf den für ebendiese Wirkung erdachten Postamenten. Ein- oder zweimal im Fasching oder zu Silvester versuchten Betrunkene, sie zu erklettern, klammerten sich grölend an die Kruppen, suchten Halt an den grünspanverwitterten Hufen, und wenn sie endlich den Sattel bestiegen hatten und ihre Hände von der harten, spitzen Mähne bluteten, wich alle Fröhlichkeit von ihnen, und sie bemerkten, wie schwierig und undankbar es selbst für wenige Augenblicke war, Teil eines Monuments zu sein.
Ferdinand hatte sich oft gefragt, womit den Rössern die unendliche Leistung des ewigen Stillhaltens gelohnt würde, deren wahres Ausmaß jeder begreifen kann, den einmal ein Fotograf um Unbewegtheit gebeten hat. Da bemerkte er eines Morgens, dass die steinernen Leiber auf dem Parlament dampften. Ebenso die bronzenen im Burghof und am Josefsplatz. Und er begriff, dass gelegentlich für eine kurze Spanne zwischen Traum und Tag der Bann gehoben war. Alle Erstarrung der Skulpturen verwandelte sich in mannigfaches Gliederspiel, und die Rappen und Schimmel galoppierten ungezügelt und lustvoll wiehernd durch die Straßen des ersten Wiener Bezirks, in dem Legionen von Polizisten dafür sorgten, dass nichts und niemand die wilde Jagd behinderte. Bei dem Turnus dieses Vorfalls musste es sich um ein unbeirrt vom Wechsel der Staatsformen, betulich von Regierung zu Regierung weitergereichtes Geheimnis handeln. Es ließ tief in die unter Politikern verbreitete Angst vor aller Wirklichkeit blicken, dass auch der derzeitige Kanzler es für klüger hielt, die Bevölkerung in dieser Angelegenheit nicht aufzuklären, sie vielmehr — wie man in Österreich zu sagen pflegt — »blöd sterben ließ«.
5
Ferdinand trat ans Fenster, um die Vorhänge zu schließen. Da bemerkte er, wie im hellerleuchteten Salon der in gleicher Höhe wenige Meter entfernt gegenüberliegenden Wohnung ein älterer, weißhaariger Herr einer etwa vierzigjährigen großen, eleganten Dame mehrmals heftig ins Gesicht schlug. Sie schüttelte sich nach jedem empfangenen Schlag, wie sich nasse Hunde schütteln, wich aber nicht zurück und versuchte nicht, sich mit den Händen oder sonst wie zu schützen. Auch der Herr bewegte sich, als vollziehe er ein altes, vertrautes Ritual, das nicht von Aggression, sondern von inbrünstiger Frömmigkeit bestimmt war, die freilich alsbald in offene Geilheit beider Beteiligten mündete. Sie begann nun, sich selbst zu ohrfeigen, traktierte ihre kleinen, unter dem engen, hochgeschlossenen Seidenkleid kaum wahrzunehmenden Brüste, indem sie drei braune Gürtel um ihren Oberkörper quetschte, und drückte ihr Becken an das abgewinkelt in die Luft gestreckte linke Knie des Herrn, der sich an den Rückenlehnen zweier klobiger Fauteuils für diese Rumpelstilziade abzustützen suchte. Nach weiteren drei oder vier Minuten begannen sie einander anzuspucken und schmiegten sich in den Speichel, und dann lachten sie und wurden ruhig und setzten sich auf den Teppich, wie um zu meditieren.
Ferdinand war beeindruckt, denn inzwischen war ihm aufgefallen, dass es sich bei den beiden um das Rechtsanwaltsehepaar Roeder handelte, das in den philharmonischen Generalproben am Samstagnachmittag im Musikverein immer genau vor ihm in der siebzehnten Reihe Platz acht und neun abonniert hatte und dessen Nackenpartien und Hinterköpfe er dadurch besser kannte als die seiner intimsten Freunde oder Freundinnen. Einmal hatte er eine ganze lange Vierte von Bruckner, die dem Dirigenten auf das Peinlichste missraten war, mit dem Studium der Haarwirbel Dr. Roeders verbracht. Sie waren kleinste Labyrinthe, die immer wieder überraschende Wendungen nahmen, durch Schuppenbrücken untereinander verbunden, über die sich die Phantasie weitertasten konnte.
Von der beim Anhören von klassischer Musik stets leicht außerhalb des Taktes mitnickenden Doktorsgattin wusste er, dass sie an der schmalsten Stelle des rechten Ohres einen großen tiefblauen Punkt besaß, als wäre dort ein Kugelschreiber ausgeronnen. Auch war ihr Fleisch schwammig, da sich die Halsketten tief darin eingruben, ja manchmal von dicken Nackenwülsten nahezu verdeckt wurden. Die Kragen ihrer Blusen wiesen am Anfang der Konzerte häufig Parfümflecken auf, die dann rasch verdunsteten. Mehrmals war Ferdinand auch aufgefallen, dass sie sich in gerade dem Augenblick, da der Dirigent erstmals auf dem Podium sichtbar wurde, aus einem kleinen Flakon eine etwas zu stark riechende Flüssigkeit hinter die Ohren schüttete, von wo diese auf den Kragen tropfte.
Die Roeders hatten von hinten und im Sitzen durchaus etwas Kleinbürgerliches, und Ferdinand schienen sie manchmal wie zwei freundliche Blumenkistchen, die an seinem Durchblick auf die Wiener Philharmoniker montiert waren. Niemals hätte er sie des eben Gesehenen für fähig gehalten. Er zog die Vorhänge zu und beschloss, der Frau Roeder am kommenden Tag anonym Blumen zu schicken als Wiedergutmachung für seine Unfähigkeit, aus ihrer und ihres Gatten Nackenpartie die Abgründe ihrer Seelen deuten zu können.
6
Als Klavierstimmer genoss Ferdinand unter Fachleuten einen ausgezeichneten Ruf. Viele Pianisten hatten ihn im Laufe der Jahre eingeladen, sie auf Tourneen zu begleiten. Seine Aufgabe war stets gewesen, die Konzertflügel, von denen die Virtuosen mitunter sogar ein oder zwei Exemplare im Reisegepäck mitführten, mehrere Male am Tag auf ihre Klangreinheit, Tonhöhe und Tonschärfe zu überprüfen, Abweichungen vom Ideal umgehend zu korrigieren und Sperrigkeiten der Mechanik zu beheben. So wie für den Klavierbau der Resonanzboden als Tonträger, die Saite als Tongeber und der Hammerkopf als Tonerreger von größter Bedeutung sind, liegt es an Hand, Ohr und Gefühl des Stimmers, dem Instrument Leben, Wärme, Seele und Volumen zu geben. Die Klangfarbe eines Instruments, die ihre Vollkommenheit aus der fachlich einwandfreien Intonation erhält, empfand Ferdinand als den heiligen Vorbezirk des Komponierens. Freilich wusste er nicht, ob es tatsächlich einen Gott gab, der unter anderem den unergründlichen Wunsch hegte, Besitzer eines komponierenden Ferdinand zu sein. Er war lediglich davon überzeugt, dass es sein unabwendbarer Auftrag war, ein Lebenswerk aus mindestens einer Symphonie zu erarbeiten, die vor seinen an der gesamten alten und neuen Musikgeschichte geschulten Kriterien bestehen konnte. Immer und immer wieder hatte er sich gefragt: Was ist es, wofür ich träume, erwache, fiebere, genese, lerne, verweigere, verführe, stürze, irre und Halt suche? — Um des Werkes willen, war die Antwort. Leuchtend und jeden Einwand überstrahlend — um des Werkes willen. Und Ferdinand wusste letztlich, dass seine Menschwerdung, die Wandlung allen Jammers in Freude, durch das Nadelöhr dieses Werkes führte.
Manchmal bewegte er sich durch das Klavierzimmer wie eine Spinne beim Weben ihres Netzes. Er dachte, ich gehe keinen Weg innerhalb dieses Raumes ein zweites Mal. Wenn ich alle Wege gegangen bin, setze ich mich ans Klavier und schlage mit dem Ringfinger ein Gis an, das Weitere wird sich von selbst ergeben. Am Gis hängt das ganze Werk. Er hörte ein in einem Klang gefangenes Orchester, das alle Töne einer gewaltigen Komposition im selben Augenblick spielte. Die Zusammenfassung der Symphonie in einer einzigen, kurzen, erschreckenden Dissonanz. Komponieren war also nichts anderes als die Entflechtung dieser Notenballung. Ferdinand hoffte, es könnte ein magischer Spruch existieren, um das Chaos in Partitur rückzuführen. Aber dann wiederum zweifelte er, ob nicht mehr Zeit bis zur Auffindung des Sesam-öffne-dich verginge als jene, die er benötigen würde, Augenblick um Augenblick, Stunde um Stunde, Monat um Monat die Stimmen der einzelnen Orchesterinstrumente fein säuberlich auf Notenpapier zu erfinden und zu arrangieren.
7
Ferdinand hatte ein Mädchen kennengelernt, das Anna hieß und die Tochter eines Pianisten war, für den er gelegentlich die Klaviere stimmte. Seit Tagen trafen sie einander bei jedem Wetter nachmittags zu Spaziergängen in die unterschiedlichsten Gegenden der Vorstadt, sprachen Belangloses und konnten die richtige Überleitung zu Ernsthafterem nicht finden. Er wusste, dass manche Beziehungen wie verderbliche Speisen eine Art empfohlene Aufbrauchfrist hatten, und sah die für Anna und ihn geltende unbarmherzig näher rücken. Nur die Landschaft des Laaerberges kann uns noch retten, dachte er, denn er glaubte an die Macht der Umgebung und hatte wiederholt erfahren, wie jede Liebesgeschichte zu ihrer Erfüllung eigener idealer Spazierwege sowie eigener Räume und Gerüche, Lichtkonstellationen und Geräusche bedurfte.
Nun saßen sie auf einer Bank vor den großen Getreidefeldern, die wie eine Schanze zu den tiefer liegenden Industriegebieten von Simmering führten. Ein Rauschen kam aus dem nahen Wald, als übte ein riesiger Vogel Flügelschlagen. Aber es war nur der Ortswind, der nichts mit dem großen Wind zu tun hat. Kein Nord-, Süd-, Ost- oder Westwind ist das, denn der geht durch die Ortschaft, durch das Land, durch die Welt. Reisende Herrschaft ist der. Ortswinde aber bleiben, gezähmt von den Bäumen und Büschen, vertraut dem Gras und den Farnen. Die Wetterhähne streifen sie, greifen den Frauen an Rock und Kopftuch, fächeln den Julimittagen Kühle zu und treiben im Dezember Schnee. Wenn einer stirbt aus dem Ort, schweigen sie wie alle anderen und werden dann für wenige Tage ruheloser und geschäftiger, denn auch sie möchten Versäumtes nachholen und zweifeln an der Unsterblichkeit. Ferdinand horchte in das Rauschen, und Anna sagte: »Hörst du das Rauschen?«