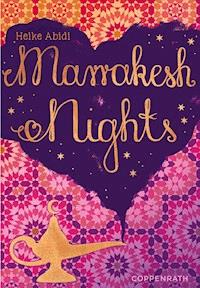Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Eden Books - ein Verlag der Edel Verlagsgruppe
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2016
Die Stunde der Wahrheit ist gekommen – Zeit fürs Klassentreffen! Seien wir ehrlich: In Wirklichkeit interessiert es uns doch alle, ob die frühere Klassenschönheit immer noch so verdammt gut aussieht, der absolute Mädchenschwarm mittlerweile einen Bierbauch vor sich herträgt und Streber Peter auch mit vierzig noch im Hotel Mama wohnt. Von überraschenden Verwandlungen über ungelöste Konflikte bis hin zu Dingen, die sich einfach niemals ändern werden – eins ist klar: Beim Wiedersehen der etwas anderen Art wird es schräg!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 353
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Herausgegeben vn Heike Abidi und Anja Koeseling
Schlachtfeld
Klassentreffen
Von alten Feinden in neuem Gewand
Inhalt
Kapitel 1: Ihr kommt doch auch alle?
»Warum tust du dir das überhaupt an?«
Remember the time, oder: Vorsicht vorm Verbiegen
Ein klasse Treffen
Alles richtig gemacht
Ach, die Kleinen . . .
Kapitel 2: Nach all den Jahren . . .
Der Stoff, aus dem die(Dreh-)Bücher sind
14 Damen und ein Gemüsehut
Verpasstes Glück
Der kleine Ahmed
Ein guter Jahrgang?
Kapitel 3: Weißt du noch? Wisst ihr schon?
Die Top Ten der Schulerinnerungen
Langweiler
Ach, Valerie . . .
Fünf Farben Violet
Ohne die anderen
Auf Olaf, den Ärmsten!
Kapitel 4: Alte Liebe, leicht angerostet
Spaß mit Phrasen: Wiedersehens-Bingo
Zeiten ändern sich
Die Geister der Vergangenheit
Unter freiem Himmel
Aus der Ferne ganz nah . . .
Kapitel 5: Vergeben und vergessen?
Fast 100 Gründe, nicht auf ein Klassentreffen zu gehen!
Kennst du Kuno?
Herr Bramstedt
Gruppenkotzen
Ein Schwein, aber dalli!
Override
Kapitel 6: Wer hätte das gedacht?
Trotz allem die Kurve gekriegt?
Sicher ist sicher
Ein Mann im Nebel
Einmal ein Kiffer, immer ein Kiffer
Namensschilder für alle
Impressum
KAPITEL 1
Ihr kommt doch auch alle?
»Warum tust du dir das überhaupt an?«
Zehn mehr oder weniger sympathische Begründungen für die Teilnahme an einem Klassentreffen
1: »Na ja, jetzt hab ich doch schon überwiesen …«
Was mich vor ein paar Wochen geritten hat, mich spontan zu diesem Treffen anzumelden, kann ich im Nachhinein selbst nicht mehr sagen. Irgendwie schien es mir eine nette Idee zu sein. Jetzt steht der Termin unmittelbar bevor, und ich habe eigentlich überhaupt keine Lust mehr, hinzugehen. Und schon gar nicht auf die zu erwartenden Mein–Haus–mein–Pferd–meine–Yacht–Gespräche. Andererseits habe ich meinen Beitrag für Begrüßungscocktail, kalt–warmes Buffet und Saalmiete schon überwiesen. Jetzt abzusagen, wäre pure Verschwendung. Da muss ich wohl durch.
(Bernd M., 52, Buchhalter)
2: »Je älter die anderen aussehen, desto besser fühle ich mich!«
Früher, in unserer Schulzeit, war ich nicht gerade das umschwärmteste Mädchen von allen. Ich hatte Pickel, eine dicke Brille und reichlich Babyspeck auf den Hüften. Inzwischen ist nicht nur die Akne verschwunden, sondern meine Haut erweist sich auch als extrem faltenresistent. Die Brille habe ich längst durch Kontaktlinsen ersetzt, und dank Jogging und Fitnessstudio ist meine Figur inzwischen ein echter Hingucker. Den anderen wird der Mund offen stehen vor Staunen! Da freu ich mich schon diebisch drauf. Neulich hab ich Regine, die olle Streberin, gesehen. Sie sieht locker zehn Jahre älter aus als ich. Ich denke, auf dem Gruppenfoto werde ich mich direkt neben sie stellen. So als krassen Kontrast.
(Melanie W., 41, Reiseverkehrskauffrau)
3: »Einfach so tun, als läge das Leben noch einmal vor uns.«
Wenn ich die Kumpels von früher wiedersehe, fühle ich mich immer wie in bessere Zeiten zurückkatapultiert. Was hatten wir für einen Spaß auf der Abschlussfahrt, beim legendären Klassencampingwochenende oder auf der Abifeier! Damals lag uns die Welt zu Füßen, alles schien möglich, sämtliche Optionen standen uns offen. Wir hatten zwar noch keinen Plan, was wir aus unserem Leben machen würden, aber eins war klar: Es würde großartig werden! So kann man sich irren. Denn tatsächlich wurde mein Leben alles andere als das. Stattdessen ausgesprochen anstrengend. Termindruck, Stress mit dem Chef, Unterhaltszahlungen, Bluthochdruck … Beim Klassentreffen will ich all das einfach vergessen und für einen Abend so tun, als wäre ich wieder dieser optimistische Typ von damals.
(Frank A., 39, Versicherungsfachangestellter)
4: »Meine Idee. Mein Plan. Natürlich bin ich dabei!«
Ich bin ein geborenes Organisationstalent. Wie sonst sollte ich einen Haushalt mit vier Kindern, zwei Katzen, einem Hund und einem meist abwesenden Gatten managen? Leider ist das Image dieses Jobs nicht besonders gut. Respekt und Dank? Fehlanzeige. Manchmal stelle ich mir vor, was ohne meine liebe Familie aus mir geworden wäre. Garantiert so etwas wie Inhaberin einer megaerfolgreichen Eventagentur. Leider wird in diesem Leben wohl nichts mehr daraus. Bis die Kinder aus dem Haus sind, bin ich zu alt, um durchzustarten. Aber alle zwei Jahre, bei der Planung des Klassentreffens, da kann ich zeigen, was ich draufhabe. Von der Anerkennung der anderen zehre ich dann bis zum nächsten Mal. Ich müsste schon den Kopf unterm Arm tragen, um mir das entgehen zu lassen!
(Agnes P., 46, Hausfrau)
5: »Höchste Zeit für späte Rache.«
An meine Schulzeit denke ich nur ungern zurück. Ich war immer der Kleinste in der Klasse, mein Stimmbruch ließ ewig auf sich warten, ich vertrug keinen Alkohol, hatte superstrenge Eltern und schrieb dazu noch gute Noten. Mit anderen Worten: Ich war das perfekte Mobbing–Opfer, nur dass es das Wort Mobbing damals noch nicht gab. Heute bin ich gut zwei Meter groß, habe eine dröhnende Bassstimme, vor der meine gut hundert Angestellten erzittern, und verdiene mich dumm und dämlich. Und ich bin in genau der richtigen Stimmung, meinen einstigen Peinigern zu zeigen, was ’ne Harke ist. Mit anderen Worten: Das Klassentreffen kommt mir gerade recht …
(Henrik B., 35, Unternehmer)
6: »Alte Liebe rostet nicht.«
»Wenn ich mit vierzig noch Single bin, heirate ich dich«, hat der schöne Thilo zu mir gesagt, als wir 17 waren. Damals war ich unsterblich in ihn verknallt. Und was soll ich sagen? Ich bin es immer noch. Fast hätte ich die Hoffnung schon aufgegeben. Aber neulich kam mir zu Ohren, er sei frisch geschieden. Seine Frau habe ihn verlassen, heißt es – wegen eines Türstehers. Ist das zu fassen? Dabei ist Thilo mindestens noch so attraktiv wie vor 23 Jahren. »Das muss ein Zeichen des Himmels sein«, dachte ich, als die Einladung zum Klassentreffen ins Haus flatterte. Das ist meine Chance! Jetzt brauche ich nur noch eine Strategie, wie ich ihn für mich gewinne. Am besten, ich besorge mir ein umwerfendes Kleid – und einen Liebeszaubertrank …
(Viola S., 40, Grundschullehrerin)
7: »Zurück in die glorreiche Vergangenheit.«
Ich wollte es nicht glauben, als meine Eltern behaupteten, die Schulzeit sei die schönste Lebensphase – aber sie hatten recht. Natürlich ahnte ich das damals noch nicht. Als ewiger Klassenbester glaubte ich, einer glänzenden Zukunft entgegenzusehen. Mein Philosophiestudium habe ich zwar summa cum laude abgeschlossen, ebenso meine Promotion, aber was hatte ich davon? Meine wissenschaftliche Karriere scheiterte, in der freien Wirtschaft konnte man mich nicht gebrauchen. Und so lebe ich heute von Hartz IV – bei meiner Mutter. Die mich ihren »süßen kleinen Versager« nennt. Natürlich werde ich das beim Klassentreffen nicht erwähnen, sondern ein paar geheimnisvolle Andeutungen über ein spannendes Buchprojekt machen – und mich im Schein meiner einstigen Erfolge sonnen.
(Kai–Olaf D., 51, Philosoph a. D.)
8: »Niemand soll sagen können, ich sei abgehoben!«
Mein Leben ist einfach großartig! Ich war bereits Stewardess, Model, Spielerfrau, Moderatorin, Werbe–Ikone und gerade drehe ich eine Doku–Soap über mein aufregendes Leben. Image ist alles – und das würde doch garantiert Schaden nehmen, wenn ich diesem Klassentreffen fernbliebe. Bestimmt hieße es dann, ich sei völlig abgehoben. Und bald stünde das auch in irgendeinem dämlichen Revolverblatt. Nein, ich geh lieber da hin und gebe mich locker, fröhlich, natürlich. Zeige allen, dass ich ganz die Alte bin (obwohl ich natürlich superjung wirke) und man mit mir Pferde stehlen kann. Und falls jemand ein Autogramm möchte – rein zufällig hab ich natürlich eine Handvoll dabei …
(Michelle G., 28, Starlet)
9: »Bühne frei … für mich!«
Ich wurde einfach zwanzig Jahre zu früh geboren. Heute starten junge Singer–Songwriter mit deutschen Texten grandios durch. Was ein Mark Forster kann oder ein Tim Bendzko, das hätte ich auch zustande gebracht. Na ja, aber mein Coversong–Programm mit Nummern von Springsteen und Dylan ist auch nicht übel. Schade nur, dass ich damit schon ewig nicht mehr gebucht worden bin. Das Publikum wolle mehr Abwechslung, heißt es in den einschlägigen Musikkneipen, in denen ich früher öfter aufgetreten bin. Aber wenn ich mit meiner Klampfe beim Klassentreffen anreise, ist das Hallo sicher riesengroß! Einen Abend lang werde ich mich wie der Star fühlen, der ich gern geworden wäre. Yeah.
(Jens J., 48, Finanzbeamter)
10: »Was heißt hier Begründung? Wiedersehensfreude ist Grund genug!«
Ganz ehrlich: Ich versteh die Frage nicht. Natürlich geh ich da hin. Diese Leute waren meine Klassenkameraden, meine Freunde, meine Leidensgenossen! Ist doch logisch, dass ich die wiedersehen möchte. Mehr Gründe brauche ich da nicht. Ohne Klassentreffen wären wir uns längst fremd geworden. Im Alltag trifft man sich leider viel zu selten. Alle haben anstrengende Jobs, große Familien, zeitraubende Hobbys – und viele wohnen gar nicht mehr hier in der Gegend. Es gibt eigentlich nur zwei Anlässe, sich wiederzusehen: Beerdigungen und Klassentreffen. Ich für meinen Teil hasse Beerdigungen!
(Irene W., 61, Innenarchitektin)
Und Sie? Warum werden Sie sich das nächste Klassentreffen auf keinen Fall entgehen lassen?
Remember the time, oder: Vorsicht vorm Verbiegen
Abgerechnet wird beim ersten Klassentreffen, das wusste ich immer. Aber dass es mich so schnell treffen würde, hätte ich nicht gedacht.
»Du hast eine Einladung zum Klassentreffen bekommen«, verkündete Philip, mein Lebenspartner, ein erfolgreicher Juniorunternehmer und bekennender Fleischesser, mit süffisanter Miene, als ich im Schweiße meines Angesichts eine Einkaufstasche nach der anderen zuerst in die Wohnung und dann auf den Küchentisch hievte.
»Was …?«, schrie ich entsetzt. »Es ist doch erst zehn Jahre her, dass ich aus der Schule raus bin.« In Gedanken fügte ich hinzu: Ich konnte doch noch gar nicht alle meine Träume in die Tat umsetzen, in denen Schönheit, beruflicher Erfolg und spießiger Wohlstand eine zentrale Rolle spielten. Angestrebt hatte ich ursprünglich mal ein BWL–Studium mit anschließendem Job als Managerin bei einem börsenstarken Unternehmen, gefolgt vom Ratenkredit fürs Auto und dem Kauf eines kleinen Häuschens in einer solargesteuerten Reihenhausidylle.
Hauptsache schön spießig und alles schön der Reihe nach.
Ach ja, das hätte ich fast vergessen: das Leben einer erfolgreichen Managerin, allerdings ganz im Zeichen der Familienorientierung. Ehemann Typ Businessclass. Zwei handzahme Fotomodell–Kinder, erst ein Junge, dann ein Mädchen – und ein kurzbeiniger Hund mit Plattschnauze. Hauptsache schön spießig und alles schön der Reihe nach.
Erreicht hatte ich von alledem jedoch nicht mal einen Furz im Universum, denn vor lauter Selbstfindungsseminaren und auf der Suche nach dem inneren Kind hatte ich es gerade mal bis zur Vorzimmersekretärin eines soliden Familienunternehmens geschafft. Und das auch nur, weil ich mit dem Juniorchef des Unternehmens eine lose Beziehung pflegte – mehr als einmal die Woche wilder Sex und der Yogakurs am Mittwochabend verband uns nämlich nicht. Nicht mal einen Trauschein hatte ich vorzuweisen. Geschweige denn einen aufregenden neuen Nachnamen. Philip hieß zu allem Überfluss Gurkenschäler. Aber vielleicht wäre das immer noch besser als gar keine Veränderung.
In Ermanglung anderer potenzieller Verehrer würde das also auch noch eine Weile so bleiben. Aber ich war ja noch jung … 28 drei viertel … seufz …, ich steuerte in rasanter Talfahrt auf die Dreißig zu.
Mir brach der Schweiß aus. Ich würde die totale Klassentreffenniete sein.
Immerhin hatte ich Anspruch auf vier Wochen Jahresurlaub und konnte mit der Zuverlässigkeit eines Schweizer Uhrwerks auf einen Buchgutschein im Wert von fünfzehn Euro zum Geburtstag und zu Weihnachten zählen. Nicht zu vergessen: einen farbenfrohen Blumenstrauß, wenn ich das zehnjährige Dienstjubiläum erreichte. Wenn das nicht ein raketenstarker Karrieresprung in meiner bisherigen nichtakademischen Laufbahn war … Mir brach der Schweiß aus. Ich würde die totale Klassentreffenniete sein.
Mit diesem bisher nicht gerade spektakulären Lebenslauf sollte ich meinen ehemaligen Klassenkameraden unter die Augen treten?
Unmöglich, meldete mein Unterbewusstsein und pochte an meine Schläfen.
Erst letzte Woche hatte mir eine Freundin noch von ihrer peinlichen Zeitreise zurück in die Neunziger erzählt, und nun hielt ich selbst eine Einladung dafür in den Händen.
Ein winziger Hoffnungsschimmer keimte in mir auf.
Hatte ich nicht unlängst in einer dieser entlarvenden Frauenzeitschriften gelesen, dass bei Einladungen zur Hochzeit folgende Regel gilt: Wer Braut oder Bräutigam das letzte Mal vor zehn Jahren gesehen hat, darf getrost absagen. Galt das auch für ein Klassentreffen?
Gewohnheitsmäßig fing ich an, die Einkaufstüten auszupacken. Das Gefrorene in die Gefriertruhe, Sahne und Joghurts in den Kühlschrank.
Ein Wiedersehen mit den ehemaligen Klassenkameraden bedeutete schließlich auch, dass man – egal, was man mittlerweile aus seinem Leben gemacht hatte – plötzlich wieder die von Ruhm und Geld träumende BWL–Absolventin von damals war, die sich beim Sportunterricht regelmäßig Push–up–Polster zwischen Busen und BH geklemmt hatte, um wenigstens beim Volleyballspielen eine gute Figur abzugeben.
Die Einkaufstüten waren leer geräumt, der Karton mit der Zartbitterschokolade ebenfalls. Sonderangebot. Nimm zehn Tafeln statt neun.
Ich konnte mir den bedeutungsschwangeren Kommentar von Ehe–Expertin Silke lebhaft vorstellen, die schon zu Schulzeiten mit ihrer schonungslosen Offenheit nicht nur ihre Mitschüler, sondern auch die Lehrer vor den Kopf gestoßen hatte: »Was … du hast dein Studium abgebrochen und greifst stattdessen deinem Lebensabschnittsgefährten halbtags unter die Arme? Eine Frau braucht doch eigenes Geld, einen richtigen Beruf, Unabhängigkeit! Schon mal was von Emanzipation gehört? Oder willst du etwa wegen jedem heißen Dessous, das du dir kaufen willst, deinen Liebsten um Geld anbetteln?«
Natürlich nicht. Aber neue Dessous brauchte ich momentan eher weniger. Heiße schon gar nicht.
Wütend griff ich in das unterste Kühlschrankfach und entsorgte Reste wässrigen Obstsalates. Selbst gemacht. Der Vitamine wegen.
Und natürlich würde auch Katrin, spargelschlank, straßenköterblond, immer akkurat gekleidet, ebenfalls ohne Rücksicht auf Verluste ihren scharfen Senf dazu beisteuern: »Wie einfallslos … dabei bist du doch immer diejenige von uns gewesen, die vor lauter Oberstreben nach dem Numerus clausus das Feiern vergessen hat, um sich stattdessen lieber mit Johanniskraut und Lernzettel unter die Bettdecke zu verkriechen. Und nun gibst du dich mit der Mittelmäßigkeit zufrieden?«
Wollte ich mir deren spitze Zungen wirklich antun? Ich bekam schwitzige Hände.
Wütend riss ich die Rumpsteaks aus der Frischhaltefolie und klatschte sie auf das Holzbrett. Frisch vom Metzger, 230 Gramm, zweieinhalb Zentimeter dick geschnitten und schön blutig. So mochte Philip sie am liebsten.
Im Gegenzug wäre es natürlich ebenso interessant zu erfahren, ob Katrin wirklich eine Laufbahn als Fotomodell eingeschlagen hatte. Den Body–Mass–Index dazu hatte sie damals gehabt – das Potenzial, sich hochzuschlafen, ebenfalls.
Und hatte Silke, rot gefärbter Fransenschnitt, drei Kilo Wimperntusche im Gesicht, den Traum, ihr eigenes Nagelstudio zu eröffnen, wahr gemacht oder ist sie dann doch mit Jonas aus der Parallelklasse nach Leipzig gezogen, um eine Frittenbude zu eröffnen?
In der Spüle stand die Metallpfanne, die ich zum Braten der Steaks brauchte, mit angebrannten Gemüseresten. Ich spritzte eine halbe Flasche Spülmittel rein, und während ich wie eine Besessene den Pfannenboden schrubbte, fragte ich mich, was wohl aus Julia, der molligen Außenseiterin mit Brille geworden war. Ob sie heute immer noch kiloweise Grünzeug futterte, in der Hoffnung, irgendwann von ihrer Zwergkaninchenzucht als gleichberechtigtes Mitglied anerkannt zu werden? Oder aus dem Streber Matthias, genannt Matze, mit damals schon so kalkweißem Gesicht wie die Bergspitze aus der Schneekoppe–Werbung und mehr Testosteron zwischen den Beinen als der Hund des Konrektors.
Um eine Antwort auf alle meine Fragen zu bekommen, müsste ich natürlich hingehen.
Zugegeben, spannend wäre es in jedem Fall, die komplette Jahrgangsstufe von damals wiederzutreffen, und sei es auch nur, um zu sehen, dass ich nicht die Einzige war, die es nicht geschafft hatte, ihren Platz im Leben zu finden. Auch interessant zu wissen, wer von ihnen bereits in die Ehefalle getappt war. Um eine Antwort auf alle meine Fragen zu bekommen, müsste ich natürlich hingehen.
Steaks vor dem Braten schön trocken tupfen, dann spritzt das Öl nicht. Wo war denn nur der blöde Salzstreuer?
»Tut mir übrigens total leid, Schatz, dass ich dich nicht auf das Klassentreffen begleiten kann«, unterbrach Philip meine Gedanken. »Ich hab Mittwoch einen geschäftlichen Termin. Du musst da wohl allein hin.« Er zuckte entschuldigend mit den Achseln.
Aber seinem munteren Tonfall war zu entnehmen, dass es ihm kein bisschen leidtat.
Spontan war ich versucht, ihm zu antworten, schluckte die Bemerkung: »Wie kommst du denn darauf, dass ich dich mitnehmen würde?«, aber dann doch herunter. Jetzt bloß keine Grundsatzdiskussionen heraufbeschwören.
Philip auf das Klassentreffen mitzuschleifen, wäre mir nicht in meinen erotischsten Träumen eingefallen. Ich war ja nicht exhibitionistisch veranlagt. Schließlich würden alle ganz genau hingucken, mit wem ich mein Sexleben teilte.
Nicht, dass Philip unattraktiv oder gar hässlich wäre, im Gegenteil, mit fast eins neunzig reiner Mannesgröße und der perfekten Anzugträger–Figur sah er mindestens so attraktiv aus wie George Clooney mit rot gefärbten Haaren. Aber deswegen musste ich ja noch lange nicht meine intimsten, pubertären Klassenzimmergeheimnisse mit ihm teilen.
Sofort fielen mir alle meine Sünden ein. Auf keinen Fall sollte Philip erfahren, dass ich regelmäßig mit Tim und Leo auf der Jungentoilette gefummelt hatte, und dass ich auf der feuchtfröhlichen Kursfahrt nach Barcelona plötzlich wie vom Erdboden verschluckt gewesen war, weil ich die Nacht in einer Ausnüchterungszelle verbracht hatte. Das hätte ich nur zu gern aus meinem Gedächtnis gelöscht.
Mit der flachen Hand schlug ich auf das Fleisch ein und brachte es danach wieder in seine Ausgangsform zurück, damit es beim Braten nicht zu schnell trocken wurde.
Der Form halber antwortete ich: »Schon okay, das ist auch wirklich nicht nötig.«
Den Tatbestand, dass Philip mich nicht zum Klassentreffen begleitete, konnte meine Seele ohne weiteren Psychoschaden verschmerzen, aber was war mit mir? Hatte ich genug Nervenstärke, um mich einer Klassen–Inquisition auszusetzen?
Der bloße Gedanke daran ließ mich durchschwitzen wie ein Ölbrötchen im Backofen. Verstohlen schnüffelte ich an meinen Achselhöhlen. Der Geruch erinnerte stark an damals, als ich aus lauter Angst vor der anstehenden Mathearbeit, für die ich, wie immer, natürlich nicht eine Minute gelernt hatte, kaum noch klar denken konnte und mich am liebsten von der Schule abgemeldet hätte.
Spaßeshalber spielte ich die ganze Situation im Kopf mal durch, während ich einen Löffel Butterschmalz in die Pfanne gab.
Angenommen, ich würde auf dieses Klassentreffen gehen. Rein hypothetisch. Was sollte ich anziehen?
Unzählige Variationen eines passenden Outfits durchliefen meine Gehirnwindungen.
Modern und sexy oder doch eher klassisch?
Hatte ich überhaupt ein schönes Paar Schuhe? Mit meinen grünen abgelatschten High Heels konnte ich nicht mehr punkten, und die flachen Ballerinas, die zentnerweise meinen Schuhschrank bevölkerten, waren viel zu sittsam für ein Klassentreffen, bei dem es darum ging, Stilgefühl und Wohlstand zu repräsentieren. Ich hasste Ballerinas, besonders die mit Riemchen und Metallschnalle, und trug sie auch nur, weil der Orthopäde meines Vertrauens mir wegen meiner beginnenden Skoliose angeraten hatte, nur noch flache Schuhe mit ordentlichem Fußbett zu tragen. Wahnsinnig sexy … Unwillkürlich rümpfte ich die Nase.
Der nächste Löffel Butterschmalz flutschte in die Pfanne.
Aufmunternd zwinkerte Philip mir zu, der meinen zähneknirschenden Blick missverstanden haben musste, und sagte: »Sieh es doch mal positiv. Wenn ich nicht mitkomme, kannst du ganz ungeniert mit deinen Verehrern von damals flirten. Du hattest doch einen Verehrer? Jedes Mädchen hatte einen Verehrer in der Schulzeit.« Er hatte es sich mittlerweile auf dem Barhocker gegenüber der Küchentheke bequem gemacht, von wo aus er einen gierigen Blick auf die Steaks werfen konnte, die mittlerweile fertig gewürzt auf ihren Bratentod warteten.
Wütend blickte ich ihn an. Was sollte denn diese dämliche Frage? Natürlich hatte ich Verehrer gehabt. Dutzende. Aber nur einer hatte die Ausdauer eines Marathonläufers an den Tag gelegt. Zugegeben, die Flirtkanone war ich nie gewesen, viel zu schüchtern, zu klein, übersät mit Pickeln, und ich trug T–Shirts in XXL, die ich von meinem großen Bruder ausgeliehen hatte. Da gab es ganz andere Raketen. Deswegen hatten die Jungs aus meinem Jahrgang auch schnell das Interesse an mir verloren. Marco dagegen, rundes Clownsgesicht, eisblaue Augen hinter einer panzerglasdicken Brille, hatte mir von der Fünften bis zum Abi nachgestellt und nie aufgegeben, mir seine Liebe zu gestehen. Kleine zugesteckte Zettelchen mit Einladungen vom Gummibärchenwettessen über Flaschendrehen am Baggersee bis hin zum Zungenkusswettknutschen waren an der Tagesordnung gewesen und der Beginn einer leidenschaftlichen Affäre, die sich auf die Nachhilfe rein mathematischer Gleichungen beschränkt hatte.
Aber zurück zur Outfitfrage. Ich könnte das blaue Kostüm anziehen, das müsste auf jeden Fall noch passen, dachte ich, während ich mir ein paar meiner Kilos, die sich mittlerweile auf meinen Hüften festgesetzt hatten, schönredete.
Schuldbeladen schob ich den nächsten Löffel Schmalz, der für das Erhitzen der Steaks bestimmt gewesen war, zurück ins Butterfass – fünf mussten genügen. Zufrieden mit meiner Wahl schwenkte ich die Bratpfanne wie ein Stierkämpfer sein rotes Tuch.
Wer von den Ehemaligen hatte bloß die bescheuerte Idee gehabt, das Klassentreffen in unserem alten Gymnasium abzuhalten, überlegte ich und tippte auf Georg. Der war damals schon der Prinzipal der Klasse gewesen.
Ob er wohl die geplante Beamtenlaufbahn eingeschlagen hatte, wie er es immer prophezeit hatte?
Es zischte bedrohlich, und das Fett spritzte bis an die Dunstabzugshaube, als ich die Steaks in die Pfanne legte.
Wollte ich dieses Klassentreffen unbeschadet überstehen, brauchte ich einen Klassentreffen–Punkte–Plan, so viel stand fest.
Punkt 1: Zum Friseur gehen. Instinktiv fasste ich mir in die zerzauste lange Mähne. Damit konnte ich meinen Ehemaligen nicht unter die Augen treten.
Punkt 2: Einen Termin bei der Kosmetikerin vereinbaren. Die ersten Falten mussten weggescannt, die Wimpern gezupft werden.
Punkt 3: Flachtreter gegen Pfennigabsätze tauschen – sprich, neue High Heels kaufen.
Punkt 4: Notfallprogramm für das Treffen im Hinterkopf behalten, das folgende weitere Punkte beinhaltete:
a.Schonungslose Ehrlichkeit vermeiden, stattdessen Small Talk betreiben, bis der Arzt kommt. Es hört sowieso keiner wirklich zu.
b.Komplett auf Alkohol verzichten, ich will ja schließlich nicht die Kontrolle verlieren und mich hinterher mit einer mit Rotwein bekleckerten Bluse auf der Titelseite einer Boulevardzeitung wiederfinden.
c.Eine Biographie erfinden, die mich nicht als Versager outete, sich aber gleichzeitig schwer überprüfen lassen würde. Mir schwebte da eine Karriere als Ghostwriterin für Promi–Biografien vor oder die einer Kronzeugin für ein Kapitalverbrechen, natürlich alles streng geheim und unter dem Siegel der Verschwiegenheit.
Studien sprachen von hundertfünfzig Flunkereien am Tag, da würde es auf eine mehr oder weniger ja nicht ankommen.
Siegessicher glotzte ich die Steaks an wie ein Versicherungsvertreter sein nächstes Opfer. Mit so viel Selbstbetrug und meinem ausgeklügelten Plan würde ich eine Klassentreffen–Inquisition mühelos überstehen.
Nur eine Nanosekunde später stellte mein Unterbewusstsein mir die Frage, warum ich bei dieser Fülle von negativen Bedenken nicht einfach allen Punkten abschwor und gleich zu Punkt 5. Desertieren, überging, anstatt mich in der Arena der Eitelkeiten auszuliefern.
Ersatzweise sollte ich vielleicht lieber mal meinen Beziehungsstatus überdenken.
Wollte ich wirklich weiterhin als Vorzimmersekretärin die vertrockneten Blätter der Yuccapalme aufsammeln, die nächsten zwanzig Jahre meine Füße in Liebestöterlatschen quetschen und irgendwann feststellen, dass ich in trostloser Langeweile verharrte, während ich noch immer darauf wartete, dass endlich der Märchenprinz vorbeigerauscht kam?
Niemals!
Mein Unterbewusstsein hatte völlig recht.
Zufrieden drehte ich die Steaks in der Pfanne. Wofür eine Einladung zum Klassentreffen doch alles gut war …
Die Steaks waren mir heute besonders gut gelungen. Vielleicht sollte ich eine Ausbildung zur Gourmetköchin machen.
Ich drehte die Hitze herunter und setzte mich schwungvoll zu Philip an die Theke. »Schatz, wir müssen reden.«
Darauf ein Steak.
Ein klasse Treffen
Das Schreiben war im Altpapier gelandet. Erst am Container fiel es Martin Meier wieder in die Hände, als er mit klammen Fingern versuchte, einen leeren Eierkarton hochkant in den Öffnungsschlitz zu schieben. Es nieselte ihm nasskalt in den Nacken, und an den Fingerspitzen fror er, obwohl es bereits März war, geradezu erbärmlich. Martin Meier steckte den Brief ein wenig umständlich in seine vordere rechte Manteltasche und vergaß ihn, bis er am übernächsten Morgen nach seinem Wohnungsschlüssel suchte und stattdessen das Kuvert ertastete.
Kurios, dass sie die Einladungen schon so früh verschickten. Bestimmt hatten sie es längst in den sozialen Netzwerken kommuniziert, die wichtigsten Zusagen auf elektronischem Wege eingesammelt und nur den virtuell Verschollenen noch ein – zugegebenermaßen freundliches – Erinnerungsschreiben zukommen lassen. Wie viele Adressen wohl noch stimmen mochten? Ein Wunder geradezu, dass sie seine hatten, war er doch erst vor einem halben Jahr in die billige Vorortbude gezogen. Zwar studierte er noch immer in der Stadt, in der er vor fast zehn Jahren sein Abitur abgelegt hatte, aber die Stadt war groß, und seine Adresse hatte recht häufig gewechselt, genau wie seine Studiengänge.
Martin Meier fragte sich, ob sie seine neue Adresse von seinen Eltern haben könnten. Bei dem Gedanken empfand er eine gewisse Scham, hatte er seine Eltern zuletzt vor über drei Jahren empfangen, als er noch mit Claudia zusammenlebte. Nachdem sich die Sache mit Claudia erledigt hatte, hatten sich auch die Eltern rargemacht – vielleicht weil sie ahnten, dass die Attraktivität seiner Bleibe mit dem Verlust des weiblichen Faktors ebenfalls schwinden würde. Wie richtig sie damit doch lagen und wie lieb von ihnen, seine Adresse weiterzugeben, ohne dabei am Telefon in Tränen auszubrechen. Gewiss waren sie tapfer geblieben und hatten den schönen Schein gewahrt. Er würde sie einladen müssen – bald, wenn er wieder Land sah.
Martin Meier war nie der Typ gewesen, der die Organisation von irgendetwas an sich riss.
Wer wohl zum »Orga–Team« gehörte, das den Brief mit diesem Ausdruck unterzeichnet hatte? Bestimmt Silke und Rainer. Es waren immer Silke und Rainer gewesen. Damals, bei der Abiturfeier, hatten sie diesen sündhaft teuren Amischlitten klargemacht, der die Spitze ihres Jubelkorsos bildete, und auch die Tanzband, das Buffet und die Örtlichkeit. Es war seinerzeit schwer gewesen, irgendetwas über die Köpfe von Silke und Rainer hinweg zu entscheiden, und am besten man machte es wie Martin Meier, der sie einfach machen ließ. Martin Meier war nie der Typ gewesen, der die Organisation von irgendetwas an sich riss, im Gegenteil: Er liebte es, den Dingen ihren Lauf zu lassen. Das »Orga–Team« hatte also seinen Segen – wer auch immer es sein mochte.
Es war klar, dass Martin Meier nicht zum Abiturnachtreffen gehen konnte. Das war völlig ausgeschlossen. Zu schnell wäre seine Geschichte erzählt gewesen. Zum Wehrdienst untauglich hatte er sich direkt nach dem Abi als Student an der Uni seiner Heimatstadt eingeschrieben, und exakt dies entsprach auch heute noch seinem Status. Nichts hatte sich seitdem geändert, nichts, außer dass er nach sechs quälenden Jahren die Juristerei an den Nagel hängte und nach hartem Ringen mit sich selbst gegen ein Studium der Psychologie eintauschte. Einen guten Psychotherapeuten würde er – wie die meisten gescheiterten Juristen – dereinst gebrauchen können, also sah er am besten zu, dass aus ihm selbst einer würde. Leider stand auch dieser Versuch unter keinem guten Stern, denn die arrogante Humorlosigkeit der Psychologiestudenten setzte ihm derart zu, dass er sich bald schon nicht einmal mehr in die Pflichtseminare hineintraute. Nur in den eigenen vier Wänden fühlte er sich sicher – so sicher, dass Claudia sich irgendwann sicher war, diese vier Wände lieber heute als morgen verlassen zu müssen. Am Boden der Tatsachen angelangt konstatierte Martin Meier, dass er, seinen hervorragenden Voraussetzungen zum Trotz, offenbar lebensuntüchtig war. Somit blieb ihm neben dem Suizid, den er aus Angstgründen konsequent ablehnte, nur eine Wahl: Lehrer werden. An dem Tag, an dem er sich für das Lehramt der Fächer Deutsch und katholische Religion an Berufsschulen einschrieb, regnete es Bindfäden. Wie hätte auch die Sonne scheinen können?
Nein, das Abiturnachtreffen ging gar nicht. Also warf Martin Meier das freundliche Schreiben ins Altpapier, nicht ohne aber zuvor noch den Termin des Treffens in seinen zerfledderten Taschenkalender einzutragen.
In den folgenden Wochen zog der Frühling ins Land. Er kam, wie in den vorangegangenen Jahren, mit recht hohen Temperaturen daher, und Martin Meier schwitzte sich in überfüllten Hörsälen zwischen unerhört kindischen Kommilitonen sitzend den Abschlussklausuren entgegen. Wie er Einführungsveranstaltungen hasste. Und wie sie in allen Fächern doch das Gleiche dozierten. Es war, als gäbe es bei genauerer Betrachtung tatsächlich nur einen einzigen Studiengang, dessen Name lautete: »Wie ich es schaffe, irgendwie doch noch Akademiker zu werden, um einen Vorteil im Leben zu erlangen und meine Kontaktanzeigen in etablierten Wochenzeitungen mit den Worten Gut situierter Akademiker sucht beginnen lassen zu können«. Es gab nichts, worauf Martin Meier in diesen Tagen hätte stolz sein können, also tat er das aus seiner Sicht Vernünftigste und hielt sich aus dem öffentlichen Leben so gut es ging heraus.
Es kam der 23. Mai und mit ihm der Tag des Abiturnachtreffens. Wahrhaft ein historisches Datum – auch für Martin Meier, der einen festen Plan für diesen Abend gefasst hatte. Es begann damit, dass er sich am späten Nachmittag in die Badewanne legte. Neben dem überraschend großen Balkon war das Badezimmer das zweite echte Highlight seiner billigen Bude, denn es gab außer der geräumigen Dusche auch eine altrosafarbene Badewanne mit wunderbar altmodischen und nicht ganz rostfreien Dreharmaturen. Hätte er schon mal Besuch empfangen, wären sie gewiss sehr gelobt worden, zumindest von denjenigen, die noch mit etwas Traditionsbewusstsein an die Dinge herangingen. Normalerweise badete Martin Meier nicht, heute aber ließ er extra viel Wasser ein, sah den Schaumbergen beim Wachsen zu und näherte sich dabei seiner inneren Mitte. Seine innere Mitte war dreißig Jahre alt und hatte einmal geglaubt, eine große Zukunft vor sich zu haben. Aber ein ausgedehntes lauschiges Schaumbad am späten Nachmittag war ja schließlich auch nicht schlecht.
Nach dem Baden machte Martin Meier Raclette. Den Raclette–Ofen hatten seine Eltern ihm vor mehreren Jahren einmal für Silvester ausgeliehen. Niemand hatte hinterher mehr danach gefragt, also war Martin Meier jetzt wohl sein rechtmäßiger Besitzer. Zur Feier des Tages legte er sogar eine Tischdecke auf und wählte das ordentlichste seines spärlichen Geschirrs. In kleinen Schälchen hatte er allerlei Zutaten vorbereitet – Gemüse, Zwiebeln, Pilze, Käse, Schinken, Salami und vieles mehr. Er hatte Kartoffeln mit der Schale vorgekocht, und ein paar Fleischstückchen legte er auf die mit etwas Öl beträufelte Grillfläche. Von den acht Raclette–Pfännchen nutzte er nur eines, denn es sollte ein möglichst langer und gemütlicher Abend werden. Doch trotz aller Gemütlichkeit schaffte es Martin Meier nicht, das Raclette–Essen mit sich selbst länger als anderthalb Stunden hinauszuziehen. Also räumte er den Tisch wieder ab, verstaute die ungegessenen Zutaten im Kühlschrank und säuberte den Raclette–Grill, so gut er konnte.
Es war etwa zwanzig Uhr fünfzehn, als er die kleine Küche in ihren vorherigen Zustand zurückversetzt hatte. Das Abiturnachtreffen hatte um achtzehn Uhr begonnen. Wahrscheinlich saßen sie schon beim Essen und führten die unvermeidlichen Gespräche: mein Job, mein Haus, mein Auto. Zum Glück hatte sich Martin Meier ein attraktives Kontrastprogramm ausgedacht: Lesen bei Kerzenschein. An diesem Abend sollte es ein ganz besonderes Buch sein, eines, das in den Kanon der Weltliteratur gehörte und das er bereits mehrfach aufgeschlagen, aber nie auch nur ansatzweise zu Ende gebracht hatte. Er mümmelte sich so bequem es ging in seinen Sitzsack und begann die ersten Worte zu lesen: »Stattlich und feist erschien Buck Mulligan am Treppenaustritt, ein Seifenbecken in Händen, auf dem gekreuzt ein Spiegel und ein Rasiermesser lagen.« Martin Meier hielt inne und legte das Buch zur Seite. Er sollte sich rasieren gehen. Immerhin war heute nicht irgendein Abend. Also ging er ins Bad, quetschte den letzten Rest Schaum aus seinem Spender und ließ die Klingen über seine Stoppeln gleiten. Nachdem die letzte Unebenheit geglättet und die letzte kleine Blutung gestillt war, hockte er sich wieder in seinen Sitzsack und überlegte, ob er mit dem zweiten Satz fortfahren oder wieder mit dem ersten beginnen sollte. Er entschied sich für den ersten.
Das Lesen fiel Martin Meier trotz der angenehmen Atmosphäre nicht leicht, und er musste sich mehr durch die Seiten quälen, als er sich eingestehen mochte. Erst gegen 23 Uhr hatte er die Stelle erreicht, an der Mr Leopold Bloom die Bühne der Erzählung betrat. Ein guter Moment, um eine Pause zu machen. Martin Meier schloss das Buch und überlegte, zu Bett zu gehen. Er war wirklich hundemüde, aber es wäre eine Niederlage, sich dies einzugestehen. Auch wenn er nicht direkt an das Abiturnachtreffen dachte, so dachte er doch, dass er an diesem Abend etwas Besseres als ein Abiturnachtreffen erleben müsste. Frühzeitig zu Bett zu gehen, war nichts, womit man imaginären Gesprächspartnern imponieren konnte, selbst wenn sich kaum eine genialere Erfindung als das Bett denken ließ. Aber das galt nicht für Dreißigjährige, die auch und gerade nachts im Leben zu stehen hatten. Also kam es, wie es kommen musste, und Martin Meier schaltete den Fernsehapparat ein. Zunächst natürlich den Kulturkanal, wo sie einen schrägen australischen Kurzfilm brachten, ein Meisterwerk, aber leider eben kurz, und so blieb am Ende nichts als eine hanebüchene Castingshow bei den Privaten. Um null Uhr zwanzig hatte Martin Meier die Nase voll von seiner gemütlichen Bude und ging in die Stadt.
Wer im Bett lag, war mehr oder weniger tot, wer auf die Fresse bekam, lebte zumindest den Moment.
Er verfolgte kein Ziel, saß einfach in der S–Bahn und sah sich die Gestalten an, denen er, wenn es nach seiner Mutter gegangen wäre, nicht hätte begegnen sollen, aber besser diesen Typen begegnen, womöglich gar auf die Fresse bekommen, als daheim im Bett zu liegen. Wer im Bett lag, war mehr oder weniger tot, wer auf die Fresse bekam, lebte zumindest den Moment.
Erst als Martin Meier allein mit einem zukünftigen Gewaltverbrecher im Wagen saß, besann er sich eines Besseren, stieg an der nächsten Haltestelle aus und befand sich, der Zufall hatte es wohl so gewollt, Minuten später vor der Kneipe, in der sie gewiss noch fröhlich tagten. Er würde natürlich nicht hineingehen, nur mal kurz durchs Fenster schauen, vielleicht auch bloß von Weitem, und direkt wieder verschwinden. Dann könnte er immer noch in die Disko gehen – oder auch ins Bett, es machte keinen Unterschied mehr. Er wollte nur sichergehen, dass er nichts verpasst hatte, obwohl das ohnehin klar war und eigentlich keiner Überprüfung bedurfte. Leise pirschte er sich an die gekippten Fenster heran, hinter denen ihm das Kneipengemurmel viel zu laut und viel zu aufgekratzt entgegenschlug. Aber er verstand noch nichts, konnte noch niemanden erkennen, musste noch ein bisschen näher …
»Hey Martin, wir haben uns ja heute noch gar nicht gesehen.« Eine Frau war aus der Kneipe herausgetreten, offenkundig im Begriff zu gehen.
»Hallo, äh …«
»Sarah«, half ihm Sarah auf die Sprünge, und Martin erinnerte sich. Das war Sarah, die mit ihm einige Kurse zusammen gehabt hatte, sozusagen eine Konstante in seinem Schülerdasein, und die er seit dem Tag der Abifeier nur ein einziges Mal gesehen hatte – beim Aufräumen am Morgen danach.
»Hallo Sarah«, beeilte sich Martin zu sagen, als ob es selbstverständlich wäre, jetzt und hier mit ihr zu reden, »ich hab es nicht früher geschafft. Lohnt es sich noch hineinzugehen?«
Du bist der erste vernünftige Mensch, den ich heute hier treffe.
Sarah lachte. Es war ein vertrautes Lachen, und irgendwie sah die lachende Sarah viel hübscher aus, als er sie in Erinnerung hatte. In seiner Erinnerung war sie die kumpelhaft unscheinbare Mitschülerin, bei der er sich irgendwann einmal, er war furchtbar alkoholisiert gewesen, wegen irgendeines Mädchens ausgeheult hatte. »Ob es sich lohnt? Das glaubst du doch selbst nicht. Du bist der erste vernünftige Mensch, den ich heute hier treffe. Was arbeitest du denn so Stressiges, dass du’s jetzt erst hergeschafft hast?«
»Ach, halb so wild. Bin Lehrer geworden, also noch nicht ganz, aber … und du?«
»Hebamme. Komm wir gehen.«
Martin war, als habe die Nacht auf einmal zu leuchten begonnen. Sarah wohnte in der gleichen Stadt, arbeitete hier seit sieben Jahren in der Kinderklinik und erweckte den Eindruck, dabei glücklich zu sein. Gegen jede Wahrscheinlichkeit und auch ohne es vorher besprochen zu haben, spazierte Sarah mit ihm durch die Gegend, lachte dabei immer wieder herzhaft über Martins schüchterne Scherze und, Martin traute seinen Ohren nicht, gestand ihm sogar, in der Mittelstufe einmal kurzzeitig in ihn verliebt gewesen zu sein. Hiervon freilich wollte sich Martin nicht zu sehr beeindrucken lassen, denn irren konnte sich jedes Mädchen einmal, und Martin war gewiss nicht der Typ, in den man sich heute noch verlieben könnte. Sarah hingegen schon. Sarah war, ja, humorvoll, gut aussehend und dabei auf vollendete Weise bodenständig. Sie übte den sinnvollsten Beruf der Welt aus, ohne dabei aufs Geld der anderen zu schauen, fuhr einen sauberen Kleinwagen und war, Martin hatte die alles entscheidende Frage dann doch noch irgendwie in einen Nebensatz verpackt, seit Längerem solo.
Eigentlich konnte es nicht stimmen, dass diese Frau noch zu haben war, denn dies setzte die komplette Geschmacksverkalkung aller männlichen Mitbewerber voraus. Aber gesetzt den Fall, dachte Martin, die anderen hätten tatsächlich alle einen Knall, könnte es dann trotzdem stimmen, dass Sarah ihm gerade angeboten hat, ihn noch nach Hause zu bringen? Und dass sie auf seinen gegen 4.45 Uhr ausgesprochenen Vorschlag, man könne in seiner Wohnung noch ein bisschen Raclette machen, mit einem belustigten Kichern zugesagt hatte? War dies alles das gleiche Leben wie noch vor ein paar Stunden?
Vielleicht, dachte Martin, sollte er wirklich Berufsschullehrer werden. Oder Busfahrer. Es spielte wahrscheinlich keine Rolle, mit Sarah an der Seite würde er alles schaffen.
Alles richtig gemacht
»Weißte? So ein Klassentreffen, das ist nix für mich. Wie lange ist das schon her? 15 Jahre? All die runzligen Gesichter von früher. Die mir dann erzählen, wie toll sie sind. Oh, ich muss eigentlich meinen Pool reinigen. Hach, da hat mir der Mechaniker einen Kratzer in meinen Bonzenbenz gemacht. Nee, nee, das kann nicht dein Ernst sein.« Mein Kumpel Paul, genannt Putze, lehnte sich selbstgefällig zurück. So als wollte er mir mit dieser Geste klarmachen, dass er hierhergehörte. Auf diesen Barhocker. Und nirgendwohin sonst. Erst recht nicht auf ein Klassentreffen.
»Ach komm«, entgegnete ich locker, »du machst da wieder ein Drama draus.« So einfach konnte ich meinen Kumpel nicht davonkommen lassen. »Putze, jetzt hör doch mal. Da gehen alle hin«, setzte ich noch mal an. »Du kennst jeden von früher. Das wird sicher lustig.«
»Ey, nee. Ich hab echt keinen Nerv auf diese Streber und Tafelputzer.«
»Sogar der Mark kommt«, sagte ich betont langsam.
Eine Sekunde lang glaubte ich, er würde vor Schreck vom Hocker fallen.
Putze orderte ein neues Bier, dann bedachte er mich mit einem finsteren Blick. »Der Dachberger.« Seit ich Putze kannte – und das war ziemlich lange –, gab es diesen Kampf zwischen den beiden. Ehrlich gesagt, konnte ich mir Putze als Kind gar nicht anders vorstellen. Wie er mit laufender Nase und einer Abschürfung im Gesicht im Papierkorb saß. Wohin ihn der deutlich größere und stärkere Mark mal wieder gesetzt hatte.
»Also gut, ich komme mit«, erwiderte Putze irgendwann, als er sein frisches Bier endlich bekommen hatte, »aber auf deine Verantwortung.«
Ich jubelte innerlich. Ich hätte niemals gedacht, dass ich meinen phlegmatischen Freund so weit bringen würde.
»Und ich habe eine Bedingung«, ergänzte Putze seine Zusage.
»Klar«, antwortete ich und sah mich schon mal nach der Bedienung um, damit ich die nächste Runde ordern konnte.
»Ich will da nicht ich sein.« Verwirrt sah ich meinen Kumpel an, während die Bedienung an uns vorüberging. »Ich will da nicht als Putze hin. Sondern als Herr Zermiuk.«
»Okay«, antwortete ich zögernd, um meinem Gehirn Zeit für ein paar Updates zu geben. »Das machen wir«, erwiderte ich, als der Groschen endlich fiel. »Eine Krawatte und ein fettes Sakko dazu. Ist doch kein Problem.«
Dann bestellte ich noch zwei Bier. Nachdenklich prostete ich Putze zu. Ein flaues Gefühl in meiner Magengegend, das nicht auf meinen Alkoholkonsum zurückzuführen war, ließ mich daran zweifeln, ob das mit dem Klassentreffen wirklich eine so gute Idee gewesen war.
Putze wollte sich im Angesicht seines erfolgsverwöhnten Intimfeindes Mark Dachberger keine Blöße geben. Vater Anwalt, Mutter Regionalpolitikerin. Jugendvorstand im örtlichen Tennisclub. Schwarm aller Mädchen. Eben ein echter Sonnyboy.
Ja, Mark war alles, was Putze nicht war. Und umgekehrt.
»Jetzt guck doch mal. Schaut doch geil aus, oder?«, präsentierte er mir sein Outfit für das Klassentreffen.
»Ich weiß nicht«, murmelte ich vorsichtig. »Ist es nicht einen Ticken zu blau?« Insgeheim verlieh ich mir selbst den Breitbandorden des diplomatischen Geschicks unter erschwerten Begleitumständen. Denn Putzes Wahlanzug, ganz in Taubenblau, war nun wirklich keine Augenweide. »Hast du nichts anderes?«
Ein Leinensakko in Rosa hatte ich seit Miami Vice nicht mehr gesehen.
Wortlos zog sich mein Freund hinter die eigenartig schiefen Türen seines Kleiderschranks zurück. Das Warten löste eine kleine Panik in mir aus. Nicht zu Unrecht, erkannte ich, als er sich mir erneut präsentierte. Ein Leinensakko in Rosa hatte ich seit Miami Vice nicht mehr gesehen. Dass Putzes Kopf eine Spiegelbrille zierte, war eigentlich nur die würdige Krönung des Gesamtkonzepts. Don Johnson auf Bockwurst. Aber gut, im Vergleich zum vorherigen Thomas–Kuhn–Anzug war dies eine deutliche Verbesserung. Immerhin.
»Kann sich doch sehen lassen«, urteilte ich. »Aber was dir jetzt noch fehlt, mein Lieber, das ist der richtige Background. Komplett mit Ehefrau und Fake–Kindern. Du wirst ein echter Gewinnertyp.«
»Ernsthaft?«
Ich nickte zuversichtlich. Das würde harte Arbeit, Putze innerhalb von ein paar Tagen vom Homo Kneipiensis zum Manager des Jahres zu machen. Aber ich würde das schon schaffen. Zumindest nahm ich mir das fest vor.
Eine Woche später gingen wir gemeinsam zu unserem Klassentreffen. Natürlich fand es nicht irgendwo statt. Sondern im Restaurant Ackerberg, der exklusivsten Adresse in unserer Region. Ich bemühte mich, für meinen Panda einen Parkplatz weitab der Nobelkarossen zu finden. Unmittelbar hinter einem rostbraunen VW–Bulli mit selbst gemalten Woodstock–Blümchen reihte ich mich unauffällig ein. Es musste ja nicht jeder gleich sehen, dass sich meine Wagenklasse seit dem Abitur kein bisschen vergrößert hatte.
Beschwingt stieg ich aus. »Alles klar, Putze?«
Mein Kumpel zupfte an seinem Anzug herum. »Logo«, gab er gezwungen lachend zurück.
Kurz checkte ich auch mein Outfit. Auf den ersten Blick mochte mein Arbeitsjackett mit den Ellenbogenflicken etwas underdressed wirken. Doch ich wollte mir treu bleiben.
Drinnen angekommen schlug uns ein unbeschreiblicher Dampf entgegen. Es roch nach Menschen und Essen in einer unangenehmen aromatischen Mischung. »Im Nebenzimmer«, sagte Putze in einem Tonfall, der ihn wie einen echten Macher klingen ließ. Die Wände des Raumes waren kunstvoll vertäfelt. Da hingen zahllose Jagdtrophäen und Bilder mit Waidmannsmotiven. Sofort wusste ich, wer dieses Klassentreffen organisiert hatte. Noch ehe er auf uns zukam.
»Der Hubertus Märzbrenner!«, rief Putze mit gespielter Freude und schüttelte dem Begrüßungskomitee in Olivgrün die Hand.
Hubertus stand irgendwie unschlüssig da und sah meinen Kumpel fragend an.
Der lachte schelmisch und erklärte: »Ich bin der Paul.« Und weil es bei unserem Gegenüber noch lange nicht hörbar Klick machte, ergänzte er gönnerhaft: »Paul Zermiuk.«
Der Organisator ähnelte einen Moment lang den glotzenden Rehköpfen an der Wand. Als hätte man ihn gerade abgeschossen. Sein Mund bewegte sich, aber seine Zunge streikte. Da fiel selbst dem Märzbrenner nichts mehr ein. Und das war gut so.
Ein bisschen wie bei den Lateinabfragen anno dazumal. Um ihn zu erlösen, gab ich ihm schnell meine Hand. Und wen wundert’s? Mich erkannte der passionierte Jäger sofort.
»Das ist aber schön, dass ihr hier seid«, stammelte er und führte uns zu den reservierten Tischen.
Putze und ich gingen auf einen Tisch zu, an dem noch zwei Stühle frei waren. Das Gespräch war hier schon in vollem Gange.