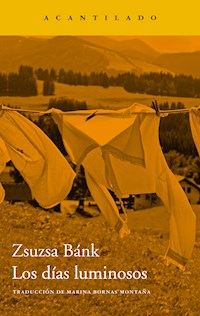Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: AUDIOBUCH
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2017
»700 Seiten magischer Sog ... Wir sehen in die Köpfe, wir sehen in die Herzen ... Man will teilhaben, mitleiden, mitlachen.« Neue Presse Was fangen wir noch an mit diesem Leben, jetzt, nachdem wir die halbe Strecke schon gegangen sind? Die Schriftstellerin Márta lebt mit Mann und drei Kindern in einer deutschen Großstadt, die Lehrerin Johanna lebt allein in einem kleinen Ort im Schwarzwald. Eine lange Freundschaft verbindet sie, in E-Mails von großer Tiefe, Offenheit und Emotionalität halten sie engen Kontakt. Was ist gewesen in ihrem Leben – und was wird noch kommen? Zuszsa Bánks neuer Roman ist eine Feier der Freundschaft und des Lebens.
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Zeit:7 Std. 43 min
Sprecher:Anna Thalbach
Ähnliche
Zsuzsa Bánk
Schlafen werden wir später
Roman
FISCHER E-Books
Inhalt
Für Michael, Louise und Friedrich
27. März 2009–17:43
Liebste Johanna,
heute Morgen hat Simon beim ersten frühen, viel zu frühen Kaffee gesagt, wäre er zehn Jahre jünger und hätte drei Kinder weniger, hätte er mich schon verlassen. Eine Drossel hatte sich ans nachtbeschlagene Fenster gesetzt und mit ihrem Schnabel angeklopft, als wolle sie uns warnen und bremsen, uns belauschen, um es an diesem Frühlingsmorgen schnell in ihre Vogelwelt zu tragen, von Ast zu Ast, von Zweig zu Zweig, Drosseln und Finken zu verkünden, die nach dieser Nachricht schnappen würden wie nach einem Wurm, hört, hört, Neues aus der Körberstraße zwölf, hört, hört.
Simon sagte es in einem Ton, als sei es ohne Bedeutung, als sei es etwas wie: Das Wetter schwenkt um, ich nehme lieber den Zug und nicht den Wagen, und vielleicht habe ich deshalb nichts erwidert, Johanna, vielleicht habe ich deshalb Tassen und Teller aus der Spülmaschine in den Schrank geräumt, wie jeden Morgen, weiter Messer zu Messern, Löffel zu Löffeln gelegt und getan, als hätte ich nichts gehört und müsste deshalb auch nichts erwidern. Obwohl Simons Satz den ganzen still verregneten, langen, viel zu langen Tag in mir hämmert, mich aufscheucht und rastlos, ruhelos wie eine Gefangene in ihrer Zelle umherschickt, die Finger knetend, auf und ab, die Ringe drehend, besonders den einen, besonders diesen einen Ring. Wirrgrelle Lichtgirlanden wie die farbigen Pfeile einer Feuerwerksrakete schießen seine Worte durch meinen müden Kopf, seit sie am Morgen gefallen sind, in dieser schmalen Zeitschleuse, als die Kinder noch schliefen und es still in unserer Küche war, still genug, um eine Drossel mit nassen Federn zu hören, die ihren spitzen Schnabel an unser Fenster schlug.
Soeben ist Lori gegangen und hat ihren Loriduft zurückgelassen, etwas L’air du printemps, Blumen im Korb, Märzregen in der Jacke, der die plötzlich heißen Tage wegwäscht, die Lorimischung aus abgestreiftem Winter und scheuem, verzagtem Frühling. Sie war mit einer Kiste gekommen, voller Goldflieder und Tulpenmagnolien aus ihrem Garten, deren Blüten an den ersten warmen Tagen heftig schwärmerisch und, wie ich gerade finde, unnütz bunt aus den Zweigen geschossen sind. Ich saß neben dem schlafenden, in seine hellblaue Babydecke gewickelten winzigen Henri auf der Küchenbank, zupfte simonvergessen an Spreißeln und schaute Lori zu, als sie mit ihrer Zitterhand die Stiele mit dem einzigen scharfen Küchenmesser schnitt und die Zweige nach und nach in die Vase steckte. Warum ich Simon nicht geohrfeigt habe?, fragte sie, auch in einem Ton, als wolle sie nur etwas sagen wie: Nein, dieses Messer schneidet nicht, aber schau dir die Farbe dieser Goldfliederzweige an, und ich musste denken, vielleicht hat sie früher genau das getan, Tulpenmagnolien genauso gestutzt, vor zwanzig, fünfundzwanzig Jahren, als ihr Mann morgens beim Kaffee sagte, liebste Lore, ich verlasse dich.
Aber was hat es mit unserem Alter zu tun, Johanna? Wenn alles ist, wie es angeblich ist, ach, wie es ja wirklich ist, müsste Simon jetzt seinen Koffer packen und gehen, nicht vor zehn Jahren, nicht morgen, nicht übermorgen, sondern heute, sofort, in diesem Augenblick müsste er gehen, spätestens morgen früh, während ich in der Tür stehe und ihm zuschaue, nachtversenkt, kaum wach, wenn er mit beiden Händen seinen Koffer zuklappt, mit wenig Kleidung, aber vielen Heften, losen Blättern und Reclambändchen, Kleist, Ibsen, Euripides, die Tasche schultert, nach Jacke und Schal greift, die Tür aufstößt und zum Tor geht, ohne sich umzudrehen, die wenigen Stufen hinunter zur Straße, rechts hinab zur Haltestelle, weil er uns den Wagen lässt, unseren rostgetränkten Wagen voller Brötchenkrumen, Bonbonpapier und verwaister Puppenarme.
Um unbemerkt zu entkommen, müsste Simon allerdings die Nacht abwarten. Die tiefspäte, hastig verfliegende halbe Stunde abpassen, wenn der Mond klar am Himmel steht, aber sein Glanz anfängt zu ermatten, wenn wir alle, Mia, Franz, Henri und ich, tief und fest im unruhigen Takt unseres Atems schlafen und träumen, fischen in unseren trübsten, unseren klarsten Traumbuchten. Nur zwei Sekunden zu früh, einer von uns würde aufwachen und Simon abhalten davon.
Márta
28. März 2009–23:09
Liebste Márta,
Ende März, die Wildgänse kehren zurück. Als ich am Nachmittag auf dem Rad von der Schule nach Hause fuhr, flogen sie krächzend, sternwärts singend unter Schwarzwaldwolken. Luftvermählt mit meinem Himmel. Deine Worte. Durch ein schmales blaues Band Richtung Schwenninger Moos. Wo bald das Knabenkraut blühen wird. Stell Dir vor, solche Dinge weiß ich jetzt. Wo und wann etwas blüht im schwarzen Wald.
Die Nacht hat meine liebsten Hügel verschluckt. Ich sollte im Bett sein. Aber schlafen werde ich später. Jetzt will ich noch ein wenig Droste-Notizen zwischen den Fingern drehen. Annette-Partikel zerreiben. Vielleicht fällt ein Wort für mich ab. Sogar ein Satz. Reiht sich ein in meinen Kapiteln. Fließt hinein, als hätte er schon immer dorthin gewollt. Ich versuche herauszufinden, ob Moorknaben und Heidehirten als Teil der Natur gedacht waren. Oder als Widersacher, Gegenspieler. Vielleicht als Feinde. Mensch und Natur eins? Oder zwei? Wieder bin ich Spürhund. Wieder sammle ich Beweise, Márta. Im Gebilde aus Zeichen, mit denen die Droste-Hülshoff die Natur ausgestattet hat. Ihre Natur aus Gott und knorziger Buche. Auf Nachtschuhen wandere ich durch ihre Talschlucht mit dem Goldbande. Was hat sie diesmal im Moorgeschwele, unter Heiderauche für mich hinterlegt?
Das hier wollte ich Dir schreiben, bevor ich losgehe. Es kostet zu viel Kraft, ein halbes Leben hinter sich zu lassen. Drei schlafende Kinder, auf ihre schmalen Betten verteilt. Eine schlafende Frau, zusammengerollt wie eine Katze, die sich unter dem löchrigen Schwarz der Großstadtnacht so unnachahmlich in den Kissen windet. Simon wird seine Koffer und Taschen nicht packen. Mit all den Dingen, mit denen sein Leben gefüllt ist. Er wird sie weiter auf Euren Schränken einstauben lassen. Er wird weiter solche Sätze denken und sie Dir auch sagen. Noch gemeinere Dinge wird er denken und Dir vielleicht nicht sagen. Aber er wird nicht alles zurücklassen und an einem anderen Ort, in einem anderen Leben neu beginnen. So viele andere Leben warten schließlich nicht auf ihn. Auf uns ja auch nicht, Márti.
Selbst mir ist danach, alles hinzuwerfen. Es ist nicht nur dieser lange, zähe Winter. Vier Monate Schnee. Fast fünf. Das Haus ringsum verschlossen, ich mutterseelenallein darin. Seit einer Weile will ich das. Ich habe es Dir verschwiegen. In all meinen jüngsten Mails verschwiegen. Aber jeden Morgen ist mir danach. Einfach alles hinzuwerfen. Wenn ich unter meinen Dachschrägen hinabsteige. Mit nackten Füßen über meinen roten Teppich laufe. Die Läden öffne. Die Welt aber lieber draußen ließe. Nur die Droste hereinbitten möchte. Irgendwann holt uns dieser Augenblick ein. Da können wir uns noch so blind und taub stellen. Wer könnte Simon besser verstehen? Ich habe auch keine Idee, was ich in der Mitte, zur Hälfte meines angebrochenen Lebens mit mir anfangen soll. Mit mir und allem, was ich bislang hineingestellt habe.
Du? Hast Du eine?
Johanna
29. März 2009–06:19
Liebste Jo,
nein, ich habe keine, nicht an diesem frostkalten Morgen, der meine vierteldurchwachte Nacht ablöst, die Raureif an unser Küchenfenster gehaucht hat, als wolle sie mich bitten, dem Winter nachzutrauern – ich weine ihm keine Träne nach, nicht eine, auch mir war er so zäh und lang, dass mir über allem die Ideen ausgegangen sind, mein Kopf ist leergepflückt und abgemäht wie eines dieser krähenliebenden Weizenfelder auf Fehmarn, nach denen ich mich sehne, sobald die Tage heller werden, sobald sie in den Abend hineinzuwachsen beginnen.
Ich dachte, ich sei im Schreiben besser als im Leben, aber gerade weiß ich gar nicht, was ich damit noch soll – es klingt lächerlich, Wörter auf leere Blätter schreiben, die Welt nach Bildern abtasten, nach Tonlagen ablauschen, nach Wörtern fahnden, um Sätze zu knüpfen und Menschen hineinzuweben, die man in der Wirklichkeit vergeblich sucht, Sätze, geleimt aus Bruchstücken, genäht aus Fetzen, aus ein bisschen Du, ein bisschen ich, ein bisschen Jambus, Trochäus, ein bisschen Simon, mein Vater, meine Mutter, meine Schwestern, ein bisschen Lori und wer noch etwas gibt und fallen lässt, Wörter in mein Gehege wirft, damit ich sie auffange und weiterschreibe. Also frage ich Dich, Johanna, Du wirst wissen, ob das ein Beruf ist, zu schreiben, sei ehrlich, sag mir, ist es einer, sag ruhig, Johanna, ist es ein Beruf?
Mia hat mich gefragt, mit ihrer zartsüßen, leichtverklebten Honigstimme, ob ich schon etwas anderes gewesen sei, etwas anderes gearbeitet hätte – die unzähligen, endlosen Möglichkeiten unseres Lebens, in ihrem klugen Köpfchen mit den unverbaut freien Denkpfaden gibt es sie, als könnte ich in diesem Jahr das eine, im nächsten Jahr das andere, im übernächsten das völlig andere sein, als könnten wir wechseln in dem, was wir sind und sein wollen, als brauchten wir uns nicht festzulegen, als könnten wir weiterspringen und uns immerzu neu am Leben versuchen. Früher, weit, sehr weit zurück in einem Früher, in dem es Dich und mich schon nebeneinander gab, hatte ich das auch gedacht, ich muss diesen Gedanken verloren und nicht weiter nach ihm gesucht haben. Gerade kostet es mich Überwindung, an den Schreibtisch zu gehen, um nach Wörtern zu kramen, in den Untiefen meiner selbst, meinem Ich, meinem Mir, in den Luftblasen meiner Márta-Strudel, den Kreisbahnen meiner Márta-Wirbel, jeden Satz, jedes Wort muss ich mir abringen, es tut mir leid, daß dieser Brief so mies ist, ich leb wie mit Ameisen im Blut. Früher, weit, sehr weit zurück in jenem Früher, sind mir diese Dinge leichtgefallen, leben, schreiben, atmen, schlafen – wie kann ich, liebste Jo, wie soll ich noch einmal zweiundvierzig Jahre durchhalten?
Deine Márti
30. März 2009–21:03
Liebste Márti,
Kathrin hat einen Beruf, so viel steht fest. Sogar einen eigenen Laden hat sie jetzt. Ist vergnügt wie ein König und baut ein Luftschloß ums andere. Ich helfe samstags. Heute wieder von halb acht bis zwei. Kathrin kann keine Aushilfe bezahlen. Nicht mit ihrem nagenden Kredit. Nicht mit drei Kindern. Nicht mit Claus, der sich als Restaurator, dann als Musiker versucht. Ich werde nicht müde, Kathrin zu empfehlen. Bei Schülern, Eltern, Kollegen. Bei allen, die aussehen, als würden sie Blumen kaufen. Zu Kathrin habe ich gesagt, es ist die beste Jahreszeit, einen Blumenladen zu eröffnen. Wenn der Winter schwach wird. Wenn er abfällt. Selbst bei uns. Der Geheime Garten nach Burnett heißt er nun doch. Fehlt nur der Rollstuhl in einer Ecke. Für dieses Schwarzwaldnest ein bisschen viel. Ein bisschen übertrieben. Aber Kathrin hat es sich nicht ausreden lassen. Seit Montag hängt das neue Schild über der Tür. Die Buchstaben springen aus blitzweißem Holz. Verteilen sich rundbunt um einen großen Schlüssel. Bevor Kathrin am Morgen aufschließt, zeigt sie mir, was in den Vasen und Eimern steht. Ich kann es mir ungefähr merken. Waldhyazinthe. Anemone. Gedenkemein. Elfenblume. Ja, Elfenblume. In Wahrheit hilft diese Arbeit mir, nicht Kathrin. Sie setzt meine schwebenden Füße auf den Boden. In Turnschuhen. Grün, mit roten Schnürsenkeln. Passend zur Schürze. Sie gibt meinem Kopf vor, was ich in diesen Stunden zu denken habe. An was ich gerade nicht zu denken brauche. Sehr heilsam, Márti. Wenn der Schwarzwaldhimmel kein Blau für mich hat. Der Schwarzwaldnebel dickschwer vor meiner Haustür liegt. Dass ich sie kaum aufstoßen kann. Wenn der gesammelte Johanna-Missmut schon am Morgen vor meine Füße kracht. Peng!
Die rosafarbenen Wände hat Kathrin aus unserer Hamburger Zeit mitgebracht. Dazu grasgrüne Kissen auf der Bank vor dem hohen Fenster. Solange man wartet, trinkt man Kaffee. Schaut auf eine Weide, die ihre Zweige auf die Dächer der parkenden Autos legt. Sie im Sommer mit Blütengelb überziehen wird. Oder man sieht dem Belgischen Riesen beim Möhrenknabbern zu. Bestaunt sein makellos weißes Fell. Nach dem jedes Kind die Hand ausstreckt. Rate doch, wie er heißt. In Hamburg würde es gehen, Márti. Das Glöckchen über der Tür würde nicht aufhören zu bimmeln. Die Leute würden Schlange stehen. Um Blumen zu kaufen, Colin zu streicheln. Kaffee am Fenster zu trinken, hinauszusehen auf Regenschirme und Asphaltpfützen. Den Splitter Nordhimmel suchen, der in ihnen schwimmt. Deine Worte. Aber wie weit das Schanzenviertel mit seinen Haarspangenläden, seinen rattenverpissten Treppenhäusern entfernt ist, kann ich am stärksten im Geheimen Garten spüren. Wie plötzlich irgendwo gelandet wirkt Kathrins Laden. Fernab vom eigentlichen Ziel. Achthundert Kilometer zu weit im Süden. Neunhundert? Also fühle auch ich mich wieder ein bisschen so. Fehlgeleitet, vom Weg abgekommen. Verirrt, verlaufen. Zu früh ausgestiegen. Zu spät.
Erinnerst Du Dich an den Blumenladen in der Nähe meiner Hamburger Wohnung? Wo Du mit dickem Mia-Molke-Bauch beinahe umgekippt bist? Man Dich hinter der Theke hat sitzen und Kräutertee trinken lassen? Bis Du wieder Farbe im Gesicht hattest? Während sie Sträuße banden, die aussahen wie eine Schwarzwaldwiese im Juli. Wenn der Regen weiterzieht und die Sonne alles gibt, was sie zu geben hat. Wenn ich Hyazinthen und Anemonen aus Kathrins Vasen pflücke und zusammenbinde, denke ich an diesen Hamburger Laden. In dem ich damals meine Blumen gekauft habe. Wenn ich fand, sie sollten auf meinem Tisch stehen und mir zeigen, weit draußen wächst so etwas. Fern von Häusergrenzen und Zaunnähten. Dein Wort.
Stell Dir vor, die Leute lächeln, wenn sie meine Sträuße sehen. Wirklich, Márti. Sie sehen sie an und lächeln. Ein Gedanke schleicht sich dann ein. Den ich nicht loswerde. Nicht verscheuchen kann. Der mich durchzuckt wie eine Deiner Lichtgirlanden. Wenn ich zwanzig, dreißig Euro für einen Strauß in die Kasse lege. Der Gedanke, ich hätte nicht Lehrerin werden sollen. Und das ist ein schlimmer Gedanke, Márti. Ein sehr schlimmer Gedanke.
Es liebt Dich,
Deine Johanna
31. März 2009–07:04
Liebste Johanna,
ich wünschte, ich könnte im Geheimen Garten vorbeischauen, bei Dir würde ich meinen Strauß bestellen, bei Dir, nicht bei Kathrin, violett müsste er, ein bisschen blau dürfte er sein, ich würde einen Kaffee nehmen, mich ans Fenster setzen und mit Colin im Schoß warten, bis er gebunden wäre, bis ich meine Nase zwischen Viola und Flieder stecken und tief einatmen könnte, oder was wächst und blüht jetzt am Tannenbühl in der Mitte des Waldes? Bin neidisch auf Kathrin, weil Ihr Euch beim Tee erst die nachtfrischen, dann die alten unvergessenen, ewig zurückkehrenden Träume klagen könnt, bevor Du Möhren in eine Schale legst, Kathrin das Glöckchen einhängt, die Tür öffnet und den feuchtkalten, wolkengeschmückt regenverkündenden, launischen Märzmorgen hereinlässt. Wie verrückt, wie unerklärbar verrückt unsere Lebenswege sich winden und kreuzen! Warum, liebste Jo, hat es Kathrin in den schwarzen Wald, in Deine Nähe verschlagen, warum nicht mich?
Aber ich beschwere mich nicht, nein, ich schimpfe nicht, mache Dir keine Vorwürfe, heute bin ich glücklich und leicht, nicht schwerelos, aber leicht, doch, fast ein bisschen ohne Gewicht, weil ich gestern schreiben konnte, bei Lori, an ihrem alten Ateliertisch aus Kirschholz, das man wegen unzähliger Farbkleckse kaum sehen kann, die Lori über Jahre darauf verteilt hat und die mich abgelenkt und weggezogen haben, auf seltsam sich verzweigende grüngelbe Straßen, in feine rote Sackgassen, während Henri von Lori spazieren gefahren oder auf ihrem Wohnzimmerteppich bewundert wurde, den er arg zugespuckt hat. Ich hatte Ruhe, Johanna, Ruhe, verstehst Du? Zwei Erzählungen habe ich überarbeitet, eine davon Das andere Zimmer, auf die Du schon wartest und die ich in dieser seligen Ruhe für nahezu fertig erklärt habe, Henris Schreie hinter geschlossenen Türen schwach wie fernes Gewitter. Ruhe, dreimal hintereinander Ruhe, um nichts, gar nichts brauchte ich mich zu kümmern, außer Henri zu stillen, wenn Lori alle zwei, drei Stunden an die Tür klopfte und mir mein jammerndes Kindchen reichte. Trotz Loris Zitterhand, mit der sie wohl leben muss, gab es warmes Essen, Sellerie, Fleisch, Petersilienkartoffeln, eine klare Suppe vorab, keine belegten Brote wie sonst, weil es ja immer schnell gehen muss, weil keiner von uns Zeit hat, Suppen zu kochen, Suppen schon gar nicht, das Kindermädchen nicht, Simon nicht, ich nicht. Erst gegen Mitternacht sind wir los, Simon holte uns spät ab, gerade noch rechtzeitig, um nicht denken zu müssen, er hat uns vergessen, Henri und mich einfach lieber vergessen.
Vor meiner Kaffeetasse liegen Einladungen in die Länder, wo Grobe Fährten im Sommer erscheinen soll, ganz oder halb oder in winzigen Auszügen in einer Sammlung, das ist übersichtlich, sehr übersichtlich, Norwegen ist dabei, mein treues Norwegen, und Schweden, ich müsste nur zusagen. Aber noch zögere ich, ich höre schon die Telefonstimmen: Márta?, dein Kind brüllt seit Stunden, seit du weggegangen bist, brüllt es! Noch fehlt es mir an Ideen, wie mir das gelingen könnte, vom Flugzeug ins Hotel, Milch abpumpen mit dieser Foltermaschine, damit sie nicht aufhört zu fließen, sprechen, lesen und die Augen nicht zufallen zu lassen, obwohl mir um zehn Uhr abends genau danach wäre, nichts wünsche ich mir um zehn so sehr, wie meine Augen zufallen zu lassen, wegen meiner von Henriklagen zerrissenen Nächte – mein ständiges Schlafen später. Aber ein Bild habe ich, Johanna, ich stehle mir eine Minute, von irgendwoher noch eine, habe also zwei Minuten, in denen ich in azurblassblauer Sommerluft sitze, über mir, nur für mich, eitel selbstverliebt der sagenhaft große Nordhimmel – und ich klitzeklein darunter.
Márti
1. April 2009–23:39
Liebste Márta,
aus dem All sinkt die Nacht mit glitzernden Nägeln – Dir klage ich meinen jüngsten Traum. Nicht Kathrin. Der alte Dämon Markus ist zurück. Führt mich jede Nacht in mein früheres Leben. Lehnt seine zwei Meter an meinen Türrahmen. Dreht seine Schulter so, dass ich die Tür nicht schließen kann. Dreitagebart und dunkle Brillenränder wie immer. Stirnlocke, die ins Gesicht fällt und unter der rechten Braue, knapp über dem Auge zum Halten kommt, wie immer. Hand am Kinn. Bärenstimme. Schulterschiefe Haltung. Grüner Parka gegen den Schwarzwaldregen. Alles wie immer. Das winzige, nicht auszurottende, nicht zu verbannende miese Etwas, das dicht an meinem Ohr raunt: Geh mit ihm, Johanna, geh. Auch das wie immer. Heute Nacht sagte Markus, die Ärzte schicken ihn. Ich sei zu früh aufgestanden und weggegangen. Ich solle mir etwas überziehen. Ins Auto steigen. Aber ich zog mir nichts über und stieg nicht ein. Ich habe Markus nicht hereingelassen. Ihn nicht hereingebeten. Obwohl dieses Haus einmal auch sein Haus war. Diese Zimmer einmal auch seine Zimmer waren. Nein, hereingebeten habe ich ihn nicht. Auch wenn es sich sehr aufwendig angefühlt hat, es nicht zu tun. Es mir zu verbieten. Ja, es ist das richtige Wort, Márti. Aufwendig. Als ich aufwachte, war ich glücklich, es nicht getan zu haben. So glücklich, wie ich heute Morgen sein konnte.
Es macht mir Angst, auf welchen Markuspfaden mein Hirn wider meinen Willen umherschleicht. Oder sind es meine Krebspfade? Meine Krankenhauswege? Die immer vor derselben Tür enden? Frauenklinik. Abteilung Gyn 2. Zimmer 5. Ich hatte gehofft, die seien stillgelegt. Verschüttet. Mit dem Moos der Wutachschlucht überwachsen. Aber der Schlaf nimmt mich mit. Wirft mich in einen Traum, den ich nicht träumen will, platsch! Ich sträube mich, ihn zu träumen. Noch den ganzen folgenden, sich bis in den Abend streckenden Tag sträube ich mich, ihn geträumt zu haben. Aber so weit bin ich noch nicht. Dass ich mir aussuchen könnte, was ich träumen will. Was lieber nicht. Eine kleine rebellische Ecke meines Kopfes öffnet Markus nachts die Tür und sagt, komm herein. Nein, du störst nicht. Überhaupt nicht. Komm ruhig, Johanna hat nichts dagegen. Auch wenn ich bei Tageslicht weiß, Markus ist längst gegangen. Ich habe gesehen, er ist gegangen. Ich weiß es doch. Das hat mein Blutlabyrinth sehr unfreundlich eingerichtet. Dass ich so viel Aufwand betreiben muss, bis es mir eines Tages gleich ist. Ich gleichgültig sein kann. Tief in meinem Traumkopf. Auch Dein Wort. Faser um Faser, Vene, Knochen, Muskel, Organ markusgleichgültig. Lunge, Nieren, Herz markusgleichgültig.
Es dauert, bis ich mich nach dem Aufstehen in Studienrätin Johanna Messner verwandle. Ich verwandle mich, wenn ich meinen Tee trinke. Unter der Brause stehe. Im Radio die Frühnachrichten höre. Merke, die Welt ist noch da. Es gibt sie. Alles geschieht in wiederkehrendem Gleichklang. Im immergleichen Wechsel. Wenn ich meine Kleider überziehe. Mein Haar bürste. Locke für Locke höllenrotes Haar über den Kamm drehe. Das seine alte Länge noch eine Weile nicht erreicht haben wird. Wenn ich die Tür öffne, aufs Rad steige und losrolle. Den ersten Hauch Schwarzwaldluft atme und weiß, es wird ein kalter, nein, heute wird ein warmer Tag. Ein Tag ohne Regen. Ohne einen Tropfen Regen.
Sei unbesorgt, für andere bleibt das unbemerkt. Ich schaue wie jeden Morgen auf meine Schüler. Wie jeden Morgen fordere ich sie auf, etwas zu lesen. Etwas zu schreiben. Zu sagen. Wie jeden Morgen zeige ich auf die Tafel. Wie jeden Morgen seit eh und je. Niemand würde denken, Frau Messner ist an einem anderen Ort. Jetzt, da sie starke und schwache Verben an die Tafel schreibt. Fallen. Träumen. Entkommen. Ich entkam. Du entkamst. Er, sie, es entkam. Jetzt ist sie an einem Ort zwischen Wachen und Schlafen. Sie versucht, sich einem bösen Traum zu entwinden. Entwinde mich, endwindest dich, entwindet sich. Gerade setzt sie alles daran, ihr Markusbild zu verjagen.
Jo
2. April 2009–23:09
Liebste Johanna,
eines Tages verwandeln sich alle in Dämonen, und uns fällt nicht mehr ein, wie wir etwas anderes in ihnen hatten sehen können. Vielleicht wird auch Simon irgendwann aussehen wie ein Dämon oder wie ein Wasserspeier an Deinem Freiburger Münster, der diese Dämonen verschrecken soll, mit seinen zu groß geratenen Ohren und Zähnen, seinen Riesenklauen. Noch tut er das nicht, nichts deutet darauf hin, dass er je so aussehen könnte, die blonden, kinnlangen Haare trägt er wie immer hinter die Ohren gesteckt, die Augen sind genauso nordmeerbleiblau tiefliegend, die Lippen, die er eins zu eins an unsere Tochter weitergereicht hat, zeigen noch genauso spitz blassrot nach oben, selbst sein Körper ist unverändert, Beine in leichtem O, Hände fein, Schultern rund, Haut weich, alles unverändert hübsch und gut, ja, noch immer gut und hübsch anzusehen.
Ich kann kaum etwas anderes tun, als um Henri herumzuspringen, also kann ich Dir nicht viel schreiben, geschweige denn Gedichte oder Erzählungen, das gehört in ein anderes Mártaleben. Simon und ich haben ein zuckersüßes Baby, das leider ein zuckersüßes Schrei-Baby ist, wie mir die Ärztin offenbart hat, nachdem Henri seit Tagen mit nichts zu beruhigen war. Er wird von Simon und mir geschaukelt, gewickelt, getröstet, getragen, gewiegt, aber nichts gefällt ihm, er wird von Mia und Franz besungen, besprochen, beflüstert, geküsst, geherzt, gedrückt, aber nichts davon mag er. Wenn Henri still ist, um Luft zu holen, höre ich sein Schreien weiter, doch die Natur hat eingerichtet, dass Simon und ich, sobald Henri wegdämmert und seufzt, sofort denken, ist er nicht wunderbar? So rosig, frisch und neu? Jetzt liegt er auf meinen Schenkeln und schläft, meine Nerven sind angeritzt, Johanna, doch ich schreibe Dir, damit Du siehst, es gibt mich, ich lebe, wenn auch nur halb, ich atme, wenn auch viel zu schnell, und wenn Ihr kommt, wird es schwierig, weil man kaum reden kann und das Gebrüll am Abend nicht auszuhalten ist – dennoch würde ich mich über nichts mehr freuen als über Dich und Kathrin auf meiner schiefen Küchenbank mit den aufmüpfigen Zupfspreißeln, vor uns auf den Brandlöchern der Tischdecke eine Flasche Marillenschnaps aus Amorbach und ein Teller handgedrehter Pralinen, von Loris Zitterfingern mit Pistazie und Kaffeebohne verziert.
Ihr fahrt doch über unsere hässliche große Stadt mit den vielen, vielen Autos und dem zurückgedrängten, röchelnden, wehrlos nadelnden Wald, über den die Flugzeuge nach West und Ost donnern? Wir könnten durch die nahen Niddaauen spazieren, hör nur, wie großartig, wie phantastisch das klingt, Henri in seinem Wagen brüllen lassen, bis wir drei im Gleichschritt den Hölderlinpfad kreuzen, ungefähr auf Höhe der 661, und uns angesichts dieser Blech- und Betonhölle zum tausendsten Mal fragen, ob es wirklich hier gewesen sein soll, dass Hölder sein wundgescheuertes Herz an Susette vergeudet und verprasst hat. Wie hört sich das an?
Die Liebe zwingt all uns nieder, aber der Mond hinter den Dächern hält gerade still. Ich kann sehen, wie er sich hinter zwei Strommasten verstecken will, nicht ahnt, dass sie zu schmal sind und es nicht ausreichen kann. Zu dumm, dieser Mond.
Schlaf gut, meine Schönste, und träum den gewünschten Traum.
Es liebt Dich,
Márta
3. April 2009–05:04
Liebste Márta,
ich kann nicht schlafen, über dem boden hängt der erste nebel langsam aufgestiegen aus dem holz der nacht. Vielleicht rächt sich Henri an Dir, weil Du ihn die letzten Wochen im Bauch so verschreckt hast. Ich habe Dir beim Reden und Denken zugehört. Immerzu hast Du gesagt, ich habe noch keine Zeit, dich in die Welt zu setzen, mein drittes Kind. Ich muss an meinen Erzählungen feilen. Ich muss Kisten packen und umziehen. Den Keller ausmisten. Meinen Husten loswerden. Ich muss eine Nacht durchschlafen, wenigstens eine.
Kathrin sagt, ich soll Dir schreiben, wir kommen. Wir haben nichts gegen schreiende Babys. Wir lieben Henri. Auf die uns eigene verklemmte, unverbraucht hemmungslose Weise. Seit wir ihn an diesem klirrend kalten Februarmorgen im Marienhospital in den Armen hielten. Vor einem Fenster mit Blick in einen rotglühenden Himmel. Im Februar! Seit Henri für eine Millisekunde die Augen für uns aufschlug. Damit wir sie sehen konnten. Nordmeerbleiblau und tiefliegend. Wie die seines Vaters. Er darf also schreien. Nur zu!
Und hör sofort auf mit unserem Alter, unserem Ende, ja? Das Du am Telefon so unausweichlich ausbreiten musstest. Mir steht das zu. Nicht Dir. Ich trage eine Narbe auf der Brust. Ich bin es, die den Tod verscheucht hat. Jetzt lässt er mir Zeit. Beschenkt mich mit einem Aufschub. Gerade ist er nirgends in Sicht. Obwohl ich ein Jahr lang gedacht hatte, da hockt er in meiner Schlafzimmerecke und lauert. Weißt Du, dass ich Dein Nacht und Tag, Deine Grobe Fährten immerzu durch meinen Kopf geschickt habe? So oft durch meine Zytostatika-Venen, dass ich alle Gedichte auswendig kann? Als seien sie von mir. Als seien es meine. Sogar die Seitenzahlen kann ich Dir sagen. Grobe Fährten, Seite zweiundzwanzig. Den Tod nicht ansehen. Besser vorgeben, er säße nicht hier. Wir hätten ihn nicht gehört. Nicht sein Füßescharren, nicht sein leises, unüberhörbar lautes Komm-komm. Auch so eine Offenbarung. Von der Du nichts wusstest.
Bislang ist es also das Ende vom Krebs. Das Ende eines Tages. Einer Woche. Bei Markus und mir das Ende von zehn meisterhaft geglückten, dann vier meisterhaft verunglückten Jahren. Ich lebe noch immer. Ja, sieh und staune mit mir, Márti. Ich lebe. Hier, im schwarzen Wald lebe ich. Ich atme. Ich stehe kopf. Raufe mir die höllenroten Haare. Schlage noch immer Purzelbäume. Ohne Markus zwar und nur mit halber Brust auf einer Seite – was schlimmer ist, wenn ich ehrlich bin. In diesem Leben spiele ich noch mit. Noch einmal hat man Karten an mich verteilt. Obwohl alle dachten, mich eingeschlossen, mein Ende sitzt auf einem dieser blauen Kunststoffstühle in der Onko-Ambulanz. Wartet, bis ich aufstehe und mitgehe. Nicht weit von meinen Schläuchen und umgedrehten Flaschen. Aus denen es in mich hineintropfte. Die Schere an meinem Lebensfaden. Ich konnte sie spüren. Du konntest sie spüren. Auch wenn Du es nie zugeben würdest. Aber ich frage ja nicht. Es soll Dein Geheimnis bleiben. Ich lasse es Dir.
Hätte ich Kinder, wäre es einfacher. Ich müsste jedenfalls nicht immer um mich selbst kreisen. Nicht denken, ich bin das Wichtigste in meinem Leben. Die Droste-Hülshoff ist es. Ihre staubigen, gelbgenagten, abgeschickten oder niemals abgeschickten Briefe sind es. Ihr Rüschhaus. Ihr Moor. Ihre Schwäne in ihrem Burggraben. Ihr Nebel über ihrer Heide. Ihr Moorknabe. Ihr hartnäckiger Husten und ihr Weg in den Tod am blauen Wasser des schwäbischen Meeres. Mein Beruf ist das Wichtigste in meinem Leben. Weil ich sonst nichts kenne und habe. Weil ich sonst nichts bin. Nur was der Beruf aus mir gemacht hat und weiter täglich aus mir macht. Weil es das Einzige ist, was mich am Morgen wach werden, aufstehen und aufbrechen lässt.
Ohne Markus bin ich nur halb, Márti. Ich schreibe es Dir, und Du wirst es nicht weitersagen. Hätte ich Kinder, fehlte ohne Markus nur ein Viertel oder Fünftel. Nicht gleich eine Hälfte. Ich müsste mir nicht so halbiert vorkommen. Franz, Mia-Molke und Henri zu haben, sie selbst gemacht, selbst in die Welt gesetzt zu haben, muss ausreichen. Vorerst jedenfalls muss es Dir ausreichen.
Ja, ich denke zu einfach. Aber lass mich doch. Dass unter Deinem Gesicht etwas schwelt, das jederzeit losbrennen und weite Flächen ansengen kann, wusste ich immer. Deine zwei Leberflecken auf der schmalen Nase, passend zu Deinen Mokka-Augen – das konnte ja nicht alles sein. Selbst als Kind wusste ich das. Wer bist du, sag, die so schön und ernst mir erscheint?, hätte ich Dich damals fragen mögen. Wenn ich es schon gekannt hätte. Also frage ich heute. Dreißig, fünfunddreißig Jahre, mein Gott, Márti, fünfunddreißig Jahre später! Wer bist du, sag, die so schön und ernst mir erscheint?
Deine Jo
4. April 2009–14:03
Liebste Jo,
etwas zu ernst gerade. Heute Nacht hat Simon so gebrüllt, dass Mia und Franz aus den Betten gesprungen sind und heulend vor uns gestanden haben. Das Pochen im Kopf – ich kann nicht glauben, wie verrückt Simon sein kann, nach all den Jahren kann ich noch immer nicht glauben, mit welcher Wucht er seine Sprengladungen in unseren Zimmern zwischen Bett, Tisch und Stuhl aufstellt und zündet. Tagelang, wochenlang räumen wir dann Trümmer weg, Eimer für Eimer Schutt, Drähte, Steine, Tapete, Putz, jeder so viel er tragen kann, Mia, Franz und ich, vielleicht sogar Henri, irgendein Splitter bleibt immer im Fuß und sticht bei jedem Auftreten.
Besser wäre, Du und ich, wir lebten zusammen, ich würde meine Körberstraße, meine Márta-Horváth-Gasse, und Du würdest Deinen Waldpfad, Deine Droste-Hülshoff-Schneise verlassen, mit mir solltest Du Dich verdoppeln, Johanna, das denke ich nicht nur in den bleigrau matten Stunden, wenn Schutt und Staub durch unsere Zimmer fliegen. Niemand müsste schreien, meine Kinder müssten nicht in Nachthemd und Pyjama im Türrahmen stehen und zuschauen, wie ihre Eltern sich zerfleischen, wegen der ewig gleichen Dinge, Geld, Zeit, Geld, Zeit und wieder Geld und wieder Zeit, wer macht was, wer bezahlt was, wer hat gerade Geld, dieses und jenes zu bezahlen, wer hat gerade Zeit, dieses und jenes zu tun. Wie oft habe ich vorgeschlagen, aufs Land zu ziehen, wo das Leben billiger, einfacher wäre, aber Simon will nicht, er braucht die Stadt. Für was? Meist sitzen wir an unseren Schreibtischen, das könnten wir genauso auf dem Land, die Kinder könnten Hunde haben und Kaninchen dressieren, sie könnten aus dem Haus in den Wald, sie dürften an einem Rieselbach aufwachsen und nicht an U-Bahn-Gleisen, umtost von einer vierspurigen Straße, die sie Tag für Tag aufs Neue überleben müssen.
All meine Worte nützen nichts, wir bleiben hier, so wie wir dann immer hierbleiben, auch wenn die Druckwelle nach der Sprengung etwas auslöst in mir, etwas ablöst von mir, und ich denke, so können wir nicht weitermachen, unmöglich können wir so weitermachen, wir können so nicht weiterleben, etwas muss sich ändern, und wenn es nur die Bewegungen auf unserem Konto sind.
Deine Márti
4. April 2009–18:20
Liebe Márti,
Du auf dem Land? Einem jener abgeschlossenen Erdwinkel? Wo noch ein fremdes Gesicht Aufsehen erregt? Du müsstest lernen, Mäuse totzuschlagen und abends allein zu sein. Mit der Dunkelheit. Dem Himmel. Dem Waldweben. Besser ist, ich schicke Geld. Soll ich Geld schicken? Mitbringen?
Kathrins Mutter wird über Ostern aus Esslingen anreisen. Den Geheimen Garten übernehmen. Ein paar Tage Blumen zu verkaufen ist ihr willkommene Abwechslung zu kranken Knien und Bandscheiben, mit denen sie sonst zu tun hat. Auch wenn Kathrin sich sorgt, dass etwas schiefgehen könnte. Aber um einmal ohne Mann und Kinder wegzukommen, bleibt ihr nichts anderes. Die Kinder werden mit Claus in die Vogesen fahren. Claus hat ein Fünf-Mann-Zelt besorgt, in dem man stehen kann. Wir haben es gestern hinter dem Blumenladen aufgebaut. Heringe in den Boden geschlagen. Stangen aneinandergesteckt. Während Kathrin Kirschzweige und Korkenzieherweide in die Vasen stellte. Die Kinder haben geschrien vor Glück. Haben Colin im Zelt springen lassen. Sind in ihre Schlafsäcke geschlüpft. Haben alle Reißverschlüsse auf- und zugezogen. Die Campingtöpfe umgedreht und mit den Löffeln draufgeschlagen. So laut, dass wir uns die Ohren zuhalten mussten.
Also ja, wir kommen. Wir kommen!
Umarmung,
Deine Johanna
5. April 2009–13:29
Liebste Johanna,
ich kann mich selbst nicht aushalten, wie könntest Du es dann? Sitze in meinem tiefen Brunnen, in den ich nicht nur wegen Simon gefallen bin, nein, aber so viel weiß ich, Simon hört mich nicht, wenn ich laut winsele und gegen die klammen Wände schlage, wenn ich doch nicht so viel geweint hätte, zur Strafe dafür soll ich jetzt anscheinend in meinen eigenen Tränen ertrinken! Ich habe keinen Rat, wie ich nach oben steigen soll, wer mich hochziehen und befreien könnte, hättest Du vielleicht Zeit? Johanna, Liebste, ich stehe neben mir, ich ist eine Andere, ich habe keine Kraft, nicht einmal fürs Aufstehen am Morgen, es reicht kaum, den Wecker auszustellen, die Decke zur Seite zu schlagen und nach meinen Hausschuhen zu tasten, wie soll ich so die nächsten Jahre überleben?
Könnte ich nie mehr schreiben, wäre mir das gleich. Siehst Du, das macht mir Angst, macht mich krank vor Angst, so ungut und übermäßig krank, dass ich kaum Luft kriege und mich beuge vor lauter Kranksein, weil nie etwas wichtiger war, als Wörter auf mein Nervenband zu fädeln und geordnet in mein Heft zu schreiben. Aber wenn das Schreiben mir nichts mehr bedeutet, was soll mit mir, wer soll ich dann sein? Johanna, entschuldige, dass ich damit bei Dir anklopfe, aber dieses überschwappende Gefühl löst sich nicht auf, als sei alle Lust aus mir gezogen. Mein Überleben im Alltag kostet mich jede Kraft, zum Schreiben bleibt mir keine – die letzten Jahre haben zu viel eingefordert, mir zu vieles genommen, geraubt, entwendet, gestohlen, sag es, wie Du willst, öffne Deine Wortkiste und finde Du ein Wort dafür. Trotz des Glücks, Erzählungen zu schreiben, keine Gedichte, ein Buch aus Mártasätzen zu knüpfen, zwischen zwei Deckeln Pappe Zeile für Zeile Mártawörter, Wörter von mir, Márta Horváth, ist der Herbst, der Winter in mir geblieben, auch Henri hat ihn nicht weggeseufzt, nicht einmal weggebrüllt hat er ihn, Tag um Tag setzt er neue Eisspuren, obwohl in den Vorgärten der Körberstraße die Magnolien und Forsythien auftrumpfend losblühen.
Lori tröstet mich mit ihrer wunderbaren Altstimme, wie geschaffen fürs Trösten, sie wird nicht müde, zu sagen, es geht vorbei, Mártilein, sicher geht es vorbei, vielleicht kehrt es zurück, aber auch dann wird es vorbeigehen, das Dumme ist nur, du musst es aushalten, Kindchen, solange es da ist, musst du es aushalten. Also liege ich auf meinem schmutzigen Sofa, der schreiende, gurgelnde, schlafende Henri neben mir, starre zur Decke und halte es aus, ja, halte es aus, so gut ich kann, Johanna, ich warte, bis es vorbei sein wird, Futur eins, so lange aber bewegt sich nichts in ein Plus oder Minus, mein Pendel schlägt in keine Richtung. Lori sagt, ich soll die kleinen Dinge sehen – gut, sehen wir die kleinen Dinge, Loris Pralinen, die für Euch bereitstehen, Walnuss, Marzipan, Nougat, den Fensterausschnitt meiner Küche, darin den frühlingsblauen Frankfurter Himmel, Flugzeuge, Kondensstreifen, trotz April noch immer nackte Winterbäume.
Ich nehme mich zusammen, bündele meine Kräfte und schaue meinen Kindern beim Wachsen zu, das ist einfach. Warte, bis Mia und Franz nach Hause kommen, und lasse sie den Mollakkord wegsingen, der sich in meinen Tag gefressen hat, sie trösten und halten mich mit ihrem reinen C-Dur, allein mit ihrer Art, die Stufen hochzustürmen, Taschen, Schuhe, Jacken wie lästige Gewichte abzuwerfen und in jeden Winkel unserer zugestellten, vollgestopften, überlaufenden, staubsüchtigen, schuttgeschundenen Zimmer Leben zu sprühen, ihr Gelächter und Gekicher auszuschütten, mich mit ihm zu überfallen, es über mir auszugießen, mich mit ihm nass zu machen und zu tränken.
Und dass Ihr kommt! Ihr kommt doch? Morgen Abend setzt Ihr Euch an meinen Tisch und schenkt den ersten Schnaps ein? Kurz bevor die Osterfeuer angezündet werden? Mia wird Räder schlagen vor Glück, und ich werde es auch.
Es liebt Dich,
Márta
19. April 2009–22:57
Liebste Márta,
war das herrlich, mit Lori und den Kindern am langen Tisch zu sitzen. Mit der großen, zu großen Mia auf meinem Schoß. Wozu das schnelle Wachsen? Henri zu bewundern. Ja, er schreit. Natürlich schreit er. Aber es hat uns nicht gestört. Mich nicht. Kathrin nicht. Sie sagt, sie hat doch vor schreienden Kindern keine Angst. Vor vielem hat sie Angst, ja. Vor dem Weltende. Einem Atomkrieg. Dem Waldsterben. Den überfluteten Küsten. Dem Kredit. Aber nein, bestimmt nicht vor schreienden Kindern. Ich danke Dir für die Gemüsesuppe. Den roten Wein. Die vielen bunten Gläser Marillenschnaps. Das frisch von Mártahand bezogene Gästesofa. Dafür, dass Du nicht um zehn mit dem Kopf auf der Tischdecke eingeschlafen bist. Sondern bis in die Nacht mit uns gelacht, ein bisschen sogar getrunken hast. Ein kleines bisschen. Lebendig bist Du mir übrigens doch vorgekommen. Gar nicht wie eine Brunnenbewohnerin. Eine Tränenteichschwimmerin. Nach Deiner alten Lebenslust hast Du fast ausgesehen. Nach Deiner schönen alten, hochbewährten Mártalebenslust.
Nachdem Kathrin zu viele Bakterien bei Euch abgeladen hatte, für die Ihr keinerlei Verwendung habt, ist sie wie immer tapfer, ohne zu ermüden diese elende Strecke gefahren. Mit Hustensprays und Lutschtabletten im Handschuhfach. Hamburg. Fehmarn. Dänemark. Ein verrücktes Stück Autobahn. Nur um in Hamburg die alten Freunde zu treffen. Einmal in die Alster zu spucken. Einer Hafenmöwe hinterherzuwinken. Ein Jahr, das vergehen würde, ohne an diesen Orten gewesen zu sein, wäre für Kathrin ja ein verlorenes Jahr. Ohne durch Eppendorf, Altona, durchs Marktviertel spaziert zu sein. Die Fassaden besucht zu haben. Ihre Hausgesichter. Hinter Altenteil aufs Meer geschaut und ihre klopfend hämmernde Sehnsucht ins Wasser geworfen zu haben. Deshalb habe ich mich also von Kathrin überreden lassen. Auch wenn das Jahr noch lang ist. Mag sein, ich verabschiede mich endgültig von den großen Städten, Márti. Hamburg nach zwei Tagen loszulassen, fiel mir nicht schwer. Zum ersten Mal nicht. Nicht wie sonst, wenn ich bei jeder Abreise gedacht hatte, wie kann ich diese Stadt aufgeben? Ihren regenunterlaufenen, treulos nach Wolken jagenden Himmel? Dein Satz. Manchmal denke ich, bei Kathrin und Claus ist es nur eine Frage der Zeit, bis sie ihre Sachen in Kisten packen und zurückgehen. Obwohl die Kinder auf diesem runzligen Forsthof ein Leben führen, wie sie das in Hamburg nie könnten. Freiglücklich hinter dem Jägerzaun durchs hohe Schwarzwaldgras springen. Im Wiesenschaumkraut in Schafgarben verschwinden.
Auf der Fähre nach Rødby hat ein Laster im Vorbeifahren unsere offene Wagentür an der Fahrerseite fast abgerissen. Sie war nicht mehr zu schließen, hing weit geöffnet über dem Boden. Die dänische Polizei konnte gerade nicht, die deutsche war nicht mehr zuständig. Also haben wir eine Weile auf die Wellen geschaut. Auf die an- und ablegenden weißen Rødby-Puttgarden-Schiffe. Die Tür dann selbst geklebt. Kathrin hatte in ihrem Notkoffer zwischen Pflaster, eingetrockneten Pastillen, Zeckenspray und Lupe auch Klebeband. Mir zuliebe hat sie sich in Kopenhagen hustend durch die Glyptothek geschleppt. Am Abend mit der Höchstladung Aspirin ins Hotelbett gelegt. Während am Nyhavn das Biertrinken losging. Stimmen und Gelächter hoch zu unserem Fenster drangen. In der Nacht war sie heißgeglüht. Atmete schwer und unruhig. Bestand aber am Morgen darauf, die Küste zum Tania-Blixen-Haus hochzufahren. Dahinter das kleine Stück zum Louisiana. Den besten Ort, den Menschen gebaut haben, sagt Kathrin. Stimmt ja auch. Wo sie unter dem nahen Öresundhimmel nur auf dem Rasen lag. Am saftiggrünen Hang, den die blonden Dänenkinder hinabrollten. Ich lief allein durch die Gänge, besorgte Tabletten im nahen Einkaufszentrum. Erst Mitternacht sind wir zurück. Unter Fernfahrern über ein nachtschwarzes Meer. Am nächsten Tag lag Kathrin wieder im Fehmarn-Bett. In unserer Pension in Petersdorf. Immer noch mit Fieber.
Nach unserer Rückkehr hat ihr Arzt eine Lungenentzündung festgestellt. Ich bin erschrocken. Lungenentzündungen und ich – das ist so eine bitter schwelende Sache. So ein Pfeil, der nicht aufhört, sich selbst abzuschießen. Claus hat uns abwechselnd sehr böse angeschaut. So böse er kann. Immerhin ist Kathrins Fieber inzwischen abgeklungen. Es geht ihr besser. Angeblich so gut, dass sie morgen in den Geheimen Garten will. Nach dem sie Sehnsucht hatte. Jedes Mal, wenn wir in Hamburg oder Kopenhagen vor einem Blumenladen standen, habe ich das in ihrem Gesicht ablesen können. Ihre Mutter hat keine Eile, nach Esslingen zurückzufahren. Sie sagt, sie bricht erst auf, wenn Kathrin einen Tag lang nicht gehustet hat. Na, das kann dauern.
Aber ich habe das Meer gesehen! Das blau flammende Meer! Meinen müden Kopf mit Seeluft gefüllt. Von der ich noch über habe. Ja, Seeluft im schwarzen Wald. Ich habe meine Füße ins Wasser gesteckt. Wie Deine Zehentaucherin. Mich gezwungen, nicht an Markus zu denken. Nicht so, als sei er gestern erst gegangen. Wie sie habe ich Schuhe und Strümpfe in den Sand geworfen und bin in die Brandung gelaufen. Nur dass ich mir nicht das Leben genommen habe. Das nicht. Nach der Überwindung, die es kostet, die Zehen im eisigen Wasser zu versenken, spürt man, wie sanft es ist. Man wird unendlich belohnt. An diesen leeren Stränden von Fehmarn wird man unendlich belohnt.
Es liebt Dich,
Johanna
2. Mai 2009–05:19
Liebste Jo,
Henri hat mich geweckt, einschlafen kann ich nicht mehr, unter diesem faden Maihimmel, ein Nerv hat sich unter meine Rippen geklemmt, ich bin von Arzt zu Arzt, habe vor Schmerzen geweint und mein Bübchen nicht halten und stillen können, Simon hat den brüllenden Henri geschaukelt, und ich habe mir schluchzend den Rücken gehalten. Jetzt liegt Henri auf seiner Decke, ich verschiebe mein Schlafen auf später und schreibe Dir, während Henri summt und gurrt wie ein Täubchen, der anbrechende Tag sich bereithält und der Regen laut an mein Fenster klopft, graukaltspitzer Stadtregen, noch ein verregneter Frühling, der wievielte wohl, von wie vielen?
Wie seht Ihr auf den Bildern wunderbar zerzaust aus! War es der Ostseewind oder der vom Kattegat, man möchte in Euer rotes, Euer blondes Haar greifen und es aus den Gesichtern streichen, damit man Euch besser sehen kann! Eure Schokohasen mit Samtband und Glöckchen sitzen auf dem Fensterbrett im durcheinandergeratenen, von den Kindern täglich durchwirbelten Osterschmuck, den ich nicht abräumen darf, zwischen handbemalten Eiern, Nestern aus Stroh und Gras und Eurem Kaffeepäckchen, vakuumverpackt von Kolben in Freiburg. Ich hätte vorher schreiben sollen, aber die Arbeit mit Henri verdreifacht sich nicht, sondern verzehnfacht sich, die Zeit frisst mir alles weg, Johanna. Oder ist es anders, ich bin nicht sicher, wird die Zeit von etwas weggefressen? Tage und Nächte verfliegen, gefüllt mit Kindergeschrei und laut nistenden Vögeln unter unserem Dach, die einsetzen, sobald die Kinder aufdrehen, als wollten sie einen Wettstreit austragen und munter weiter zwitschern, sobald die Kinder zwei Sekunden still sind – oder zwitschern sie ständig, aber ich kann es nur hören, wenn die Kinder einmal schweigen? Simon und ich, wir haben keinen Augenblick für uns, nachts tragen wir Mia und Franz in ihre Betten, Füße, Arme, Kopf baumelnd, zu jeder Stunde ein anderes Kind, das zwischen uns, in unsere Mitte gekrochen ist, in die Mulde aus Kissen, Mártaschulter und Simonduft, oder ich taste mich durch die Dunkelheit, um den weinenden Henri aus der Wiege zu heben, so benommen, als hätte er mich aus tiefstem ruhigen Schlaf gerissen, obwohl ich den schon lange nicht mehr kenne, diesen tiefruhigen Schlaf, von dem ich erholt aufwache. Schlafen werde ich später einmal, wenn ich alt bin, werde ich schlafen, Johanna, Nacht und Tag, soviel ich will.
Nachdem Ihr an der Ecke Körberstraße Richtung Norden abgebogen seid, sind wir Hals über Kopf nach Sark, so wie es unsere Art ist, Hals über Kopf, Simon mit einem Auftrag fürs Reiseblatt in der Tasche, von dem er nichts gesagt hatte, seine Osterüberraschung für mich. Erst habe ich ihn verflucht, dann unsere Taschen gepackt für eine haarsträubende Reise über den Atlantik, von Saint-Malo auf die Fähre nach Jersey, dort aufs Schiff nach Guernsey und weiter nach Sark, bei jedem Abschnitt hatte ich Angst vor kotzenden Kindern, und ja, Mia hat alle verfügbaren Tüten vollgespuckt, aber Franz trug den schreiend roten Ball, den Du ihm geschenkt hast, treppauf, treppab von Fähre zu Fähre, auf Sark dann vorbei an Schafweiden, Pferdekoppeln und einem moosüberwucherten Friedhof mit kippenden Grabsteinen, so unaufdringlich hübsch, der Tod könnte einem fast gefallen. Hasen schauten ihm zu, wie er den Ball warf, rollte, kickte, köpfte, schlug und trat, als wir ankamen, hob die Hotelchefin den schmierschlammigen Ball auf und trug ihn zwischen spitzen Fingern auf unser Zimmer, ohne eine Miene zu verziehen, als sei es das Gängigste auf Sark, den dreckigen Ball eines Jungen mit eisverziertem Mund und kurzen Hosen in ein blitzsauberes anderes Zimmer zu tragen.
Jeden Abend haben Franz und Mia diesen Ball im lauen Osterwind auf der leergefegten, in Staub ertrinkenden Hauptstraße zum Himmel gejagt und Wolken mit ihm abgeschossen, ja, piff-paff abgeschossen, während Simon nach Sätzen suchte, aus denen er seinen Textteppich weben würde. Tags lief er durch die Atlantiksonne und griff nach den Geschichten, die überall herumliegen, man muss sie nur aufpicken, unter Steinen und Büschen warten sie darauf, gefunden und erzählt zu werden, Krieg, Adel, Schiffsunglücke, Steuersünder, Pferdekutscher, Hunde und Wind, viel, unendlich viel Wind, der die Häuser zerzaust und Bäume schieflegt. Molke und Franz schoben Henri im Kinderwagen durch Bärlauchwälder, über fußschmale Ginsterpfade zum großen Wasser, dem Rauschen nach meerabwärts, wir alle leicht und fröhlich, selbst Simon, selbst ich, es war mir gleich, wie viel Henri schrie, ich bilde mir ein, es war weniger. Wenn er festgezurrt in seinem Tuch auf Simons Brust geseufzt hat, war ich glücklich, Johanna, nicht nur über Mia, Franz, Henri und Simon, weil sie zu mir gehören, weil ich zu ihnen gehöre, nicht übertrieben, hochtrabend, lächerlich bekloppt glücklich, aber doch glücklich, so still und leise vor mich hin glücklich, so glücklich, wie ich es gerade sein kann, jedes Mal, wenn wir am Wasser standen und sagten, Henri, das ist das Meer, siehst du, hörst du es?
Die Stadtvögel fangen jetzt aufdringlich laut mit dem Zwitschern an, der Regen lässt nach, und ich muss meinen Tag beginnen, schnell noch dies eine, das ich Dir seit Sark schreiben will. In den Auslagen der Cafés und Geschäfte dort hingen Schilder ›Summer season – Help wanted‹. Vor einer Bäckerei mit maisgelb gestrichenen Fenstersprossen blieb ich mit Herzschmerzen stehen, als ich ›contact Kate‹ las. Mit zwanzig hätten wir sofort angeheuert, Johanna, wir hätten nicht nachdenken müssen, wir hätten einen kühlgrünen, windzerwühlten, heckenrosenduftgetränkten Sarksommer lang Brötchen und Kaffee hinter dieser Theke verkauft und in den Nächten unterhalb der Weiden an den Piratenstränden im klammen Sand den Himmel ausgelacht. Ach, Johanna, fern und verloren!
Márta
6. Mai 2009–00:16
Liebste Márta,
schwarze Nacht legt sich um die Berge. Da hebt der Abendstern gemach sich aus den Föhrenzweigen. Meine Traumabgründe rufen. Ich soll in ihnen jagen. Pfeil und Bogen schultern und losziehen. Nur diese wenigen Zeilen. Bevor ich die Stiegen nach oben gehe. Vorgebe zu schlafen. Mich weiter mit dem Mond anfreunde. Ja, großartig wäre es, mit Dir einen Sommer lang auf Sark Kaffee und Hörnchen zu verkaufen. Am Abend sonnenverbrannt in einer Bucht zu dösen. Im Wind das Salz der Freibeuter. Stattdessen sitze ich über Ideen für Deutschklausuren. Von direkter zu indirekter Rede. Er sagt, ich habe aufgehört, dich zu lieben. Er sagt, er habe aufgehört, sie zu lieben. Er sagt, ich verlasse dich. Er sagt, er verlasse sie. Er sagt, morgen gehe ich. Er sagt, morgen gehe er.
Ich ärgere mich, dass der Frühling den Winter neu einbestellt hat. Als hätte er schon keine Lust mehr. Zum Radfahren muss ich wieder Handschuhe und Mütze anziehen. Und dass ein Sarksommer für uns wohl nie mehr kommen wird, Márti. Vielleicht, wenn ich in Rente gehe. Also in dreiundzwanzig Jahren. Wenn Deine Kinder zum Studium nach Amerika aufgebrochen sein werden. Futur zwei. Aufgebrochen sein werden. Aber Kate wird wahrscheinlich nicht mehr leben. Und wer will uns dann noch haben?
Johanna
13. Mai 2009–23:57
Liebste Jo,
mich will sicher keiner haben, nur der Alltag schließt mich in seine großen dicken Arme, als habe er mich schmerzlich vermisst, der Aufstehalltag, Schulalltag, Stadtalltag, mein Alltag aus Erschöpfung und Pfeifen im Ohr, das auf Sark schüchtern geschwiegen hat, oder war nur der Wind zu laut, um es zu hören?
Während ich Dir schreibe, verabschiedet sich ein mild lockender Maiabend, der mich aufs Dach unter seine Sterne geholt hat, die Nacht ist meine Wohnung – gelogen, Sterne gab es keine, ich habe sie mir bloß zurechtgeträumt, in den maiblauen Abendhimmel gemalt, als ich die Leiter hochstieg und die Wohnung unter Dreck und Müll habe versinken lassen, zwischen Müslibrocken und Resten von Lutschbrötchen, Bilderbüchern und Rasseln, Kleidern und Schuhen, die nicht mehr zuzuordnen sind. Franz hat die Waschmaschinentür aufgehebelt, er hat die Schrauben herausgedreht, verteilt in unauslotbare Nischen und die Tür ausgehängt, das Bad ins Schlafzimmer getragen, die Küche ins Bad, durch alle Zimmer baut er Landeplätze für Raketen, auf einem feinen Weg der Verwüstung aus Taschentüchern, Shampooflaschen und Henris Spuckfäden. Dazu zeigt die Schule ihr übliches Gesicht, Mias Hauptlehrerin ist krank, die Nebenlehrerin auch, die Kinder haben Rollerpause und Mandalamalerei, Mia könnte genauso gut zu Hause bleiben, aber hier warten ja nur ihre blöden Eltern, der Vater schreit, die Mutter schreit, dritte Person Singular, Prädikat im Präsens, der Vater brüllt, die Mutter brüllt, der Vater rauft sich die Haare, die Mutter rauft sich das Haar, Akkusativobjekt im Singular, der Vater wirft mit Dingen um sich, die Mutter wirft mit Dingen um sich, Dativobjekt im Plural, und so weiter, endlos weiter in unserer überdrehten, heißgelaufenen Horváth-Leibnitz-Wutspirale. Das Telefon ist kaputtgegangen, mitten im Gespräch mit Ildikó hat es sich tot gestellt, vielleicht um mich im letzten Augenblick zu retten, mich zu schnappen und in Sicherheit zu bringen, vielleicht macht es deshalb keinen Mucks, bis mein Körper im Futur zwei herausgefunden haben wird, welche tiefliegende Reserve er noch entdecken könnte, vielleicht hat er eine Spur und folgt ihr.
Die Kinder saugen mein Leben weg, Johanna, wer ungestört arbeiten will, darf keine Kinder haben, wer etwas anderes erzählt, lügt, aber das weiß ich erst jetzt, niemand hat mir das früher gesagt, alle haben geschwiegen. Zum Schreiben komme ich kaum, jetzt, da ich schreiben müsste, das Schreiben heftig an meinen Kopf, meine Hände klopft und raunt, schreib, schreib, schreib, dreimal hintereinander, Márta, schreib endlich! Etwas braut sich in mir zu dieser Wortbesessenheit, dieser Satzversessenheit zusammen, ich drifte davon und schrecke hoch, sobald sich jemand aus dem echten, wirklichen Leben meldet, dem Leben in der Körberstraße zwölf. Die zwei halben Tage Kindermädchen für Henri fressen viel Geld und sprudeln einfach weg, weil zu vieles liegenbleibt, das mir dann erst auffällt. Aber ich habe doch geschrieben, Johanna, hier haben sich Kindermädchen, Lori und Simon abgewechselt, ich durfte in meinen trüben Erzähltümpeln fischen, und es hat mich ruhiggestellt, auch wenn ich ständig denken musste, nie wird es fertig, nicht in diesem Leben. Den abgerissenen Faden nach Tagen oder Wochen aufnehmen, im Kampf gegen heftige Schübe von Mattigkeit, ist fast unmöglich – aber schlafen werden wir später einmal, wenn wir tot sind vielleicht.
Ich zwinge mich zu denken, bescheide dich, Márti, zeig Demut, wie du es vor Jahr und Tag auf einer harten Höchster Kirchenbank neben Johanna gelernt hast, richtig arbeiten kannst du erst, wenn auch Henri jeden Morgen das Haus verlässt – das ist der Kampf, den ich täglich austrage und verliere. Der Kindergarten sagt, kein Platz, Franz ist auf der Warteliste die vergessenswerte Nummer siebenundvierzig, uns bleibt die tägliche Fahrerei ans andere Ende der Stadt, merke, mit Kindern niemals umziehen, man darf sich zwanzig Jahre nicht bewegen, muss an ein und derselben Stelle ausharren und dort Klinkenputzerei betreiben, auch so etwas, das mir niemand gesagt hat, dass ich mit Kindern ständig würde Klinken putzen müssen. Nur Klein-Henri hat einen Platz in Aussicht, er ist die Nummer eins seines Jahrgangs, weil ich ihn vor der Geburt angemeldet habe, geht alles gut, hat er seinen Platz in nur zweieinhalb Jahren!
Über allem werde ich verrückter und dünnhäutiger, meine Haut wird dünner, mein Kopf verrückter, ich brülle die Kinder an wegen nichts, Franz wegen seiner langen, kurzen, dicken, dünnen Stöcke, die er tausendfach unter hundeverpinkelten Stadtbäumen aufliest, mit seinem Schnitzmesser zu Pfeilen spitzt und als Rätselpfad durch alle Zimmer legt, Mia wegen eines zerknittert angefressenen Papiers, das ich aus ihrem Ranzen ziehe. Später werde ich sagen, die Kinder haben mein Leben weggesaugt, als alte Frau werde ich das zu Dir sagen, also, wenn ich richtig alt sein und mit Dir bei einem Schnaps sitzen werde, im schwarzen Wald, in Hamburg oder hier, wo immer das sein wird, werde ich sagen, hör mal Johanna, meine Kinder haben mein Leben weggesaugt, Mia, Franz und Henri haben es weggesaugt, weg ist es.
Trotzdem ängstigt es mich, wenn sie nicht da sind, wenn sie mit Lori losziehen, um Stadtsträuße zu binden, aus Löwenzahn, Gänseblümchen, Wiesenschaumkraut, Bärenklau, wenn sie bei meinen Eltern übernachten, im Gepäck vier Flaschen abgepumpter, tiefgekühlter Mamamilch, wenn sie bei meinen Schwestern sind, bei Ildikó in der Rotlintstraße, bei Anikó in Stuttgart-Degerloch, wenn sie mit Simon an einem mildregnerischen Frühlingstag wie heute, wie gestern, wie vorgestern, die Fähre zum Höchster Schloss nehmen, zu Deiner verwunschenen alten Heimat aus krummen Altstadtgassen und Klinkersteinen, nach Fischen in der Nidda Ausschau halten, aber keine finden, und ich mich erinnere, aha, so war mein Leben früher einmal, ich und ich und wieder ich. Träume, Prinz? So wären es Träume nur gewesen?
Du kannst Dir nicht vorstellen, wie sehr ich ringe um ein Quäntchen Schreiben, um einen Hauch Ich, nein, kannst Du nicht, auch wenn Du vieles kannst, das wird Dir nicht gelingen – doch nachts die Nase an mein duftendes, winziges neues Söhnchen zu halten und so einzuschlafen, wer will das ersetzen?
Márti
21. Mai 2009–18:46
Liebe Márta,
was soll ich sagen? Wohin soll ich mich retten? Wer und was bleibt mir im Alter? Noten, die ich verteilt habe? Mein lächerlicher Traum ist, als alte Frau irgendwo in dieser mittelmäßigen Welt angesprochen zu werden. An einem Strand in Thailand. Unter einem Gipfelkreuz in den südlichen Dolomiten. In einer Barockkirche am Bodensee. Am liebsten dort. Gefragt zu werden, Verzeihung, sind Sie nicht Frau Messner? Sankt Anna? Zu hören, wie sehr ich als Lehrerin taugte. Wie ich die Liebe zur Literatur in jemandem geweckt habe. Zur Malerei. Zum Sport. Das bleibt mein bescheidener Ausblick. An dem ich mich festhalte. Ja, lächerlich.
Einen Jungen gibt es in meiner Klasse – der reinste Knabe im Moor. Er zeichnet. Gesichter. Körper in Bewegung. Hände. Vor allem Hände. Kinderhände. Erwachsenenhände. Zusammengelegte, gefaltete, klatschende, ringende Hände. Immer wieder Hände. Aber die Bewegungen wirken langsam. Ein bisschen wie gelähmt. Auch in seinen Naturbeobachtungen. Auffliegende Vögel. Mit weit ausgebreiteten Flügeln. Fischadler. Sperber. Wanderfalken. Ein Nest mit Jungen. Die ihre federlosen, nackten Hälse nach Futter strecken. Eine Baumreihe aus Tannen, der schwarze Wald gibt sie vor. Bachlandschaften. Gebirgszüge. Unendlich filigran und ziseliert. Natur und Mystik, Márti. Überall Schattengeister und Nebel. Schweiß und Blut des Dickichts. Mein altes Thema, mein Ich, mein Mir. Das mich mit Jan wieder antippen und einen nächsten Kreis öffnen will. Er ist ein Junge wie’n Reh. Der in alles Finsternis zeichnet, Geheimnis. So weite Räume öffnet, dass ich beim Betrachten schwanke. Ich kann mir nicht erklären, woher Jan solche Räume nimmt. Solche Abgründe kennt. Wie er in seinem Alter so verwinkelt, verschachtelt sehen kann. Gesichter verstehen und zeigen kann, was sie zu verbergen haben. Zu verstecken wünschen. Das verstört mich. Gibt mir oft zu denken. Wenn ich abends auf meinem Sofa liege und versuche, den Gedanken an Schule und Schüler lieber nicht mehr zu denken. Nicht noch in den Abend, die Nacht hinein.
Wie oft begegnen mir solche Talente? Einmal in meiner Schullaufbahn? Zweimal? Sie zu finden wäre doch meine eigentliche Aufgabe. Bei einem zeichnenden Jungen ist es einfach. Es gibt wenige. Jan ist fein und schlank für sein Alter, mit zarten, fast edlen Zügen; übrigens mit dem Ausdruck einer gewissen rohen Melancholie. Er riecht, wäscht sein Haar nicht. Seine Kleider sind entweder zu klein, zu eng oder zu groß und zu weit. In der Sportstunde ist er der Einzige mit Straßenschuhen. Ich lasse es ihm durchgehen. Kommentiere es nicht einmal. Gebe vor, es nicht gesehen zu haben. Ich will ihm ersparen, sich auch darum noch kümmern zu müssen. Er scheint genug im Kopf zu haben, was ihn aufscheucht und umtreibt. Die Kinder sagen nichts. Obwohl sie sich sonst über jede Benachteiligung sofort beschweren. Über jede Ungerechtigkeit. In dieser Sache halten sie zu ihm. Sind mild. Auch wenn ich glaube, dass Jan keine Freunde unter ihnen hat. Aber sie lassen ihn auf Strümpfen turnen. Barfuß. Oder auf der Bank sitzen. Wo er sofort anfängt zu zeichnen.
Johanna
1. Juni 2009–10:24
Liebste Jo,
Lori hat die ersten Pfingstrosen gebracht und Henri ausgeführt, geht mit ihm durch Grüneburgpark und Palmengarten, also kann ich Dir schreiben, von meiner kurzen Reise aufs nahe Land, meiner willkommenen Abwechslung, weil man Nacht und Tag hören wollte, von mir vorgetragen, aus meinem Mund, mit meiner Márta-Horváth-Stimme, in der Provinz, der echten, tiefen, wo man die sonderbarsten Menschen trifft, die mir wie unter einem Brennglas erschienen sind, nah und überdeutlich in ihren leeren Landschaften und überfüllten Gasthöfen. Nur zwei Stunden Zug nach Nordosten, und die andere Welt beginnt, wo sie unter Wolkengirlanden leben, ihre Gärten morgentaugetränkt, ihre Häuser dachrinnenvertäut – nie bin ich sicher, ob in diesen schlafenden Dörfern überhaupt jemand meinen Kleistergedanken folgen will, zersägt von den Autorennen der Jugend am Abend, eingekreist von Hügeln und ihren aufgestickten Wäldern, Sommerfrischenwälder, am Ende des Tals mein kleines Hotel, mit Liegestuhl und einem Teller Kirschen, ja, Kirschen Anfang Juni, nur für mich dorthin gestellt, damit ich sitzen, Kerne durch die klare Landluft spucken und meinen Blick an die grünwuchernde Wiese verlieren konnte, an die sich unermüdlich jagenden, treibenden Bienen und Hornissen.
In der Gaststube ging es nach meiner Lesung laut ausgelassen weiter, die Wirtin stellte Flaschen und Gläser hin, für eine Handvoll Leute, darunter eine Maskenbildnerin, die Perücken fürs nächste Theater knüpft, das weit entfernt sein muss. Der Braten war gut, das Bier war gut, eins hatte ich mir erlaubt, wir redeten über ölverpestete Meere und den Unwillen, die Welt zu retten, lachten laut und viel, die anderen tranken laut und viel, nach Bier und Obstler noch eine Menge anderes, und erst am Ende, als es mich schon sehr zum Bett zog, ich mich in Gedanken verabschiedet hatte und aufbrechen wollte, schob meine Gastgeberin den linken Ärmel ihres Cardigans hoch, und ich konnte die Narbe über ihrem Handgelenk sehen, nicht alt und blass, sondern frisch und rot, nicht quer, sondern längs, so wie es sein muss, damit es etwas wird, damit es auch gelingen kann.
Diese lachend leichte, biertrinkende, obstlertrinkende, hinreißende Frau, die mit Dir und mir an jedem Caféhaustisch sitzen und plaudern könnte, diese Frau mit dem großen Elan, Lesungen mit so hoffnungslos hoffnungsvollen Dichtern wie mich aufs Land zu bringen, mit dieser langen roten, halbwegs frischen Narbe unter dem Handgelenk – die halbe, nein, die ganze Nacht habe ich das nicht zusammenfügen können, Johanna. Ich habe mich in den Kissen gedreht, die Augen aufgeschlagen und den Mond im Himmel gesucht, die Sterne, ihren Sternenstaub, Kometen, Achterschiffe und Eidechsen und noch etwas anderes, das ich aber nicht gefunden habe. Ich habe die Augen geschlossen, wieder geöffnet und in die Dunkelheit gestarrt, auf meinen Wecker mit der alarmroten Digitalanzeige, auf die zwei blinkenden Punkte zwischen den Ziffern, vier Uhr sechs, vier Uhr acht, vier Uhr zehn, und habe das nicht zusammenfügen können, Johanna, die ganze Nacht nicht, nein.
Márta
5. Juni 2009–17:08
Liebe Márta,
eigentlich will ich an diesem leuchtend sonnengelben Junitag keinem bitteren Gedanken folgen. Der schwarze Wald zeigt ein Gesicht, als wäre schon richtig Sommer. Frauenmantel und Moosaugen fangen mit dem Blühen an. Vielleicht ist es nur Zufall, dass wir zwei noch leben, Márti. Alles ist möglich, jeder trägt alles mit sich. Auch so ein Spruch meiner Mutter. Wahrscheinlich von Böhmen nach Wien mitgebracht. Der alten Dora abgerungen. Aus der kleinen Tasche ihrer Kochschürze stibitzt. Fürs eigene große Leben eingepackt. Fürs eigene Klugtun. Aber hör nur, so verkehrt klingt er nicht. Unter all unseren Möglichkeiten schlummert auch die eine, uns eines schönen Tages das Leben zu nehmen. Wir haben nur noch keinen Gebrauch gemacht von ihr.
Dass wir am Telefon immer auf meine Eltern zu sprechen kommen, scheint nun zur Gewohnheit zu werden. Ich warte nur auf Deine Stichworte. Höchst. Friedhof. Georg. Deine Márta-tastet-sich-vor-Linie. Wahrscheinlich wünschen wir beide, sie wären noch am Leben. Tief unten in unserem Blutrauschen. Dein Bild. Gestern habe ich herumgedruckst, aber hier und jetzt schreibe ich es. Nein, an den Gräbern war ich lange nicht. Häßliche, rohe Steinblöcke, als ob die Toten Kopf an Kopf in einem Armenhaus schliefen.