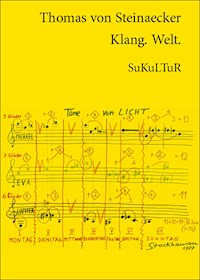Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Frankfurter Verlagsanstalt
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2009
1913. In der abgeschiedenen Festung Benesi in der deutsch-afrikanischen Kolonie Tola hat das Schicksal eine bunte Schar glücksuchender Auswanderer zusammengewürfelt: Den Holzhändler Gerber, den die Hoffnung auf neue Reichtümer in diese gottverlassene Gegend geführt hat. Seine Schwester, die schöne und geheimnisvolle Käthe, der nach einer Scheidung die Rückkehr nach Deutschland unmöglich ist. Schirach, den strammen Offizier, der aus seiner kleinen schwarzen Schutztruppe ein preußisches Heer machen will. Den drogensüchtigen Arzt Dr. Brückner sowie den Forscher Lautenschlager, der mit Tropenhelm und Plattenkamera nach unbekannten Eingeborenenstämmen sucht. Inmitten dieses Ensembles steht Henry, ein Schiffbrüchiger. Ein Sohn reicher Eltern ist er, doch öffnet ihm das hier, so fern der Heimat, keine Türen. Er muss seinem Schicksal auf die Sprünge helfen, und nimmt die Identität seines Chefs an, der bei dem Schiffsunglück ums Leben kommt. Unter fremdem Namen plant er als Architekt die Stadt, die in der Steppe entstehen soll, ein wahrlich chaotisches Unterfangen...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 476
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
INHALT
Titelseite
Impressum
Widmung
1 Der Angriff
2 Ein Platz an der Sonne
3 Paris, 1913
4 Ein Rundgang
5 Daheim
6 Krarē
7 Der Tag wird kommen
8 Die Expedition
9 Spiele und Visionen
10 Damals
11 Das Schiff in den Lüften
12 Unterwegs
13 Nackt
14 Reise zum Mond
15 Der Wald im Ozean
16 Die Beschleunigung der Uhren
17 Ein Ende, ein Anfang
18 Alle Wünsche gehen in Erfüllung
19 Die Umwandlung
Thomas von Steinaecker
Schutzgebiet
Roman
Die Arbeit des Autors am vorliegenden Buch wurde durch den
Deutschen Literaturfonds e.V. gefördert.
1. Auflage 2009
© Frankfurter Verlagsanstalt GmbH,
Frankfurt am Main 2009
Alle Rechte vorbehalten
Herstellung und Umschlaggestaltung: Laura J Gerlach
Umschlagmotiv: Neo Rauch
eISBN: 978-3-627-02160-3
Für Stefanie
Wir leben in einer Zeit, in der alles möglich ist.
Jules Verne: Das Karpathenschloss, 1892
1 DER ANGRIFF
Die Verrückten meinen es ernst. Bei jeder Kugel, die dicht neben ihm im Boden einschlägt und Staub aufwirbelt, zieht Colonel Durand hinter dem Dornbusch den Kopf ein. Durch den Feldstecher späht er die Zinnen der Festung entlang. In Bismarckburg, wo der Stellvertreter des deutschen Bezirksamtmannes, ein Baum von einem Mann, nach kurzen Verhandlungen ohne jede Kampfhandlung kapitulierte, hieß es doch, die Station Benēsi verfüge über keinerlei strategische Bedeutung. Mit Widerstand der noch etwa fünf verbliebenen Bewohner oder der Schutztruppe sei nicht zu rechnen.
Was aber, sacré culot, verteidigen diese Verrückten jetzt in dieser gottverlassenen Gegend? Steppe, wohin das Auge reicht, und gleich hinter den grauen Mauern: eine verkohlte Fläche von der Größe eines Dorfes. Aus dem Aschenfeld ragen vereinzelt Stümpfe und Baumgerippe, ganz so, als sei hier schon einmal eine Schlacht geschlagen worden. Möglich, dass sich im Inneren des mächtigen Gebäudes etwas befindet, das einen Kampf auf Leben und Tod rechtfertigt – möglich, aber unwahrscheinlich. Fest steht: Eine gut vorbereitete Verteidigung sieht anders aus. Wie die Deutschen auf dem Wehrgang in hastigen Bewegungen hin und her irren, das reinste Guignol. Ein Maschinengewehr befindet sich offensichtlich auch nicht in ihrem Besitz, lediglich Kleinfeuerwaffen. In spätestens einer Stunde wird der ganze Spuk vorüber sein.
Ein Knall hallt durch die Steppe. Der Ballon mit der Antenne, der über dem linken der beiden Türme der Festung schwebte, ist zerschossen, flattert in die Tiefe. Gleich darauf, tatsächlich ganz wie im Kasperltheater oder bei einer Spieluhr, schiebt sich eine weiße Fahne zwischen die Zinnen. Nein. Ein fetter Mann, so breit wie ein Laken, hat sich aufs Wehr gestellt und feuert auf die Angreifer – ja ist denn das zu fassen.
Colonel Durand gibt dem Soldaten, der ein paar Meter entfernt von ihm hinter einem Stück Wellblech Deckung sucht, ein Handzeichen: Jetzt! Der Schuss streckt den Mann im weißen Anzug sofort nieder. Rücklings, wie ein mit Steinen gefüllter Sack, liegt er da.
Und die Verrückten –?
Feuern weiter. Ein braungebrannter Dünner, oder ist es ein Eingeborener?, beugt sich über den Getroffenen. Colonel Durand nimmt ihn ins Visier, ein Schuss ins Bein wird ihm eine Lehre sein. Doch da hat die dunkle Gestalt sich schon wieder erhoben, Durand abgedrückt. Der Mann taumelt – Durand reißt den Feldstecher an die Augen –, taumelt zum Rand der Mauer – was tut der? –, hält sich die Seite, macht einen Schritt vor.
In die Luft.
2 EIN PLATZ AN DER SONNE
Henry schlägt die Augen auf, er treibt im Meer. Wasser, in allen Richtungen. Bis zum Horizont. Er ist verloren.
Die Sturmwolken haben sich verzogen, die Sonne brennt ihm ins Gesicht. Ein stechender Schmerz in seinem rechten Fuß, bei dem Unglück muss er sich verletzt haben. Um ihn schaukeln auf den glitzernden Wellen Setzlinge, Tannen, Fichten, Pappeln, umgestürzt, aufrecht, noch in ihren Töpfen, schaukelt ein Wald, der aufgeblähte weiße Körper eines Pferdes. Daneben, vielleicht eine Armlänge von Henry entfernt, ein Balken, an den sich jemand klammert, ein Mann. Henry will rufen, hat keine Stimme mehr, seine Zunge, ein Stein in seinem Mund. Er greift nach dem Mann und ins Leere, in die über den Balken geworfene Jacke, lässt die Tür los, an der er hängt, es zieht ihn hinab, er schnappt nach Luft, sinkt, warum nicht sinken? Wenn nicht von Haien gefressen, wird er entweder verdursten oder ertrinken. Er sinkt tiefer.
Es ist egal.
Das Salz in seiner Nase. Der Druck auf seinen Körper. Ein paar Minuten kürzen endlose Stunden sinnlosen Leidens ab. Doch die Vorstellung, tot zu sein, will einfach nicht ihren Schrecken verlieren. Und die Ruhe, von der es heißt, dass sie einen am Ende überkommt: Sie stellt sich nicht ein. Stattdessen arbeitet es weiter in ihm. Wofür hat er all die Strapazen auf sich genommen? Wofür hat er alles aufgegeben? Das soll es nun also gewesen sein, sein Leben?
Unwillkürlich strampelt er mit den Beinen. Steigt höher, noch während sich in seinem Kopf Wörter formen. Ich will nicht.
Und wieder: Ich. Will. Nicht. Sterben.
Da erträgt er es nicht länger, atmet ein, Wasser statt Luft, nach oben muss er, nach oben, sucht Halt, greift nach etwas über sich, irgendetwas, bekommt es zu fassen, zieht sich an die Oberfläche, spuckt, hustet, Rotz rinnt ihm aus der Nase. Erschöpft legt er den Kopf auf das schwankende Stück Holz. Es ist die Tür, seine Tür.
Er treibt im Meer. Die Sonne scheint.
EIN BLITZ ZUCKT AUF, im grellen Licht kniet Natalie am Heck des Beiboots, das vom Sturm hin und her geworfen wird, Gischt spritzt an ihm hoch. Den einen Arm hat sie nach Henry ausgestreckt, den Mund aufgerissen, brüllt, wie auch der Kapitän hinter ihr. Was, das kann Henry wegen des Dröhnens um sich herum nicht verstehen. In der Entfernung ragt der silberne Bug der Brünnhilde senkrecht aus dem Meer. Wie ein Kirchturm. Verzweifelt versucht Henry, die Tür, auf der er liegt, in die Richtung des Beiboots zu lenken. Eine Welle hebt es mit sich, hält es einen Herzschlag lang in der Höhe – dann treibt es mit einem Mal kieloben, ist es in der Schwärze verschwunden.
»Natalie«, flüstert er, er ist wieder bei Stimme, schreit: »Natalie!« Etwas läuft aus seinem Mund, etwas Weiches, Salziges, Wasser, nein, Brei. Henry blickt ins verschwommene Gesicht einer alten Schwarzen, klammert sich an die Tür und merkt, dass er nur einen Sackfetzen in den Händen hält.
»Natalie!«, ruft er der Alten zu, die ihn, wie er meint, immer noch mit ungerührtem Ausdruck ansieht. Mit ihren Fingern füttert sie Henry aus einer Schüssel. Sie murmelt, summt leise dazu, er kann es jetzt hören. Das Dröhnen des ohrenbetäubenden Sturms ist plötzlich verstummt.
Auch als sich Henry – Minuten oder Stunden später – im Traum behaglich auf dem roten Diwan im Salon seiner Eltern in New York ausstreckt, begleitet ihn dieses Murmeln. Und wieder Murmeln, Summen, im Halbschlaf, während er sich in die Hosen macht, es warm an seinen Beinen entlang rinnt – sieht ihm die Alte dabei zu? Ihm ist zu übel, er ist zu schwach, als dass ihn das beschäftigen könnte.
Der unförmige Raum, in dem er schwebt, schrumpft, und er muss, er will hinaus. Als er dann, endlich einigermaßen klar im Kopf, in das Gesicht der Alten schaut, die, das erkennt er auch ohne Brille, keine Zähne mehr hat, weiß er: Das Fieber ist überwunden, er hat das Schiffsunglück überlebt, es ist ausgestanden. Natalie, seine Frau, jedoch ist tot, sie muss tot sein.
Er aber will leben.
Er fühlt den klumpigen Brei, den ihm die Alte einflößt, in seiner Speiseröhre, seine Zunge leckt an ihren Fingern. Es ist ihm, als sitze er in seinem eigenen Magen. Die Wände sind feucht.
IRGENDWANN ist er dann stark genug, um aufzustehen. Er spannt sich das Brillengestell, das man neben ihn gelegt hat, um die Ohren. Trotzdem nimmt er alles leicht verschwommen wahr, auch fehlt das rechte Glas. Unter dem ruhigen Blick der in einer Ecke hockenden Alten schwankt er auf den Ausgang zu, das Loch in der düsteren Hütte, stolpert, stürzt, rappelt sich auf. Draußen reißt er die Hand vors Gesicht – ein stechender Schmerz in den Augen – und blinzelt zwischen den Fingern hindurch ins gleißende Licht: Vor sich runde Lehmhütten mit Wellblechdächern. Eine Ziege dreht sich meckernd nach ihm um. Eine Schwarze sitzt im Schatten einer Hütte – er ist einer Ohnmacht nahe. Urplötzlich kommt ihm da ein Kupferstich in den Sinn, ein Kupferstich aus einem Buch, das er in New York abends im Bett als Vorbereitung auf die Reise gelesen hatte: Unser Platz an der Sonne. Lange hatte er damals die Illustrationen auf den Seiten betrachtet. Nun steht er direkt vor ihnen – eine Wirklichkeit, in die er nur einzutreten braucht. Stattdessen torkelt er vor Erschöpfung und Übelkeit zurück, tastet sich an den Wänden der Hütte entlang, weil er in ihrem Innern plötzlich nichts mehr erkennen kann, stößt gegen etwas, die Alte, ein Tier, und erbricht sich mehrmals auf den Boden der Behausung, bevor er auf seinem Lager oder dem, was er dafür hält, in einen tiefen Schlaf fällt. Bei seinem nächsten Ausflug gelangt er bis an den Rand des Dorfes, in das man ihn verschleppt hat. Aber kein Meer, keine Siedlung, nicht einmal ein Weg ist zu sehen. Nur das hohe ausgedorrte Gras und die Dornbüsche der Steppenebene. Einige krüppelige Bäume. Hier und da Kühe und Büffel. Zirpen.
Tage später stiehlt er sich noch einmal davon. Diese trostlose Ansammlung vereinzelter Hütten kann nicht weit entfernt vom Strand gelegen sein, wo ihn die Wilden wohl gefunden haben, und hat er den einmal erreicht, muss er doch unweigerlich auf eine Straße oder eine Stadt stoßen, und von dort wiederum kann es keine zwei Tage dauern, bis er an sein eigentliches Ziel gelangt, die Festung Benēsi. Auf der Landkarte wirkte Tola am westlichen Rand des riesigen Kontinents winzig klein, ein afrikanisches Liechtenstein. Doch als die Mittagszeit vergeht, die Landschaft sich immer noch nicht verändert und er sein Wasser aufgebraucht hat, das er in einem aus der Hütte entwendeten Fellbehältnis aufbewahrt, entschließt er sich zur Umkehr. Fürchterlich ist die drückende Hitze außerhalb der schattigen Hütten, unerträglich Henrys Durst.
Die Schwarzen haben keine Notiz von seinem Fluchtversuch genommen. Abends stellt ihm die zahnlose Alte wie immer eine Holzschüssel mit Brei hin. In weißen Flocken schält sich seine Haut vom Nacken und den Armen. Auf einen weiteren Ausbruch verzichtet er vorerst, da er es für möglich hält, sich in der Steppe zu verlaufen. Ohnehin muss von Benēsi aus Rettung zu ihm unterwegs sein. Die Ahnung, dass er sich für einen Suchtrupp zu weit entfernt vom Unglücksort befindet, unterdrückt er.
Vier Tage nach seinem Ausflug tritt Henry auf dem Marktplatz vor ein Grüppchen von Männern, die ihm die Anführer dieses Eingeborenenhaufens zu sein scheinen, und deutet auf einen Esel.
»I want to go to Benēsi. In order to do so I need this donkey and a certain amount of food. So show me the way to the city and get my things ready – if you will.«
Im grellen Tageslicht klingt der Satz nicht ganz so ehrfurchtgebietend wie Henry noch in der Nacht zuvor erhofft hat. Die Schwarzen wenden die Köpfe nach ihm. Henry kneift das rechte Auge zusammen. Ob die Brille den Wilden Respekt einflößt? Er kann ihren Ausdruck nicht deuten.
»Benēsi. I wish to go to Benēsi.«, wiederholt er, unsicher geworden. Vielleicht kennt man hier die Festung Benēsi nicht,
sicher aber doch die Hauptstadt Tolas.
»Loué?«, setzt er fragend hinzu. Ein nackter Junge stellt sich vor ihn, reckt das Kinn hoch und hält sich die Finger wie Ringe an die Augen. »Benēsi. Ai sch tu Benēsi«, äfft er ihn nach.
Einer der Männer baut sich stumm vor Henry auf. Obwohl der Schwarze kleiner ist als er, duckt sich Henry instinktiv.
»Please«, versucht er es noch einmal. »Loué . . . I will die here . . .« Zum ersten Mal seit er hier ist, hat er Angst vor diesen Wilden. Die Eingeborenen seien weitestgehend friedfertig gegenüber dem Weißen eingestellt und kooperativ. So hieß es. Die Schutzherrschaft der Deutschen lasse sie in jeder Hinsicht profitieren, sei es in den Sachen der Hygiene, der Wirtschaft oder der Bildung. Warum hielt man ihn also fest? Warum halfen sie ihm nicht, seinesgleichen zu finden? Und wenn sie ihn ermorden wollten, warum hatten sie es nicht schon längst getan? Wenn der Suchtrupp ihn nicht findet, wird angenommen werden, Henry sei beim Schiffbruch ums Leben gekommen. In diesem Fall wäre er tatsächlich tot. Einen Henry Peters gäbe es dann nicht mehr. Neben seinem Namen in den Akten zu Hause wird ein Kreuz oder der Vermerk vermisst gesetzt, selbst wenn in diesem Dorf, diesem Loch immer noch jemand lebt oder besser vegetiert, ein Weißer, einer, der einmal den Namen Peters trug.
In der Hütte haust er zusammen mit einer Familie: einem Mann, zwei Frauen, sechs Kindern und der Alten. Sie beachten ihn kaum, sein Essen – Brei, Fladenbrot, selten Fleischabfälle, Datteln – wird kommentarlos in die ihm zugeteilte Ecke geworfen. Bei dem Mann oder den Frauen darf er nicht sitzen. Eines der Kinder hat ihm einen Stecken in die Hand gedrückt. An den Gesten des Kleinen kann er ablesen, dass er auf die Ziegen vor der Hütte aufpassen soll. Also wird er zum Hirten. Zumindest vorläufig. Bis ihm ein Ausweg aus dieser Situation einfällt. Seine Scham darüber, dass er auf eine ihm selbst unerträgliche Weise nach Kot stinkt – er hat noch immer Durchfall – und seine Hose mehr und mehr einem Fetzen gleicht, ist mittlerweile größer als die Trauer um Natalie. Ihre Hochzeitsreise, die zwei Wochen auf dem Schiff, war die längste Periode, die sie zusammen verbracht hatten. In den Monaten davor hatten sie stürmische Liebesbriefe ausgetauscht; sie schrieb ihm nach New York, er ihr in die Fasanenstraße nach Berlin. Wie sehr sie sich auf die Reise freuten, von der keiner wissen durfte. Ihr gemeinsames Geheimnis schweißte sie noch mehr zusammen. Fast jeden Abend war er zu Hause mit ihrem Porträt in der Hand eingeschlafen. Eine der Fotografien hat er auch jetzt noch immer wieder vor Augen, vielleicht weil er sie so oft betrachtet hat. Sich an Natalie selbst zu erinnern, wie sie da in der Kajüte neben ihm lag, an Deck mit ihrem weißen Sonnenschirmchen spazierte, will ihm nicht gelingen.
Nachts liegt er frierend auf dem nackten Boden in der Hütte, zählt die Tage, die er schon im Dorf verbracht hat, und versucht, das aktuelle Datum zu errechnen. Hin und wieder wird er von seinen Gefühlen überwältigt. Verzweiflung, weil keine Veränderung seiner Lage in Sicht ist. Hoffnung, weil es doch nicht sein kann, dass er, der Amerika und Europa kennt, gut kennt, ein wahrer Weltbürger, in einer Hütte im afrikanischen Busch versauert. Und er beschimpft sich: Warum musste er nach Tola fahren und Natalie mit ins Unglück stürzen. Nie hätte er es hier zu irgendetwas gebracht. Als Handlanger Selwins. Der war der Architekt, der hatte das Sagen, nicht er, sein Lehrling. So sinnlos und klein ist all das, für das er bisher gearbeitet hat. Seine Ausbildung in Chicago. Seine Grand Tours durch Europa. Ja, sein ganzes bisheriges Leben. Weibische Weinkrämpfe überkommen ihn, nach denen er sich, wie er zu seiner Verwunderung feststellt, besser fühlt. Anfangs verbirgt er seine Tränen vor den Wilden. Dann kümmert es ihn nicht mehr. Auf Wurzeln kauend, gucken sie ihm mit stumpfen Augen zu. Nach solchen Ausbrüchen lässt er seine Wut darüber, die Beherrschung verloren zu haben, an den Ziegen aus. Mit einem Stock prügelt er auf sie ein. Sie meckern.
Er hört auf, die Tage zu zählen. Noch einmal ist er ausgebrochen, marschiert allein in der prallen Sonne durch die glühende Steppe. Als er etwas hört, das wie das Klappern von Pferdehufen klingt, rennt er los, er will es nicht glauben, Erleichterung und Freude steigen dennoch in ihm auf. Dann steht er fassungslos vor einem an einem Baum aufgehängten rostigen Topf. In der Nacht, unter freiem Himmel, glaubt er, erfrieren zu müssen. Wie kalt es hier wird. Er hat seine Kräfte überschätzt. Am Morgen versucht er, mithilfe des einen Glases seiner Brille ein Feuer zu entfachen. Die kleine Flamme wächst rasch und greift auf einen ausgedorrten Strauch über. Nur mit Glück gelingt es ihm, das Feuer wieder zu löschen. Lange trampelt er auf der rauchenden Asche herum, um ganz sicher zu gehen, dass die Gefahr eines Buschbrands gebannt ist. Endlich taumelt er zurück ins Dorf. Vor einer Hütte tuschelt eine junge Schwarze mit einer anderen und blickt zu ihm hinüber. Jeder Tag ist von da an derselbe. Immer ist es Sommer. Vielleicht September. Die Fragen, was aus den Mitreisenden wurde, was die Schwarzen gegen ihn im Schilde führen und warum der Rettungstrupp immer noch nicht eingetroffen ist, sind vergessen. Es wird für Henry zunehmend wichtiger, dass er regelmäßig seine Mahlzeiten bekommt, vor allem nicht nur Abfälle; dass die Ziegen zum Sonnenuntergang im eingezäunten Bereich vor der Hütte zusammengetrieben sind. Und er empfindet es als eine der größten Freuden seines bisherigen Lebens, als ihn der Mann in der Hütte zu sich winkt. Seitdem essen sie wortlos zusammen. Nur manchmal ertappt er sich dabei, dass er beim Anblick einer Hütte diese automatisch auf ihre Statik hin prüft oder überlegt, wo am besten eine Kanalisation zu platzieren wäre. Das sind die wenigen Gelegenheiten, bei denen er sich noch die Brille kurz vor die Augen hält. Ansonsten spürt er kein Bedürfnis mehr, die Dinge scharf zu sehen.
Einmal macht er beim abendlichen Zusammensitzen den Versuch herauszubekommen, wie er in dieses gottverlassene Dorf gekommen ist und was mit ihm geschehen soll.
»Mein Schiff ist gesunken. Haben Sie mich gefunden?« Er probiert es mit Deutsch, obwohl er merkt, dass er etwas aus der Übung ist. Englisch wäre ihm lieber. Doch schnell hat er wieder in seine zweite Muttersprache hineingefunden. Mit den Händen unterstreicht er seine Beschreibung vom Untergang der Brünnhilde.
»Haben Sie mich gefunden?« Er deutet auf die Schwarzen. Sie zeigen ihm ihre weißen Zähne. »Können Sie mir sagen, wo wir hier sind?«, fragt er weiter. Er weiß nicht, was für Gesten er machen soll, deutet auf die Wand der Hütte und auf sich, sagt: »Hier«. Ein Kind kann das Lachen nicht mehr unterdrücken, klopft auf den Boden, »Hier«, aufseinen Bauch, »Hier«. Mit jeder weiteren nutzlosen Frage – das idiotische »Sie« kann er einfach nicht abstellen – wird er zorniger auf die Wilden und auf sich selbst. »Wie lange bin ich schon hier?«, »Haben Sie noch andere Überlebende gefunden?«, »Haben Sie von der Festung Benēsi gehört?« Plötzlich verstummt das Gelächter.
»Benēsi?«, sagt der Schwarze, den Henry für sich Otto nennt, weil ihn dessen kantige Gesichtszüge und die weißen Schläfen an seinen Großonkel Otto erinnern; eine Frau des Schwarzen, die dickere, heißt für Henry nach seiner Großtante Dixi.
»Holz«, sagt der Schwarze.
Aufgeregt nickt Henry. »Holz.«
Für einen Moment meint er in den Augen des Schwarzen so etwas wie Achtung zu erkennen.
»Benēsi?«, fragt Henry noch einmal, drängender.
»Benēsi, Benēsi«, wiederholt der Schwarze und schaut zu Boden.
»Wo – Holz? Wo – Benēsi? Können Sie mich dorthin führen?« Henry erhebt sich. Die Wilden sprechen also Deutsch. Thank God. Aber mehr als »Benēsi« und »Holz« scheinen sie nicht zu verstehen. Oder sie wollen es nicht. Sie haben sich von ihm abgewandt und murmeln sich etwas zu.
Obwohl Henry das nach diesem Abend erwartet hat, ergibt sich keine Änderung seiner Lage. Zu einem weiteren »Gespräch« kommt es nicht mehr. Die Familie verhält sich ganz so, als hätte der kurze Wortwechsel zwischen ihnen und ihrem Gast oder Gefangenen, es macht keinen Unterschied, nie stattgefunden.
Hin und wieder glaubt Henry fest daran, die ganze Reise, sogar Natalie und sein Auftrag, in der Festung Benēsi an der Errichtung einer neuen Siedlung mitzuwirken, sei seiner Einbildung entsprungen, er lebe schon immer hier – nur um sich selbst dann wieder zu ermahnen, jetzt bloß nicht irre zu werden. Natürlich gibt es die Festung Benēsi, natürlich hat es auch Natalie gegeben.
Anders als in New York die Neger-Hausmädchen, fand er anfangs die schwarzen Weiber nur hässlich. Nach einiger Zeit bleiben seine Blicke jedoch immer wieder an ihren nackten Brüsten hängen. Er hat sich abgewandt und geschämt und daran denken müssen, dass die Weiber hier ja nicht einmal wie zu Hause der Rasse der Nigger zuzurechnen sind, sondern nur Wilde sind, und dass er sich deshalb auch nicht schämen muss.
Eine Schwarze gefällt ihm besonders. Er nennt sie insgeheim Johanna, nach der Schauspielerin Johanna Brom, die er oft im Theater gesehen hat und der halb Berlin zu Füßen lag. Die ersten Male versteckt, dann mehr und mehr ohne auf den Mann in der Hütte zu achten, der fast täglich mit einer seiner Frauen schläft, befriedigt Henry sich in seiner Ecke, das Bild der Schwarzen vor Augen, Johanna.
Einen verstauchten Fuß hält er vor den anderen geheim. Unter großen Schmerzen tut er so, als könne er ohne Probleme laufen. Möglicherweise würde er als arbeitsuntauglicher Krüppel in die Steppe getrieben werden. Die Entzündungen an seinen Zehen will er dann nicht wahrhaben. Er ertappt sich dabei, wie er sich selbst beruhigt, ganz so, als erkläre er die Lage einem Fremden: »No problem at all. It was worse yesterday.« Es sind diese Sätze, die er vor sich hinlallt, als er eines Tages wieder der Alten ins Gesicht sieht, die ihn füttert. »Ich hab’ kein Fieber, kein Fieber, ich hab’ doch kein Fieber!«
Es kann sein, denkt er plötzlich und verwirft den Gedanken sofort wieder, dass er schon die ganze Zeit hier lag, seit dem Untergang der Brünnhilde, und dass er die Zwischenzeit nur zusammenfantasiert hat. Als er wieder bei Sinnen ist, das Fieber sinkt, glaubt er für eine Schrecksekunde, er müsse auf der Stelle seiner Pflicht nachgehen, Ziegen hüten, sonst hätten die Wilden das Recht, ihn zu bestrafen. Morgens macht er seine Liegestütze, wäscht sich, reibt sich mit den Blättern des Busches ein, dessen Namen er nicht kennt und den er dog rose nennt, weil ihn die hellroten Beeren an die Hagebutten zu Hause erinnern. Mit einem Schwarzen sitzt er im Schatten einer Hütte. Einmal sieht er, wie ein Bewohner des Dorfes mit einem aufgespannten Regenschirm in die von der Hitze brütende Steppe hinaus spaziert. Aber Henry ist zu sehr mit dem Backen von Fladen, der neuen Aufgabe, die ihm übertragen wurde, beschäftigt, als dass ihn das wirklich kümmern könnte. Er möchte auch gar nicht darüber nachdenken, was dieses Bild bedeutet.
Es ist ein Bild mehr.
ER TRITT AUS DER HÜTTE und alles ist anders. Die Wege zwischen den Hütten sind gefüllt mit Pferden und Gestalten in langen weißen Gewändern und Turbanen, nur ihr Gesicht ist unverhüllt. Inmitten der Hühner und Ziegen liegen bunte Tücher auf dem Boden ausgebreitet, daraufWaren, Schmuck, Textilien, auch Früchte. Jemand schlägt eine Trommel, es wird gerufen und laut gelacht. Das Dorf hat sich in einen Basar verwandelt. Von dem Mann, bei dessen Familie er in der Zeit ohne Tage, Wochen und Monate gelebt hat, wird er auf ein Pferd ohne Sattel gehoben. Um nicht mit dem Oberkörper nach hinten zu kippen, muss er sich am Reiter festhalten, der, das sieht er jetzt, den Karabiner einer deutschen Marke umhängen hat. Mauser. Schon ist die Karawane aufgebrochen. Nahezu lautlos zieht sie auf einem Pfad durch die Steppe. Nur einmal noch dreht sich Henry um, nach seiner monatelangen Leidenszeit, da ist das Dorf bereits nicht mehr zu sehen gewesen.
Dann, es kann keine Viertelstunde vergangen sein, stoßen sie auf eine Straße, eine breite Chaussee, auf der von Eingeborenen gezogene Karren rollen und an deren Ende zu Mittag etwas Mächtiges, Graues aus dem Horizont wächst, ein Felsen, vom Wind und Regen geglättete Türme, Zinnen, eine Festung, in deren Mauern Schiefer glitzert: Benēsi. Henry kann es kaum fassen. All die Monate, in denen er immer wieder von der Festung geträumt, sich nach ihr gesehnt, Fluchtpläne wegen mangelnder Orientierung als irrsinnig verworfen hat, lag sein Ziel nur wenige Stunden zu Pferd, höchstens zwei Tagesmärsche vom Dorf entfernt.
Im Innenhof der Festung sieht Henry, der die Schmerzen in seinen Hoden und dem Rücken kaum länger ertragen hätte – mit Sattel zu Hause war er ein guter Reiter –, einen fleischigen, mittelgroßen Weißen, vielleicht 40 Jahre alt, mit angegrautem Kaiserbart und Spazierstock in einem cremefarbenen Anzug und grüner Krawatte, sehr elegant, wie aus einer Zeitschrift ausgeschnitten, mit dem Schwarzen, der der Anführer der Karawane sein muss, verhandeln und dabei auf ihn, Henry, deuten. Kläffend drängen sich zwei Wolfshunde um ihre Beine. Jetzt sagt der Weiße etwas zu ihm, Henry kann seine – wie ihm beim ersten Hören scheint – muhenden Laute nicht verstehen.
»I beg your pardon, Sir.«
Plötzlich die Angst, dass man vielleicht auch hier weder Deutsch noch Englisch spricht.
»Ludwig Gerber. Der Verwalter Benēsis. Habe Sie schon erwartet. Verzeihen Sie, dass wir Sie erst jetzt auslösen konnten, Herr . . .«, wiederholt der Dicke. Der starke bayerische Einschlag der Sätze klingt in Henrys Ohren seltsam unwirklich und fehl am Platz in dieser Umgebung.
Man wusste die ganze Zeit über, dass er in diesem Loch gefangen gehalten wurde. Es fällt ihm wie Schuppen von den Augen, während er mit der Hand die rutschende Hose hält. Er war nur das Pfand in einem Geschäft zwischen zwei Parteien, hier die Schwarzen, da die Weißen. Henry Peters aber hat er in diesem Dorf oder sogar schon am Strand, wo vielleicht auch einmal Natalie und die Überreste seiner Habe angespült würden, zurückgelassen. Für immer. Henry Peters, den Assistenten von Gustav Selwin, dem in jener fürchterlichen Nacht ein von einem Mast herabstürzendes Segel den Schädel zertrümmerte. Ungläubig hatte Selwin, dem das Blut sofort aus Mund und Nase schoss, in Henrys schreckgeweitete Augen geschaut, solange bis er auf die Knie ging und vornüber kippte; als habe er seinem Schüler noch etwas sagen wollen. Henry mag mit seinen 27 Jahren erheblich jünger sein als Selwin; wer aber soll das in seinem momentanen Zustand schon so genau erkennen. Unvergleichlich angenehm, für einen erfahrenen Architekten gehalten zu werden. Ungeahnte Befugnisse. Außerdem, das fühlt er: Die Monate im Dorf der Eingeborenen, sie haben ihn reifen lassen. Jede Katastrophe birgt auch die Möglichkeit eines Neubeginns in sich.
Er stellt sich vor: »Gustav Selwin, Architekt. Überlebender der Brünnhilde. Zu Ihren Diensten.«
Unmittelbar nachdem Henry von Gerber das erfahren hat, was er ohnehin schon zu wissen glaubte, dass es sich nämlich bei ihm, Selwin, um den einzigen bekannten Überlebenden des Schiffbruchs handelt, wird er von einem Schwarzen in dunkelblauer Livree durch schier endlose Gänge, über knarzende Holztreppen, an ausgestopften Papageien, Geweihen und Köpfen seltsamer Tiere vorbei, in ein Zimmer geführt.
Ein Waschtisch, ein Sekretär, ein Holzparavent, der den Schlaf-vom Wohnbereich trennt, ein Himmelbett.
Ein Fenster im zweiten Stock mit Blick auf die Steppe.
Hinter ihm schließt sich die Tür. Gerber in seinem gelben Anzug vorhin, die frischen, stark süßlich duftenden Früchte in einer Schale auf dem Tisch, dann das vollbärtige Gesicht mit der kaputten Brille und den schulterlangen fettigen Haaren im Spiegel, das seine Augen besitzt. Wie eine Fata Morgana.
DIE POSTEN IN DEN GÄNGEN sind für den Komfort und zur Sicherung der Festung unabdingbar. In Situationen wie diesen kommt Gerber sich jedoch wie ein Gefangener vor, dessen Bewegungen hier im Zimmer die Schwarzen draußen mit großen Ohren verfolgen. Kaum hörbar, aber für Gerber viel zu laut, quietscht die Tür, als er sie einen Spalt öffnet, gerade so weit, dass er den Kopf hindurchstecken kann, um vorsichtig nach dem Boy Ausschau zu halten. Die Gänge sind leer. Eine gescheckte Katze läuft davon, dreht sich nach ihm um, läuft weiter. Eigentlich ist das ein Regelverstoß: die Nichtbesetzung eines Postens. Für heute soll es ihm recht sein.
Rasch schließt er die Tür wieder, hastet nur im Beinkleid durchs Zimmer zur Truhe, hebt den Deckel und holt den Schurz heraus.
Gerber ist erst vor einer Woche wieder dieses Heidengerede vom schwarzen Elefanten als Ahnherr des Negervolkes in den Sinn gekommen und zugleich dieser Tanz der Schwarzen in Loué, als er vor knapp zwei Jahren mit seiner Schwester Käthe gerade in der Hauptstadt eingetroffen war. Auf einer Straße hatte sich damals ein Mob gebildet. Gerber war mit Zachary Pike, dem Landvermesser, den er während der Überfahrt auf dem Schiff kennen gelernt hatte, auf die Veranda des Verwaltungsgebäudes getreten, in dem sie residierten, und konnte von dort den Menschenauflauf überblicken. In dessen Mitte standen drei Eingeborene. Nur mit einem Schurz bekleidet, bewegten sie sich, eigentlich waren es nur sehr kleine Bewegungen mit dem Kopf, den Beinen und dem Gesäß gewesen; diese vollführten sie aber mit so viel Grazie und Kraft, dass ihr Schauspiel Gerber unmittelbar und gewaltig beeindruckte. Ihre Ketten scharrten.
»Der Chief des wichtigsten Stammes in Tola zusammen mit seinen Söhnen«, hatte Zachary Pike Gerber zugeraunt. Und weiter: »Das ist der Elefantentanz.«
Wie Gerber damals erfuhr, ging die Legende, dass der Chief eben dieses Stammes von einem gewaltigen Elefanten namens Mnaba, schwarz wie die Nacht, abstamme, der von allen anderen Tieren in der Steppe und im Dschungel gleichermaßen geachtet wie gefürchtet wurde. Schrecklich sein Zorn. Groß seine Güte. Zu ihm flohen sie, wenn der Löwe nach Beute jagte; ihm beugten sie sich, wenn er einen seiner Untertanen, der einem anderen ein Leid zugefügt hatte, mit seinen Stoßzähnen aus dem Dschungel trieb. Einmal im Jahr, nach der ersten Regenzeit, feierte man ihn. Und wenn sich am Ende vor Mnaba und seiner Gemahlin die Geschenke aus Früchten, Gold und Edelsteinen türmten, so die Legende, dann war es an ihm, seinen Getreuen zu danken. Er erhob den Rüssel, begann ihn zu schwenken, nach links und nach rechts, die Beine dazu, bald bebte der gesamte Dschungel von Mnaba-Di, dem Elefantentanz, den die Stammeshäuptlinge, die Elefantenabkömmlinge, bis heute aufführen. Sie spenden ihrem Volk Dank. Umgekehrt fließen ihnen Kräfte, magische Kräfte, zu.
Als ihm vor einer Woche die Geschichte wieder einfiel und er diesen elenden Schurz nicht vergessen konnte, war Gerber schließlich zu Hoki, der Schneiderin, gegangen, um einen neuen Anzug in Auftrag zu geben – nur um am Ende noch wie beiläufig hinzuzufügen, dass Hoki ihm außerdem noch ein Lendengewand anzufertigen und einige Ketten nach der Sitte der Chiefs der Umgebung zu besorgen habe, zu Studienzwecken, sie wisse schon, der Schurz solle seine Größe besitzen. Und kein Wort zu irgendjemandem, sonst . . . er machte mit der Faust das Zeichen für eine herabschnellende Peitsche.
Seit gestern Abend liegt das Bestellte nun in seiner Truhe. Sein Beinkleid möchte er doch anlassen. Dann die erste Schwierigkeit: Wie legt man so ein Ding an, wo befindet sich hier ein Knopf, eine Schnur? Zumindest scheint Gerber der Schurz zu passen; mit den Händen gehalten, spannt sich das Lederstück um seinen Bauch. Und jetzt – es bereitet ihm mit einem Mal unbändiges Vergnügen, eine Freude wie seit Kindertagen nicht mehr – macht er einen Schritt nach vorne, links, rechts, beugt den Oberkörper, und dann, gleich dem Elefanten, der mit seinem Hinterteil grazil und doch mächtig die Stämme des Dschungels beiseite schiebt: ein Hüftschwung.
AUF DEM GRUND DES OZEANS liegt sie, Natalie Peters, geborene Treibel, zwischen Algen, ihre Kette, das Medaillon mit der Fotografie ihres Mannes schwebt an ihrem Hals, die Arme hat sie erhoben, als balanciere sie, die Augen weit geöffnet, schaut sie auf die Schwärme von Fischen, die an ihr vorbeiziehen, rot, schwarz, gelb, die sie streicheln, an ihr knabbern, da ist der Finger ab, nach Tagen, Wochen, die Nase, das Ohr, ihr weggenascht und fortstibitzt, reißt die Strömung ihr das Kleid in Fetzen, nackt liegt sie da, ohne Bein und Arm und Gesicht, werden die Algen zu ihrem Mund, ihren Augen, grün.
3 PARIS, 1913
Die Eingeborene hebt ihre Hängebrust mit der Hand an, damit das Baby auf ihrem Arm leichter daran saugen kann. Ab und zu kratzt sich die Frau. Bei jeder Bewegung klirren die Reife – aus Gold? –, die ihr wie ein Mühlsteinkragen vom Hals abstehen. Sie schaut teilnahmslos, als ob sie Henry nicht wahrnehmen würde. Auf der weißen Tafel vor dem Zaun ihres Geheges liest er: Négresse avec petit (Tola).
Auf der Wiese daneben haben sich die Schwarzen in einer Reihe vor einem Lagerfeuer aufgestellt, über dem ein Tier brät, machen zwei Schritte vor, beugen den Oberkörper, treten zurück, eine menschliche Welle, dazu singen sie etwas. Sie tragen schwere Holzschilder und Lanzen, ihre nackten Oberkörper sind vollständig tätowiert. Der Rauch des Feuers weht so dicht, dass der Eiffelturm, der die ganze Zeit über mächtig im Hintergrund in den Himmel ragte, verschwunden ist. Fast scheint es Henry in diesem Moment, als ob er sich tatsächlich im afrikanischen Busch befände.
Was die Tätowierungen wohl darstellen?, fragt Henrys Cousine, Mlle. Villiers, die ihr Taschentuch wieder vom Mund genommen hat, so dass ihre schmalen Lippen zum Vorschein kommen.
Ob er etwas erkennen könne.
Sie beugt sich über den hüfthohen Holzzaun, hält dabei ihren weißen Hut am Hinterkopf mit der einen Hand fest, in der anderen ihr zusammengebundenes Spitzensonnenschirmchen. Eine brünette Strähne hängt ihr ins Gesicht.
Henry ist unklar, ob das eine weitere Probe ist, das Stichwort für etwas, das von ihm erwartet wird. Kurzentschlossen ruft er nach dem Wärter mit dem gelben Tropenhelm. Einer der Eingeborenen im Gehege solle an den Zaun treten. Der harsche Befehlston aus seinem Mund überrascht ihn selbst – und freut ihn zugleich, weil er seine eigene Stimme sicher und, wie er meint, nahezu akzentfrei in der fremden Sprache reden hört. Als seine Cousine entrüstet sagt, sie verlasse unverzüglich das Gelände, weiß er, dass er richtig gehandelt hat. Mehrmals dreht sie sich um und zeigt ihm ihr schnell aufgespanntes Schirmchen, woraufhin er sie lächelnd bitten muss, zu bleiben. Schließlich lässt sie sich mit gespielt beleidigter Miene und erhobener Stupsnase dazu bewegen.
Wortlos, mittels eines Stocks, einer Art Zeigestab, hebt der Wärter den tätowierten Arm des schwarzen Mannes an, etwa so wie man ein Stück Fleisch in der Pfanne wendet, um zu überprüfen, ob es schon gar ist. Mlle. Villiers wirft zunächst nur einen kurzen angewiderten Blick darauf. Dann, nachdem Henry über die bunten Spiralen, Kreise und Rechtecke auf der Haut des Wilden streicht – ganz glatt ist sie, wie die eines Kindes –, berührt auch seine Cousine den Arm vorsichtig mit den Fingerkuppen. Ihren Handschuh hat sie dafür abgestreift. Einen Augenblick lang, das sieht Henry an ihrer gerunzelten Stirn, ist sie völlig gefangen genommen. Der Gedanke verwirrt ihn über die Maßen, dass das der erste nackte Männerarm sein könnte, den seine Cousine berührt, und dass er, Henry, sich schuldig gemacht haben, dass er zu weit gegangen sein könnte. Er trägt die Verantwortung bei diesem Ausflug. Eigentlich ist die Szene absolut ungehörig – und trotzdem befriedigt ihn der Anblick der schmalen Finger seiner Cousine auf den Tätowierungen des Eingeborenen.
Henry ist es fast, als könnte er ihre Berührung auf seinem eigenen Oberarm spüren.
Später schlendern sie in Richtung Ausgang, da erblickt er etwas, nach dem er schon insgeheim Ausschau gehalten hatte. In der Sorge, dass seine Cousine ihn auslachen würde, wenn er darauf bestände, den Umweg zu machen, hatte er sich jedoch damit abgefunden, dass es sich eben wohl oder übel nicht ergeben würde. Nun steht es nur wenige Schritte entfernt vor ihnen: le manoir a l’envers, das verkehrte Haus.
»Attendez, attendez«, murmelt Henry und greift seine Cousine an der wieder behandschuhten Hand.
Ein kurioser Anblick, allerdings weniger imposant als Henry es sich nach der Zeitungslektüre vorgestellt hatte.
Eine auf den Kopf gestellte mittelalterlich anmutende Festung. Die vier Türmchen dienen als Fundament. Darauf, einige Meter über der Erde – eine nicht zu verachtende statische Leistung – ruht der Wehrgang; wie die Borte eines Vorhangs hängen die Zinnen davon herab. Dann folgt der erste Stock, ganz oben schließlich, mit umgedrehten Rundbogenfenstern, das Erdgeschoss.
»Mais c’est drôle!«, entfährt es seiner Cousine. Jetzt ist sie es, die Henry zu der Schlange vor dem Eingang zieht. Nur widerwillig folgt er ihr. Als er die Menschenmassen erblickt, ist ihm mit einem Schlag die Lust verloren gegangen, das verkehrte Haus zu besichtigen. Das ist eine Kuriosität; keine Sache, auf die man als ernsthafter Architekt, wie er einmal einer sein würde, Bezug nehmen könnte.
Während sie warten, fallen Henry die Schweißperlen auf, die sich im trotz ihrer ansonsten zarten Figur üppigen Dekolleté seiner Cousine gebildet haben und die sie wie nebenbei, dabei tief in die Furche fahrend, mit ihrem Taschentuch abtupft. Um die kopfstehende Festung an den Türmchen vorbei durch eine Luke im Wehrgang zu betreten, muss man eine steile Eisenleiter erklimmen. Im Inneren quiekt seine Cousine vor Vergnügen. Ein Tisch, Stühle, die von der Decke hängen. Ein Lüster, der aus dem Boden heraus, an einem straffen Drahtband in die Höhe ragt. Die Kerzen glimmen elektrisch. Bilder an den Wänden, mit dem Nagel am unteren Rand des Rahmens befestigt.
Ein Scherz, muss Henry denken. Er wandert hier im Stein gewordenen Scherz des Russen herum, der all das ersonnen hat. Henry wird ganz übel bei dem Gedanken. Dass er diesem Russen auf den Leim gegangen ist, ist ein Beweis mehr für seine Unreife, dafür, dass er noch weit davon entfernt ist, ein wahrer Gentleman zu sein, der über einen Lebensplan verfügt und die Verantwortung für seine Taten übernehmen kann, weil er sich seines Ziels gewiss ist.
Als seine Cousine und er das verkehrte Haus wieder verlassen, kommt es Henry für Sekunden so vor, als sei auch die Welt um ihn, die Bäume mit ihren Wipfeln, die Herren mit ihren Zylindern, die Damen mit ihren Schirmchen, falsch herum.
Am Ausgang besteht seine Cousine darauf, zum Salon der Frézons eine Droschke und nicht die Métropolitain zu nehmen. »Ach, wissen Sie, eingepfercht zwischen so vielen Menschen überkommt mich auf der Stelle schlimmstes Unwohlsein«, zwitschert sie mit ihrem Pariser Akzent und macht mit einem ganz und gar undamenhaften Pfiff einen Kutscher auf sich aufmerksam. »Allein schon der Gedanke, dass jetzt gerade« – sie deutet auf den Boden – »unter unseren Füßen Hunderte von Franzosen in Zügen durch enge Tunnels rasen! Also eines kann ich Ihnen, cher cousin, versprechen: So lange ich lebe, werde ich nur ebenerdig reisen. Selbst auf die Gefahr hin, dass man mich deshalb trotz meiner Jugend in allen Salons für altmodisch erklären wird. Ich werde mich, Sie sind mein Zeuge, der Flut von Neuerungen, die jedes Jahr unsere Hauptstadt überschwemmen, verweigern. Jawohl. Manchmal habe ich ja sogar im Nachhinein das Gefühl, in zwölf Monaten ist nicht ein, sondern seien vier, fünfJahre vergangen. Ich weiß nicht, wie es Ihnen dabei geht, aber mir dreht sich der Kopf!«
Henry bietet ihr beim Einsteigen in die Kutsche seine Hand an und widerspricht ihr nicht, obwohl er es in New York liebte, mit der ratternden Subway unter den höchsten Häusern nicht nur Amerikas, der Welt!, wie er dann stets dachte, hindurch zu fahren, allein gezogen von der Kraft der Elektrizität, die bald auch in der Provinz alle Zugtiere oder gar vor Karren gespannte Menschen überflüssig machen würde. Und irgendwann würde man Gebäude statt nach oben Stockwerk um Stockwerk nach unten bauen. Strom würde sie taghell erleuchten. Kein Heimweh würde einen zurück an die Oberfläche steigen lassen, weil doch alles und noch prächtiger vorhanden wäre, in der Welt unter der Welt.
Auf der Fahrt in der Droschke, die Champs-Elysées entlang, bei der jedes Mal, wenn sie von einem Automobil knatternd überholt werden, das Fluchen des Kutschers zu vernehmen ist, haben Mlle. Villiers und Henry eine Zeitlang schweigend durch das Fenster geschaut. Er darf nicht vergessen, sobald er zu Hause ist, auch wenn es heute Abend spät werden sollte, noch mit der Nachtpost den Brief an Natalie abzuschicken, den er ihr nach dem Aufstehen geschrieben und in dem er ihr ihrem Wunsch gemäß den Ablauf des heutigen Tages Punkt für Punkt geschildert hat, mit wem er was unternehmen werde, bei wem er eingeladen sei. Er könnte ihr allerdings den Brief auch erst morgen oder übermorgen senden – bis auf einige Namen, mit denen seine Verlobte ohnehin nichts anfangen kann, wäre der Inhalt derselbe. Besichtigung von This-is-an-important-building-to-see, anschließend Kaffee und Kuchen im Salon von Madame I-don’t-know-her-face.
So niedlich sei ihr Cousin, immerzu in Gedanken an seine hübsche Verlobte und die anstehende Hochzeit. Wie schön doch die Liebe sein müsse für den, den Amors Pfeil endlich treffe, und wie beneidenswert Henry doch sei! Ein trauriger Unterton schleicht sich in die Stimme Mlle. Villiers, die sich, soweit Henry weiß, immer noch nicht für einen ihrer vielen Verehrer entschieden hat.
Ja, sicherlich, antwortet er. Er könne sich über die Maßen glücklich schätzen. »Chère cousine«, fährt er auf Französisch fort, er muss gar nicht nach dem passenden Ausdruck suchen; es ist wie damals, als er als Kind auf dem Handschlitten den Hügel im Central Park herunterrutschte, »was halten Sie aber von diesem plötzlichen Einfall? Wie muss es wohl sein, als Wilder durch Paris zu fahren? Also sich in genau dieser Situation zu befinden – als Wilder –, in der ich mich gerade befinde, in dieser Kutsche, einer schönen jungen Dame gegenübersitzend. Wenn ich selbst also ein Wilder wäre sozusagen, in Schurz und beinahe nackt«, Mlle. Villiers kichert und hält sich die Hand vor den Mund, »was würde ich wohl empfinden, beim Anblick der Gebäude hier. Was meinen Sie? Mir kam gerade der Gedanke, ob ich sie nicht für die Gipfel eines einzigen großen Bergmassivs halten würde. Und die Automobile – wahrscheinlich erschienen sie mir als eine unbekannte, unheimliche Spezies von Tieren oder gar – oder gar als Geister.«
Wie als Antwort darauf ertönt von Ferne aufgeregtes Hupen, das in Henrys Ohren tatsächlich für eine Sekunde wie der Ruf eines Tieres klingt.
»Des weiteren frage ich mich«, führt er hastig seinen Monolog zu Ende, »was genau der Eingeborene wohl sähe. So las ich vor kurzem im Figaro einen Bericht über gewisse Stämme in Neuseeland, die das Schiff der Entdecker nicht wahrnahmen, nicht wahrnehmen konnten, da es ihre Vorstellungskraft sprengte. Gut möglich, dass der Eingeborene die Stadt, den Verkehr und all das gar nicht sähe und stattdessen nur die Menschen, die Passanten in einem leeren Raum, nicht wahr?«
Mlle. Villiers dreht sich zu Henry. Über ihrer Stupsnase eine tiefe Falte.
»Doch wenn die Wilden nur das denken und sehen können, was sie kennen, und sie leben also nun hier, in diesem Dorf, auf dem Weltausstellungsgelände, im ihnen unbekannten Paris – wo denken diese Menschen dann, dass sie jetzt gerade sind, Henry?«
M. FRÉZON STELLT THESEN AUF. Mme. Willot pflichtet ihm bei, sie ist seine Adjutantin. M. Allou widerspricht M. Frézon, er ist sein Widersacher. M. Cormier ist aufM. Frézons Seite. Mme. Frézon wechselt ihren Standpunkt. M. Grévy ist der vornehme Zuhörer, er schweigt. Mlle. Villiers stellt Verständnisfragen, über die die anderen schmunzeln. Mme. Allou versucht zu vermitteln, sie ist die Schlichterin.
Schon kurze Zeit nach seiner Ankunft im Salon der Frézons hat Henry die herrschende Rollenverteilung erkannt. Sie gleicht jener der Gesellschaften, die er aus New York kennt.
Sagt M. Frézon »A« und M. Allou »B«, sagt Mme. Allou »Mais ce n’est pas grave, mes chers amis! A, c’est B!« Und so weiter. Henry richtet sich in seinem Ledersessel auf und blickt immer zu demjenigen, der das Wort hat, um einen interessierten Eindruck zu vermitteln. Es gilt, dem Ruf des jungen, hochintelligenten Mannes zu entsprechen, von dem er weiß, dass er ihm, durch seine Mutter und seinen Onkel verbreitet, vorausgeeilt ist.
»Und jede Note entspricht wirklich einer Farbe?«, fragt Mme. Allou mit gespieltem Erstaunen, während sie mit ihrem seidenen Fächer wedelt und die Pfauen darauf Räder schlagen lässt.
Man diskutiert über die Stücke eines Komponisten, bei denen sich angeblich zu den Klängen des Orchesters mittels eines Farbenklaviers die Decke des Konzertsaals in einen schillernden Regenbogen verwandeln soll.
»In der Tat, Madame. Ich wurde selbst Zeuge eines solchen Schauspiels bei meiner letzten Reise nach St. Petersburg«, hebt M. Frézon an zu erzählen. Und Henry erinnert sich mit einem Mal an die Recherchen für eine Studie, die er in der Blackstone Library an jenen Tagen in Chicago entwarf, an denen sein Lehrer Burnham keine Zeit für ihn hatte – was leider häufig vorkam.
Henry plante damals, ein Werk über nicht realisierte Bauwerke zu schreiben, Gebäude, die durch den Tod ihres Schöpfers oder aufgrund widriger Umstände nicht fertig gestellt werden konnten. Der Ursprung für dieses Vorhaben lag in einer Episode aus seiner Jugend, die ihn nachhaltig beeindruckt hatte. Der gute alte Ferguson, der ihm bewundernswert geduldig, aber dennoch erfolglos, die Grundgriffe auf der Violine beizubringen versuchte, erzählte Henry einmal von Beethovens Zehnter Sinfonie, ja richtig, es gebe sie, oder besser: es hätte sie beinahe gegeben. Der Meister habe sie schon fertig im Kopf gehabt und einem Freund auf dem Klavier vorgespielt. Allein der viel zu frühe Tod des Genies habe die Niederschrift verhindert und die Welt um ein Meisterwerk gebracht, die, existierte die Partitur, nicht dieselbe wäre, da sei er, Ferguson, sich sicher.
In den folgenden Unterrichtsstunden hatten der Lehrer und sein Schüler über weitere Fragmente der Musikgeschichte gesprochen. Mozarts »Requiem«: Wären doch mehr Skizzen vorhanden, die über den ursprünglich intendierten Fortgang der Komposition Aufschluss geben könnten! Schuberts lang vergessene »Unvollendete«: War der Torso Absicht? Schließlich Richard Wagners Projekt über den Heiligen der Inder, Buddha, eine Oper namens »Die Sieger«: Vielleicht im Kopf des Komponisten komplett vorhanden; allein, die wenigen Notizen, die er von ihr hinterließ – nicht aussagekräftig genug, what a shame.
Henry, der zunächst froh darüber war, eine Pause von den praktischen Demonstrationen seiner musikalischen Unfähigkeit nehmen zu dürfen, fand es bald seltsam, ja, beunruhigend, wie lang und mühevoll die Wege sein konnten, die zum erlösenden, aber dann häufig nur flüchtig irgendwo hingekritzelten Einfall führten. Und beides, die Wege und der Einfall, waren vollkommen nutzlos und würden nie jemanden kümmern, käme es nicht zur Veröffentlichung des Werkes. Das Ohnmachtsgefühl angesichts der Erkenntnis, wie viele unfertig liegengelassene Arbeiten voller brillanter Ideen in all den Jahrtausenden verschwunden sein mussten, ohne dass man sie je zu Gesicht bekommen hatte, erfasste Henry wieder, einige Jahre später, bei seinen Spaziergängen in Chicago. Er stellte sich vor, die Stahlgerippe der Gebäude um ihn blieben durch unglückliche Zufälle nackt, die wichtigsten architektonischen Werke, auf die Burnham und er ihre Hoffnungen setzten, Ruinen, die bald wieder abgerissen werden würden. In dieser Zeit beschloss Henry, zum Streiter für das Reich des Unvollendeten zu werden. Er würde ihm zu neuer Geltung verhelfen. Hätte er sich erst einmal einen Namen als Architekt gemacht, würde er sich unter anderem auch dafür einsetzen, dass jene Werke, die als Plan existierten, aber bislang unrealisiert geblieben waren, tatsächlich gebaut würden. Der ungerechte Lauf der Geschichte: Er würde durch Henry zumindest ein wenig in Ordnung gebracht werden.
Diese schwärmerischen Studententage liegen zwar nun schon einige Jahre zurück. Aber die Erinnerung an sie lässt in Henry, während M. Frézon weiter von seinen russischen Erlebnissen erzählt, einen Gedanken aufsteigen, der in ihm beim letzten unsäglich langweiligen New Yorker Salon bereits an Kontur gewonnen hatte, dann aber durch die Reisevorbereitungen, die Überfahrt nach Europa zu seiner zweiten Grand Tour verdrängt worden war: Er wird nicht, wie von seinem Vater gewünscht, dem sein Immobilien-Geschäft in New York nicht mehr genügt, die Außenstelle von »Peters-Immobilien« in Berlin übernehmen. Wenn er jetzt, wie mit seinem Vater abgesprochen oder besser: von ihm diktiert, nach der Rückkehr von seiner halbjährigen Reise durch Europa weg aus New York, seinem Geburtsort, und damit aus der Stadt, die er liebt, für lange und vielleicht für immer nach Deutschland zieht und deutsche Kunden für den Ankauf von Land im amerikanischen Osten akquiriert, dann wird die Architektur für Henry zum bloßen Steckenpferd werden. Die Ausbildung, der Unterricht bei Burnham, alles wäre umsonst gewesen. Seine Träume würden Träume bleiben. Seine Mutter würde Recht behalten. Immer wenn er von seinem Wunsch spricht, Architekt zu werden, bekommt sie diesen zärtlichen Ausdruck, an dem er erkennt, dass sie zwar stolz auf ihn ist, in ihm aber noch einen Jungen sieht, den man nicht für voll nimmt. In Berlin würde er von allen als »echter Peters« wahrgenommen werden. Er würde unglücklich werden.
Und dann die Sprache! Wenn er Deutsch spricht, macht er noch immer so viele Fehler. Manchmal ringt er nach dem richtigen Wort, he’s fumbling for words. Er weiß dann, dass er den passenden Begriff schon einmal gehört hat; oft will er ihm jedoch nicht im rechten Moment einfallen. Französisch spricht er fast genauso gut wie Deutsch. Nur: Er ist doch eigentlich Deutscher – zwar der Sohn von Berliner Auswanderern und in den USA geboren, aber in deutschen Kreisen aufgewachsen.
Andererseits gehen ihm bei seinen Briefen an Natalie Ausdrücke wie »Meine Liebste« und »Ich liebe Dich«, »Ich verzehre mich nach Dir« leichter von der Hand, als wenn er sie auf Englisch schriebe. Mehr noch, das Deutsche verleitet ihn dazu, die Rolle des Liebhabers zu spielen, von der er immer noch nicht weiß, ob sie ihm auch wirklich liegt. In das Verhältnis mit Natalie ist er ja zu Anfang mehr oder weniger ohne eigenes Zutun hineingerutscht. Zu Hause wurden die Treibels, wichtige Geschäftspartner des Vaters, und insbesondere deren älteste Tochter über die Maßen gelobt. Die Eltern hatten schon länger eine Zusammenführung ihrer Kinder im Sinn. In der weitläufigen Wohnung der Treibels in Charlottenburg vor zwei Jahren, als er ihnen auf seiner ersten Grand Tour einen Besuch abstattete, schien dann auch alles überaus gespannt darauf zu warten, wie wohl die erste Begegnung verlaufen würde. Wie auf einer Bühne kam er sich vor. Und hatte nicht eine der alten Damen, die in ihren grünen Samtsesseln versunken saßen, sogar einen Operngucker gezückt, durch den sie ihn betrachtete? Gerührt lächelten die Mutter, Großmama und sämtliche Tanten im Salon einander zu, als Natalie errötend vor ihm knickste. Hätte man ihnen applaudiert, es hätte ihn nicht verwundert.
Nachdem man dann die jungen Leute im Wintergarten allein gelassen hatte, wurde schnell deutlich, dass Henry und Natalie dieselbe Abneigung gegenüber der Situation verband, in die sie beide gegen ihren Willen geraten waren.
»Wie die uns angestarrt haben!«, seufzte das Mädchen und traf den verwirrten Gesichtsausdruck der dicken Tante Erna so genau, dass Henry schallend auflachen musste. Man fand Gemeinsamkeiten im Wunsch, solchen Gesellschaften ein für alle mal zu entfliehen. Natalie, die Henry von Anfang an Heinrich nannte, konnte witzig und treffend Konversation machen. Das Entzücken darüber, dass sie überaus kunstinteressiert war, deutete er wenig später als etwas, das er bei Unterhaltungen und Ausflügen mit den blassen jungen Damen der deutschen Gemeinde in New York noch nie empfunden hatte – das musste sie wohl nun sein: die Liebe.
Beim nächsten Tête-a-tête im Wintergarten, am folgenden Tag, hatte Natalie ihm wie gebannt zugehört, als er ihr von seinen Studien bei Burnham erzählte. Mit ihren schwarz gekräuselten Locken und wässrig blauen Augen, ihrem träumerischen Blick und den Lippen, die sie so spitzbübisch schürzen konnte, wenn jemand ihren Spott herausforderte, war sie tatsächlich die Schönste der drei Treibel-Schwestern. Nicht wenige angesehene Junggesellen Berlins, so hieß es, hatten bereits um sie geworben. Henry hatte nach ihrer Hand gefasst, Natalie schien sofort begriffen zu haben; kussbereit hatte sie den Kopf in den Nacken gelegt. Er war nicht darauf eingegangen, möglicherweise ein Fehler, da ihn dieses Bild auf der restlichen Strecke seiner damaligen Grand Tour geradezu verfolgte, sein Verlangen nach diesem so schönen und klugen Mädchen, das solch einen Kussmund besaß, nur vergrößerte und ihn zu schriftlichen Ergüssen veranlasste, in deren leidenschaftlichen Ton er sich manchmal beim nochmaligen Durchlesen kaum wiedererkennen wollte.
Bald waren die Briefe zwischen Berlin und New York zu einer liebgewonnenen Gewohnheit geworden. Wie gut es tat, über das kaum erträgliche Gewicht schreiben zu können, das die goldberahmten Gemälde der vielen Generationen von Peters in der Eingangshalle ihres Hauses für ihn bedeuteten; von seinen Hoffnungen, Wünschen für die dann hoffentlich selbst bestimmte Zukunft. Und wie wunderbar zu lesen, das »Ich verstehe Sie«, das »Wir empfinden gleich«, das »Halte aus, lieber Heinrich«.
Dass all dies dann vor zwei Wochen in Charlottenburg zur Verlobung geführt hatte, war logisch und absehbar gewesen. Freilich: Bis zu einem Nachmittag im Herbst letzten Jahres in New York schrieb Henry zwar regelmäßig nach Deutschland, und es beunruhigte ihn, wenn Natalies Briefe nicht wie sonst einmal wöchentlich eintrafen – doch an eine feste Bindung hatte er bis dahin nicht gedacht.
»Wie findest du denn die kleine Treibel?«, hatte ihn damals unvermittelt seine Mutter gefragt.
»Natalie?«, auf so ein Gespräch war er nicht vorbereitet gewesen. »Well, she’s a splendid girl, I suppose.«
Seine Mutter, nach einer Pause: »Ja gibt es denn . . . möchtest du denn sagen, dass es etwa . . . eine Überraschung geben könnte?«
Erst da, als Henry erkannte, worauf seine Mutter hinaus wollte, tauchte in ihm die Idee einer Ehe mit diesem Mädchen auf, merkte er, dass sie bereits als zu ihm gehörig betrachtet wurde – und es erfüllte ihn mit einem Mal mit Glück, wenn er sie sich an seiner Seite vorstellte. Jemand, der aus eigener Erfahrung wusste, wie es war, schwer an einem Erbe wie dem seinen zu tragen; jemand, der wahrlich bezaubernd anzusehen war; jemand, den er all das, was er die letzten Jahre über Architektur und Kunst gelernt hatte, nun selbst lehren konnte, ein Projekt.
»Liebe Mutter . . .«, antwortete er.
Die hielt ihr Taschentuch an den Mund, Tränen schossen ihr in die stets geröteten Augen. »Nein, unser Junge!«, weinte sie, um dann mit bemerkenswert kräftiger Stimme, durch das Haus laufend, zu rufen: »Vater, schnell! Es ist etwas passiert!«
Nach über zwei Jahren des regen Briefverkehrs zwischen den Kontinenten wurde also Verlobung gefeiert. Auf der Überfahrt hatte Henry an der Reling beim Anblick der grünschwarzen Tiefen unter sich noch eine gewisse Furcht vor dem Kommenden befallen – eine Furcht, die wie weggeblasen war, als er seiner freudestrahlenden Natalie die zarte weiße Hand küsste und Herrn Treibel eben das fragte, was schon lange für niemanden mehr eine Überraschung darstellte. Wie anders und, ja, reizender Natalie doch war als das Mädchen, nach dem er sich während der Zeit des Wartens täglich mehr gesehnt hatte, obwohl er es, wenn er sich an es zu erinnern versuchte, gar nicht mehr klar vor sich sah, ein Umstand, der nur umso mehr seine nicht selten mit dem Wörterbuch verfeinerten schriftlichen Liebesbeteuerungen befeuerte.
Andererseits fühlt und denkt er eben amerikanisch. Ganz und gar, wie der Deutsche sagt. Schon früh, als ihm Minna, sein Kindermädchen, deutsche Gutenachtgeschichten vorlas, hatte er mit ihr darüber auf Englisch gesprochen, hatte er gegen die Spitznamen und Koseworte, die ihm seine Mutter als Junge auf ihrem Schoß ab und zu auf Deutsch ins Ohr flüsterte, auf Englisch protestiert und mit Wonne beim Mittagessen die derben Schimpfwörter, die er vom Spielen mit den anderen Kindern im Borough kannte, den Erwachsenen über die makellos weiße Tischdecke hinweg zugerufen.
Und all diese Sitten und Moden in Berlin! Er kennt sich da nicht aus. Die drei Male, die er sich mittlerweile dort aufhielt und eine im Kreis der New Yorker Deutschen gebräuchliche Redensart verwendete, wurde er schief angesehen. »Das sagt man heutzutage übrigens nicht mehr«, flüsterte ihm Tante Edeltraud einmal leise mit einem wohlwollenden Gesichtsausdruck zu. Als er damals von seiner ersten Deutschlandreise nach New York zurückkehrte, sah er seine Bekannten und Verwandten, die meisten – so wie seine Eltern – gebürtige Deutsche, mit anderen Augen. Die Zeit, so schien es ihm, war für alle Auswanderer mit dem Moment des Verlassens der Heimat stehen geblieben. Die Auswanderer selbst, in ihren mit Samt ausgekleideten Salons, hatten etwas von eingemachten Schattenmorellen in einem Kompottglas.
Jenes Deutschland, das Henry aus den Geschichten seiner Eltern von Kindesbeinen an vertraut war, und das doch auch seine Heimat sein sollte, glich für ihn vor seinem allerersten Besuch einem Land aus einem Märchenbuch. Einem Land mit schroff erhabenen und schneebepuderten Alpen im Süden, sturmumtosten Meeresküsten im Norden, dazwischen: dunkle Tannenwälder; bevölkert vom urigen Wurzelsepp in Lederhosen und vom tollkühnen Deichgraf, Schauplatz großer und glorreicher Schlachten.
Rein gar nichts hatte es dann gemein mit dem unübersichtlichen, geschäftigen Berlin. Und wenn schon Henry bei seinem ersten Besuch vor einigen Jahren das legendäre Land seiner Vorstellung darin nicht wiederzuerkennen vermochte, so hatte er doch für einen Moment gehofft, hier stattdessen wenigstens einige beispielhafte Pionierleistungen der Moderne vorzufinden, schließlich nannte man die Stadt ja auch Spree-Chicago. Allein: Bis auf Behrens’ Turbinenfabrik schienen die Berliner Neubauten – protzig-klobige Fassaden oder triste Blocksiedlungen – den Charakter ihrer Bewohner nach außen kehren zu wollen, das lautstark Auftrumpfende der Ober-, das selbstgefällig Kommode der Mittel-und die maßlose Tristesse der Unterschicht. Alle Pracht wirkte beim näheren Hinsehen wie eine aus tief sitzenden Minderwertigkeitskomplexen heraus entstandene Miniatur-Kopie von Paris. Stolz wurden da wahlweise Schinkels antikisierte Theater-und Museumstempel oder seine neugotischen Kirchen als »typisch deutscher Stil« angepriesen. Architektonisch gesehen freilich tiefstes Mittelalter. Aber keines, das in Henry jenes wahrlich märchenhafte Schaudern auszulösen vermochte, das er etwa beim Anblick von Notre-Dame empfand. Vielmehr hinterließ die Automobilfahrt an der Seite eines mit Burnham bekannten Berliner Architekten, die Linden entlang, einen überaus schalen Nachgeschmack. Es war ihm, als bewege er sich durch die Kulissen eines Theaterstücks.