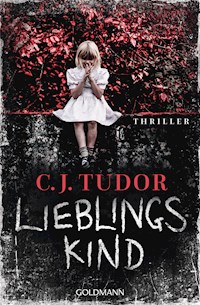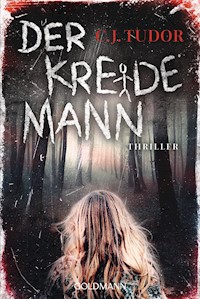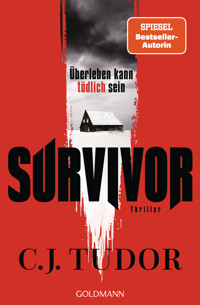
12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Goldmann Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2024
Als Hannah erwacht, findet sie sich in einem komplett zerstörten Autobus wieder, der in der Abgeschiedenheit der Wälder verunglückt ist. Die Ausgänge sind blockiert, sie und einige andere Überlebende sind in den Trümmern gefangen. Aber die Zeit läuft, denn in Kälte und Eis ist ihnen der Tod sicher.
Als Meg wieder zu sich kommt, befindet sie sich in einer Gondel, hoch oben über verschneiten Bergen, und hat keinerlei Erinnerung, wie sie dorthin kam. Begleitet wird sie von fünf Fremden – und einem Toten.
Carter blickt zum Fenster eines einsam gelegenen Retreats hinaus, in dem er und seine Begleiter sich verschanzt haben. Als ihr Generator im Schneesturm droht zusammenzubrechen, zieht Unheil herauf.
In jeder der Gruppen lauert ein Mörder. Aber wer ist es? Und wer wird entkommen?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 517
Ähnliche
Buch
Als Hannah erwacht, findet sie sich in einem komplett zerstörten Autobus wieder, der in der Abgeschiedenheit der Wälder verunglückt ist. Die Ausgänge sind blockiert, sie und einige andere Überlebende sind in den Trümmern gefangen. Aber die Zeit läuft, denn in Kälte und Eis ist ihnen der Tod sicher.
Als Meg wieder zu sich kommt, befindet sie sich in einer Gondel, hoch oben über verschneiten Bergen, und hat keinerlei Erinnerung, wie sie dorthin kam. Begleitet wird sie von fünf Fremden – und einem Toten.
Carter blickt zum Fenster eines einsam gelegenen Retreats hinaus, in dem er und seine Begleiter sich verschanzt haben. Als ihr Generator im Schneesturm zusammenzubrechen droht, zieht Unheil herauf.
In jeder der Gruppen lauert ein Mörder. Aber wer ist es? Und wer wird entkommen?
Weitere Informationen zu C. J. Tudor und zu lieferbaren Titeln der Autorin finden Sie am Ende des Buches.
C. J. Tudor
Thriller
Deutsch von Marcus Ingendaay
Die Originalausgabe erschien 2023 unter dem Titel »The Drift« bei Michael Joseph, Penguin Random House UK, London.Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Deutsche Erstveröffentlichung Februar 2024
Copyright © der Originalausgabe 2023 by Betty & Betty Ltd.
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2024
by Wilhelm Goldmann Verlag, München,
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München
Umschlaggestaltung: UNO Werbeagentur, München,
nach einer Vorlage von Lee Motley/MJ
Umschlagfoto: Trevillion Images/Yolande de Kort
CN · Herstellung: ik
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN 978-3-641-30502-4V001
www.goldmann-verlag.de
Für meine Familie
Nach und nach zogen sie immer engere Kreise um den Kadaver. Aasfresser. Sie hatten bereits diejenigen Teile im Blick, die sie sich als Erstes herausreißen würden.
Die gefrorene Leiche lag halb begraben in einer Schneewehe. Mit ihren ausgestreckten Armen sah sie aus wie der perfekte Schneeengel. Die eisblauen Augen unter den gefrosteten Wimpern starrten hoch in einen ähnlich blauen Himmel. Der Blizzard war vorbei.
Irgendwann wurde die erste Krähe mutiger, landete auf der Brust des menschlichen Körpers und pickte probeweise an Lippen und Nase. Schließlich stieß sie ihren Schnabel in eines der eisblauen Augen. Zog daran. Zog heftiger. Bis das Auge mit einem nassen Geräusch abriss.
Hochzufrieden hüpfte die Krähe davon und flatterte mit ihrer Beute auf eine nahe Kiefer.
Jetzt gab es auch für die anderen kein Halten mehr. Schon im nächsten Moment fiel ein schwarzes Geschwader flügelschlagend über das gefundene Fressen her.
Binnen Minuten hatte der Tote kein Gesicht mehr, keine Identität.
In der Nacht kamen größere Räuber, und am Morgen war von dem Körper nicht mehr übrig als eine zerfetzte Karkasse.
Eine Woche später erlegte ein Jäger einen streunenden Wolf. Ein entkräftetes, abgemagertes Tier, aber sein Fleisch war trotzdem willkommen. Alles, womit er seine Familie ernähren konnte, war willkommen.
Bald darauf erkrankte der Jäger schwer und starb. Dasselbe geschah mit seiner Familie. Und allen, die sie kannten.
Die Krähen fielen tot vom Himmel.
DIE ERDE IST VOLL DER TOTEN ANSTÄNDIGEN KERLE
Hannah
Irgendwo piepste die Alarmfunktion einer Armbanduhr. Jemand übergab sich, lautstark und ganz in ihrer Nähe. Mehrere Fahrgäste hingen in aberwitzigen Positionen über den Sitzen, die überwiegend aus der Verankerung gerissen worden waren. Blut sammelte sich in Augenhöhlen oder tropfte aus weit aufgeklappten Mündern.
Hannah registrierte die neue Situation mit klinischer Sachlichkeit. Da schlug ihr Vater durch, hätte ihre Mutter jetzt gesagt. Ihr Vater konnte das auch, sachlich bleiben. Der Umgang mit dieser Kaltschnäuzigkeit war nicht immer einfach. Aber es gab Situationen, in denen nur das weiterhalf.
Sie löste den Sicherheitsgurt und rutschte von ihrem Sitz. Der Gurt hatte ihr vermutlich das Leben gerettet. Als der Bus umkippte und sich auf dem steilen Abhang zweimal überschlug, wirkten Kräfte auf die im Bus befindlichen Körper ein, die durch einfaches Festhalten nicht mehr beherrschbar waren. Die vielen Verletzten gingen hauptsächlich auf diesen – letzten – Akt des Unfallgeschehens zurück. Jetzt lag der Bus still und in einem Winkel von annähernd fünfundvierzig Grad in einer Schneewehe und rührte sich nicht mehr.
Auch sie, Hannah, hatte ein paar Blessuren davongetragen, jedoch nichts Ernstes. Zum Beispiel war nichts gebrochen, nichts blutete. Damit waren innere Verletzungen zwar nicht ausgeschlossen, aber ihrem ersten Eindruck nach war sie wohlauf.
Jetzt regten sich auch andere. Hannah hörte Leute stöhnen, andere schreien. Das Heulen war verstummt, vorerst jedenfalls. Sie blickte umher, um den Schaden aufzunehmen. Der Bus war mit insgesamt zwölf Studenten kaum ausgelastet, aber er war halt das Transportmittel, das die Academy für sie bereitgestellt hatte. Schätzungsweise die Hälfte der Studenten hatte den Unfall nicht überlebt, vornehmlich die, die nicht angeschnallt waren.
Aber da war noch etwas anderes, etwas, das mehr Ahnung war als Gedanke, aber noch Folgen haben könnte. Draußen tobte ein Blizzard, und sie steckten in einem Bus fest, der bereits zur Hälfte in einer Schneewehe versunken war. Was bedeutete das? Was folgte daraus? Der Gedanke trat jedoch gleich wieder in den Hintergrund, weil im selben Moment eine Stimme an ihr Ohr drang.
»Hey! HEY! Kann mir jemand helfen? Meine Schwester ist eingeklemmt.«
Hannah blickte durch den Mittelgang nach hinten. Im Heck des Wagens kauerte ein übergewichtiger Typ mit schwarzer Lockenmähne neben einem verletzten Mädchen und hatte ihren Kopf in seinen Schoß gebettet.
Hannah zögerte. Sie war selbst noch ganz benommen und musste ihre Gedanken erst sortieren. Zwar gehörte sie nicht zu denjenigen, die unangenehme Aufgaben lieber auf andere abwälzten, jedoch ertrug sie die physische und emotionale Nähe nicht, die mit dem sich abzeichnenden Drama unweigerlich verbunden war. Da sich aber offenbar niemand zur Hilfeleistung in der Lage sah und sie außerdem über medizinische Kenntnisse verfügte, war es wohl ihre Pflicht. Unsicher und leicht desorientiert aufgrund der Schlagseite stolperte sie durch den Gang in den rückwärtigen Teil des Busses.
Hinten angelangt, sah sie sofort, dass das Mädchen es wohl nicht »schaffen« würde, wie es in Katastrophenfilmen immer hieß. Die Diagnose kam nicht aus ihrem Sachverstand, sondern war reines Bauchgefühl. Dieses Mädchen lag im Sterben, und auch ihr Bruder wusste das, klammerte sich aber an eine letzte absurde Hoffnung. Weil es alles war, das ihm jetzt noch blieb.
Das Mädchen war sehr hübsch mit ihrem blassen weißen Teint und den langen dunklen Locken. Solche Haare, so einen schwarzen Wasserfall, hätte Hannah auch gern gehabt statt dieser trostlosen strähnigen Matte, die man nur nach hinten binden konnte, damit es nicht so auffiel. Hannah registrierte genau, wie viel Neid in ihrer Bewunderung lag, selbst jetzt, im Angesicht des Todes. Offenbar war der Mensch so.
Das Mädchen hatte bereits diesen weit entfernten Blick und bekam offenbar nur noch schwer Luft. Hannah sah, dass ihr linkes Bein unter zwei Sitzen klemmte, die durch den Crash nahezu vollständig zusammengedrückt worden waren. Multiple Frakturen an Ober- und Unterschenkel war allerdings eine unzureichende Diagnose, denn Schrottteile und menschliches Gewebe bildeten hier eine ununterscheidbare Masse, sodass der Blutverlust wohl das eigentliche Problem darstellte. Das heißt, wenn die rasselnden Atemgeräusche nicht gewesen wären – Atemnebengeräusche, wie es korrekt hieß. Diese nämlich wiesen auf weitere, weniger sichtbare Verheerungen hin und würden die Schöne wohl das Leben kosten. So ähnlich wie bei dieser englischen Prinzessin damals – Diana. Sie verblutete am Ende an einer winzigen Ruptur der linken oberen Lungenvene. Die Rettungskräfte hatten keine Chance, so etwas rechtzeitig zu erkennen.
»Wir müssen ihr Bein freikriegen«, sagte der junge Mann. »Kannst du mir helfen, den Sitz anzuheben?«
Hannah besah sich die Situation. Sollte sie ihm wirklich sagen, dass es darauf nicht mehr ankam? Dass er nicht mehr viel tun konnte, als bei ihr zu bleiben – in der wenigen Zeit, die sie noch hatte? Aber dann erinnerte sie sich, wie ihr Vater ihr einmal gesagt hatte: »In Extremsituationen hilft es psychologisch schon weiter, wenn man wenigstens so tut, als könne man etwas ausrichten, obwohl das objektiv gar nicht der Fall ist.«
Sie schüttelte den Kopf. »Noch nicht.«
»Warum nicht?«
»Wenn wir jetzt den Fremdkörper aus der Wunde entfernen, fängt es erst richtig an zu bluten.«
»Was schlägst du stattdessen vor?«
»Trägst du einen Gürtel?«
»Ja, wieso?«
»Zieh ihn aus, dann binden wir erst einmal ihren Unterschenkel ab. Danach können wir meinetwegen versuchen, sie von diesem Sitz zu befreien.«
»Okay.« Er sah nicht so aus, als hätte er verstanden, was sie meinte, und hantierte länger an der Schnalle, ehe der Gürtel aus den Schlaufen glitt. Sein Bauch quoll über den Bund seiner Jeans. Seine Schwester blieb währenddessen auffallend still. Sie hatte genug damit zu tun, trotz der Schmerzen genug Luft in ihre Lunge zu bringen, und atmete nur in winzigen Zügen.
»Für eine Ärztin bist du aber ziemlich jung«, sagte der Mann, als er ihr den Gürtel reichte.
»Ich studiere noch.«
»Ach so«, sagte er und nickte. »Dann gehörst du zu der Grant-Truppe.«
Die Academy war nicht gerade bekannt für ihre Medizinerausbildung. Der ganze Sinn dieser Einrichtung bestand überhaupt nur darin, den Sprösslingen wohlhabender Eltern für horrendes Geld irgendeine Art Uni-Abschluss zu verschaffen. Trotzdem war man einige Jahre zuvor im Department auf die Idee gekommen, ausgerechnet in der hintersten Provinz ein ultramodernes Forschungsinstitut zu errichten, mit einem der weltweit führenden Virologen an der Spitze, ebenjenem Professor Grant. Seitdem zog es einen völlig neuen Typ Student an das entlegene Bergcollege: weniger reich, dafür handverlesen und hochbegabt.
»Und jetzt wickle den Gürtel oberhalb des Knies um ihren Oberschenkel, zieh so stramm an, wie du kannst, und halt ihn fest. Prima, das machst du gut.«
Das Mädchen stöhnte leise, was jedoch kein ganz schlechtes Zeichen war. Solange es noch auf Schmerzreize reagierte, lag es zumindest nicht im Koma.
Unterdessen redete der Mann auf seine Schwester ein. »Ist schon gut«, raunte er ihr ins Ohr, wobei er sich die lange Mähne aus dem Gesicht wischte. »Das wird wieder.«
»Okay«, sagte Hannah. »Dann wollen wir mal.«
Behutsam legte der Mann den Kopf seiner Schwester ab und tat sein Möglichstes, Hannah mit der freien Hand zu unterstützen – ohne Erfolg. Metall knirschte auf Metall, und der Sitz gab ein wenig nach, aber nicht mehr. Sie brauchten mindestens einen weiteren Helfer. Also insgesamt zwei, die mit vereinten Kräften den Sitz anhoben, während der dritte das Mädchen unter dem Sitz hervorzog.
An mehreren Stellen hörte Hannah Stimmen. Die Überlebenden versuchten herauszufinden, ob ihre Reisebegleiter noch existierten.
Laut rief sie in den Bus: »Hey, wir brauchen hier Leute, die mal mit anpacken können. Hört mich jemand?«
»Sorry, aber das passt gerade ganz schlecht«, sagte ein Witzbold aus dem vorderen Teil.
Doch dann erhob sich eine hochgewachsene Gestalt und bewegte sich auf sie zu. Schmaler Junge, blond, eine Gesichtshälfte blutüberströmt. Was, wie Hannah wusste, nicht viel bedeuten musste. Selbst oberflächliche Kopfverletzungen bluteten oft höchst eindrucksvoll.
»Du hast um Hilfe gerufen?«, fragte er förmlich und mit leicht deutschem Akzent.
»Wir brauchen jemanden, der den Sitz mit anhebt, damit wir ihr Bein rausholen können«, sagte Hannah.
Der Blonde warf einen Blick auf das eingeklemmte Mädchen und schien sich ebenfalls keine Illusionen über ihre Überlebenschance zu machen. Aber er bemerkte auch Hannahs Körpersprache und nickte nur.
»Also gut, auf drei: eins, zwei …«
Es brauchte mehrere Versuche, bis es Hannah gelang, das Bein unter dem Sitz herauszuziehen.
Der Bruder rollte seine Jacke zusammen und schob sie dem Mädchen unter den Nacken. Er trug ein ausgeleiertes Sweatshirt mit einem Spruch: Darüber muss ich erst mal nachdenken. Krass, welche nebensächlichen Sachen einem manchmal auffallen, dachte Hannah.
Sie spürte eine Hand an ihrem Arm und drehte sich wieder dem großen Blonden zu. Ein Typ wie aus der Image-Broschüre eines alpenländischen Fremdenverkehrsvereins, fehlten eigentlich nur Lederhose und Gamsbart.
»Wie viele Tote haben wir?«, fragte er.
»Vier? Fünf? Keine Ahnung. Sicher sind auch einige verletzt.«
Er blickte auf das Mädchen und nickte abermals. »Hast du mitgekriegt, wie das passiert ist?«
Hannah versuchte sich zu erinnern. Auch sie hatte nur gedöst, während das Schneetreiben draußen immer heftiger wurde. Plötzlich der beleidigte Sound eines Lkw-Horns und kreischende Bremsen, aber da schlitterten sie bereits von der Straße, wo sich die Vorwärtsbewegung des Busses in eine Rotation um die Längsachse umwandelte, die erst zum Stillstand kam, als es auch vor Hannahs Augen Nacht wurde. Welcher Schwachkopf war eigentlich auf die Idee gekommen, den Bus bei diesem Wetter loszuschicken? Aber die Academy wollte die Studenten eben rechtzeitig in das Retreat bringen. Nur dort waren sie in Sicherheit.
»Nicht so richtig«, musste sie zugeben.
Abermals ließ sie ihren Blick über die Verwüstung gleiten. Menschliche Körper, die nicht mehr dort waren, wo sie hätten sein sollen, andere, die stöhnend oder schreiend in ihren Gurten hingen. Sie versuchte, sich an den halb fertigen Gedanken zu erinnern, der ihr schon vorher bei diesem Anblick gekommen war.
Der Bus lag halb schräg auf der rechten Seite. Die Fenster auf der Linken waren bis vorn zur Fahrerkabine intakt und schauten hoch in den dämmernden Abendhimmel. Schon jetzt, wenige Minuten nach dem Unfall, hatte sich auf den Scheiben eine dünne Schneeschicht abgesetzt. Den größten Schaden hatte die rechte Fahrzeugseite abgekriegt. Verbogener Stahl, geplatztes Glas, wo man hinsah. Zudem lag die rechte Hälfte komplett unter Schnee, und das wiederum bedeutete …
Dass sie den Bus nicht mehr verlassen konnten. Weil alle Türen blockiert waren.
»Wir sitzen in der Falle«, sagte sie laut.
Der Blonde nickte, wie zufrieden darüber, dass er nicht als Einziger auf diesen Trichter gekommen war. »Stimmt. Aber selbst wenn nicht, unter diesen Wetterbedingungen wären wir sowieso bald am Ende.«
»Was ist mit dem Notausstieg?«, fragte Hannah.
»Schon versucht, aber der klemmt offenbar.«
»Was?«
Der Junge zog sie am Ellbogen ein paar Meter weiter, wo drei Stufen zur Bustoilette hinabführten – und zu einer weiteren Tür. Darüber ein roter Aufkleber: IMNOTFALLROTENHEBELZIEHENUNDTÜRAUFSTOSSEN. Der Blonde zog an dem Hebel und drückte gegen die Tür. Es tat sich nichts.
Er machte aber Platz, um Hannah Gelegenheit zu geben, es ebenfalls zu probieren. Doch selbst mehrere, zunehmend wütende Versuche brachten kein anderes Ergebnis. Die Tür ging nicht auf.
»Scheiße!«, fluchte sie. »Wie ist so etwas möglich?«
»Schwer zu sagen«, sagte er. »Wahrscheinlich hat sich bei dem Unfall der ganze Rahmen verzogen.«
»Moment mal. Gibt es da nicht diesen Notfallhammer, mit dem man die Scheiben einschlagen kann?«
»Korrekt. Womit wir gleich bei dem nächsten Problem wären.«
»Was soll das heißen?«, fragte sie gereizt.
Der Blonde trat einen Schritt zurück und deutete auf die rote Halterung über dem Fenster links. Sie war leer, kein Hammer mehr da.
»Streng genommen müsste es sogar einen zweiten Hammer geben, für die Dachluke.« Er deutete nach oben. »Aber der fehlt ebenfalls.«
In Hannahs Kopf drehte sich alles. »Aber wieso?«
Der Blonde antwortete mit einem fatalistischen Lächeln. »Tja, gute Frage. Wahrscheinlich, weil irgendwelche Arschgeigen den Hammer geklaut haben. Und natürlich, weil es kein Schwein für nötig hielt, vor der Fahrt die Sicherheitseinrichtungen zu überprüfen. Ist so«, sagte er, als erübrigte sich jede weitere Erklärung.
»Wir müssen Hilfe holen«, sagte Hannah, um die aufkommende Panik halbwegs unter Kontrolle zu bringen.
Aber dann fiel ihr ein, dass das ja gar nicht ging.
»Unsere Handys!«
Sämtliche Handys waren vor der Fahrt einkassiert worden und befanden sich – ausgeschaltet – irgendwo im Gepäckraum des Busses. Keine Kommunikation während der Fahrt, auch keine elektronischen Spuren.
Niemand sollte erfahren, wohin die Reise ging.
Hannah starrte den Blonden an. Da sie keinen Notruf absetzen konnten, war auch völlig offen, wann Hilfe eintreffen würde. Es war nicht einmal klar, ab wann sie überhaupt als vermisst galten. Im Augenblick sicherlich noch nicht. Und wer würde sich schon bei diesem Schneesturm auf den Weg zu ihnen machen?
Sie sah aus dem Fenster in das wirbelnde Weiß des Himmels. Konturen waren nicht mehr zu erkennen, und langsam schneiten auch die Scheiben zu. Es war, als ginge für sie alle ganz langsam das Licht aus.
Sie saßen in der Falle, zusammen mit den Toten. Und wenn nicht bald Hilfe eintraf, würde der Bus auch zu ihrem Grab.
Meg
Es begann mit einem Schaukeln, gar nicht mal stark, eher angenehm. Ein Gefühl, als würde sie von Engeln gewiegt. Doch das Schaukeln wurde schnell stärker, und eine gewaltige Hand fasste sie grob an und knallte ihren Kopf gegen die Scheibe, während ihr Körper in die Gegenrichtung gerissen wurde. Hart schlug sie auf dem Boden auf.
»Auu! Shit.«
Mit einem Mal war sie hellwach, und ihr Herz raste.
»Scheiße, was soll das?«
Sie rieb sich den schmerzenden Ellbogen, aber ihr verstörter Blick fand noch keine Antwort. Ihre Augen brannten, als hätte ein böser Sandmann Straßensplitt hineingestreut. Ihr Hirn fühlte sich an wie Matsch.
Du bist aus dem Bett gefallen. Aber wo?
Sie richtete sich auf. Das, woraus sie gefallen war, war jedoch kein Bett, sondern eine Holzbank. Eine lange, umlaufende Bank an der Wand eines ovalen Raums. Der Raum war eine Art überdimensionierte Glaskugel und schaukelte hin und her. Draußen, hinter der Scheibe, nichts als grauer Himmel und Schneegestöber. Ihr wurde übel, aber das verdrängte sie.
Sie war auch nicht allein. Auf der langen Bank saßen noch andere. Fünf insgesamt. Und alle waren gleich angezogen, trugen den gleichen blauen Schneeanzug, saßen alle zusammen in diesem kleinen Raum, der von Windböen geschüttelt wurde – und allmählich zuschneite.
Quatsch, das ist kein Raum. Räume bewegen sich nicht, Dummie.
Sie stieß sich mit Händen ab und stand auf, so gut es ging. Ihre Knie wollten sie erst nicht tragen. Außerdem stieß erneut Übelkeit in ihr auf. Ich muss das in den Griff kriegen, dachte sie. Wohin sollte sie sich in dem engen Raum, der kein Raum war, auch übergeben? Auf wackligen Knien wankte sie an das gegenüberliegende Fenster, stützte sich mit beiden Armen ab und presste die Nase an die Scheibe wie ein kleines Kind, das im Winter den ersten Schnee erblickt. Unten – aber wirklich ganz weit unten – erstreckten sich die schneebedeckten Wipfel eines Waldes, und über ihr stürzten in einem irren Wirbel Massen von Schnee aus dem grauen Himmel.
»Fuck«, murmelte sie.
Abermals geriet der ganze Raum in Bewegung. Jenseits der dicken Verglasung heulte der Wind wie ein hungriges Tier hinter Käfigstäben. Immer wieder wurde die Scheibe von Salven von Nassschnee getroffen, die ihr jede Sicht nahmen. Allerdings hatte Meg genug gesehen.
Hinter sich hörte sie jemanden stöhnen. Eine weitere Gestalt in blauer Einheitskluft erwachte aus der Bewusstlosigkeit und schälte sich aus der Kapuze wie eine hässliche Raupe. Ob Mann oder Frau war noch nicht ganz klar. Auch in die anderen Gestalten kehrte langsam das Leben zurück. Trotzdem zuckte in ihr die wahnwitzige Vorstellung auf, dass sie jeden Moment in die halb verwesten Gesichter von Untoten blicken könnte.
Doch der Mann (Mitte dreißig, Vollbart) glotzte sie nur benommen an. Er schob die Kapuze zurück und rieb sich den stoppeligen Schädel.
»Was zum Henker war das?« Er blickte umher. »Wo bin ich?«
»In einer Seilbahn.«
»Einer was?«
»Seil. Bahn. Kennen Sie doch: Das sind so Gondeln, die an einem langen Stahlkabel hängen.«
Er sah sie feindselig an. »Ich weiß, was eine Seilbahn ist. Ich wüsste nur gerne, was ich hier mache.«
Meg blickte neutral zurück. »Kann ich Ihnen nicht sagen. Wie sind Sie denn hierhergekommen?«
»Keine Ahnung. Und du?«
»Weiß ich auch nicht.«
»Das Letzte, woran ich mich erinnere …« Seine Augen weiteten sich, als er das sagte. »Gehörst du nicht zu der Gruppe, die ins Retreat sollte?«
Retreat klang erst einmal unverfänglich nach Wellness-Urlaub und Wohlfühloase – was wohl auch beabsichtigt war. Doch Meg verband nichts Angenehmes mit dem Ort, im Gegenteil, für sie wohnte dort der Horror. Kein Wort, das unpassender war als Retreat.
Sie antwortete nicht, sondern starrte weiter nach draußen.
»Jedenfalls fahren wir erst einmal nirgendwohin.«
Beide starrten sie jetzt in das graue Nichts, das allmählich hinter den nassen Placken aus Schnee verschwand. Dass der Schneesturm so schlimm würde, hatte wirklich niemand geahnt.
»Wir stecken fest.«
»Was? Sag das noch mal.«
Meg wandte sich um, denn die Frage kam von einer Frau hinter ihr, die nicht älter sein konnte als sie selber. Sie hatte rote Haare und etwas Schrilles in der Stimme, ihre Miene war panisch. Erstaunlich, wie sehr die Angst ein Gesicht verzerren konnte. Die Frau würde noch Probleme machen, das deutete sich jetzt schon an.
Meg antwortete nicht gleich, sondern checkte die anderen in der Gondel. Einer lag noch im Tiefschlaf, die Kapuze tief ins Gesicht gezogen. Manche Leute kriegst du mit nichts wach. Die beiden anderen (ein kleiner Dicker mit dunklem Lockenkopf und ein älterer grauhaariger Herr mit Brille) waren soeben erwacht. Sie streckten sich und blickten einigermaßen verwirrt in die Runde. Zumindest blieben sie ruhig, das war schon einmal gut.
»Wir stecken fest« wiederholte Meg für die Rothaarige. »Wahrscheinlich ein Stromausfall.«
»Stromausfall? Na toll, das hat uns noch gefehlt.«
»Es geht sicher gleich weiter.« Dies kam von dem Mann mit Vollbart. Seine anfängliche Aggressivität hatte sich aufgelöst. Er lächelte der Rothaarigen sogar aufmunternd zu. »Keine Sorge, alles wird gut.«
Das war glatt gelogen. Denn selbst wenn es irgendwann weiterging und sie wohlbehalten das Retreat erreichten, selbst dann war noch längst nicht alles gut. Aber Lügen waren der Schmierstoff des Lebens. Die Rothaarige jedenfalls war fürs Erste beruhigt und revanchierte sich ihrerseits mit einem Lächeln. Problem gelöst.
»Sagten Sie Seilbahn?«, fragte der ältere Herr. »Soweit ich weiß, war von einer Seilbahn nicht die Rede.«
»Okay, weiß irgendjemand Genaueres?«, fragte Meg mit Blick in die Runde.
Alle sahen sich an.
»Zuletzt waren wir auf unserem Zimmer.«
»Dann brachten sie uns das Frühstück – aufs Zimmer.«
»… das übrigens ungenießbar war.«
»Danach bin ich irgendwie wieder eingeschlafen.«
Die Verwirrung unter den Passagieren nahm eher zu als ab.
»Okay, erinnert sich irgendjemand, was danach geschah?«, fragte Meg. »Ich meine bis zu dem Moment, in dem wir hier aufgewacht sind?«
Allgemeines Kopfschütteln.
»Sieht ganz so aus, als hätten sie uns unter Drogen gesetzt«, seufzte der Bärtige.
»Jetzt seien Sie nicht albern«, sagte die Rothaarige. »Warum sollten sie das tun?«
»Na ja, damit wir nicht mitkriegen, wohin die Reise geht und wie wir in diese Seilbahn gekommen sind«, sagte der kleine Dicke.
»Ach Unsinn. Ich kann nicht glauben, dass die da so etwas tun würden.«
Das ist witzig, dachte Meg. Selbst in einer Lage, die eigentlich keinen Zweifel ließ, wollen die Leute »denen da« nichts unterstellen. Im Auge des Blizzards war der Sturm eben kaum wahrnehmbar.
»Na gut«, sagte der Bärtige. »Da wir vermutlich noch länger zusammenhocken werden, schlage ich vor, dass wir uns erst einmal vorstellen. Also, ich heiße Sean.«
»Meg«, sagte Meg.
»Sarah«, sagte die Rothaarige.
»Karl«, sagte der kleine Dicke und hob kurz die Hand.
»Angenehm, Max«, sagte der ältere Herr und lächelte.
»Ich nehme an, wir sind alle aus demselben Grund hier«, bemerkte Sean.
»Wir sollen doch nicht darüber sprechen!«, entgegnete Sarah.
»Ich denke, nach Lage der Dinge können wir mal eine Ausnahme machen.«
»Die Ausnahme beseitigt die Regel.«
Meg blickte auf Sarah. »Komisch, mein Chef hat das auch immer gesagt.«
»Echt?«
»Ja. Ging einem tierisch auf den Nerv mit dem Spruch.«
Sarah kräuselte die Lippen, und Max schaltete sich ein. »Apropos, was habt ihr denn vorher gemacht? Beruflich, meine ich.«
»Ich war Lehrerin«, erklärte Sarah.
Quelle surprise, dachte Meg.
»Ich war Anwalt«, sagte Max und hob wie entschuldigend die Hände. »Okay, ich weiß, was ihr jetzt denkt, und ihr dürft mich auch gerne verklagen.«
»Ich war in der Hüpfburg-Branche«, sagte Karl.
Die anderen blickten ihn an – und brachen im nächsten Moment in Lachen aus. Eine nervöse Überreaktion, die keine wirkliche Entlastung brachte.
»Hey«, erklärte Karl etwas beleidigt, »mit Hüpfburgen ist gutes Geld zu verdienen. Zumindest früher einmal.«
»Und was machst du so?« Megs Frage ging an Sean.
»Ich? Ach, dies und das. Ich hatte schon alle möglichen Jobs.«
Ein Windstoß versetzte die Gondel in eine stärkere Pendelbewegung.
»O Gott«, sagte Sarah und fasste sich an den Hals. Sie trug einen kleinen silbernen Kreuzanhänger, wie Meg missfällig feststellte. Gleichzeitig fragte sie sich, was diese Frau ihr eigentlich getan hatte.
»Wir sind also ein ziemlich bunter Haufen«, sagte Max.
»Und Regel hin oder her, man kann wohl sagen, dass wir alle auf dem Weg ins Retreat waren. Ist doch so, oder?«, bemerkte Karl und hob dabei die buschigen Brauen.
Zögernd und nacheinander nickten jetzt alle.
»Als Freiwillige?«
Abermals Nicken. Ins Retreat gingen überhaupt nur zwei Sorten Mensch, Freiwillige und solche, die keine andere Wahl hatten.
»Heißt das, dass wir uns jetzt zu unseren Beweggründen einlassen müssen?«, fragte Max. »Oder sparen wir uns das für unseren ersten Abend im Retreat auf?«
»Falls wir je dort ankommen«, sagte Sarah und warf einen furchtsamen Blick auf das Stahlkabel im Schneesturm.
Sean hingegen lenkte die Aufmerksamkeit auf den Schlafenden in der Ecke. »Was meint ihr? Wollen wir ihn hier nicht langsam von den Toten erwecken?«
Meg zog ein Gesicht, stand aber auf, trat an die liegende Gestalt heran und schüttelte vorsichtig die fremde Schulter. Der Mann kippte seitwärts von der Bank und schlug dumpf auf dem Boden auf.
Sarah, die sich hinter Meg befand, schrie laut auf.
Im selben Moment waren ihr gleich zwei Dinge klar. Erstens: Sie kannte diesen Mann. Und zweitens: Er war tatsächlich tot.
Carter
»Draußen zieht ein Sturm auf.«
Carter ächzte und wälzte sich auf dem Sofa auf die andere Seite. Er kannte diese Stimme. Das war Caren. Caren mit C, wie sie ihm bereits bei ihrer allerersten Begegnung mitgeteilt hatte. Als machte das den großen Unterschied. Oder als müsste er ihr demnächst eine beschissene Weihnachtskarte schicken.
»Carter, nur zu deiner Information: Ein Hangover befreit dich nicht vom Einkaufsdienst.«
Carens Ton war forsch. So klang sie immer: forsch. Nur mit Mühe gelang es ihm, ein einzelnes Lid aufzuklappen und sie – halbwegs – zu fokussieren. Genauso hatte er sich das vorgestellt: Caren in Laufhose und Laufweste, die Haare straff zu einem Pferdeschwanz gebunden. Wollte wahrscheinlich gerade ins Fitnessstudio. Carter machte die Augen wieder zu und vergrub sein Gesicht in dem muffigen Sofakissen.
Aber Caren war noch nicht fertig, die akustische Bedonnerung seines schmerzenden Hirns ging weiter. »Vergiss nicht, wir brauchen ausreichend Vorräte. Falls wir durch den Schnee wieder von der Außenwelt abgeschnitten sind.«
Dann hörte er, wie die Kühlschranktür erst auf- und dann wieder zuging, gefolgt vom Hackgeräusch eines Messers und dem Jaulen der Küchenmaschine. Schließlich wurde etwas Hartes, Gläsernes unmittelbar neben ihm auf das Beistelltischchen geknallt.
»Trink das. Tut dir gut.«
Aus der Deckung des Kissens heraus linste Carter halb schräg nach oben. Auf dem Tischchen neben ihm stand ein Glas mit einer rötlichen Flüssigkeit.
»Was ist das? Eine Bloody Mary?«
Caren hob eine Braue und marschierte ostentativ zur Tür. Carter brachte sich in eine sitzende Position, griff nach dem Glas und nahm einen großen Schluck.
»Himmelherrgott!!«
Sein ganzer Mundraum stand in Flammen. Hölle, wie das brannte! Er sprang hoch und rannte zur Spüle, wo er das rote Zeug ausspuckte, das kalte Wasser aufdrehte und seinen Mund direkt unter den Hahn hielt. Gierig soff er an der eiskalten Quelle und klatschte sich das Wasser sogar ins Gesicht. Am Ende stand er wie begossen auf dem Fliesenboden und war endlich in dem neuen Tag angekommen.
Er wandte sich um. Von hinten, von der Tür aus beobachtete ihn Caren. Sie hatte die Arme vor der Brust verschränkt und grinste hämisch.
»Du hast gesagt, das Zeug tut mir gut.«
Schulterzucken. »Stimmt doch auch. Jetzt bist du wenigstens wach.«
Als er geduscht und sich rasiert hatte, fühlte er sich langsam wieder wie ein Mensch. Was ein Blick in den Spiegel so nicht bestätigen konnte.
Die Leute im Ort hatten sich längst an Carter gewöhnt und schraken bei seinem Anblick nicht mehr unwillkürlich zurück. Offenbar vergaßen sie schnell, wie er früher einmal ausgesehen hatte.
Seine gesamte rechte Gesichtshälfte war durch Erfrierungen dritten Grades weithin verwüstet. Die Wange, ein Großteil der Stirn und das Kinn waren schwarz verfärbt und abgestorben. In der Mitte, dort, wo einmal die Nase gewesen war, klaffte ein dunkles Loch, und die Lippen zogen sich unnatürlich nach der geschädigten Seite, weil dort der betreffende Gesichtsmuskel zerstört worden war. Intakt geblieben waren nur seine blitzenden blauen Augen. Ihr fester Blick erinnerte als Einziges daran, was dieser Mann einst gewesen war.
Carter gab sich alle Mühe, seinem alten Äußeren nicht nachzuweinen. Er war ohnehin nie sonderlich attraktiv gewesen und schon in jungen Jahren zu dick. Aber auch später wurden seine Züge nicht gefälliger. Nur konnte es passieren, dass er gegen Morgen aus einem Traum erwachte, in dem sein Gesicht noch unversehrt war. Etwas grob vielleicht, aber wenigstens ein Gesicht. Traf ihn dann die Erkenntnis, dass der Traum ausgeträumt und sein Gesicht geradezu ausradiert war, konnte es passieren, dass sich sein Kissen mit Tränen tränkte. Dabei war er alles andere als wehleidig und nicht im Mindesten eitel. Nur eine Nase hätte er gerne noch gehabt. Manchmal sind es eben die scheinbar kleinen Dinge, die einen am tiefsten runterziehen.
Er schlurfte nach unten in den großen Wohnbereich, wo schon Nate, Miles und Julia abhingen und Kaffee tranken. Das Monopoly-Brett auf dem großen Wohnzimmertisch hielt den letzten Spielstand fest. Nate beherrschte (mal wieder) den Immobilienmarkt, und Julia drehte sich einen Spliff, worüber sich Caren (mal wieder) aufregen würde, wenn sie später vom Training zurückkehrte.
Der Rest der Gruppe, bestehend aus Jackson und Welland, war gerade nicht da. Jackson absolvierte vermutlich gerade sein Meditations- oder Yogaprogramm, während Welland (mit etwas Glück) nur in einer Schneewehe steckte.
Sie waren ein bunter Haufen hier im Retreat, zusammengeschmissen von den Mächten Zufall und Notwendigkeit. Und trotzdem schafften sie es, miteinander auszukommen, ohne sich gegenseitig an die Gurgel zu gehen. Meistens jedenfalls.
Zum Glück war das Retreat großzügig ausgelegt und mit allen Annehmlichkeiten ausgestattet. Selbst im Wohnbereich mit seinem Hochglanzparkett, den anheimelnd zerschlissenen Teppichen und Ledersofas konnte man sich gut aus dem Weg gehen. Außerdem gab es da einen riesigen Flachbildschirm, DVD-Player, Spielkonsolen, eine Stereoanlage sowie in dem Regal dahinter eine umfangreiche CD-Sammlung, allerlei zerlesene Romane und Gesellschaftsspiele. Ähnlich sah es in der Küche aus. Alles hypermodern und vom Feinsten, vom amerikanischen Supersize-Kühlschrank bis hin zur granitgefassten Kochinsel mit Platz für eine ganze Kochshow.
Die Gäste im Retreat wurden durchweg gut versorgt.
Meistens jedenfalls.
Nate blickte hoch, als Carter den Raum betrat: »Digga, siehst du wieder scheiße aus!«
»Mir ist klar, dass dich meine Schönheit verunsichert.«
Nate warf ihm eine Kusshand zu. »Nein, ohne Scherz, man muss dich einfach lieben: so teuer, wie du deinen Arsch verkaufst.«
»Jetzt machst du mich aber verlegen.«
Nate grinste. Selbst in verkatertem Zustand war er ganz der coole Surfer mit seinen sonnengebleichten Haaren, den glatten, gut definierten Oberarmen, der Bandana. Nach gängigen Maßstäben wäre jemand wie Nate für Carter zwar das Feindbild schlechthin gewesen, doch irgendwie waren sie im Verlauf der letzten drei Jahre Freunde geworden.
»Wann seid ihr beiden eigentlich ins Bett gekommen?«, fragte Julia, schob sich einen einzelnen dunklen Strang ihrer Dreads hinters Ohr und platzierte vorsichtig einen Filter in den Knick des Blättchens.
Julia, die Dünne mit den Tattoos, kam aus Kalifornien, war in einer Kommune aufgewachsen und verhielt sich noch immer so, als sei ein Protestcamp eher ihr Ding. Das Retreat war ganz offenkundig nicht die ideale Umgebung für ihren Kampf gegen das Schweinesystem.
Carter verzog das Gesicht, was sogleich wieder wehtat. »Paar Stunden, nachdem du aufgestanden bist.«
Miles hob eine Braue. Er zeigte keinerlei Symptome einer Alkoholvergiftung, sondern sah proper aus wie immer in Poloshirt und Chinos. Gehobene Leisurewear, wie gemacht für eine gepflegte Bootstour auf der Themse.
»Ja nun, einen Tick später war es zugegebenermaßen schon«, erklärte er mit dem Timbre des perfekten Gentlemans. »Aber da hattest du vermutlich schon einen Filmriss, Carter.«
»Ist eben mein bevorzugter Partygag.«
»Du meinst, wenn du nicht mehr Herr deiner Sinne bist?«, fragte Miles.
»Manche Leute stecken sich eine brennende Zigarre in den Arsch, ich gönne mir einen Filmriss.«
»Aber das machen sie nicht wirklich, das mit der Zigarre?«, fragte Julia.
»O doch. Hab ich mit eigenen Augen gesehen.«
Nate gluckste. »Echt, Leute, warum tun wir uns das an?«
»Weil es nichts anderes zu tun gibt?«, mutmaßte Julia.
Da nickten sie alle und grinsten. Die Wahrheit schmerzte, aber komisch war es trotzdem, irgendwie.
Und natürlich stimmte es nicht ganz. Im Retreat gab es reichlich zu tun, siehe die verschiedenen Putz-, Koch- und Hauswirtschaftsdienste, anders hätte so eine Einrichtung auch nicht funktioniert. Damit der Laden lief, hatte jeder seine Aufgaben, dafür sorgte schon Miles. Hinzu kamen die Freizeitanlagen: Gym, Pool, die Skipisten, all das wollte gewartet sein. Und nicht zu vergessen: die Einkaufstour.
Carter trat an die Korktafel in der Küche und sah nach. Na klar, er war dran, schon wieder! Irgendwie verging die Zeit hier anders als im Rest der Welt.
Einkaufen mochte er gar nicht. Nicht zuletzt, weil es mit Einkaufen im strengen Sinn wenig zu tun hatte. Kurz in den Laden an der Ecke und fertig – sorry, das reichte nicht. Einkaufen für das Retreat war Skiwandern in einem Gebiet, das mit schwarzen Rauten nur so gespickt war. Es begann mit der Abfahrt hinunter ins Dorf, über tückische Hänge, die Carters Fähigkeiten weit überstiegen. Und endete mit ihm als Muli, das den voluminösen, auf die Skier geschnallten Transportsack mit dem ganzen Zeug mühevoll bergauf zu ziehen hatte.
Aber Carter war auch eindeutig der schlechteste Skifahrer in der Gruppe. Anders als die anderen hatte er als Kind nie »Wintersport« oder »Skiurlaub« gemacht. Was es maximal gab, als er klein war: eine vereiste Abraumhalde, auf der er mit seiner Schwester hinunterbretterte. Auf einer alten Kühlerhaube statt eines Schlittens.
Die ganze Tour war äußerst langwierig. Und gefährlich. Und da waren die unerwünschten Begegnungen mit Wildtieren noch nicht mal mit drin.
Er merkte, wie sich das Pochen in seinem Kopf zurückmeldete.
»Muss es denn unbedingt heute sein? Ich meine, wir haben noch jede Menge an …«
»Auf gar keinen Fall!« Julia schüttelte entschieden den Kopf. »Du kennst die Regeln.«
Was zutraf. Er kannte sie nun wirklich.
»Julia hat recht«, erklärte Miles auf seine irritierend sachliche Art. »So, wie es aussieht, steht uns der nächste Wintersturm ins Haus. Lange kann es nicht mehr dauern.«
Carter blickte durch das große Panoramafenster nach draußen. Dieses Fenster erstreckte sich fast über die ganze Front des Gebäudes und bot einen atemberaubenden Blick über Kiefernwälder, schneebedeckte Hänge und den dramatisch zerklüfteten Gebirgskamm im Hintergrund.
Es war jedoch so, dass selbst dieses Szenario nach einer Weile kaum Ehrfurcht gebietender war als eine Fototapete. Eigentlich nahm man es gar nicht mehr wahr.
Im Übrigen sprach Miles nur aus, was jeder sehen konnte. Schon jetzt blies ein herrischer Wind den Schnee zu wechselnden Schraffuren, und die dunkle Wolke über dem Horizont bedeutete ebenfalls nichts Gutes. Bedeutete, je nach Schwere des Sturms, dass sie hier tage-, vielleicht wochenlang isoliert waren.
Auch Nate sagte jetzt: »Tut mir leid, Digga, aber du musst. Da draußen geht bald die Welt unter.«
Wie aufs Stichwort flog unten die Eingangstür auf und ließ eine eisige Bö bis hinauf ins Obergeschoss und den Wohnbereich hinein. Kurz darauf trampelten schwere Stiefel die Wendeltreppe hoch.
»Herrschaftszeiten! Was für ein Kackwetter!«
Das war Welland, der übergewichtige, aknezerkraterte Welland. Mit fünfundzwanzig war er der Jüngste in der Gruppe, aber wegen seines technischen Sachverstands so etwas wie der Hausmeister im Retreat. Zwar drückte er mit seinem wehleidigen Genöle systematisch auf die Stimmung, aber ohne diese Hackfresse lief auch nichts, deshalb nahmen ihn die anderen hin.
Zusammen mit Welland stürmte ein weiterer Hausgenosse in den Raum, der Terrierrüde Dexter. Dexter sprang gleich auf Carter zu und schlabberte ihn mit seiner stinkigen Zunge ab.
»Na, mein Freund, warst du spazieren?« Carter vergrub sein Gesicht in dem kalten rauen Fell und flüsterte immerhin so laut, dass alle es hören konnten: »Hast du auch schön gegen Wellands Bein gepisst? Feiiin! Braver Hund!«
»Wie steht es mit den Generatoren?«, fragte Miles.
Welland schüttelte die filzigen Locken und stampfte sich den Schnee von den Stiefeln. »So weit okay. Aber die Netzstörungen bereiten mir Kopfschmerzen. Diese Ausfälle haben eindeutig zugenommen.«
Welland schaffte es zuverlässig, aus jeder Lage das Maximum an Negativität herauszuholen.
»Kein Grund, gleich die Pferde scheu zu machen. Ich überprüfe das später noch mal.«
»War auch nicht meine Absicht, Miles. Ich meine ja nur: Sechs Sekunden sind klar zu lang. Du weißt selbst, was passiert, wenn plötzlich der Saft wegbleibt …«
»O ja, dessen bin ich mir bewusst«, sagte Miles, aber so, dass es plötzlich ganz still wurde.
Mit rotem Kopf zog sich Welland die Stiefel aus. »Scheiße, ich hab schon Frostbeulen an den Zehen«, maulte er. »Pass auf, als Nächstes werden sie schwarz und fallen ab. Hab keine Lust, rumzulaufen wie so ein Scheißzombie …« Dann fiel sein Blick auf Carter, und er schob schnell hinterher: »Ach du Scheiße, tut mir leid, Mann. Du warst nicht gemeint.«
Was gelogen war.
Worauf Carter den Hund auf dem Boden absetzte und lächelnd erwiderte: »Ist schon okay.«
Aber es war alles andere als okay.
Er hatte bloß keine Zeit, länger darüber nachzudenken, weil im selben Moment (und ganz wie von diesem notorischen Schwarzseher vorausgesagt) die Netzspannung in den Keller schnurrte und der Alarm losging.
»Verdammt«, rief Welland. »Was habe ich euch gesagt!«
Miles hob die Hand, damit jetzt nicht alle durcheinander quasselten, und starrte angestrengt auf seine Armbanduhr. Er zählte die Sekunden: Eins, zwei, drei, vier, fünf …
Ein elektrisches Signal ertönte, als der Generator die Stromversorgung übernahm und alles in den Normalbetrieb zurückkehrte. Auch der Alarm verstummte abrupt.
Nate pfiff durch die Lippen. »Gefühlt eine Ewigkeit, würde ich sagen.«
»Sechs Komma zwei Sekunden«, erklärte Miles. »In dieser Größenordnung sehe ich da noch kein Problem.«
»Und in welcher Größenordnung würde es zum Problem?«, fragte Carter.
Miles überlegte. »Alles unter acht Sekunden ist unproblematisch. Erst wenn der Stromausfall noch länger dauert, wird es schwierig.«
»Warum acht Sekunden?«, fragte Nate.
»Nun ja, im Fall einer Versorgungsunterbrechung werden auch die automatischen Schließanlagen im Haus freigestellt. Dies geschieht aber nicht sofort, sondern wegen der Restspannung in diesen Anlagen mit einer Verzögerung von bis zu acht Sekunden«, sagte Miles. »Zugleich springen – normalerweise innerhalb von vier, fünf Sekunden – die Generatoren an, sodass die Verriegelung insgesamt intakt bleibt.«
Trotzdem reichlich knapp, dachte Carter. Wenn es auf wenige Sekunden ankommt.
»Ich sehe mir die Schlösser im Keller noch einmal an«, sagte Welland. »Vielleicht sollte man auch die Gerätesteuerung neu aufsetzen. Bei einem längeren Stromausfall ist nämlich nicht gesichert, dass die …«
»Ich sagte, ich überprüfe das später«, unterbrach ihn Miles. »Reicht das, oder brauchst du eine schriftliche Bestätigung?«
Diesmal hatte selbst ein Blödmann wie Welland die Botschaft kapiert. »Nee, schon klar«, grummelte er.
Alle anderen nickten.
»Gut.«
Dann sagte Nate: »Wenn das geklärt ist, gehe ich jetzt ins Gym. Muss den Alkohol aus dem System kriegen. Hat jemand Lust mitzukommen?«
»Ich könnte einen kurzen Saunagang vertragen«, sagte Julia, sog ein letztes Mal an ihrem Spliff und drückte ihn im Aschenbecher aus. Dann verließen beide den Wohnbereich in Richtung Aufzug.
Welland jedoch blieb und schälte sich aus dem Schneeanzug. »Du solltest auch langsam los, Carter«, sagte er. »Wird aber nicht lustig, das sage ich dir gleich.«
»Sicher: Jeder ist mal dran mit Einkaufen.« Carter schnippte mit dem Finger. »Jeder bis auf einen. Du warst noch nie dran.«
»Ich kann nicht Ski laufen, das weißt du doch.«
»Ich auch nicht.«
»Außerdem habe ich Asthma.«
»Komisch, aber die Tauglichkeitsprüfung für einen Job im Hochgebirge hast du geschafft? Wie geht das?«
»Zumindest bin ich hier nicht einfach so reingeschneit wie ein hergelaufener …«
»Könnt ihr beiden euren Ehestreit nicht woanders austragen?«, schnappte Miles. »Ach, Carter, dich muss ich noch sprechen, bevor du aufbrichst.«
»Wieso, was ist denn los?«
Miles warf Welland einen missbilligenden Blick zu, denn der hatte seine nassen Klamotten einfach auf dem Boden liegen lassen und kramte in den Küchenschränken nach etwas Essbarem.
Miles stand auf und ging zum Aufzug. »Komm mit«, sagte er zu Carter.
Carter seufzte. »Okay.«
Wobei er auf dem Weg zum Aufzug extra nah an Welland vorbeiging und raunte: »Du Scheißkerl hast nie im Leben Asthma.«
Die Aufzugtüren öffneten sich, und sie traten hinein. Miles hielt seinen Zugangspass auf das Feld B des Lesegeräts, und der Aufzug glitt nahezu geräuschlos in die Tiefe.
Das Retreat war ein viergeschossiges Gebäude, das direkt in den Felsen gebaut war. Wohnbereich, Küche und Gym waren im ersten Obergeschoss, im zweiten lagen die beiden Schlafsäle sowie zwölf Einzelzimmer für das Personal. Im Erdgeschoss befanden sich nicht nur die große Eingangshalle, sondern auch das Gym und die Saunalandschaft sowie diverse Technik- und Vorratsräume.
Der Keller hingegen war Sperrzone, nur Miles und ein paar Auserwählte hatten Zugang zum Allerheiligsten.
Wie jetzt. Die Aufzugtüren glitten auf, und die beiden Männer traten in einen hell erleuchteten Gang, der bei Carter Gänsehaut verursachte. Das lag weniger an der niedrigen Raumtemperatur, als an der mit Bewegungssensoren ausgerüsteten Deckenbeleuchtung, welche die vorausliegende Strecke immer nur ausschnittweise der Dunkelheit entriss. Was er erkennen konnte, waren einzelne Türen, die offenbar zu stillgelegten Büroräumen führten. Vor einer, der dritten, zückte Miles abermals seinen Zugangspass, und sie waren am Ziel.
An der rechten Wand mehrere Computerarbeitsplätze, links eine Reihe Edelstahlschränke mit flachen Schubladen.
»Also: Worum geht es?«, fragte Carter so beiläufig wie möglich.
Miles musterte ihn mit einer Kälte, die Carter selbst bei Leichen selten erlebt hatte.
»Jemand stiehlt hier Medikamente.«
»Was?«
Miles zog eine Edelstahlschublade auf, darin ganze Klinikgebinde von Antibiotika und starken Schmerzmitteln.
»Sieht aber nicht so aus, als ob hier was fehlt«, sagte Carter.
Miles nahm eine Schachtel aus der unteren Lage, machte sie auf und hielt sie umgekehrt in die Höhe. Sie war leer.
»Meiner Schätzung nach ist etwa jede zweite Einheit in irgendeiner Weise manipuliert.«
»Und was ist mit den anderen in den …« Er deutete mit dem Kopf auf den hohen Kühlschrank.
»Äußerlich ist zwar alles da, deshalb habe ich ein paar zufällig ausgewählte Injektionsfläschchen getestet.«
»Und?«
»Mehrere enthielten lediglich ein Placebo.«
»Das heißt kein echtes Plasma?«
»Genau, nur Wasser.«
Etwas schnürte Carter die Luft ab, und die nächste Frage war eigentlich überflüssig.
»Aber wie ist so etwas möglich? Du hast die einzige Karte für den Keller.«
»Zumindest die einzige, von der wir wissen.«
Auch wieder wahr.
»Aber das ist noch nicht alles«, sagte Miles.
»Wie, da kommt noch mehr?«
»Jackson ist weg.«
Carter starrte ihn an. »Was!? Bist du sicher?«
»Er war gestern Abend nicht in seinem Zimmer, und ich kann ihn auch sonst nirgendwo finden.«
Carter überlegte. Er kannte Jackson eigentlich gar nicht. Oder zumindest nicht so wie die anderen hier. Stiller Mensch Anfang dreißig, der Fleisch und Alkohol ablehnte, sich überwiegend mit Yoga und Meditation beschäftigte und deshalb meist für sich blieb. Carter war noch kein einziges Mal mit ihm aneinandergeraten, aber das war wenig verwunderlich, denn wo nichts ist, gibt es auch keine Konflikte. Soweit es Carter betraf, war der Mann ein Geist.
»Meinst du, er hat das Zeug gestohlen und sich abgesetzt, bevor man ihm dahinterkommt?«
»Möglich. Aber wohin?«
Gute Frage, denn es gab ja nur das Dorf im Tal. Der kleine Flugplatz lag eine Autostunde entfernt und war nur über eine schmale, gewundene Nebenstraße erreichbar. Und woher wollte Jackson überhaupt ein Fahrzeug bekommen? Blieb noch die Seilbahn, aber auch das erschien wenig plausibel.
»Vielleicht alles nur blinder Alarm«, sagte Carter. »Vielleicht ist er nur … spazieren gegangen. Oder auf einer Winterwanderung oder so was.«
Allein Miles’ Blick vernichtete den Einwand. »Ohne seinen Schneeanzug?«
Stimmt, daran hatte Carter nicht gedacht.
»Die ganz Sache bleibt vorerst strikt unter uns«, sagte Miles. »Sollte Jackson etwas zugestoßen sein, geht die Moral endgültig vor die Hunde, vor allem nach der unerfreulichen Sache mit Anya.«
Unerfreulich, so konnte man es auch nennen. Carter schluckte. »Und was, wenn er vorher gefunden wird?«
Miles spitzte heikel die Lippen, und Carter hatte plötzlich einen Kloß im Hals.
»Dann ist er ein toter Mann.«
Hannah
Die Überlebenden versammelten sich im Heck des Busses.
Die Toten lagen überwiegend im vorderen Teil.
Hannah hatte sich von ihrem Zustand persönlich überzeugt, das heißt, sie hatte sie untersucht und ihren Tod festgestellt. Fünf junge Menschen beiderlei Geschlechts, die ihren nächsten Geburtstag nicht erleben würden. Für sie kam der Tod gewaltsam und gänzlich unerwartet. Aber unerwartet und gewaltsam kam er häufig, besonders in diesem Alter. Trotzdem waren die, die im vorderen Teil des Busses lagen, keine schönen Leichen. Leichen waren überhaupt selten schön.
In gewisser Weise war es ein Segen, dass sich die meisten im Bus nicht oder nur oberflächlich kannten. Abgesehen von dem jungen Mann mit der schwer verletzten Schwester gab es niemanden, der um irgendwen weinte. Im Gegenzug – dies war die schlechte Nachricht – hatte auch niemand Grund, irgendwem zu helfen. Vielmehr lautete das Gebot der Stunde: Rette sich, wer kann. Genau das könnte noch zum Problem werden. Vorerst jedoch wurde es von einem anderen, noch größeren Problem verdrängt, und Hannah sah sich außerstande, die Grundsatzdebatte zu eröffnen. Noch nicht.
Außer ihr, dem blonden Deutschen und dem Geschwisterpaar gab es drei weitere Überlebende: einen athletischen jungen Mann mit dunklen Haaren, ein zierliches junges Mädchen mit kurzen braunen Haaren und Brille sowie einen schlaksigen Jungen mit Pferdeschwanz und Gesichtspiercings – derselbe, der vorher gekotzt hatte. Die drei redeten miteinander.
»Und wie kommen wir jetzt hier raus?«
»Hast du mal nach draußen geguckt? Draußen erfrieren wir nur.«
»Aber hier drin sterben wir auch.«
»Und was sollen wir jetzt tun?«
»Ich kapier immer noch nicht, wie sie uns die Handys abnehmen konnten.«
»Und ich kapier nicht, warum nicht wenigstens einer sein Handy an Bord geschmuggelt hat.«
»Wie lange es wohl dauert, bis Hilfe kommt?«
»Ich meine, sie können uns doch nicht die ganze Nacht mit den toten Leuten allein lassen.«
Hannah hätte ihnen sagen können, dass die Toten derzeit ihr geringstes Problem waren. Im Gegensatz zu der Kälte, die sich bald bemerkbar machen dürfte. Schon jetzt war es nicht allzu warm. Die Daunenjacken und Jeans, die sie am Leib trugen, waren für eine Fahrt im beheizten Bus gedacht und kein Ersatz für Schneeoveralls. Mit jeder Stunde, die verging, wuchs die Gefahr einer Unterkühlung.
Was ebenfalls fehlte: Verpflegung. Zwar hatten sie von der Academy Lunchpakete erhalten und etwas Wasser, aber auch das war nur Reiseproviant – und musste nun viel länger reichen. Immerhin gab es eine Toilette, die trotz der starken Schlagseite des Busses wohl benutzbar war. Wenigstens für dieses menschliche Bedürfnis war also gesorgt, vorerst jedenfalls.
Unterdessen schneite der Bus weiter zu. Nicht mehr lang und ihnen war nicht nur die freie Sicht nach draußen genommen, sondern der Bus war auch umgekehrt von der Straße nahezu unsichtbar. Aber wer weiß, vielleicht hörte der Sturm ja bald auf, dann hatten sie gleich mehr Möglichkeiten. Und was, wenn er das nicht tat?
»Okay, alle mal Ruhe, bitte! Ruhe!«
Der große Blonde war aufgestanden und nahm die Studenten in den Blick. Obwohl mehr oder weniger in demselben Alter wie seine Kommilitonen, besaß er eine natürliche Autorität, welche die anderen instinktiv erkannten. Nach und nach verstummten sie.
»Zunächst einmal«, sagte er, »und um die Kommunikation unter uns zu vereinfachen, schlage ich vor, dass wir uns vorstellen. Ich bin Lucas.«
»Josh«, sagte der athletische junge Mann.
»Ben«, sagte der gepiercte Schlaks.
»Cassie«, sagte das zierliche Mädchen.
»Und ich bin Hannah«, sagte Hannah.
Sie wandte sich nach dem jungen Mann um, der seiner Schwester nicht von der Seite wich, aber jetzt hochsah.
»Daniel … und Peggy.«
»Danke«, sagte Lucas. »Okay, die Situation ist folgende: Wir können keine Hilfe rufen, und wir kommen aus dem Bus erst einmal auch nicht raus.«
»Spitze«, murmelte Ben.
»Und was ist mit dem Notausgang?«
»Lässt sich nicht öffnen«, sagte Hannah.
»Bist du sicher?«
»Du darfst es gern selbst versuchen.«
Josh stand auf, ging in den vorderen Teil des Busses, war jedoch bald wieder da.
»Stimmt. Kriegt man nicht auf.«
»Fuck«, fluchte Ben
»Und wie es aussieht, verfügen wir auch nicht über die nötigen Werkzeuge, um die Fenster einzuschlagen«, fuhr Lucas fort.
»Heißt?«
»Heißt: Nirgendwo ist mehr ein Notfall-Hammer vorhanden«, sagte Hannah.
»Alter!«, rief Ben und verdrehte die Augen. »Mehr als diesen Schrotthaufen hatten sie nicht für uns übrig?«
Eine berechtigte Frage, dachte Hannah. Der Bus war zweifellos nicht mehr der neueste. Hatte im Etat der Academy wohl auch keine Priorität, weil die meisten Studenten ohnehin in großräumigen Limousinen, wenn nicht gar per Heli auf den Berg kutschiert wurden.
»Spielt im Augenblick auch keine Rolle, da in dem Schneesturm draußen ohnehin niemand lange überleben würde.«
»Was schlägst du stattdessen vor?«, fragte Josh.
»Erst einmal Ruhe bewahren und auf Hilfe warten.«
»Und wenn keine Hilfe auftaucht?«
»Dann überlegen wir weiter. Im Übrigen gibt es vielleicht doch eine Möglichkeit, wie wir hier rauskommen. In diesem Fall sollten wir die zwei Fähigsten unter uns losschicken, um Hilfe zu holen. Zurzeit ist das aber ziemlich sinnlos, weil sie bei diesem Versuch draufgehen würden.«
»Er hat recht«, sagte Hannah. »Lieber abwarten, bis sich das Wetter beruhigt hat.«
»Und warum sollten wir auf dich hören?«, warf Cassie ein und blickte sie herausfordernd an.
Hannah entging nicht, dass sich Cassies Frage nur auf sie, Hannah, und nicht auf Lucas bezog. Dessen Führungsanspruch blieb unangetastet. Trotzdem antwortete sie so höflich und so besonnen, wie es ihr möglich war: »Weil ich schon einmal einen Survival-Lehrgang absolviert habe.«
Was so nicht stimmte. Ihr Vater hatte das, sie nicht.
»In einer Lage wie dieser«, sagte Hannah, »bleiben wir tunlichst an Ort und Stelle, zumindest bis sich der Sturm gelegt hat. Wir haben zu essen, wir haben ein Dach über dem Kopf und – ganz wichtig – wir haben uns.«
»Sollen wir uns jetzt alle ganz fest in den Arm nehmen, willst du das?«, fragte Cassie.
»Du sagst es«, entgegnete Hannah. »Denn die größte Herausforderung in den nächsten zwölf Stunden wird die Kälte sein. Das bedeutet, wir werden schon etwas zusammenrücken müssen, um den Wärmeverlust in Grenzen zu halten.«
»Meinst du, wir stecken hier so lange fest?«, fragte Ben und schien zum ersten Mal ernsthaft besorgt.
»Das ist durchaus möglich. Bei dem Sturm da draußen können auch die Rettungskräfte nicht ausrücken.«
»Aber sie schicken doch jemanden, oder?«, fragte Cassie. Diesmal war ihre Frage ausschließlich an Lucas gerichtet.
»Aber natürlich«, erwiderte Lucas und klang dabei so beruhigend, dass selbst Hannah ihm um ein Haar geglaubt hätte. »Sie treiben doch nicht diesen Aufwand, um uns in Sicherheit zu bringen, und lassen uns dann auf halber Strecke hängen.«
Das ergab Sinn. Allerdings wusste Hannah nur zu genau, dass die Academy den Aufwand hauptsächlich deswegen trieb, weil sie nicht für noch mehr Todesfälle verantwortlich sein wollte.
Als Nächstes hob Ben die Hand, was Hannah freute, bedeutete es doch, dass die Gruppe sie und Lucas als Anführer akzeptierte. Das machte gleich alles viel leichter.
»Ja?«, sagte sie.
»Sollten wir nicht mal bei den anderen checken, ob sie vielleicht ein Handy haben? Ich meine, könnte doch sein …«
»Mit den anderen meinst du die Toten?«, hakte Hannah nach.
Er sah verlegen zur Seite. »Na ja, mehr oder weniger schon. Ich meine, sie brauchen doch jetzt ihre Jacken und die Esssachen eh nicht mehr.«
Hannah blickte zu Lucas, denn der Vorschlag klang vernünftig.
Lucas sagte: »Wir sollten alle zur Verfügung stehenden Mittel einsetzen.«
»Und wer … wer guckt nach?«, fragte Josh.
»Ich mache das«, erklärte Hannah.
»Ich komme mit«, sagte Lucas.
Sie nickte, und gemeinsam gingen sie in den vorderen Teil des Busses.
»Eigentlich wollte ich dich nur mal allein sprechen«, raunte ihr Lucas dabei zu.
»Ich dich auch.«
»Okay?«
»Sag du zuerst«, entgegnete Hannah.
»Ist dir an den Toten etwas aufgefallen?«, fragte Lucas.
»Wie meinst du das?«
»Es sind ausnahmslos Studenten, oder?«
»Ja, ich denke schon.«
»Und auch die Überlebenden sind allesamt Studenten, nicht?«
»Worauf willst du hinaus?«
»Wo steckt dann der Fahrer?«
Sie starrte ihn an. Natürlich. Warum war ihr das nicht aufgefallen? Wo war der Fahrer? Hannah, du Schlafmütze! Wieder mal nicht aufgepasst. Sie blickte umher, als müsse der Fahrer jeden Moment irgendwo aufploppen. Hahaha, voll verarscht!
»Das gibt’s doch nicht«, sagte sie.
»Weißt du, wie er aussah?«, fragte Lucas.
Noch so ein Punkt. Sie hatte ihn wahrgenommen, als sie einstieg, aber ihm keine Beachtung geschenkt. Sie wusste nur, er stand vorn neben dem Bus und rauchte noch eine Zigarette. Unscheinbarer Typ, nicht allzu groß, nicht allzu kräftig, unscheinbar eben. Mehr wusste sie nicht.
»Keine Ahnung.«
»Aber du entdeckst ihn nirgends hier?«
Hannah ging sämtliche Gesichter durch. »Nein.«
»Dann bleiben nur zwei Möglichkeiten. Entweder es gibt noch einen zweiten Fluchtweg …«
»Oder?«
»Oder er ist durch den Notausstieg raus und hat anschließend die Tür verriegelt.«
»Aber warum?«
»Wüsste ich auch gern«, sagte Lucas. »Aber du wolltest mir ebenfalls etwas sagen?«
Hannah war etwas überrumpelt von dem abrupten Themenwechsel. »Also, wir haben fünf tote Studenten, richtig?«
»Korrekt.«
»Davon haben vier die erwartbaren Verletzungen von dem Unfall.«
»Und der fünfte?«
Hannah zog Lucas weiter nach vorn, wo ein junger Mann mit Kraushaar in verrenkter Position auf seinem Sitz saß. Die blutige Delle in seinem Kopf war nicht zu übersehen.
»Akut dürfte eine stumpfe Gewalteinwirkung auf den Schädel todesursächlich sein«, erklärte sie.
Lucas blickte sie beinahe belustigt an. »Okay, er kam also bei dem Crash ums Leben.«
»Ja, aber … eigentlich war sein Schicksal schon vorher besiegelt. Schau dir mal seine Augen an.«
Lucas beugte sich über den Toten, und Hannah hörte, wie er scharf die Luft einsog. Die Hornhaut des Studenten war rosa verfärbt. Ein Granatauge.
Jetzt wurde sogar Lucas blass. »Aber wir wurden doch alle getestet?«
Und die Tests waren angeblich idiotensicher und zuverlässig.
»Offenbar hat irgendjemand nicht aufgepasst«, sagte sie.
»Verdammte Scheiße. Glaubst du, er hat andere angesteckt?«
»Das werden wir erst erfahren, wenn jemand Symptome zeigt.«
»Gerade eben hast du noch allen empfohlen, zusammenzurücken.«
»Ja. Weil wir sonst alle erfrieren.«
»Und das Infektionsrisiko?«
»Müssen wir erst einmal vernachlässigen. Für Schutzmaßnahmen ist es ohnehin zu spät. Wir atmen seit Stunden dieselbe Luft und haben dieselben Gegenstände angefasst. Entweder wir haben Glück und kommen alle davon … oder eben nicht.«
Wenn sie ehrlich war, musste sie dieses Gedankenspiel selbst erst einmal sacken lassen.
»Das heißt, sogar wenn rechtzeitig Hilfe eintrifft«, sagte Lucas langsam, »sogar dann werden einige von uns sterben.«
Lucas war hochintelligent, doch selbst er hatte die Situation offenbar nicht zu Ende gedacht.
Hannah schüttelte den Kopf. »Wenn Hilfe kommt und das Department herausfindet, dass es an Bord eine Infektion gab … wird keiner von uns je das Retreat erreichen.«
Meg
Bei dem Toten handelte es sich um Sergeant Paul Parker, und sie hatte schon in der Mordkommission mit ihm zusammengearbeitet. Später wurden sie beide zur Einsatzgruppe Infektionsschutz und öffentliche Ordnung versetzt. Oder wie man intern sagte, zum »Kommando Feuer & Flamme«. Aufgabengebiet: Alles erschießen und verbrennen, was die öffentliche Ordnung gefährdete.
»Eines musst du dir merken, Hill: Sie sind nicht wie wir. Eigentlich erlösen wir sie nur von sich selbst.«
Einverstanden. Sehe ich genauso: Wir erlösen sie nur. Aber manchmal wünschte sie sich, irgendeine Macht könnte sie von den Bildern in ihrem Kopf erlösen. Sie herausschneiden wie bei einer Lobotomie. Auch Vergessen konnte eine Erlösung sein.
Doch all das tat natürlich nichts mehr zur Sache, denn das Namensschild an dem Lanyard unter dem Schneeanzug sagte eben nicht Paul Parker, sondern Mark Wilson – Security.
»Wer ist er?«, fragte Sarah. »Ist er okay?«
»Er heißt Mark Wilson«, sagte Meg und gab damit die Lüge einfach weiter. »Und er ist tot.«
Sarah hielt sich die Hand vor den Mund. »O mein Gott!«
»Wieso das denn?«, fragte Sean.
Gute Frage. Meg legte dem Toten die Hand auf die Wange. Jedoch nicht, um womöglich noch einen Minimalpuls zu erspüren, sondern seine Körpertemperatur. Die Haut war kühl, aber bislang nicht kalt und wächsern. Sie hob seinen Arm an. Auch dort war alles locker und gut beweglich, die Totenstarre hatte noch nicht eingesetzt. Die Leiche war höchstens ein paar Stunden alt, der Tod erst jung.
»Könnte es sich um eine Nebenwirkung der Drogen handeln, die uns verabreicht wurden?«, fragte Max.
Die Vermutung lag nahe. Meg kniete sich neben den Leichnam, der mit einem Schlag nur mehr Objekt war, kein Paul oder Mark oder wie immer sich dieser Körper zu Lebzeiten genannt hatte. Sie untersuchte Gesicht und Mund. Einen Mund, den sie einmal geküsst hatte, aus Begierde, aus Einsamkeit, aus Bequemlichkeit oder Verzweiflung, aber nie aus Liebe, nicht einmal ganz zu Anfang. Mag sein, Beziehungen wurden schon auf weniger gegründet. Aber das reichte eben nicht für ihr Überleben.
Jetzt klappte sie den Unterkiefer herunter und suchte in der Mundhöhle nach Erbrochenem, was auf eine Überdosis hingedeutet hätte. Der Befund war negativ. Dafür entdeckte sie Blut an den Zähnen, sie konnte es sogar riechen. Ihr Gesicht spannte sich noch weiter an, als sie daraufhin den Reißverschluss seines Schneeanzugs öffnete. Unter der Außenkleidung trug er nur weiße Skiunterwäsche – oder ursprünglich weiße. Denn jetzt war die ganze Brust dunkelrot.
»Heilige Scheiße!«, entfuhr es Karl. »Ist das etwa Blut?«
»Sieht so aus.«
Meg biss die Zähne zusammen und hob das Oberteil leicht an, das sich alles andere als bereitwillig von der Haut löste. Die Wunde befand sich direkt unterhalb des Brustbeins, etwa im Bereich der sechsten und siebten Rippe. Vermutlich war die Leber getroffen. Präzise, tödlich.
»Er wurde erstochen«, sagte sie nüchtern und wandte sich wieder den anderen zu, die wortlos auf den Toten starrten und in diesem Moment die eigene missliche Lage glatt vergaßen. Meg fragte sich, ob auch nur einer von ihnen je eine echte Leiche gesehen hatte.
Selbst im Jahr zehn des ungebremsten Grauens gab es wohl immer noch Leute, die sich von alledem abschirmen konnten. Für sie waren Tote etwas, das höchstens im Fernsehen vorkam und selbst da nur in stark verpixelter Form. Außerdem gab es nach wie vor ländliche Gebiete, in denen die Seuche kaum Spuren hinterlassen hatte. Dasselbe galt für die Gated Communities der Reichen und Superreichen. Wer nicht in den urbanen Hotspots ausharren musste, dem bot sich durchaus die Möglichkeit, das Blutbad auf den Straßen einfach auszusitzen.
»Aber warum sollte jemand so etwas tun?«, fragte Sarah mit zittriger Stimme und fasste sich an ihr Kruzifix.
Von Meg nur Achselzucken, obwohl sie dieser Drama-Queen am liebsten die Meinung gegeigt hätte. »Wer weiß? Aber wer immer es war, er wusste genau, wie man einem Menschen mit einem einzigen Stich eine tödliche Verletzung beibringt. Konnte natürlich auch reines Glück gewesen sein.«
»Du kennst dich aber aus«, sagte Sean.
»Ich war früher bei der Polizei«, erwiderte Meg.
»Ach, tatsächlich?«, sagte Karl.
»Ja, tatsächlich.«
Sie blickte in die Runde, falls jemand noch weitere Fragen hatte, was nicht der Fall war. Neuerdings hatte fast jeder eine, wie es hieß, »gebrochene Erwerbsbiografie«. Oder eine Vergangenheit, über die er lieber nicht redete.
»Weißt du, wie lange er schon tot ist?«, fragte Max. »Ich nehme an, er wurde erstochen, bevor wir kamen.«
»Oder sie haben ihn einfach hier abgelegt«, sagte Karl.
»Und keiner hat gemerkt, was mit ihm los war. Oder vielmehr nicht mehr los war. Alle dachten, er wäre am Pennen.«
Meg besah sich den Toten erneut. Hatte wirklich keiner etwas gemerkt? Oder war es allen nur egal?
»So wird es gewesen sein«, sagte sie laut. »Auf jeden Fall ist er noch nicht lange tot. Höchstens ein paar Stunden, würde ich sagen.«
»Und wenn es nicht so war?«, warf Sarah ein.
»Dann hat ihn wohl einer von uns umgelegt«, entgegnete Karl und sah dabei Meg an. »Das denkst du doch, oder?«
»Aber wir waren alle bewusstlos«, sagte Sarah.
»Augenscheinlich ja«, bemerkte Max.
Sarah riss empört die Arme hoch. »Aber das ist doch lächerlich. Von uns war es bestimmt keiner. Wir kennen ihn ja nicht mal.«
Als Meg darauf nicht reagierte, kreuzte Sarah die Arme vor der Brust, als wollte sie sagen: »Na bitte, hab ich’s doch gewusst.«
Max kratzte sich am Kinn, dann sagte er: »Wobei die Tatsache, dass er schon vorher tot war, nicht zwingend bedeutet, dass die hier anwesenden Personen als Tatbeteiligte ausscheiden.«
Sarah blickte ihn an. »Was reden Sie da?«
»Was er sagen will«, unterbrach Sean, »ist Folgendes: Nur weil der Mann nicht in der Gondel umkam, kann es trotzdem sein, dass wir ihn vorher abgestochen haben. Ist doch so, oder?«
Max blickte Meg Hilfe suchend an. »In Anbetracht der Tatsache, dass wir noch eine ganze Weile miteinander auskommen müssen, würde ich mich gern davon überzeugen, dass keiner der hier Anwesenden eine Waffe mit sich führt.«
»Wieso das denn? Uns wurde doch schon alles abgenommen«, entgegnete Sean und blickte an sich hinunter. »Ich meine, ich habe nicht einmal meine eigenen Klamotten an.«