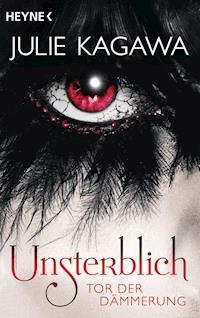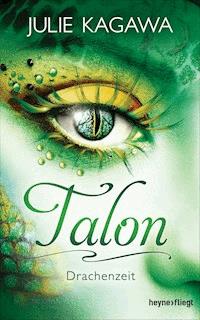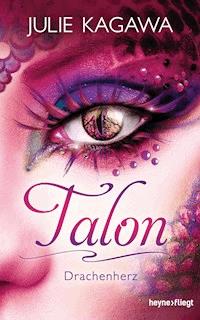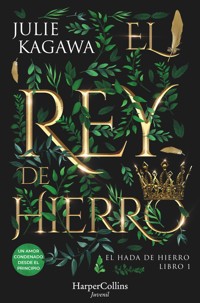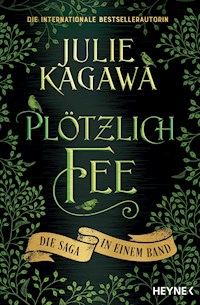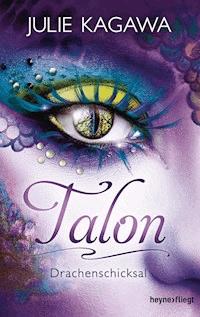
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Talon-Serie
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2018
Das mutige Drachenmädchen Ember hat sich entschieden: gegen Riley und für Garret, ihren Sankt-Georgs-Ritter. Auch wenn sie weiß, dass er nur ein kurzes Menschenleben hat und sie ihn für immer verlieren könnte. Denn der große Kampf gegen Talon steht bevor: Ember, Garret und der rebellische Riley brechen noch einmal zusammen zu einer gefährlichen Mission auf. Es gilt, die letzten mächtigen Drachen zu finden, die vielleicht bereit sind, es mit Talon aufzunehmen. Doch der Weg zu ihrem Versteck könnte die drei das Leben kosten. Und sie haben nur eine Chance, wenn sie einander bedingungslos vertrauen …
Die Stunde der Entscheidung bricht an – das Schicksal aller freien Menschen und Drachen steht auf dem Spiel.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 539
Ähnliche
JULIE KAGAWA
Talon
DRACHENSCHICKSAL
Roman
Aus dem Amerikanischen von
Sabine Thiele
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Die Originalausgabe erscheint unter dem Titel The Talon Saga Book 5: Inferno bei Harlequin Teen, Ontario
Copyright © 2018 by Julie Kagawa
Copyright © 2018 der deutschsprachigen Ausgabe by Wilhelm Heyne Verlag, München, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
Redaktion: Kristof Kurz
Umschlaggestaltung: Nele Schütz Design, München, unter Verwendung eines Motivs von © Shutterstock / Pindyurin Vasily
Satz: Christine Roithner Verlagsservice, Breitenaich
ISBN 978-3-641-17184-1V002
www.heyne-verlag.de
Das Buch
Das Drachenmädchen Ember hat sich entschieden: gegen den abtrünnigen Drachen Riley und für Garret, den Sankt-Georgs-Ritter. Auch wenn Garret nur ein kurzes Menschenleben hat und Ember ihn im Kampf gegen Talon für immer verlieren könnte, so ist er doch ihre wahre Liebe.
Ember, Garret und Riley wissen, dass die Talon-Organisation sie diesmal vernichten kann – außer es gelingt ihnen, die letzten Drachen zu finden, die mutig genug sind, gemeinsam mit ihnen zu kämpfen. Doch der Weg zu ihrem Versteck ist lang und gefährlich. Und sie haben nur eine Chance: Sie müssen einander bedingungslos vertrauen …
Embers Spiel mit dem Feuer wird das Schicksal aller freien Menschen und Drachen entscheiden ...
Die Autorin
Schon in ihrer Kindheit gehörte Julie Kagawas große Leidenschaft dem Schreiben. Nach Stationen als Buchhändlerin und Hundetrainerin machte sie ihr Interesse zum Beruf. Mit ihren Fantasy-Serien Plötzlich Fee und Plötzlich Prinz wurde sie rasch zur internationalen Bestsellerautorin. Drachenschicksal ist der fünfte und finale Band in der Talon-Saga um eine magische Liebe, die nicht sein darf. Julie Kagawa lebt mit ihrem Mann in Louisville, Kentucky.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Für Tashya.
Zusammen können wir Drachen töten.
Erster Teil
FUNKE
Ember
Ich konnte mir definitiv Schöneres vorstellen, als stundenlang durch den Dschungel zu stapfen.
Es war unglaublich heiß. Normalerweise machte mir Hitze nichts aus, aber die Feuchtigkeit unter dem Baumkronendach musste ungefähr zweihundert Prozent betragen. Ich hatte das Gefühl, unter einer feuchten, schweren Decke zu laufen und zu atmen. Meine Klamotten – das olivgraue Shirt, die Cargohose, sogar die Socken in meinen Kampfstiefeln – waren schweißdurchtränkt. Mein Haar hatte ich zurückgebunden, es hing mir trotzdem in die Augen und klebte an meiner Stirn. Insekten surrten an meinen Ohren vorbei, brummten in den Bäumen, überall um uns herum – ein ständiges, hohes Sirren, das mit dem Hintergrundlärm verschmolz, wenn man sich nicht darauf konzentrierte.
Hinter mir bewegte sich Garret wie ein Schatten, buchstäblich lautlos glitt er durchs Unterholz. Auch ohne mich umzudrehen wusste ich, dass er da war. Ich konnte ihn spüren – seinen regelmäßigen Atem, den ruhigen Herzschlag. Mittlerweile wusste ich blind, wo er war; mit jedem Tag wurde seine Präsenz – in meinen Gedanken, in der Welt um mich herum – stärker. Er machte sich Sorgen. Nicht um uns und unsere Situation, auch wenn er wie immer extrem wachsam war und unsere Umgebung ständig im Auge behielt. Doch in Gedanken war er zu Hause, beim Orden und den Menschen, die wir zurückgelassen hatten. Ich konnte es ihm nicht verübeln. Auf einem anderen Kontinent braute sich ein Krieg zusammen. In den Staaten machte Talon sich zum Schlag bereit, und auch wenn wir ihre Pläne nicht kannten, wussten wir, dass sie über eine riesige Armee aus Klonen verfügten, eine Armee aus Drachen, die für den Krieg gezüchtet waren und darauf programmiert, Befehlen bedingungslos zu gehorchen. Mithilfe dieser Drachen hatten sie schon den Orden des Heiligen Georg fast ausgelöscht und damit ihren größten Feind mit einem Schlag beinahe vollständig zerstört. Der Orden lag in Trümmern. Nun konnte Talon seine schrecklichen Pläne ohne Widersacher verfolgen. Und wo waren sie? Stapften durch den tiefsten, dunkelsten Teil des Amazonas-Regenwaldes, kämpften gegen Insekten und Kletterpflanzen und die lähmende Hitze auf der Suche nach etwas, das es gar nicht geben sollte.
Vor uns folgten Riley und unser Guide einem schmalen, sich windenden Pfad, der eigentlich nicht einmal das war, und schlugen uns mit ihren Macheten den Weg durch das Unterholz. Auch wenn der Einzelgänger es sich nicht anmerken ließ, machte er sich ebenfalls Sorgen. Garret war nicht der Einzige, der jemanden zurückgelassen hatte. Rileys Untergrundnetzwerk – die Einzelgänger und Nestlinge, die Talon hatten entkommen können – war ebenfalls in Gefahr, da die Organisation systematisch jeden Drachen eliminierte, der sich ihr nicht unterordnete. Beinahe hätte diese Reise nicht stattgefunden. Riley hatte lange gezögert, sein Untergrundversteck zu verlassen, und erst zugestimmt, als Wes und Jade ihm versichert hatten, dass sie sich in seiner Abwesenheit um die Nestlinge und Einzelgänger kümmern würden. Letztendlich hatte er sich darauf eingelassen, aber es war klar, dass er das Ganze hier schnell hinter sich bringen und wieder zu seinen Leuten zurückkehren wollte. Garret ging es genauso mit dem Orden.
Doch das hier war wichtig. Ob es uns gefiel oder nicht, wir befanden uns im Krieg mit Talon, und die Organisation war bereit, alles zu zerstören, was uns etwas bedeutete. Wir brauchten jeden verfügbaren Verbündeten, und wenn diese Spur sich als echt erweisen sollte, dann konnte uns das weiterhelfen. Nicht sehr viel, aber die Chancen wären etwas gleichmäßiger verteilt.
Der Guide, hochgewachsen, mager und wie Riley mit einer Machete bewaffnet, blieb plötzlich stehen. Der Pfad vor uns war von Schlingpflanzen und Zweigen blockiert. »Einen Moment, bitte«, sagte er und hackte auf die wuchernde Botanik ein. Riley half ihm, und zusammen arbeiteten sie sich rasch durch das Dickicht.
Nachdem ich meinen Rucksack abgenommen hatte, holte ich aus der Seitentasche eine Trinkflasche hervor. Meine Haut pulsierte vor Hitze und Feuchtigkeit. Ich trank ein paar Schlucke, dann reichte ich die Flasche an Garret weiter, der sie mit einem dankbaren Nicken entgegennahm.
»Nun …«, seufzte ich und lehnte mich gegen einen dicken, knotigen Baum, dessen dichte Blätterkronen über mir hoch in den Himmel ragten. Insekten flatterten zwischen den Ästen herum, und nur wenig Sonnenlicht schaffte es durch die Blätterdecke über uns. »So hatte ich mir mein Wochenende nicht vorgestellt.« Ich atmete tief die Luft ein, die sich wie der Dampf in einer Sauna anfühlte. »Klimaanlagen sind eine wunderbare Erfindung, Garret«, verkündete ich. »Wie haben wir das nur jemals ohne ausgehalten?«
Garret lächelte leicht, als er mir die Flasche zurückgab. Er schien sich hier wie zu Hause zu fühlen. In seinen Stiefeln und seiner Tarnjacke, das blonde Haar kurz geschnitten, sah er aus wie ein Soldat. »Ich dachte, Drachen mögen die Hitze«, sagte er mit einem Blick auf unseren Guide, der immer noch mit Riley zusammen den Weg freihackte. Ich schnaubte und beugte mich hinunter, um die Flasche wieder im Rucksack zu verstauen.
»Ja, und die meisten Menschen glauben, wir sitzen in dunklen, langweiligen Höhlen auf Goldhaufen. Das machen wir auch nicht mehr, oder? Vor allem seit wir unser Vermögen mit einem Computer verwalten können, schön gemütlich von einem Büro mit Klimaanlage aus.« Ein Moskito von der Größe meines Daumens landete hungrig auf meinem Arm, und ich schlug ihn weg. »Vielleicht hat uns das ja verweichlicht, aber ich zumindest bin froh, dass wir die Annehmlichkeiten des modernen Lebens angenommen haben. Air-Condition und ein Klo im Haus ist doch sehr viel besser, als den ganzen Tag in einer Höhle auf einem Schmuckhaufen zu hocken.«
Garret wurde ernst. »Nicht alle Drachen denken offensichtlich so.«
»Nein.« Ich schauderte leicht, als ich mich aufrichtete und den Rucksack wieder auf meine Schultern hievte. Der Dschungel schien sich um uns herum zu schließen und erinnerte mich daran, warum wir hier waren. »Ich schätze nicht.«
Riley kam schwer atmend zu uns. Er hielt sein Haar mit einem Bandana zurück, doch ein paar dunkle Strähnen klebten an seiner Stirn. Das weiße Tanktop unter seinem offenen, langärmeligen Hemd war schweißdurchtränkt. Einen winzigen Moment lang glitzerten seine Augen im Schatten der Baumkronen golden.
Wärme machte sich tief in mir breit, wie eine Kerze, die im Windzug tanzt. Der Sallith’tahn, die lebenslange Bindung zwischen zwei Drachen, der Riley – oder besser Cobalt – zu meinem Seelenverwandten gemacht hatte, meiner anderen Drachenhälfte. Doch das Band war schwächer geworden, nur noch ein leises Flackern, wo vorher ein heißes, brennendes Inferno des Verlangens geherrscht hatte. Ich hatte den Sallith’tahn gebrochen. Ich, ein Drache, hatte mich für einen anderen entschieden. Ich hatte die Liebe anstatt des Instinktes gewählt. Vermutlich würde diese Sallith’tahn-Sache nie ganz verschwinden, und Riley würde mir wahrscheinlich die Zurückweisung auch niemals verzeihen, aber im Moment waren der Krieg und die Bedrohung durch Talon wichtiger als unsere kleinen Streits und Eifersüchteleien. Wir mussten zusammenarbeiten, um zu überleben. Allein hatten wir keine Chance.
»Unser Guide sagt, wir sind fast da«, berichtete Riley und schraubte den Deckel von seiner eigenen Trinkflasche. »Noch etwa fünfundvierzig bis sechzig Minuten, seiner Einschätzung nach.« Er trank rasch ein paar Schlucke und wischte sich mit dem Hemdsärmel den Schweiß vom Gesicht. »Mann, ich habe vergessen, wie beschissen der Urwald ist. Gut, dass Wes nicht hier ist. Er würde sich nonstop beschweren. Hast du noch den Kompass, Heiliger Georg?«
»Ja.« Garret runzelte leicht die Stirn. »Warum? Wir haben doch einen Guide.«
»Nicht mehr.« Riley warf dem hageren Mann, der immer noch auf das Unterholz einhackte und uns mied, einen bösen Blick zu. »Etwa eine Meile von hier steht eine Statue, die den Weg markiert, und ab da sind wir auf uns gestellt. Er weigert sich, uns über diesen Punkt hinaus zu begleiten.«
»Er verlässt uns?«, fragte ich finster. »So war das nicht abgemacht.«
»Offensichtlich schon.« Riley schraubte verächtlich die Flasche wieder zu und hängte sie sich über die Schulter. »Er hat gesagt, er würde uns so weit bringen, wie er kann. Nun, das wäre dann wohl bis hier.«
»Warum?«
»Weil sich hinter der Statue das Territorium eines Gottes erstreckt.«
Trotz der erstickenden Hitze lief mir ein Schauder über den Rücken, und ich schluckte schwer. »Dann sind wir wohl auf dem richtigen Weg.«
»Ja.« Riley rieb sich den Hinterkopf und wirkte gleichzeitig nervös und verärgert über die eigene Nervosität. »Ich fand die Idee, einen Gott zu treffen, ja von Anfang an schlecht. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass Götter mich einfach nicht sonderlich mögen.«
»Dich?«, fragte Garret, und der Hauch eines Lächelns spielte um seine Lippen. »Mit deiner absoluten Verachtung gegenüber Autoritätspersonen? Wie kann das sein?«
»Ha, ha, lach nur, Heiliger Georg. Wir werden schon sehen, wie lustig es ist, wenn wir nur noch vom Wind verwehte Staubhaufen sind.«
Wir gingen weiter, stapften hintereinander den schmalen Pfad entlang und folgten unserem Guide in das Territorium eines Gottes.
Der Urwald wurde noch dichter, noch wilder, Äste und Schlingpflanzen griffen von allen Seiten nach uns. Unser Guide hielt plötzlich an und murmelte etwas, das ich nicht verstand. Vor uns erhob sich eine Statue aus Stein neben dem Weg, fast vollständig überwuchert von Büschen und Wurzeln. Das knurrende Antlitz einer schuppigen, gehörnten Gestalt starrte uns an.
Riley legte den Kopf zur Seite. »Hm«, meinte er. »Soll das ein Drache sein? Es sieht aus, als hätte ein Wildschwein ein Kind mit einem Alligator gezeugt.«
Ich schüttelte den Kopf. »Geht’s noch respektloser? Noch hat mich bisher kein Blitz getroffen, und ich hätte gern, dass das so bleibt.«
Der Guide drehte sich um, das Gesicht ernst im Schatten des Unterholzes. »Bis hierhin gehe ich«, sagte er. »Ihr müsst dem Weg folgen. Ich werde hier warten, bis ihr fertig seid.«
Riley runzelte die Stirn. »Hast du nicht gesagt, du würdest diesem Meister oder Gott oder was auch immer dienen?«
»Das tue ich auch. Aber ich bin nur seine Stimme außerhalb des Urwalds. Allein diejenigen, die eingeladen sind, dürfen sein Territorium unversehrt betreten. Deshalb werde ich hier auf euch warten. Wenn ihr bei Sonnenuntergang nicht zurück seid, weiß ich, dass ihr nicht mehr zurückkommen werdet. Los, geht.« Er nickte in Richtung des Pfades. »Mein Meister ist ein ungeduldiger Gott. Es wäre recht unklug, seinen Zorn auf sich zu ziehen.«
Wir kämpften uns tiefer in den Dschungel, steuerten auf das Unbekannte zu. Auf das Territorium eines Gottes.
Beinahe sofort war mir klar, dass etwas nicht stimmte. Meine Dracheninstinkte erwachten nervös, auch wenn ich nichts Ungewöhnliches sah. Doch ich spürte Blicke auf mir, jemand beobachtete uns aus dem Dickicht.
Garret gesellte sich auf dem schmalen Pfad neben mich und flüsterte mit hartem Blick: »Jemand verfolgt uns.«
»Ja«, flüsterte ich zurück. Meine Hand zuckte nach der Glock unter meinem Shirt, doch ich wollte unseren Verfolgern nicht zeigen, dass wir von ihnen wussten. »Sollen wir es Riley sagen?«
»Er weiß es bereits«, antwortete Garret und sah weiter nach vorn. Er wirkte völlig gelassen, doch ich spürte die Anspannung in ihm. Er konnte jederzeit losschlagen. »Bleib wachsam, und mach dich bereit zu handeln.«
In diesem Moment betraten wir eine Lichtung, und mehrere Gestalten lösten sich aus dem Unterholz. Sie waren groß, schlank, nur mit einem Tuch um die Lenden bekleidet, bewegten sich wie Geister. Lautlos näherten sie sich uns. Bevor wir etwas sagen konnten, hatten sie uns umringt, und ein Dutzend Speere mit Knochenspitzen waren auf unsere Herzen gerichtet.
Garret
Zwei Wochen zuvor
Ich stand in Gabriel Martins Büro und wartete auf den Lieutenant. Als er leicht humpelnd ins Zimmer kam, suchte er etwas auf seinem Schreibtisch, ließ sich schließlich mit einer schmerzverzerrten Grimasse auf den Stuhl dahinter sinken und sah mich über die Tischplatte hinweg an. Eher aus Gewohnheit stand ich ruhig in Habachtstellung da, bis er mir bedeutete, mich ebenfalls zu setzen.
»Sebastian«, begrüßte er mich, als ich mich auf dem Stuhl ihm gegenüber niedergelassen hatte. »Du kommst gerade von der Krankenstation, nicht wahr? Wie geht es St. Anthony?«
»Unverändert, Sir«, antwortete ich. Tristan St. Anthony lag seit zwei Tagen im Koma und reagierte auf nichts. Er war entweder ganz schön hart im Nehmen oder hatte verdammt viel Glück gehabt, da viele seiner schwer verletzten Brüder die erste Nacht nicht überlebt hatten.
»Sturer Bastard. Er musste ja alles verkomplizieren. Der Arzt wird mir sicher einen Vortrag halten, weil wir ihn verlegen müssen.« Martin lächelte schwach, dann schüttelte er seufzend den Kopf. »Wir brechen auf, Sebastian«, fuhr er ernst fort und sah mich dabei an. »Wir sind hier nicht sicher. Wir haben viele Verluste erlitten, unsere Verteidigung ist zusammengebrochen, und Talon weiß nach wie vor, wo wir uns befinden. Wenn sie wieder angreifen, werden wir das nicht überleben.«
»Jawohl, Sir«, antwortete ich. Ich hatte so etwas erwartet. Martin hatte recht damit, den Stützpunkt zu verlassen, die verbleibenden Soldaten zu sammeln und sich zurückziehen, um den Kampf zu einem anderen Zeitpunkt fortzusetzen. So konnten wir nicht gegen Talon bestehen. Mir gefiel die Vorstellung nicht, den Stützpunkt dem Feind zu überlassen, aber uns blieb kaum eine Wahl. »Wohin werden Sie gehen?«
»Irgendwohin, wo Talon uns nicht finden kann.« Martin seufzte. »Der Orden verfügt über einige sichere Unterkünfte im ganzen Land. Bis jetzt mussten wir noch nie darauf zurückgreifen. Mein Plan ist es, sich in eines dieser Verstecke zurückzuziehen und Kontakt mit dem Rest des Ordens aufzunehmen. Wenn jemand von den anderen Ordenshäusern überlebt hat, wird er dasselbe tun.«
»Glauben Sie, es könnte andere Überlebende geben?«
»Bei Gott, ich hoffe es«, sagte Martin. »Wir können einfach nicht die Einzigen sein, die noch übrig sind. Es muss noch andere geben – selbst eine Handvoll ist besser als niemand. Talon kann doch nicht jedes einzelne Mitglied des Georgsordens getötet haben. Was ist mit deinen Drachen?«, fragte er. »Was werden sie tun?«
»Riley plant auch, den Stützpunkt zu verlassen, Sir.« Der Einzelgänger und die anderen Drachen hatten die letzten zwei Tage in den leeren Offiziersquartieren am anderen Ende des Grundstücks verbracht. Es waren zu wenige Georgskrieger übrig, um den Drachen Ärger zu machen, doch Riley und die anderen hielten sich dennoch fern. Drachen auf dem Gelände des Heiligen Georg waren den meisten Soldaten immer noch unheimlich, und weder Martin noch Riley wollten ein Risiko eingehen. Den Soldaten war es verboten, sich zur »Drachenseite« zu begeben, und der Einzelgänger hatte seinen Leuten jeden Kontakt zum restlichen Stützpunkt untersagt. Riley selbst hielt sich von den Soldaten so weit wie möglich fern. Sein angeborenes Misstrauen gegenüber den Georgskriegern und der Wunsch, sein Untergrundnetzwerk zu schützen, ließen ihn nur zögerlich den Kontakt zu Menschen suchen, selbst zu Martin. Nur Ember bewegte sich ungezwungen zwischen den beiden Lagern und agierte als Botin zwischen den Drachen und dem Georgsorden, überbrachte Nachrichten und Informationen. Man warf ihr harte und skeptische Blicke zu, wenn sie über den Hof oder in ein Zimmer ging, doch bisher hatte es noch keine Probleme mit dem frei auf Ordensgebiet herumlaufenden Drachen gegeben.
Dass die verbleibenden Soldaten gesehen hatten, wie der rote Drache einen Gegenangriff gegen die Armee geführt hatte, die den Stützpunkt sonst völlig zerstört hätte, half natürlich. Die Männer änderten ihre Einstellung. Langsam. Man war nicht mehr offen feindselig, sondern nur noch misstrauisch. Außer Martin hatte seit ihrer Ankunft niemand mit Ember oder den anderen Drachen gesprochen, aber es hatte sie auch keiner offen bedroht oder verspottet. Mehr konnte man wohl nicht erwarten.
Leider hielten noch ein paar an ihrem alten Hass fest und fanden, der Orden solle die »Echsen« erschießen – und mich gleich dazu, solange man die Chance dazu hatte. Zum Glück besaß Martin absolute Autorität über das Westliche Ordenshaus und wurde so weit respektiert, dass man ihm selbst im Angesicht dessen gehorchte, was sonst als extreme Blasphemie gegolten hätte. Die Männer redeten natürlich trotzdem hinter seinem Rücken, wagten es aber nicht, offen zu rebellieren.
Martin rieb sich die Stirn. »Dann geh zu deinen Drachen und rede mit ihnen. Finde heraus, was sie vorhaben. Ich würde ihnen ja gerne Schutz versprechen, wenn sie mit uns kommen, aber du kennst den Orden genauso gut wie ich. Die Soldaten hier habe ich im Griff, aber wenn wir auf andere Überlebende treffen, weiß ich nicht, ob ich sie überzeugen kann – egal, was passiert ist.«
»Weshalb wir auch gehen werden. Bevor man noch auf uns schießt.«
Wir drehten uns um. Ember und Riley standen im Türrahmen und musterten uns. Der Einzelgänger wirkte grimmig, fast schon trotzig, als er Martin ansah. Ember warf ihm einen kurzen, genervten Blick zu, bevor sie sich neben mich stellte.
»Riley will damit sagen«, erklärte sie rasch, als Martins Augen sich verengten, »dass unsere Leute fast wiederhergestellt sind und wir einen sicheren Unterschlupf für sie finden sollten, bevor Talon erneut Jagd auf uns macht. Wenn sich der Orden wieder sammelt, sollten wir besser nicht hier sein, zumindest nicht am Anfang. Ich fürchte, die anderen werden nicht so … verständnisvoll sein wie Sie, Lieutenant.«
Riley grinste. »Das habe ich doch gesagt.«
Wir ignorierten ihn. »Das dachte ich mir«, antwortete Martin und nickte. »Verständlich, unter den Umständen. Wann wollt ihr uns verlassen?«
»Heute Abend«, erwiderte Ember. »In ein paar Stunden schon. Jade und den anderen Verletzten geht es gut genug, um zu reisen, weshalb wir nach Sonnenuntergang aufbrechen und die Nacht durchfahren werden. Sie müssen sich dann keine Gedanken mehr um uns machen.«
Martin dachte darüber nach und sah schließlich mich an. »Und du, Sebastian?«, fragte er, wie ich es vorausgesehen hatte. »Wirst du sie begleiten?«
Sein Tonfall war weder ärgerlich noch anklagend, mein Magen verkrampfte sich trotzdem. Ich wusste, was er eigentlich sagen wollte: Du bist ein Soldat des Heiligen Georg. Das hier ist dein Zuhause, bei den Menschen, die dich großgezogen haben. Du gehörst hierher, zu deinen Brüdern. Du gehörst zu uns.
Ich zögerte nur einen Moment, dann nickte ich. »Jawohl, Sir.«
»Und ich kann dich nicht überzeugen, dich uns anzuschließen?«, fragte Martin. »Wir könnten deine Hilfe wirklich gebrauchen, Sebastian«, fügte er rasch hinzu. »Vor allem jetzt. Dein Wissen und deine Erfahrung mit dem Feind haben uns diese Nacht überleben lassen. Und natürlich die Ankunft deiner Drachen.« Ein Mundwinkel zuckte kaum merkbar, dann wurde er wieder ernst. »Ich hätte dich gern bei uns, Sebastian. Ich kann es dir natürlich nicht befehlen, aber der Orden – oder was davon noch übrig ist – braucht jede mögliche Hilfe.«
»Es tut mir leid, Sir«, antwortete ich fest. »Aber ich werde dem Orden nicht wieder beitreten.« Ich hatte mich für eine Seite entschieden, und der Georgsorden war nicht länger mein Zuhause. Auch wenn ein kleiner Teil von mir wünschte, dass ich ihn begleiten könnte. Und sei es nur, um für die Drachen zu sprechen und den Wandel voranzutreiben. Doch meine Loyalität lag woanders, das stand zweifelsfrei fest.
»Ich verstehe.« Er seufzte wieder und nickte. »Dann pass gut auf dich auf, Sebastian. Ich weiß nicht, was der Orden jetzt tun wird oder ob es überhaupt noch einen Orden gibt. Aber …« Sein Blick zuckte zu Ember. »Ich weiß, dass sich einiges ändern wird. Ob zum Besseren oder Schlechteren, bleibt abzuwarten.« Er griff in seine Schreibtischschublade und holte ein Wegwerfhandy heraus, das er mir reichte. »Hier«, sagte er. »Es ist nur eine Nummer eingespeichert. Darüber kannst du mich jederzeit kontaktieren. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass sich unsere Wege noch einmal kreuzen werden.«
Bevor ich etwas erwidern konnte, klopfte es an der Tür, und Martin blickte auf. »Ja?«
»Sir!« Ein Soldat trat in den Raum und warf mir, Ember und Riley einen misstrauischen Blick zu, bevor er sich an Martin wandte. »Lieutenant, die Wachen haben einen Mann vor dem Tor abgefangen. Er will seinen Namen nicht nennen oder woher er kommt. Wir haben nur aus ihm herausgebracht, dass er eine Botschaft hat …« Sein Blick huschte zu Riley und Ember. »Für die Drachen.«
Riley
Nun, dieser Tag wurde immer seltsamer.
Ein Mann saß schweigend am Tisch im Konferenzzimmer, flankiert von Soldaten des Georgsordens. Er war schlank und knochig, trug ein einfaches Hemd und eine dunkle Hose, seine Haut war gebräunt und ledrig. Er hatte die Hände vor sich gefaltet, den dunklen Blick auf die hölzerne Tischplatte gerichtet, bis wir vier – ich, der Heilige Georg, Ember und Martin, der Lieutenant des Ordens – uns zu ihm an den Tisch stellten.
»Ich bin Lieutenant Martin«, erklärte der Offizier, »derzeitiger Kommandant des Westlichen Ordenshauses des Ordens des Heiligen Georg. Wer sind Sie? Weshalb sind Sie hier?«
Der Mann hob endlich den Kopf. Ruhig sah er den roten Nestling neben dem Heiligen Georg an.
»Ember Hill«, sagte er mit leiser, aber gut hörbarer Stimme. Dann blickte er mich aus dunklen Augen an. »Ex-Agent Cobalt. Mein Meister lässt grüßen.«
Ember versteifte sich, ebenso wie der Heilige Georg und die beiden Wachen, deren Hände zu ihren Waffen glitten. Der Mann am Tisch blieb jedoch ungerührt. Ich trat vor, spürte, wie sich Cobalt in mir regte und auf diese potenzielle Drohung reagierte. »Und wer soll das sein?«, knurrte ich.
»Vergeben Sie mir, Ex-Agent.« Der Mann neigte den Kopf. »Aber mein Meister möchte nicht, dass seine Angelegenheiten in Gegenwart der Soldaten des Heiligen Georg erörtert werden.« Er sah zu Martin und seinen Männern hinüber. »Diese Botschaft und alles, was damit zusammenhängt, ist nur für Sie und Miss Hill bestimmt. Sebastian darf bleiben, wenn er möchte«, fuhr er fort. Er kannte auch den Namen des Soldaten? Wer war dieser Mensch? Und wer war dieser mysteriöse Meister, der so gut über uns Bescheid wusste? »Die restlichen Ordensmitglieder müssen den Raum verlassen. Mein Meister besteht darauf, dass seine Nachricht nur für eure Ohren bestimmt ist.«
»Unmöglich«, erwiderte Martin. »Sie befinden sich auf Ordensterritorium in einem Ordenshaus des Heiligen Georg. Sie werden alles, was Sie den Drachen mitteilen wollen, auch uns sagen müssen.«
»Kommen Sie schon, Lieutenant«, sagte der Mann versöhnlich. »Sie sehen doch, dass ich keine Bedrohung darstelle. Ich bin kein Drache, kein Soldat. Ich bin nicht bewaffnet. Ihre Männer haben bereits überprüft, dass ich kein Abhörgerät oder Ähnliches trage. Zwei Drachen und ein früherer Soldat des Ordens sollten keine Probleme mit einem gebrechlichen alten Mann haben.« Seine dünnen Lippen zuckten. »Aber Sie dürfen mich gern an den Tisch fesseln, wenn Sie das beruhigt.«
»Wer sind Sie?«, knurrte ich. Gebrechlicher alter Mann, klar doch. Harmlos war er nicht, dafür wusste er viel zu viel. »Wer zum Teufel hat Ihnen gesagt, wer wir sind oder dass wir uns hier aufhalten?«
»Das werde ich Ihnen erzählen«, sagte der Fremde und faltete erneut die Hände. »Wenn der Orden den Raum verlassen hat.«
Ich sah zu Martin. Der Offizier überlegte einen Moment angespannt, dann nickte er einmal und bedeutete den beiden Soldaten, den Raum zu verlassen. Sie warfen ihm besorgte Blicke zu, drehten sich aber sofort um und gingen nach draußen. Martin musterte den Fremden eindringlich, bevor er sich an Sebastian wandte.
»Wir sind draußen. Ruf uns, wenn du uns brauchst.«
»Jawohl, Sir«, antwortete der Soldat.
Der Offizier warf dem Mann am Tisch einen letzten Blick zu, verließ dann das Konferenzzimmer und schloss die Tür hinter sich. Wir waren mit dem Fremden allein.
Der Mann saß unbewegt da. »Na gut«, sagte ich und trat an den Tisch. »Sie haben Ihren Willen bekommen, der Orden hört nicht länger mit. Also sprechen Sie endlich, Mensch. Sie wissen, wer wir sind, was wir sind, und wahrscheinlich auch, warum wir hier sind. Ich kann mir nur eine Organisation vorstellen, die über solche Informationen verfügt.«
»Ich gehöre nicht zu Talon«, versicherte mir der Mann. »Diesen Verdacht sollten wir gleich von Anfang an ausräumen. Sie haben keinen Grund, mich zu fürchten. Ich vertrete eine einzelne Person, keine Organisation, auch wenn Talon ein Grund für meine Anwesenheit ist. Mein Meister hat mich mit einer Botschaft hergeschickt. Er möchte Sie, Ex-Agent Cobalt, und Miss Hill treffen und einige Dinge mit Ihnen besprechen.«
»Aha. Und wir sollen alles stehen und liegen lassen und uns jetzt sofort mit dieser mysteriösen Person treffen, habe ich recht? Tut mir leid, aber das reicht mir nicht. Zumal wir nicht einmal den Namen dieser Person wissen. Oder Ihren.«
»Mein Name ist nicht wichtig«, sagte der Fremde. »Ich bin nur seine Stimme. Seinen Namen sollten Sie allerdings schon einmal gehört haben, Ex-Agent Cobalt. Mein Meister nennt sich selbst Ouroboros.«
Ouroboros?
Mir wurde schwindelig. Ich spürte, wie mich Ember und der Heilige Georg anstarrten, und ich sah vermutlich genauso fassungslos aus, wie ich mich fühlte. »Das ist unmöglich«, verkündete ich. »Ouroboros ist …«
»Eine Legende?«, vervollständigte der Mann mit einem leichten Lächeln meinen Satz. »Ein Mythos?«
»Tot«, sagte ich rundheraus. »Der Drache, den man Ouroboros nannte, ist aller Wahrscheinlichkeit nach tot. Nachdem er zum Einzelgänger wurde, hat ihn niemand mehr gesehen …«
»Und das ist jetzt über dreihundert Jahre her«, ergänzte der Fremde. »Ja, das lässt Talon alle glauben. Doch Ouroboros ist alles andere als tot, Ex-Agent Cobalt. Und er hat mich hierhergeschickt, um Sie und die Tochter des Großen Wyrm zu finden.« Sein Blick wanderte zu Ember, die rasch die Schultern straffte. »Er möchte etwas mit Ihnen beiden besprechen. Persönlich.«
Ember sah von mir zu dem alten Mann. »Ich schätze, dieser … Ouroboros ist wichtig?«, fragte sie. »Wer ist das überhaupt?«
Ich holte tief Luft. »Ouroboros«, erklärte ich mit ehrfürchtiger Stimme, »ist ein Wyrm. Ein sehr, sehr alter Wyrm. Nur unsere berüchtigte Anführerin von Talon ist älter.«
Ember zog die Augenbrauen nach oben. »Oh.«
»Ja.« Ich nickte. »Er ist also ganz schön wichtig. Auch wenn er eigentlich gar nicht existieren sollte. Vor langer Zeit – ich rede hier von über dreihundert Jahren – gerieten er und der Große Wyrm in Streit. Mittlerweile hat man den Grund vergessen, aber man glaubt, dass es etwas mit Talon zu tun hatte und der Richtung, in die der Große Wyrm die Organisation führte. Man erzählt sich, dass der Streit zu einem ausgewachsenen Kampf zweier Giganten wurde. Am Ende hat Ouroboros Talon verlassen und wurde zum Einzelgänger. Der erste seiner Art. Und dann ist er einfach … verschwunden. Die offizielle Talon-Version lautet, dass er gestorben ist, aber vor allem unter den Einzelgängern hält sich die Legende, dass Ouroboros irgendwie überlebt hat und sich seitdem vor Talon versteckt.« Riley schüttelte den Kopf. »Natürlich ist das nur ein Mythos. Niemand hat etwas von Ouroboros gesehen oder gehört, seit er sich von Talon losgesagt hat.«
Der Heilige Georg sah zu dem Mann am Tisch. »Scheint doch kein Mythos zu sein, oder?«
»Nein.« Ich musterte den Fremden misstrauisch. »Wenn also wahr ist, was Sie sagen«, fuhr ich fort, »und Ouroboros am Leben ist, wo zum Teufel war er dann die ganze Zeit? Warum hat er nichts getan? Ist es ihm egal, dass viele von uns wegen Talon und dem Orden gestorben sind? Er ist wahrscheinlich der Einzige, der sich dem Großen Wyrm entgegenstellen könnte und zumindest eine winzige Chance hätte. Warum hat er nichts von sich hören lassen oder die Einzelgänger wenigstens kontaktiert? Warum jetzt?«
»Ich maße mir nicht an, Ouroboros’ Beweggründe zu kennen«, entgegnete der Mensch. »Ich bin hier, um eine Botschaft zu überbringen, sonst nichts. Die modernen Kommunikationsmöglichkeiten wie Telefon, Computer und all diese Dinge sind ihm zuwider. Telefone können abgehört und zurückverfolgt, Computer gehackt werden. Ouroboros ist … ein Traditionalist, wenn man so will. Wenn Sie Antworten möchten, müssen Sie ihn selbst fragen.«
Ich knurrte frustriert. »Na gut. Wo ist er?«
Der Mann blinzelte. »Bitte entschuldigen Sie, Ex-Agent«, entgegnete er, seine Stimme immer noch unglaublich ruhig. »Das kann ich Ihnen leider nicht sagen.« Er hob eine Hand, als ich noch näher trat. »Sie sollten doch am besten wissen, welche Anstrengungen ein Einzelgänger auf sich nimmt, um seinen Aufenthaltsort geheim zu halten.«
»Wie sollen wir ihn dann finden?«, fragte Ember.
»Wenn Sie zustimmen, sich mit meinem Meister zu treffen, werde ich Sie hinbringen. Doch ich warne Sie. Es ist eine lange, anstrengende Reise. Ouroboros ist nicht hier in den Vereinigten Staaten. So lange unentdeckt zu bleiben bedeutet, sich nahezu völlig von der Zivilisation zurückzuziehen. Die Reise wird einige Zeit in Anspruch nehmen.«
»Zeit, die wir nicht haben«, erwiderte ich verärgert. »Wir befinden uns mitten im Krieg, und Talon ist auf dem Vormarsch. Ich kann die Nestlinge nicht hierlassen und wegen eines Gesprächs um die halbe Welt jetten.«
»Selbst wenn es Ouroboros ist, mit dem Sie sprechen werden?«, fragte der Fremde sanft. »Der erste Einzelgänger? Einer von nur vier Wyrms auf der ganzen Welt! Der den Großen Wyrm schon vor Jahrhunderten kannte und der zweitmächtigste Drache aller Zeiten ist? Ex-Agent Cobalt, ich könnte mir vorstellen, dass gerade Sie mit Ihrem Untergrundnetzwerk, das Sie vor Talon verbergen wollen, doch sicher erfahren möchten, warum Ouroboros Sie zu sich ruft.«
»Hey, verstehen Sie mich nicht falsch.« Ich hielt eine Hand in die Höhe. »Ich würde Ouroboros furchtbar gern treffen und ihn ein wenig ausquetschen. Vor allem, wie er es geschafft hat, über dreihundert Jahre nicht auf Talons Radar zu erscheinen.« Ich fuhr mir mit der Hand über den Kopf. »Doch der Zeitpunkt ist wirklich ungünstig. Ich kann die Nestlinge jetzt nicht alleinlassen. Talon ist immer noch hinter uns her, und uns bleibt wahrscheinlich nicht viel Zeit bis zur zweiten Angriffswelle, wie auch immer die aussehen wird. Ich muss meine Leute so weit wegbringen wie möglich, bevor sie wieder zuschlagen.«
Ember sah erst mich, dann den Mann am Tisch an. »Müssen wir Ihnen jetzt gleich antworten?«, fragte sie.
»Nein, Miss Hill.« Der Mann schüttelte den Kopf. »Bitte lassen Sie sich Zeit, besprechen Sie erst alles untereinander. Aber … Ouroboros ist kein geduldiger Wyrm. Er vergibt nicht, und er vergisst auch nicht.« Er klang immer noch gelassen und ruhig. Es war keine Drohung, nur eine Feststellung, doch die Warnung hallte in mir trotzdem nach. »Niemand darf seine Zeit verschwenden. Wenn Sie das Angebot jetzt ablehnen, werden Sie in Ihrem ganzen Leben keine zweite Chance erhalten. Deshalb entscheiden Sie sich weise.«
»Verdammte Scheiße«, meinte Wes. »Ouroboros? Der erste Einzelgänger? Das ist doch total unmöglich. Ich dachte, er wäre … Ich meine, er soll doch …«
»Gar nicht existieren«, vervollständigte Pearl, die an der Wand lehnte, seinen Satz. Ember, der Heilige Georg und ich hatten den Fremden unter der Aufsicht zweier nervöser Soldaten zurückgelassen und uns in unser Behelfsquartier am anderen Ende des Stützpunktes zurückgezogen. Dort hatten wir uns in Wes’ Zimmer versammelt, zusammen mit zwei anderen Drachen, die sich uns kürzlich angeschlossen hatten: Pearl, ein früherer Basilisk, deren Motive für ihre Anwesenheit uns immer noch nicht klar waren, und Jade, ein ausgewachsener asiatischer Drache mit einer Vorliebe für Tee und einem Hang zur Distanziertheit.
»Ouroboros ist ein Mythos«, fuhr Pearl fort. »Eine moderne Legende, die die Einzelgänger sich erzählen, weil sie ihnen Hoffnung gibt.« Ihr langes Silberhaar leuchtete schwach in der dunklen Ecke, die sie für sich beansprucht hatte. Auch wenn die Sonne erst in einigen Stunden untergehen würde, hatten wir die Vorhänge zugezogen und das Licht ausgeschaltet. Die einzige Beleuchtung stammte von Wes’ Laptopdisplay auf dem Tisch. Mein menschlicher Hackerfreund schien auf Sonnenlicht genauso allergisch zu reagieren wie ein Vampir.
»Der Mann lügt«, beharrte Pearl. »Jeder bei Talon weiß, dass Ouroboros vor langer Zeit gestorben ist. Nach all den Jahren hätten wir doch etwas von ihm sehen oder hören müssen.«
»Nun, sag das mal dem Menschen da drüben im Konferenzzimmer des Ordens«, ich zeigte mit meinem Daumen auf die geschlossene Tür. »Entweder hat er zu viele halluzinogene Pilze gegessen, oder er hat recht, und der erste Einzelgänger will sich wirklich mit uns treffen.«
Jade, die bisher schweigend neben einem Kleiderschrank gestanden hatte, musterte mich interessiert. »Wenn Ouroboros tatsächlich lebt und nach euch verlangt, dann solltet ihr gehen. Man erhält nicht oft einen Ruf von einem alten Wyrm, wenn überhaupt je.«
»Ja, aber …« Ich raufte mir gleichermaßen frustriert und neugierig mit beiden Händen das Haar. Natürlich wollte ich zu ihm. Es ging schließlich um Ouroboros, den legendären ersten Einzelgänger, der seine Existenz so gut vor Talon verborgen hatte, dass jeder – inner- und außerhalb der Organisation – ihn für tot gehalten hatte. Dreihundert Jahre lang. Ich würde töten, um sein Geheimnis zu erfahren.
Doch was würde mit meinem Untergrundnetzwerk passieren, wenn Talon erneut angriff? Meine Leute hatten tapfer gegen Talons Klonarmee gekämpft und das Blatt zugunsten des Ordens gewendet. Ohne unser Eingreifen wäre der Orden abgeschlachtet worden.
Der Preis dafür war hoch, viel zu hoch gewesen. Einige hatten es nicht geschafft. Fünf Nestlinge waren tot, begraben im Wüstensand, zusammen mit den Soldaten, neben denen sie gekämpft hatten. Ich kannte ihre Namen, ich erinnerte mich an jeden Tag, an dem ich einen von ihnen von Talon weggebracht hatte, mit dem Versprechen auf ein besseres, freies Leben.
»Du machst dir Sorgen um die anderen«, sagte Ember leise.
»Natürlich«, antwortete ich. »Ich kann sie jetzt nicht alleinlassen, es ist zu gefährlich. Talon will uns mit allen Mitteln töten und hat eine große Klonarmee zur Verfügung. Ich wage es nicht, sie in die anderen Verstecke zurückzuschicken – die Nester sind alle aufgeflogen. Ich habe nur noch einen Ort, an den wir gehen können, und ich hoffe, dass Talon ihn mittlerweile nicht auch schon gefunden hat.«
»Dann geht es also wieder auf die Farm«, sagte Wes, und ich nickte. Er seufzte. »Verdammt, Riley, da kann ich sie auch hinbringen. Ist ja kein Kunststück, einen verdammten Van zu fahren.«
Als ich ihn schockiert anstarrte, schaltete sich auch Jade ein. »Wenn du dir Sorgen um ihre Sicherheit machst, dann kann ich dich beruhigen. Ich werde bis zu deiner Rückkehr bei ihnen bleiben. Solange ich auf sie aufpasse, haben die Nestlinge nichts von Talon zu befürchten.«
»Ich … sagt mal, geht’s euch gut?«, fragte ich die beiden fassungslos. Was war hier nur los? Wes hasste Menschen, vor allem Teenager. Und Jade kannte uns kaum. »Was ist denn in euch gefahren?« Ich runzelte die Stirn. »Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, ihr tut alles, um mich loszuwerden.«
»Riley.« Wes warf mir einen seiner patentierten »Nur Idioten um mich herum«-Blicke zu. »Denk doch mal nach. Ouroboros ist der zweitälteste Drache der Welt, und er ist ein Gegner des Großen Wyrm. Was, wenn wir ihn überreden könnten, für uns zu kämpfen?« Der Hacker schüttelte den Kopf. »Wenn du da kein Potenzial siehst, Kumpel, dann ist bei dir wirklich alles verloren.«
»Ja«, bestätigte Jade mit einem ernsten Nicken. »Kenne dich selbst, kenne deine Feinde. Tausend Schlachten, tausend Siege.«
»Was zum Teufel soll das heißen?«
»Dass wir uns mitten in einem Krieg befinden.« Der asiatische Drache warf mir einen Blick zu, der fast so verächtlich war wie der von Wes. »Und seinen Feind zu kennen ist der Schlüssel zum Sieg. Wissen ist die größte Waffe, die wir haben, und wer besitzt mehr Wissen als derjenige, der länger als nahezu jeder andere auf diesem Planeten gelebt hat?«
»Und ich kenne dich, Riley«, ließ sich Ember vernehmen. »Du willst Ouroboros treffen. Wenn du diese Chance vergeigst, wirst du dich den Rest deines Lebens in den Hintern beißen.«
»Das stimmt«, erklärte Pearl. »Wenn mich eine Legende zu sich rufen würde, hätte das oberste Priorität für mich.«
Ich seufzte. »Euch ist schon klar, dass immer noch ich der Anführer des Untergrundnetzwerkes bin«, bemerkte ich. »Ich sag’s nur, falls ihr es vergessen haben solltet.« Wie erwartet zeigte sich keiner beeindruckt, und ich schüttelte ergeben den Kopf. »Na gut, wenn der erste Einzelgänger uns sehen will, dann werden wir hinfahren. Wes, Jade, seid ihr euch wirklich ganz sicher, dass ihr die Nestlinge …«
»Himmel, hau endlich ab«, sagte Wes. »Du klingst ja wie ein verdammtes Kindermädchen.«
Ember
Gegenwart
Die Menschen umringten uns lautlos wie Geister in der Düsternis des Dschungels. Es musste ein knappes Dutzend sein. Alle hatten dunkle Haut und trugen nur Lendentücher und Halsketten aus Muscheln und Knochen. Die meisten hielten rohe Holzspeere in der Hand, die in einem Stachelkranz auf uns zeigten. Einige Männer hinter dem Kreis hielten Bogen und Pfeile. Keiner sprach oder gab ein anderes Geräusch von sich. Alle beobachteten uns aus undurchdringlichen schwarzen Augen.
»Okay«, murmelte Riley und blickte in die Runde. »Das ist ein bisschen beunruhigend. Glaubt ihr, das ist das Empfangskomitee?« Seine Stimme klang amüsiert, hatte allerdings einen warnenden Unterton. Garret hatte seine Waffe gezogen, den Lauf zu Boden gerichtet, um im Notfall reagieren zu können.
»Was sie wohl wollen?«, fragte ich und ließ die Speerspitzen nicht aus den Augen, die mir ins Gesicht ragten. Garret war hinter mich getreten, und ich spürte seine Anspannung. Riley zuckte mit den Schultern.
»Keine Ahnung, aber nur um das herauszufinden, will ich mich nicht aufspießen lassen.« Sein Blick zuckte zu mir, und ein grimmiges Lächeln spielte um seine Lippen. »Du hast doch noch Kleidung zum Wechseln dabei, oder?«
»Wir sollen uns verwandeln? Vor all diesen Menschen?«
»Wem sollen sie es schon erzählen? Den Affen?« Er verdrehte die Augen, bevor er seine Aufmerksamkeit wieder auf die Menschen richtete. »Auf diese Weise müssen wir noch nicht einmal kämpfen. Sie werden einfach nur die Speere fallen lassen und wegrennen.«
»Und wenn nicht?«
»Dann wäre ich lieber in Drachengestalt, wenn sie versuchen, mir einen Speer in den Hintern zu schieben.«
Die Menge vor uns teilte sich auf einmal, und ein alter Mann kam auf uns zu. Ein Stück vor uns blieb er stehen. Er war dünn, fast schon bis auf die Knochen abgemagert, mit Armen, dürr wie Zweige; ein paar kümmerliche weiße Haarsträhnen klebten an seinem Schädel. Er musterte uns aus klaren und scharfen Augen, dann hob er eine klauenartige Hand und zeigte auf mich.
»Du«, krächzte er mit schwerem Akzent. »Name.«
»Mein Name?«, fragte ich. Die Krieger hielten weiterhin schweigend die Speere auf uns gerichtet. Der alte Mann gab keine Antwort, sondern sah mich nur mit seinen stechenden schwarzen Augen an. »Ember«, sagte ich leise. »Ember Hill.«
Er nickte einmal und trat zurück, dann ließen die Männer ihre Speere sinken. Der Alte hob eine faltige Hand und bedeutete uns, ihm zu folgen.
Wir gehorchten und gingen hinter ihm einen schmalen Pfad entlang, der sich bald verlief, als wir tiefer in den Dschungel vordrangen. Selbst Garret und Riley hatten Mühe mitzuhalten. Der alte Mann und die Krieger glitten wie Geister an den Bäumen und Sträuchern vorbei, lautlos und beinahe unsichtbar. Sie verschmolzen perfekt mit ihrer Welt, anders als wir, die lauten Eindringlinge, die in groben Stiefeln durch das Unterholz trampelten und sich den Weg mit einer Machete freihacken mussten. Der Urwald schloss sich um uns herum, wurde dunkler und noch dichter, als ob ihn unsere Anwesenheit sowie unser Versuch, uns einen Weg hindurch zu bahnen, beleidigte. Nach ein paar Minuten hatte ich die Orientierung verloren, was mich ziemlich nervös machte. Wenn unsere mysteriösen Führer beschlossen, uns mitten im Dschungel sitzen zu lassen, würden wir nie wieder den Weg zurück finden.
»Wohin bringen sie uns wohl?«, flüsterte ich Garret nach ein paar Minuten des Schweigens zu. Der Soldat hatte seine Waffe wieder verstaut, doch seine Haltung war immer noch angespannt, er behielt die ganze Zeit unsere Umgebung sowie die Männer im Blick, die sich lautlos neben uns zwischen den Bäumen bewegten.
»Ich weiß es nicht«, antwortete er und warf einen Blick nach oben. Ich tat es ihm gleich und sah einen kleinen gelben Affen auf einem knotigen Ast, der aus großen schwarzen Augen zu mir herabschaute. »Aber sie kennen unsere Namen«, fuhr Garret fort. »Das bedeutet, sie haben auf uns gewartet.«
Wir gingen weiter durch die Düsternis und folgten den beharrlich schweigenden Männern. Einmal versuchte Riley, mit dem alten Mann zu sprechen, doch der schüttelte nur den Kopf und legte einen Finger an die Lippen. Nach zwei Stunden Fußmarsch fragte ich mich allmählich, ob wir jemals ankommen würden oder ob der Dschungel einfach nie aufhörte, als Garret mich plötzlich anstieß und auf etwas in den Bäumen vor uns deutete.
Erst fiel mir nichts Besonderes auf: nur hoch aufragende Baumstämme, Unterholz, Ranken und Schatten. Dann erkannte ich den Umriss einer uralten Steinmauer zwischen den Bäumen, fast bis zur Unkenntlichkeit von Moos, Schlingpflanzen und knotigen Wurzeln überwuchert. Als wir näher kamen, sah ich einen alten Torbogen in der Mauer, der von zwei verwitterten und überwucherten Statuen flankiert wurde, deren Gesichter nicht mehr zu erkennen waren. Hinter der Mauer erhob sich ein großes Steingebilde in den Himmel, genauso von der Zeit gezeichnet wie die Statuen.
Ich hob die Augenbrauen. Lebten diese Menschen hier? In einem verborgenen Dorf tief im Dschungel, umgeben von den Ruinen einer noch älteren Zivilisation? Ich war fasziniert. Es war schwer zu glauben, dass es noch Orte auf der Welt gab, die die moderne Zivilisation nicht erreicht hatte und wo die Menschen noch immer ohne Strom oder Telefon oder Computer lebten.
Als wir uns dem Torbogen näherten, blieb der alte Mann stehen und wandte sich uns mit erhobener Hand zu. Ich drehte mich um und sah, dass sich die Krieger zurückgezogen hatten und ein Stück vom Durchgang entfernt standen.
Der alte Mann sah erst mich an, dann Riley und Garret. Er trat einen Schritt zurück, deutete auf uns, dann auf den Torbogen hinter sich. Ich runzelte die Stirn.
»Sie kommen nicht mit uns?«
Keine Antwort, er wiederholte nur seine Geste, ein wenig nachdrücklicher dieses Mal. Riley sah uns an und zuckte mit den Schultern.
»Wir sollen wohl ohne ihn gehen. Passt auf. Ich möchte ungern in einen Hinterhalt geraten und kann gut darauf verzichten, dass Bogenschützen aus jeder Ecke ihre Pfeile auf uns abfeuern.«
Vorsichtig gingen wir auf den Torbogen zu. Einmal sah ich über die Schulter und entdeckte, dass der alte Mann und die Krieger verschwunden waren. Als ob es sie nie gegeben hätte.
Wir durchschritten den Torbogen. Hinter der Mauer erstreckte sich ein riesiger Platz. Moos und Gestrüpp hatten ihn zur Hälfte geschluckt, verwitterte Steinplatten ragten daraus hervor. Mauern bröckelten unter dem Gewicht dicker Wurzeln, die sich wie riesige Pythons zwischen aufgeworfenen Steinen und Geröll über den Platz wanden und unser Vorankommen erschwerten. Überwucherte Ruinen standen am Kopf der Stufen, Bäume schoben sich durch das Gestein und die Dächer und streckten sich gen Himmel. Zwischen den Stufen und Gebäuden wanden sich weitere Straßen hindurch und verschwanden ins Ungewisse.
»Es ist furchtbar still hier«, meinte Riley, als wir vorsichtig den ausladenden Platz überquerten. Insekten stoben davon, flohen über Steine und Ranken, sonst bewegte sich jedoch nichts. »Ich will nicht klischeehaft klingen, aber ihr spürt es auch, nicht wahr?«
Ich nickte. Er hatte recht. Vor ein paar Minuten noch war es laut im Dschungel gewesen: summende Insekten, rufende Vögel, kreischende Affen in den Baumkronen hoch über uns. Jetzt herrschte eine gespenstische Stille, als ob jedes Lebewesen in einem kilometerweiten Radius Angst hatte, einen Laut von sich zu geben.
»Das gefällt mir nicht«, sagte Garret, als in diesem Moment die Erde unter unseren Füßen erbebte.
Wir erstarrten mit gezogenen Waffen in der Mitte des Platzes. Angespannt sahen wir uns um. Wieder erzitterte die Erde, ein entferntes Vibrieren, begleitet von einem gedämpften Dröhnen. Und noch einem. Insekten flogen auf, ein paar Steine lösten sich aus einer Wand und fielen zu Boden, während die Schritte beständig lauter wurden und mein Herz immer schneller schlug. Beinahe blieb es stehen, als ich einen Drachenrücken hinter den Hausdächern sah – die mindestens zwölf Meter hoch waren.
»Oh, verdammt«, sagte Riley leise. Und dann beobachteten wir sprachlos, wie ein Drache so groß wie ein Haus ganz ruhig zwischen den Ruinen ins Licht trat.
Er war alt; das war offensichtlich, auch wenn man seine überwältigende Größe außer Acht ließ. Seine Schuppen waren von einem dumpfen Schwarzgrau, der Farbe von Moorwasser, und seine riesigen Schwingen waren eingerissen und voller Löcher. Moos und anderes Grünzeug wuchs auf seinen Schultern und seinem Rücken und verlieh ihm ein struppiges Aussehen. Wenn er sich hinlegte, verschmolz er wahrscheinlich mit dem Dschungelboden. Seine gebogenen schwarzen Krallen waren länger als mein Arm, und knochige Hörner ragten aus einem schmalen, schädelartigen Gesicht, in dem die Augen orangerot in den Höhlen glühten. Diese Augen fixierten mich nun, als Ouroboros hoch über uns den Kopf hob. Er verzog das Maul zum schrecklichsten Lächeln der Welt.
»Ember Hill.« Seine Stimme war ein tiefes Grollen, das die Erde erbeben ließ und in meinen Knochen widerhallte. »Tochter des Großen Wyrm. Endlich lernen wir uns kennen.«
Meine Beine zitterten, und meine Stimme war irgendwo zwischen meinem Herzen und meiner Kehle stecken geblieben. Einen Moment hegte ich den wahnsinnigen, furchtbaren Gedanken, dass Ouroboros uns vielleicht zu diesem vergessenen Tempel im Nirgendwo gelockt hatte, um uns umzubringen. Oder besser gesagt mich, die Tochter seiner jahrhundertelangen Rivalin. Vielleicht, weil er glaubte, dass die Beseitigung der Nachkommenschaft des Großen Wyrm irgendwie zu Talons Zerstörung beitragen würde. Oder vielleicht war er einfach nur auf Rache aus, und da er an die Anführerin von Talon nicht herankam, wollte er stattdessen ihre Tochter töten.
Nun, wenn das zutrifft, hast du Pech gehabt. Ich bin nicht der Lieblingszwilling. Wenn du mich verschlingst, dann erreichst du nur …
… dass du dem Großen Wyrm die Unsterblichkeit verweigerst. Mein Blut gefror zu Eis. Ich war das Gefäß des Großen Wyrm, erschaffen, um ihre Erinnerungen aufzunehmen, damit sie noch einmal tausend Jahre leben konnte. Hatte Ouroboros uns deswegen hierher gerufen? Hatte er irgendwie vom Plan des Großen Wyrm erfahren, unsterblich zu werden, und wollte das ein für alle Mal verhindern?
Der alte Drache beobachtete mich immer noch wie ein König, der darauf wartet, dass sein Sklave das Gesicht vom Boden erhebt. Ich warf einen Blick in das schauerliche Reptiliengesicht und sah Belustigung in seinen brennenden Augen. Er wusste, wie er auf uns wirkte, und genoss es wahrscheinlich.
Komm schon, Ember, du bist die Tochter des Großen Wyrm. Selbst wenn er dich töten will, wirst du dir deine Angst nicht anmerken lassen.
Ich holte verstohlen Luft, hob den Kopf und trat einen Schritt auf den zweitältesten Drachen der Welt zu.
»Ouroboros.« Ich zwang mich zur Ruhe. Wie sie es tun würde. »Was für ein Vergnügen, dich endlich kennenzulernen.«
Ouroboros lachte. Bei dem tiefen, dröhnenden Geräusch setzte mein Herz einen Schlag aus, und jeder Vogel in einem meilenweiten Umkreis flatterte wahrscheinlich erschrocken auf. Neben mir zuckte Riley zusammen, und Garret griff nach seiner Waffe, auch wenn er seine Hand einen Moment später wieder zurückzog. Gegen einen Drachen dieser Größe konnten wir nichts ausrichten. Wir hätten schon eine Rakete gebraucht, um seinen Schuppen auch nur einen Kratzer zuzufügen. Das hier war der König in seinem Reich, der unangefochtene Gott des Dschungels, und jeder hier wusste das.
Wenn schon Ouroboros von Schnauze bis Schwanz etwa fünfundzwanzig Meter maß, wie groß war dann erst der Große Wyrm?
Ein Furcht erregender Gedanke.
»Ah.« Ouroboros lachte und schüttelte den riesigen Kopf. »Sehr erfrischend, mit jemandem zu reden, mit dem man ein vernünftiges Gespräch führen kann«, verkündete er mit einer Stimme, die mir einen Schauder nach dem anderen über den Rücken jagte. »Meine Untertanen – die Menschen, denen ihr auf dem Weg hierher begegnet seid – verbeugen sich immer nur und pressen die Gesichter in den Staub. Wenn sie sich überhaupt hinter diese Mauer wagen, dann wollen sie mir nicht mal ins Gesicht sehen. Ich hatte gehofft, die Tochter des Großen Wyrm und der berüchtigte Einzelgänger Cobalt wären nicht so leicht einzuschüchtern.« Er warf Riley einen Blick zu und legte den Kopf schief.
Riley zögerte für den Bruchteil einer Sekunde, als ob auch er sich kurz sammeln müsse, bevor sich seine Lippen zu einem leichten Lächeln verzogen. »Ich wollte nicht unhöflich sein«, sagte er und klang so herausfordernd wie immer. »Du hast dich gerade mit Ember unterhalten, und da wollte ich nicht unterbrechen. Könnte ja sein, dass hier in der Gegend auf so etwas die Todesstrafe steht.«
Ouroboros schnaubte, und eine Rauchwolke von der Größe eines Kleinwagens stieg in Richtung der Baumkronen auf. »Du bist also wirklich so, wie man sich erzählt«, meinte er zufrieden. »Ich verstehe, warum Talon dich so verabscheut. Vielleicht überlebst du ja tatsächlich das, was noch auf dich zukommt. Aber …« Seine Miene verdüsterte sich, eine unheilvolle Wolkenwand schien sich vor die Sonne zu schieben. »Als Erstes möchte ich eine Sache aus der Welt schaffen.«
Garret hatte sich bisher weder bewegt noch etwas gesagt, als der Wyrm seine Aufmerksamkeit endlich auf den Menschen richtete. »Heiliger Georg«, knurrte Ouroboros und ließ damit den Boden erzittern. »Die letzten Vertreter deines Ordens, die mir untergekommen sind, waren zwei Lanzen schwingende Ritter, die ich samt ihrer Pferde zermalmt habe. Jetzt jagt ihr uns mit Gewehren und Fahrzeugen und modernen Waffen. Ich habe mich zwar von Talon und dem Rest der Zivilisation losgesagt, aber ich weiß immer noch, was in der Welt los ist. Dein Orden hat viel Zerstörung und Tod über die Drachen gebracht. Ihr habt uns jahrhundertelang unerbittlich gejagt und alles darangesetzt, um uns auszurotten.« Der riesige Drache beugte sich vor, seine Klauen bohrten sich in den Stein, als er den Kopf senkte und den Soldaten mit glänzenden roten Augen musterte. »Drachen vergessen nicht, Heiliger Georg«, grollte er. »Und wir vergeben auch nicht. Hast du gedacht, du könntest das Territorium eines Wyrm betreten und es lebendig wieder verlassen?«
Mein Magen krampfte sich zusammen. Garret sah den Drachen ruhig und ohne Furcht, aber auch schicksalsergeben an. »Der Georgsorden war im Unrecht«, sagte er und bewegte sich nicht, als die mächtige Schnauze näher kam und ihn in Rauch hüllte. »Was wir deinesgleichen angetan haben …« Er warf mir und Riley einen Blick zu. »Es gibt keine Entschuldigung für das Gemetzel, das wir angerichtet haben. Aber ich gehöre nicht mehr zum Orden. Ich bin hier, weil ich das Kämpfen beenden will.«
Wut flammte in mir auf, und ich ballte die Fäuste. Warum stand Garrets Loyalität überhaupt zur Debatte? Hatte er nicht schon genug getan, um seine Treue zu beweisen? Er hatte mehrmals sein Leben riskiert, war bedroht und entführt, misshandelt und von seinem eigenen Orden in den Rücken geschossen worden. Alles zum Schutz der Drachen. Um dem Georgsorden zu zeigen, dass seine alten Feinde nicht die Dämonen waren, für die er sie hielt.
Natürlich war das, bevor Talon seine roboterartige Drachenarmee auf den Orden losgelassen und ihn beinahe mit einem Schlag zerstört hatte. Was nicht gerade hilfreich gewesen war. Doch ein paar Ordensmitglieder hatten dennoch auf uns gehört. Wie Lieutenant Martin. Wenn er eine Gruppe von Einzelgängerdrachen auf seinem Stützpunkt erlaubte, dann gab es noch Hoffnung. Hoffnung auf eine Zukunft ohne Krieg, in der die Drachen nicht mehr in Angst leben mussten. In der Teenager nicht zu Killern und Auftragsmördern gedrillt wurden. Und in der ein früherer Soldat des Heiligen Georg und ein Drache zusammen sein konnten, ohne dass beide Seiten sie auseinanderbringen oder töten wollten.
Ouroboros wirkte jedoch leider weder beeindruckt noch beschwichtigt. »Ich fürchte, das reicht nicht, Drachentöter«, meinte er. Mein Herzschlag beschleunigte sich vor Angst. »Willst du mir damit sagen, ein Mörder sollte für all die Leben, die er genommen hat, nicht bestraft werden, nur weil er Reue zeigt? Dass er dadurch das Blut von seinen Händen waschen kann?«
»Nein«, flüsterte Garret, doch er fasste sich rasch wieder und sah zu dem riesigen Drachen auf. »Aber lebendig kann ich mehr Gutes tun als tot. Zumindest, bis das hier vorbei ist. Ich weiß, dass es nie genug sein wird, aber ich kann wenigstens versuchen, meine Vergangenheit wiedergutzumachen.«
»Ach wirklich?« Der alte Wyrm verzog verächtlich die Lippen und zeigte dabei gelbe Reißzähne von der Größe kurzer Schwerter. »Du bist nur ein Mensch. Dein Leben ist ein Herzschlag, das Flattern eines Schmetterlings. Wenn ich dich hier und jetzt zerstöre, dich wie ein Insekt zerquetsche, wird es niemand erfahren. Niemand wird um dich trauern. Ein Mensch weniger auf der Welt wird keinen Unterschied machen.«
»Äh, Moment mal«, schaltete sich Riley nervös ein. »Ich gebe ja zu, dass der Kerl ein ganz schöner Drecksack war, als er noch für den Georgsorden gearbeitet hat, aber er war uns seither ziemlich nützlich.«
Der Wyrm ignorierte ihn und setzte sich mit einem Angst einflößenden Lächeln auf. »Ich gebe dir eine Chance, Heiliger Georg«, sagte er und nickte in Richtung des Torbogens. »Lauf. Jetzt. Wir werden sehen, wie weit du kommst, bevor meine Flammen dich erreichen. Aber wisse, Mensch, dass ich seit über hundert Jahren niemanden mehr gejagt habe. Sei so nett und versuch wenigstens, dich zu wehren, ja?«
Garret bewegte sich nicht. Sein Blick zuckte für einen Sekundenbruchteil zu mir, sodass ich die Emotionen in seinen Augen erkennen konnte, bevor er den Wyrm wieder ansah. »Nein«, sagte er ruhig. »Ich werde nicht weglaufen. Ich habe nichts mehr zu verbergen.«
»Nun.« Ouroboros klang etwas beleidigt. »Wie langweilig. Dann muss ich mich wohl mit einem kleinen Snack zufriedengeben. Keine Angst, Mensch.« Er bäumte sich auf wie eine Schlange, riss die Kiefer auseinander und präsentierte die enormen Reißzähne und den riesigen Schlund. »Ich mache es kurz.«
Ich sprang vor Garret und verwandelte mich im selben Moment in Drachenform. Der alte Wyrm zog sich überrascht zurück, als ich mich mit ausgebreiteten Flügeln vor den Soldaten stellte, in dem verzweifelten Versuch, ihn vor dem riesigen Wesen vor uns zu schützen. Ich wusste, dass ich im Grunde nichts tun konnte. Ein einziger Schlag von Ouroboros konnte uns beide sofort töten. Aber ich würde nicht zusehen, wie Garret vor meinen Augen starb.
Ich spürte eine weitere Energiewelle, und ein schlanker blauer Drache trat vor den alten Wyrm. Überrascht sah ich Cobalt an, der seinen goldenen Blick jedoch auf den über uns aufragenden Drachen gerichtet hielt.
»Deshalb sind wir nicht hier, Ouroboros«, sagte der Einzelgänger mit einem kaum hörbaren Zittern in der Stimme. »Und du hast uns auch nicht nur wegen eines Snacks gerufen. Was willst du wirklich?«
Ouroboros wirkte amüsiert. Er setzte sich auf die Hinterbeine, legte den Kopf zur Seite und musterte uns mit seinen uralten roten Augen. »Nun«, grollte er, »ich schätze, das beantwortet meine Frage. Das Verhalten des Mädchens verwundert mich nicht besonders, jetzt, da ich es kennengelernt habe, aber ich gebe zu, dass du mich heute überrascht hast, Cobalt. Wenn man bedenkt, wie lange du gegen den Georgsorden gekämpft hast, hätte ich erwartet, dass du es genießen würdest, wenn einer deiner Feinde vor deinen Augen zerquetscht wird.«
»Oh, versteh mich nicht falsch.« Cobalt sprach beiläufig, doch sein Körper war wie ein straff gespanntes Seil zwischen dem Wyrm und uns. »Das war hauptsächlich wegen eines gewissen roten Nestlings, der dazu neigt, sich ohne nachzudenken vor einen angreifenden Drachen zu werfen.« Er warf mir einen genervten Blick zu, bevor er sich wieder an Ouroboros wandte. »Aber ich riskiere meine Haut natürlich nicht für irgendeinen dahergelaufenen Menschen. Dieser Soldat hat mit uns gegen Talon und den Georgsorden gekämpft, und heutzutage nehme ich jeden Verbündeten, den ich bekommen kann.«
Der alte Wyrm nickte. »Ausgezeichnet«, sagte er und verwirrte uns damit komplett. »Genau das habe ich herausfinden wollen. Ich wollte testen, wie weit ihr euch gegenseitig beistehen würdet«, erklärte Ouroboros. »Zwei Drachen und ein Soldat des Heiligen Georg können vielleicht keine Feinde mehr sein, aber es ist schwer zu glauben, dass sie Verbündete oder sogar Freunde sind. Ich wollte herausfinden, ob ihr wirklich ein Team seid, das gemeinschaftlich denkt und handelt, oder nur ein zufällig zusammengewürfelter Haufen von Fremden. Mit Letzterem hätte ich nur meine Zeit vergeudet, denn ich bezweifle, dass ihr das Bevorstehende überleben werdet.«
»Dann … wolltest du ihn gar nicht töten?«, fragte ich, erleichtert, dass ich überhaupt etwas herausbrachte und nicht vor Angst verstummt war.
»Oh, ich hätte ihn definitiv getötet«, sagte Ouroboros. »Wenn du den Soldaten nicht verteidigt hättest, würde er sich jetzt in meinem Magen allmählich auflösen.« Er fuhr sich mit der Zunge über die Zähne. »Mmm, es ist lange her, dass ich einen Sterblichen gegessen habe«, überlegte er sehnsüchtig. »Vielleicht sollte ich wieder Opfer verlangen.«
Ich schauderte, und neben mir kräuselte Cobalt verächtlich eine Lippe. Ouroboros schien es nicht zu bemerken. »Ihr wollt einen Schlag gegen Talon landen«, fuhr er fort. »Aber Mut und Entschlossenheit allein gewinnen keine Kriege. Wenn ihr die Organisation bekämpfen wollt, werdet ihr Soldaten und Verbündete brauchen. Da kann ich euch helfen.«
»Wie?«, fragte Cobalt. »Willst du dich uns anschließen?«
Mein Herz schlug schneller bei der Vorstellung. Mit einem Wyrm wie ihm, dem zweitältesten Drachen der Welt, an unserer Seite hatten wir eine Chance, Talon endgültig zu vernichten.
Doch Ouroboros schnaubte nur. »Ich habe seit über dreihundert Jahren nicht mehr mit meinesgleichen gesprochen, und in dieser Zeit haben Talon und der Große Wyrm irgendwann vergessen, dass ich existiere. Oder sie halten mich für tot. Wenn ich jetzt mit euch zurückkehre, wird Talon erfahren, dass ich am Leben bin, und der Große Wyrm würde sich eine solche Konkurrenz nicht gefallen lassen.«
»Aber … du bist ein Wyrm«, protestierte ich. »Du könntest uns helfen, diesen Krieg zu gewinnen. Unzählige Drachen werden von Talon benutzt und vernichtet. Wie kannst du da einfach zuschauen?«
»Zuschauen?« Ein leichtes Grollen lag in der Stimme des Wyrm – eine Warnung, es in Gegenwart eines Gottes nicht zu weit zu treiben. »Ich tue sehr wohl etwas, Nestling«, fuhr er fort. »Ich habe euch hierher gerufen. Weil sich eine Gelegenheit ergeben hat, gegen den Großen Wyrm und Talon loszuschlagen. Doch die Zukunft ist ungewiss, und Talon bleibt nicht untätig. Der richtige Zeitpunkt, um mich zu zeigen, ist noch nicht gekommen. Vor allem, da ich bezweifle, dass ihr den Krieg überlebt oder auch nur die nächste Schlacht. Ich habe euch hierher gerufen, weil ich Informationen habe, die euch helfen könnten und die vor allem du, Ex-Agent Cobalt, sehr interessant finden wirst. Wie du ja bereits gesagt hast, zieht ein Krieg auf. Man kann es mit einer so großen Organisation wie Talon nicht mit einer bunt gemischten Gruppe aus Nestlingen und Einzelgängern aufnehmen. Ihr werdet Verbündete benötigen, und davon habt ihr im Moment nicht sehr viele.«
Du könntest uns trotzdem helfen, dachte ich störrisch, auch wenn ich es nicht laut aussprach. Einen gigantischen Wyrm, der einen wie einen Käfer über die Mauer schleudern konnte, verärgerte man besser nicht. Dennoch war ich wütend. Wir waren den ganzen weiten Weg hierhergekommen und hatten unsere Freunde zurückgelassen, obwohl sie noch in Gefahr schwebten, um uns mit dem legendärsten Einzelgänger der Welt zu treffen. Nur damit der uns dann sagte, er wolle sich nicht die Mühe machen, mit uns gegen Talon zu kämpfen.
Meine Rückenstacheln sträubten sich. Cobalt warf mir einen warnenden Blick zu, als ob er wusste, was ich dachte, und wandte sich wieder an den Wyrm.
»Du weißt nicht zufällig, wo wir welche finden können?«, meinte er.
Ouroboros lachte. »In der Tat, das weiß ich. Die Drachen dort sind sehr unglücklich mit der Organisation, und manche sind schon sehr lange an diesem Ort. Sie würden sich nur zu gern dem Kampf gegen Talon anschließen. Wenn ihr zu ihnen gelangen könnt.«