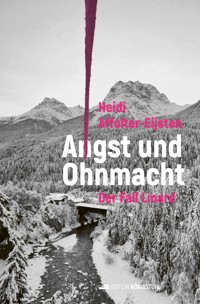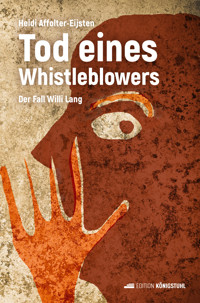
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Edition Königstuhl
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2024
«Tod eines Whistleblowers» schildert unterschiedliche Fälle von Whistleblowing. Sie basieren auf realen Fällen, wurden jedoch aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes verfälscht. Der berühmte Fall im Zürcher Sozialamt lief anders ab, verratene Bankdirektoren gibt es viele und für gewisse Nachbarn ist Whistleblowing ein mit Passion gepflegtes Hobby. Beliebt sind Anzeigen wegen möglicherweise nicht bewilligten Bauten oder vermuteter Finanz- oder Steuerdelikte. Der Neid ist überall. Anonymes Whistleblowing hat jedoch auch eine andere, unter Umständen tragische Seite, dann nämlich, wenn Betroffene sich nicht damit abfinden, dass jemand ihr Leben so im Vorbeigehen zerstört, und zum Gegenangriff übergehen – und genau darum geht es in dieser spannenden Geschichte.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 215
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Heidi Affolter-Eijsten
Tod eines Whistleblowers
Heidi Affolter-Eijsten
Tod eines Whistleblowers
Der Fall Willi Lang
Impressum
© 2023 Edition Königstuhl
Alle Rechte vorbehalten.
Kein Teil dieses Buches darf ohne schriftliche Genehmigung des Verlags reproduziert werden, insbesondere nicht als Nachdruck in Zeitschriften oder Zeitungen, im öffentlichen Vortrag, für Verfilmungen oder Dramatisierungen, als Übertragung durch Rundfunk oder Fernsehen oder in anderen elektronischen Formaten. Dies gilt auch für einzelne Bilder oder Textteile.
Bild Umschlag: lollok/depositphotos.com
Gestaltung und Satz: Stephan Cuber, diaphan gestaltung, Bern
Lektorat: Manu Gehriger
Druck und Einband: CPI books GmbH, Ulm
Verwendete Schriften: Adobe Garamond Pro, Akrobat
ISBN 978-3-907339-45-9
eISBN 978-3-907339-77-0
Printed in Germany
www.editionkoenigstuhl.com
Heidi Affolter-Eijsten wurde in Amsterdam geboren. Nach Umzug in die Schweiz Besuch des Gymnasiums und der Universität in Zürich. Studium der Rechte und Promotion. Seit 1986 als selbständige Rechtsanwältin in Zürich tätig, langjährige Lehrbeauftragte für Strafrecht und Mitautorin eines Strafrechtskommentars.
Zahlreiche Publikationen, u. a. eines Buches zu ethischen Grundwerten im Spannungsfeld von Realität und Zeitgeist. In ihrem Buch «Angst und Ohnmacht» greift die Autorin das erste Mal ein aktuelles Thema auf und bettet es in eine spannende Handlung ein. Ihre langjährige Erfahrung als Anwältin in Strafverfahren kommt ihr dabei zu Gute.
«Der grösste Lump im ganzen Land
ist und bleibt der Denunziant»
(August Heinrich Hofmann von Fallersleben)
«Der Zweck, sagt ihr, heiligt die Mittel?
Das Dogma heiligt den Büttel?
Den Galgen? Den Kerkerkittel?
O schwarzumflortes Kapitel!
Fest steht trotz Schrecken und Schreck:
Die Mittel entheiligen den Zweck!»
(Erich Kästner)
Inhalt
Vorwort zu «Tod eines Whistleblowers»
Kapitel 1 Verrat ist kurz, die Reue lang
Kapitel 2 Willi Lang
Kapitel 3 Die Probleme der Eheleute Denoth
Kapitel 4 Skandal lokal
Kapitel 5 Marc Antons schlechtes Gewissen
Kapitel 6 Carolina Denoth
Kapitel 7 Marc Antons Wut
Kapitel 8 Anna Berger Conti und die neue Klientin
Kapitel 9 Margot Küng
Kapitel 10 Ratlosigkeit
Kapitel 11 Serafin Lusch
Kapitel 12 Margot Küngs Einvernahme
Kapitel 13 Wo ist Willi?
Kapitel 14 Anna und das Whistleblowing
Kapitel 15 Der Tote vom Zürichberg
Kapitel 16 Bei Thea Lang
Kapitel 17 «Auch du bist verletzbar!»
Kapitel 18 Verdächtige, Verdächtige…
Kapitel 19 Anna und der Staatsanwalt
Kapitel 20 Chaos
Kapitel 21 Teamsitzung
Kapitel 22 Der orientalische Dolch
Kapitel 23 Das Gespräch mit Anna
Kapitel 24 Annas Gedanken
Kapitel 25 Frieds Traum
Kapitel 26 Die Befragung von Janosh Dreher
Kapitel 27 Die Befragung von Simone Klarer
Kapitel 28 Und jetzt?
Kapitel 29 Der Keller der Denoths
Kapitel 30 Nach der Pressemitteilung: Marc Anton Denoth
Kapitel 31 Jan Kramer
Kapitel 32 Margot Küng
Kapitel 33 Staatsanwalt, Anwältin und die lieben Nachbarn
Kapitel 34 Serafin Luschs Ängste
Kapitel 35 Und im Sozialamt?
Epilog
Vorwort zu «Tod eines Whistleblowers»
Fast täglich liest man von Whistleblowern, die wirkliche oder scheinbare Missstände publik gemacht haben. Das Thema ist gerade jetzt (Dezember 2022) hochaktuell und so verwundert es nicht, dass sich die Politik vermehrt der Problematik Whistleblower annimmt. Das aktuelle Beispiel liefert der Deutsche Bundestag mit dem neu beschlossenen Hinweisgeberschutzgesetz (oder eben auf Neudeutsch «Whistleblower Gesetz»). Ziel des Gesetzes soll ein besserer Schutz von Whistleblowern (Hinweisgebern) aus Behörden und Unternehmen sein. Das ist für Hinweisgeber, die mit ihrem Namen zu dem, was sie bekannt geben, stehen, nachvollziehbar. Das Gesetz soll aber – und das ist problematisch – auch für anonyme Whistleblower gelten. Es entspricht einer allgemeinen Lebenserfahrung, dass jemand eher zum Denunzieren bereit ist – und letztlich ist anonymes Whistleblowing nichts anderes – wenn er oder sie dank der Anonymität nichts dabei riskiert. Das sind eben keine Helden, anders als jene, die mit Namen dazu stehen. Die Motive der anonymen Whistleblower sind oft alles andere als edel oder sozial gerechtfertigt. Im Gegenteil: Anonymes Whistleblowing vergiftet das Klima überall; in Betrieben und letztlich auch das Klima in der Gesellschaft. Sicher: Es führt hin und wieder zu gewünschten Resultaten; und da soll der Zweck die Mittel heiligen? Unser nördlicher Nachbar scheint mit seinem neuen Hinweisgebergesetz die Erfahrungen von zwei Diktaturen des 20. Jahrhunderts vergessen zu haben, Diktaturen, die massgeblich auf Denunziantentum aufbauten.
Für anonymes Whistleblowing wird heute geworben. Compliance Abteilungen von Firmen legen den Angestellten nahe, ihnen möglichst jegliches Fehlverhalten oder Verdacht auf Fehlverhalten von Firmenangehörigen zu melden. Steuerverwaltungen lieben Whistleblower und Zeitungen erst recht, liefern sie ihnen doch wunderbare Skandale und Schlagzeilen. So gibt es Medien, egal ob Zeitungen, Webseiten oder andere, die auf der ersten Seite die Leser auffordern, ihnen möglichst publizitäts- oder skandalträchtige Geschichten mitzuteilen, gerne anonym – sie würden von der Rechtsabteilung der entsprechenden Zeitung geschützt.
Die durch anonymes Whistleblowing Verratenen können sich eigentlich kaum wehren. Für sie gilt die Unschuldsvermutung nicht, wohl aber bleibt der anonyme Verdacht für immer bestehen. Anonymes Whistleblowing holt schlicht das Schlechteste aus den Menschen heraus.
Im Buch werden verschiedenen Arten des Whistleblowings beschrieben. Sie sind alle irgendwann geschehen, wobei Personen und Zeitpunkt aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes verfälscht wurden. Der zu Beginn des 21. Jahrhunderts berühmt gewordene Whistleblower Fall im Zürcher Sozialamt lief anders ab, verratene Bankdirektoren gibt es viele – sie sind im Fokus, Whistleblowing in der Nachbarschaft ist für gewisse Nachbarn ein beliebtes Hobby, wie die Autorin aus ihrer Anwaltspraxis weiss. Beliebt sind unter anderem Anzeigen bei möglicherweise nicht bewilligten Bauten von Wintergärten, wie auch vermutete Finanzdelikte. Wenn jemand plötzlich über scheinbar mehr Geld verfügt, gibt es Nachbarn, die schnell mit einer Anzeige wegen vermuteter Steuerhinterziehung reagieren. Letzteres wird dem Steueramt gemeldet. Der Neid ist überall. Die Fälle sind somit nicht erfunden, leider.
Anonymes Whistleblowing hat jedoch auch eine andere, unter Umständen tragische Seite, dann nämlich, wenn der oder die Betroffene sich nicht damit abfindet, dass jemand sein oder ihr Leben so im Vorbeigehen anonym zerstört hat.
Kapitel 1 Verrat ist kurz, die Reue lang
Rosmarie Kunz ärgert sich an diesem noch kühlen Junimorgen über ihren zweijährigen Beagle, der ungestüm immer wieder ins Dickicht rennt und auf ihr Rufen hin nicht zurückkommen will. Der morgendliche Spaziergang im Zürichberg Wald wird daher heute wohl wieder länger dauern und dabei hätte Rosmarie Kunz an diesem Tag noch einiges zu tun. Schon das dritte Mal ist Billy jetzt verschwunden, kam die ersten zwei Male nach längerem Rufen schliesslich zurück. Doch dieses Mal kommt er gar nicht zurück. Er bellt in der Ferne mitten im dunklen Dickicht. Rosmarie Kunz schimpft und weiss, dass sie sich jetzt in die unwegsame Tiefe des Waldes begeben muss, um den Hund zu holen. Es ist nicht das erste Mal. Wahrscheinlich hat er wieder ein totes Reh gefunden. Was sie allerdings erstaunt, ist sein mit Heulen durchsetztes, heftiges Bellen. Das tut er doch eigentlich sonst nicht. Mühsam kämpft sie sich in den Wald hinein und erkennt schliesslich von weitem das weiss-rotbraune Fell ihres Hundes. Auf ihr Rufen hin kommt er wiederum nicht, obwohl er sie jetzt eigentlich sehen müsste. Sie geht schimpfend hin, bleibt jedoch völlig erstarrt stehen, als sie sieht, was Billy so in Aufregung versetzt hat. Auf dem Boden liegt ein Mann. Er liegt auf dem Bauch und ist offensichtlich tot. Rosmarie Kunz bleibt auf Abstand, packt ihren Hund, der mittlerweile am Hosenbein des Toten zieht und zerrt ihn zurück auf den Weg. Mitten im Wald hat sie keinen Mobileempfang auf ihrem Smartphone, sodass sie sich einen Ort suchen muss, wo sie die Polizei anrufen kann. Die Fragen der Polizistin, die abnimmt, kann sie kaum beantworten. Sie sei nicht nahe ran gegangen, es sei aber klar ein Mann und er sei tot. Nein, sie habe nicht den Puls gefühlt, sie habe ihn ganz sicher nicht angefasst, aber dass er tot war, sei erkennbar gewesen. Über sein Alter könne sie nichts Genaues sagen, es müsse aber ein Mann in mittleren Jahren sein. Sie habe nur auf dem Hinterkopf sein schütteres, leicht ergrautes Haar gesehen. Sie beschreibt der Polizistin genau ihren Standort und nach einer halben Stunde sieht sie, wie ein Polizeifahrzeug den Waldweg hinauffährt. Rosmarie Kunz fragt sich, wie man sich in einer solchen Situation zu verhalten hat. Schliesslich hat sie in ihren 51 Jahren noch nie einen Toten gefunden, weder im Wald noch sonst wo.
Sie beschreibt dem aussteigenden Polizisten, der sich als Wachtmeister Jon Sobic vorstellt, den Fundort. Dieser fragt sie, ob sie den Toten kenne. «Nein», meint Rosmarie Kunz, «ich habe ja sein Gesicht nicht gesehen, und überhaupt, ich habe ihn nicht berührt.» Warum sie denn so gefasst sei, fragt Sobic. Dumme Frage, denkt Rosmarie Kunz. «Ja, wie sollte ich denn sonst sein? Mein Beagle war in heller Aufregung, wenn ich auch noch durchdrehe, hilft das niemandem.» «Führen Sie mich bitte zum Fundort», fordert sie Sobic auf. Rosmarie Kunz seufzt und geht den unwegsamen Weg das dritte Mal, schürft sich wiederum ihre Arme an Ästen und dornigen Büschen auf und gelangt schliesslich an den Fundort, wo sich nichts geändert hat. Wachtmeister Sobic und seine Kollegin, die Gefreite Rosa Morger, ziehen sich Handschuhe an und unterziehen den Toten einer ersten Untersuchung. „Da muss der kriminalistische Dienst kommen», meint Sobic schliesslich: «Rufen Sie dort an, Rosa, und benachrichtigen Sie auch die Rechtsmedizin. Was ich sehe, sind mindestens vier Einstiche im Rücken, wohl von einem Messer. Der Mann wird somit nicht mitten im Wald an einem Herzinfarkt gestorben sein. Ich frage mich, ob er hier ermordet worden ist. Drehen wir ihn mal um.» Frau Kunz, die noch immer danebensteht und sich fühlt wie in einem Dienstagabend-Krimi im Fernsehen, wird unruhig und fragt, ob sie gehen könne. «Natürlich», meint Sobic, «gehen Sie nur, geben Sie aber vorher dem Aspiranten Huber – er fährt das Polizeiauto – ihre Personalien. Wir werden wahrscheinlich noch einige Fragen haben.»
Nachdem Rosmarie Kunz gegangen ist, drehen Sobic und Rosa Morger den Toten um. Beide schrecken zurück. Das Gesicht des Toten hat Blutflecken und er scheint irgendetwas im seltsam aufgerissenen Mund zu haben. Sobic ist ein erfahrener Ermittler, aber ein solches Bild hat sich ihm noch nie geboten. Vorsichtig öffnet er den Mund des Toten und holt etwas in ein Stofftuch gewickeltes heraus. Er öffnet es und bemerkt mit Ekel, dass es die abgeschnittene Hälfte einer Zunge ist. Rosa Morger wird grün im Gesicht und muss sich kurz ins Dickicht zurückziehen. Sobic schaut sich das Tuch genauer an und erkennt eine Schrift. Mit Mühe entziffert er «Verrat ist kurz, die Reue lang». Er kann sich darauf keinen Reim machen.
Kapitel 2 Willi Lang
Die Zürichbergstrasse, benannt nach eben diesem Zürichberg, ist eine edle Adresse in Zürich. Es ist das Quartier, in dem Wilhelm und Thea Lang wohnen. Ein schönes Quartier mit hübschen Einfamilienhäusern und herrschaftlichen Villen älteren Datums, die heute alle kaum mehr bezahlbar sind. Die Bewohner sind sich ihrer Privilegien bewusst und hüten und pflegen ihre Strasse und die daran anstossenden Gärten mit viel Sorgfalt. Man kennt sich. Die meisten Bewohner wohnen schon seit vielen Jahren dort.
Das Haus der Langs gehört Thea Lang. Es ist das Erbe ihres Vaters und sie hat es vor etwas mehr als zwei Jahren in die Ehe eingebracht. Das väterliche Erbe bestand jedoch nicht nur aus diesem Zürichberg-Haus, sondern zusätzlich auch aus einem beachtlichen Vermögen. Davon profitierte nach der Eheschliessung auch Wilhelm, im Quartier nur Willi genannt. Aber anstatt sich darüber zu freuen, entwickelte Willi einen Riesenkomplex: Alles gehörte Thea. Obwohl Thea, eine bescheidene und liebenswürdige Frau, ihn das nicht spüren liess, hatte er immer das Gefühl, er müsse Thea fragen, wenn er sich etwas Aussergewöhnliches anschaffen wollte. Theas Vermögen war für Willi Liebe auf den ersten Blick gewesen. Thea, die damals noch Loher hiess, war vor drei Jahren – im Sommer 2018, als er sie im Sozialamt, wo sie beide arbeiteten, das erste Mal sah – das gewesen, was man früher uncharmant eine alte Jungfer genannt hatte. Ehen werden am Arbeitsplatz geschlossen, dachte sich Willi, und verstärkte seine Bemühungen, nachdem er genaueres über Thea, besonders über Theas Steuervermögen – man hat ja so seine Beziehungen – erfahren hatte.
Thea hätte sich wohl besser auch über Willis Vorleben erkundigt. Aber als Mittvierzigerin war sie des Alleinseins müde und Einsamkeit ist ein schlechter Ratgeber. Bisher hatte es keine valablen Kandidaten gegeben und Willi konnte charmant sein, war es wenigstens bis nach der Eheschliessung. Dabei war Thea ein Juwel: Liebenswürdig, intelligent, fleissig und hilfsbereit, kurzum ein Engel der sozialen Dienste der Stadt Zürich – und so wurde sie auch überall genannt. Doch das interessierte Willi herzlich wenig. Er hatte in seinen bald 52 Jahren schon viele Beziehungen gehabt und lebte von den Frauen. Wenn sie ihn langweilten, verliess er sie von einem Tag auf den anderen, allerdings erst, wenn er eine bessere Partie in Aussicht hatte. Und Thea war wahrlich eine gute Partie. Willi hingegen war ein Ausbund an Rücksichtlosigkeit, der Empathie wohl vortäuschen konnte, aber nie welche empfand. Freunde hatte er kaum und eine Familie schien er auch keine zu haben.
Das alles wusste Thea nicht, wollte es gar nicht wissen, denn sie glaubte sich sehr verliebt. Nur ein halbes Jahr nach dem Kennenlernen heirateten sie und alle mochten Thea ihr spätes Glück gönnen – wenn es denn ein Glück geworden wäre. Schon kurz nach der Eheschliessung wurde Willi ein missgelaunter Ehemann, der, als ihm ein Jahr nach Eheschliessung eine halbe Invalidenrente (IV-Rente) zugesprochen worden war, viel zu oft zu Hause sass und sich langweilte. Willi war jahrelang Sachbearbeiter im Sozialamt gewesen. Thea hatte nie ganz herausgefunden, was denn der Grund für die halbe IV-Rente und die damit verbundene Reduktion auf eine 50- prozentige Stelle gewesen war. Er hatte die IV-Rente schon weit vor ihrer Beziehung beantragt. Theas Nachfragen blieben unbeantwortet. Es schien ein sensibles Thema zu sein. Willi war offensichtlich gesund und fit. Nur an Manneskraft fehlte es ihm – diesbezüglich führte Thea enttäuscht ihr jungfräuliches Leben weiter. Doch immerhin war sie nicht mehr allein in ihrem grossen Haus, und da die Eheleute Lang eigentlich nicht auf ein Einkommen von Willi angewiesen waren, fand sich Thea mit dem Minderverdienst ab. Dass Willi seit der Reduktion seines Arbeitspensums meistens zu Hause war, störte Thea deutlich mehr.
Hobbys hatte Willi keine, ausser einem: Im Estrich hatte er ein Fernrohr aufgestellt und beobachtet zu allen Tages- und Nachtzeiten die Nachbarn, entweder mit dem starken Fernrohr oder mit diversen anderen, handlicheren Ferngläsern. Das hatte zwischen Thea und Willi schon mehrmals zu Streit geführt. Thea befürchtete, nicht zu Unrecht, dass irgendein Nachbar das mal bemerken und sich daran stören könnte.
Es dauerte, bis die Nachbarn auf Willis Hobby aufmerksam wurden. Die Langs, besonders Thea, waren im Quartier beliebt. Gegen aussen war Willi sehr freundlich und hilfsbereit, hatte schon zweimal das sommerliche Quartierfest organisiert – so weit war nachbarschaftlich vorerst alles in Ordnung – bis eines Tages der Nachbar zur linken, Hans Schuppisser, einen Anruf von Willi erhielt, mit dem Hinweis, er habe eine tote Katze auf der Terrasse. Nun, Schuppissers hatten tatsächlich eine tote Katze auf der hinteren Terrasse, aber die Terrasse war eigentlich von nirgendwo her einsehbar. Von der Terrasse beziehungsweise vom Fundort der Katze her schaute Hans Schuppisser hinauf zu Willis und Theas Haus. Eigentlich konnten die Langs die Katze nur sehen, wenn sie sich aus der Lukarne im obersten Stock ihres Hauses hinausbeugten. Hans Schuppisser war irritiert. Am nächsten Tag traf er Thea Lang auf der Strasse und fragte sie freundlich, ob sie denn die tote Katze auch gesehen habe. «Nein», antwortete Thea ebenso freundlich, aber sie sei auch nicht so aufmerksam wie Willi. Von wo aus Willi denn die Katze entdeckt habe, wollte Hans Schuppisser wissen. «Keine Ahnung», meinte Thea, nun doch etwas besorgt, vielleicht vom obersten Stockwerk aus, sie werde Willi fragen.
Die Geschichte versandete und schliesslich dachte Hans Schuppisser nicht mehr daran, bis er drei Monate später Carolina Denoth auf der Quartierstrasse traf. Die Denoths sind die VIPs dieses gehobenen Zürichbergquartiers. Marc Anton Denoth ist CEO der Turicum Bank, die in letzter Zeit des Öfteren positiv in den Medien erwähnt worden war, als erfreuliches Ausnahmebeispiel für die Schweizer Bankenwelt. Das Haus der Denoths liegt direkt gegenüber dem Hause der Langs. Es ist das grösste und schönste Haus an der Strasse, eine richtige Villa mit parkähnlichem Garten. Ein hoher Zaun schirmt das Denoth’sche Grundstück ab und der Garten ist von der Strasse aus nicht einsehbar.
Carolina Denoth erzählte also Hans Schuppisser, dass sie schon zwei Mal, als sie in ihrem Bad im ersten Stock gewesen sei, direkt in einen Feldstecher geschaut habe, der auf gleicher Höhe aus dem Fenster hinter dem Badezimmervorhang der Langs hervorgeguckt habe. Ganz sicher sei sie sich nicht, aber jetzt hätten sie ein blickdichtes Rouleau vor das Badezimmerfenster montiert. Ohnehin, seit Willi Lang so oft zu Hause sei, habe sie schon mehrmals das Gefühl gehabt, dass er eigentlich nicht viel mache, und sie fühle sich auch immer mal wieder beobachtet.
Während Carolina Denoth und Hans Schuppisser miteinander redeten, kam Kevin Minder hinzu – er wohnt im Haus rechts von den Langs – und Hans Schuppisser und Carolina Denoth erzählten ihm die ganze Geschichte. Schuppisser erinnert sich auch wieder an die tote Katze auf der nicht einsehbaren hinteren Terrasse seines Hauses. «Das ist aber unangenehm», meinte Kevin Minder, «was soll das? Sollen wir mal mit ihm reden?» «Nun», meinte Carolina Denoth, «beweisen kann ich es nicht und verboten ist es ja eigentlich auch nicht, er kann ja behaupten, dass er, was weiss ich, die Landschaft beobachte. Aber behalten wir ihn im Auge.» Die Geschichte machte schliesslich im Quartier die Runde und in der Folge erhielt Willi Lang den Übernahmen «Peeping Willi». Das realisierte Willi allerdings nicht. Thea bemerkte jedoch, dass die Nachbarn zurückhaltender und weniger kontaktfreudig geworden waren. Ein Sommerfest sollte dieses auch Jahr nicht stattfinden, obwohl die Covidvorschriften im Juli 2021 Gartenfeste draussen im kleineren Rahmen erlaubt hätten. Das stimmte Thea nachdenklich. Sie sprach Willi darauf an:
«Willi, falls du es nicht gemerkt haben solltest, unsere Nachbarn gehen immer mehr auf Distanz zu uns. Sie haben realisiert, dass du sie mit Fernrohr und Feldstecher beobachtest.» «Das stimmt doch gar nicht», warf Willi ein. «Lass mich ausreden Willi. Du hast Fernrohre und du hast Feldstecher. Das haben sie nun mal bemerkt und Caroline Denoth fühlt sich beobachtet.» «Diese Bonzengöre sollte besser auf ihren Mann aufpassen …» Thea unterbrach ihn wieder. «Diese Bonzengöre hat aber auf der Höhe ihres Badezimmers einen Feldstecher bemerkt, der aus einem Fenster unseres Hauses hinter dem Vorhang hervorschaute. Zudem hast du gewusst, als du mich geheiratet hast, dass du in ein, wie nennst du es, «Bonzenquartier» einziehst, und du hast das damals sehr gewollt, so besehen, hast auch du eine Bonzengöre geheiratet. Meinst du, die Nachbarn bemerken deine Einstellung nicht, meinst du, sie spüren nicht, dass du sie beobachtest?» «Ich beobachte sie nicht!» «Doch, das tust du Willi, oder mindestens muss es für die Nachbarn so aussehen. Weisst du, wie sie dich mittlerweile im Quartier nennen? Peeping Willi, guckender Willi, wahrscheinlich in Anlehnung an einen alten Film, der Peeping Tom hiess. Das ist kein Ruhmesblatt für dich Willi. Mich belastet das. Ich wohne seit vielen Jahren in diesem Quartier, hatte nie Probleme mit den Nachbarn, im Gegenteil, wir hatten immer die beste Beziehung untereinander. Einige kenne ich schon seit meiner Kindheit. Die ganze Strasse ist mein Zuhause und dieses Zuhause beschmutzt du nun. Die Abwehr der Nachbarn gegen dich richtet sich auch gegen mich. Sag nicht, dass du das nicht bemerkt hast. Was denkst du, warum dieses Jahr kein Sommerfest stattfindet?»
«Weil wir noch immer in der Pandemie sind», antwortete Willi. «Nein, Willi, das ist es nicht. Jetzt, im Sommer 2021 sind kleinere Feste wieder erlaubt. Liest du denn keine Zeitungen?» «Du siehst Gespenster, Thea!» «Ich sehe nur ein Gespenst Willi, und das bist du. Was immer du gemacht hast, was immer du machst, das die Nachbarn so erzürnt, hör auf damit! Und überhaupt: warum bist du so viel zu Hause? Ich glaube, das Beobachten der Nachbarn ist zu einer eigentlichen Sucht geworden. Warum gehst du nicht mehr mit der Harley-Davidson, die ich dir zu unserer Hochzeit geschenkt habe, auf Reisen oder auf Ausflüge? Und du hast mir nie gesagt, weshalb du fünfzig Prozent invalid geschrieben worden bist. Du bist doch fit wie ein Turnschuh. Das sehe nicht nur ich. Auch im Sozialamt tuscheln sie über dich. Dir wird nachgesagt, allerdings hinter vorgehaltener Hand, dass du deine IV-Rente mit unlauteren Mitteln erschlichen hast. Irgendwie sollst du einen besonderen Draht zu unserem Chef haben. Willi, da sind so viele Probleme, die dich umgeben, und nur du scheinst sie nicht zu bemerken. Nochmals, hör mit all dem auf, hör auf!»
Willi schaute Thea erstaunt an. Noch nie hatte sie die Stimme erhoben, schon gar nicht gegen ihn, und in ihrem Gesicht war etwas, das er noch nie gesehen hatte. War es Trauer, Besorgnis? In diesem lieben, runden Gesicht, auf das er zu Anfang ihrer Beziehung so angesprochen hatte, das immer voller Liebe und Zärtlichkeit für ihn gewesen war. Willi schüttelte den Kopf. Das konnte nicht sein. Schweigend verliess er das Haus.
Einen Monat später erhielt Kevin Minder von der Stadtverwaltung einen Brief mit dem Hinweis, sie habe Kenntnis davon erhalten, dass er einen nicht bewilligten Wintergarten an sein Haus angebaut habe. Ein Bauinspektor der Stadt würde in den nächsten Tagen eine Besichtigung vornehmen, um zu beurteilen, ob eine nachträgliche Baubewilligung möglich sei, oder ob Kevin den Wintergarten wieder entfernen müsse. Kevin war wütend. Da musste ihn doch jemand verpfiffen haben. Sein hinterer Garten mit dem neuen Wintergarten ist von den Nachbarn nicht einsehbar, ebenso wenig wie der hintere Teil des Gartens der Schuppissers. Beim Verdacht, wer ihn verpfiffen haben könnte, musste er nicht lange überlegen. Er ging zum Haus Schuppisser und klingelte. Hans Schuppisser öffnete ihm und liess ihn eintreten. Die Schuppissers luden ihn zu einem Glas Wein ein und Kevin erzählt die Geschichte des Wintergartens. «War er denn nicht bewilligt?», fragte Hans. «Nun ja, ich habe kein Baugesuch gestellt, es ist auch ein ziemlich rudimentäres Bauwerk, so klein, dass ich nicht daran gedacht habe, es bewilligen zu lassen. Aber natürlich, wenn der Bauinspektor zur Überzeugung kommt, dass ich illegal einen Wintergarten angebaut habe, bekomme ich Ärger. Einsehbar ist er eigentlich nur aus dem obersten Stock aus der Lukarne der Langs, ebenso wie damals deine tote Katze. Der aufmerksame Willi könnte das natürlich bemerkt und mich anonym angezeigt haben.»
Hans Schuppisser rief wütend aus: «Dieser Willi vergiftet das bisher so harmonische Nachbarschaftsklima im Quartier. Schau Kevin, wir gehen jetzt rüber zu den Langs und fragen ihn einfach.» Sie gingen hinüber und klingelten an der Türe der Langs. Doch es war Thea, die öffnete, und als sie die Gesichter ihrer Nachbarn sah, vermutete sie sofort Ärger. Nein, der Willi sei nicht da, er sei für ein paar Tage zu einem Bekannten aufs Land gefahren. Ob sie ihm denn etwas ausrichten könne. «Nein, nein», meinen die Nachbarn, «wir kommen zurück, wenn er wieder da ist.» Wiederum macht die Geschichte im Quartier die Runde und aus Peeping Willi wurde Willi Whistleblower. Der Wintergarten der Minders war wirklich illegal. Zwar gelang es Kevin, ein nachträgliches Baugesuch zu stellen, das schliesslich auch bewilligt wurde, doch er musste eine gesalzene Busse bezahlen.
Kapitel 3 Die Probleme der Eheleute Denoth
Die Denoths sind seit bald 30 Jahre verheiratet und die Beziehung ist nicht mehr ganz so frisch und schon gar nicht mehr so leidenschaftlich, wie sie dereinst war. Sie leben dennoch durchaus zufrieden zusammen und gehen freundlich und respektvoll miteinander um. Dreimal im Jahr geht Carolina Denoth für zwei bis drei Wochen in die Kur und in dieser Zeit bekommt Marc Anton Denoth, allerdings erst seit der Pandemie, ab und zu Besuch von einer geheimnisvollen Dame in einem roten Alfa Romeo. Wer die Dame ist, weiss niemand, und das soll auch so bleiben. Denoth ist diskret. Der Alfa Romeo fährt jeweils in die Garage, deren Tor sich dann sofort wieder schliesst. Am nächsten Morgen in der Früh verlässt der rote Alfa wieder das Grundstück beziehungsweise die Garage der Denoths. Die Besuche haben keine erkennbare Regelmässigkeit, was auch zum Sicherheitsdispositiv Denoths gehört.
Doch Denoth hatte nicht mit Willi Whistleblower gerechnet. Eher zufällig bemerkte der aufmerksame Willi eines Abends, wie der rote Alfa bei den Denoths in die Garage fuhr, die sich dann sofort wieder schloss. Trotzdem erhaschte Willi einen kurzen Blick auf die offensichtlich attraktive Lenkerin. Er wusste, dass Carolina Denoth mal wieder in der Kur weilte, und die Neugier liess ihn erschauern: «Aha, Marc Anton Denoth, der seriöse, vielgelobte CEO einer renommierten Bank und Familienvater – ein Ehebrecher vor dem Herrn, besser vor dem Nachbarn, habe ich es doch geahnt», grinste Willi – und Willi grinst viel und oft, wenn er jemanden ertappt hatte.
Am nächsten Morgen stand Willi schon um 5 Uhr mit seinem iPhone hinter der Hecke der Denoths. Tatsächlich verliess kurz darauf die Dame im roten Alfa Romeo die Garage. Willi machte schnell ein paar Fotos, auf denen man die Autonummer sehen konnte. Auch das Profil der Frau war erkennbar. Dieses Profil kam ihm bekannt vor. Er notierte sich sicherheitshalber das Nummernschild des Alfa Romeo auf einem Zettel. Bald darauf fand er heraus, auf wen der Alfa Romeo eingetragen war – und sein Grinsen wurde noch viel breiter.
Aber auch Willi wurde beobachtet. Nach ein paar Schnappschüssen steckte Thea ihr iPhone wieder ein. Ihr Lächeln war jedoch bitter.