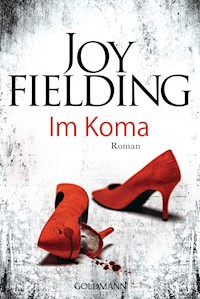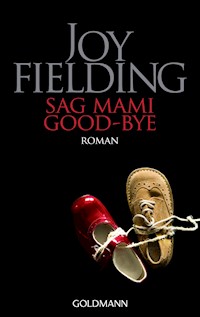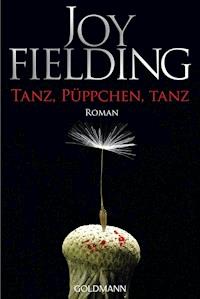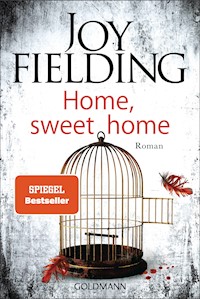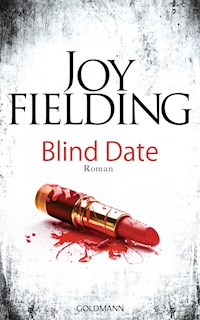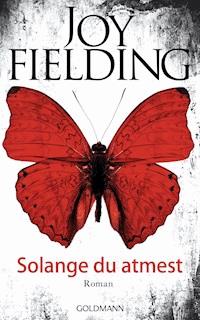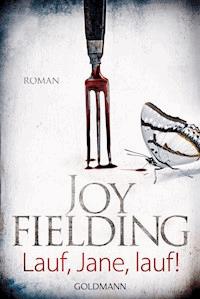Das Buch
Jamie Kellog lebt in Florida und hat mit ihren beinahe dreißig Jahren noch immer Schwierigkeiten, das Leben in den Griff zu bekommen. Auch mit der Liebe hat es bisher nicht geklappt, denn Jamie hat ein ausgesprochenes Faible für charmante Herzensbrecher. Alles ändert sich aber an dem Abend, an dem sie Brad Fisher begegnet und zum ersten Mal das Gefühl hat, wirklich verstanden zu werden. An seiner Seite fühlt sie sich geborgen und sicher, sie schenkt Brad ihr ganzes Vertrauen. Als er ihr vorschlägt, eine gemeinsame Reise nach Ohio zu unternehmen, ist sie überglücklich, denn was wäre schöner, als einige Tage mit ihrem Geliebten unterwegs zu sein? Doch Brad ist in Wahrheit ein skrupelloser Killer …
Joy Fielding
gehört zu den unumstrittenen Spitzenautorinnen Amerikas. Seit ihrem Psychothriller „Lauf, Jane, lauf“ waren alle ihre Bücher internationale Bestseller. Joy Fielding lebt mit ihrem Mann und zwei Töchtern in Toronto, Kanada, und in Palm Beach, Florida. Weitere Informationen unter www.joy-fielding.de
Mehr von Joy Fielding:
Die Schwester • Sag, dass du mich liebst • Das Herz des Bösen • Am seidenen Faden • Im Koma • Herzstoß • Das Verhängnis • Die Katze • Sag Mami Goodbye • Nur der Tod kann dich retten • Träume süß, mein Mädchen • Tanz, Püppchen, tanz • Schlaf nicht, wenn es dunkel wird • Nur wenn du mich liebst • Bevor der Abend kommt • Zähl nicht die Stunden • Flieh wenn du kannst • Ein mörderischer Sommer • Lebenslang ist nicht genug • Schau dich nicht um • Lauf, Jane, lauf!
Joy Fielding
Träume süß,mein Mädchen
Roman
Deutsch von Kristian Lutze
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Die Originalausgabe erschien unter dem Titel
»Mad River Road«
bei Atria Books, New York
Ungekürzte Lizenzausgabe
der RM Buch und Medien Vertrieb GmbH
und der angeschlossenen Buchgemeinschaften
Copyright © der Originalausgabe 2006 by Joy Fielding, Inc.
Copyright © der deutschsprachigen Erstveröffentlichung 2006
by Wilhelm Goldmann Verlag, München,
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH
Neumarkter Str. 28, 81673 München
Umschlaggestaltung: UNO Werbeagentur
Umschlagmotiv: FinePic, München
ISBN : 978-3-641-02811-4
V003
www.goldmann-verlag.de
www.penguinrandomhouse.de
Inhaltsverzeichnis
Das Buch
Die Autorin
Widmung
Prolog
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Weiterleben Von Lily Rogers
Weiterleben Von Lily Rogers
Weiterleben Von Lily Rogers
Weiterleben Von Lily Rogers
Weiterleben Von Lily Rogers
Weiterleben Von Lily Rogers
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Danksagung
Copyright
Für Novella
Prolog
Drei Uhr in der Früh. Seine liebste Tageszeit. Der Himmel war dunkel, die Straßen waren verlassen. Die meisten Menschen schliefen. Wie die Frau im Schlafzimmer am Ende des Flures. Er fragte sich, ob sie träumte, und lächelte bei dem Gedanken, dass ihr Albtraum erst beginnen sollte.
Er lachte, sorgfältig darauf bedacht, keinen Laut von sich zu geben. Es wäre sinnlos, sie zu wecken, bevor er entschieden hatte, wie er vorgehen wollte. Er stellte sich vor, wie sie sich im Bett rührte, aufrichtete, ihn näher kommen sah und wie üblich halb belustigt, halb geringschätzig den Kopf schüttelte. Er hörte die Verachtung in ihrer tiefen, kehligen Stimme. Das ist mal wieder typisch für dich, würde sie sagen, einfach blindlings loszuschlagen, dich in eine Sache zu stürzen, ohne alles vorher zu durchdenken.
Aber er hatte einen Plan, dachte er, streckte die Arme über den Kopf und bewunderte für einen Moment seinen schlanken Körper, den harten Bizeps unter dem kurzärmeligen schwarzen T-Shirt. Er hatte immer große Mühe auf sein Aussehen verwendet, und mit 32 war er in besserer Verfassung denn je. Das macht das Gefängnis mit einem, dachte er und lachte wieder in sich hinein.
Er hörte ein Geräusch, blickte zum offenen Fenster und sah, dass ein großer Palmwedel gegen die obere Hälfte der Scheibe schlug. Der stärker werdende Wind wehte die zarten Stores in mehrere Richtungen gleichzeitig, sodass die Gardinen aussahen wie flatternde Fahnen, deren rasende Bewegung er als Zeichen der Ermutigung und Anfeuerung nahm. Der Wetterbericht hatte bis zum Morgengrauen heftige Schauer im Großraum Miami angekündigt. Die hübsche blonde Ansagerin hatte sogar vor schweren Gewitterstürmen gewarnt, aber was wusste die schon? Sie las einfach ab, was auf den Texttafeln vor ihr stand, und diese dummen Vorhersagen waren in mindestens der Hälfte der Fälle falsch. Nicht, dass das irgendwie von Belang war. Morgen würde sie mit neuen unverlässlichen Prognosen wieder auf Sendung gehen. Nie wurde jemand zur Rechenschaft gezogen. Er formte eine Pistole aus seinen behandschuhten Fingern und drückte ab.
Heute Nacht schon.
Mit drei raschen Schritten schlich er auf Turnschuhen über das helle Parkett im Wohnzimmer und stieß mit der Hüfte gegen die spitze Kante eines hohen Ohrensessels, an den er nicht mehr gedacht hatte. Er fluchte leise – ein Schwall farbenprächtiger Schmähungen, die er von einem ehemaligen Zellengenossen in Raiford gelernt hatte – und zog das Fenster vorsichtig zu. Sofort übertönte das leise Summen der Klimaanlage das gequälte Heulen des Windes. Er hatte es gerade noch rechtzeitig ins Haus geschafft, dank eines Seitenfensters, das genauso leicht aufzubrechen war, wie er es immer vermutet hatte. Sie hätte mittlerweile wirklich eine Alarmanlage installieren lassen sollen. Eine allein lebende Frau. Wie oft hatte er ihr erklärt, wie leicht irgendjemand ihr Fenster aufstemmen könnte? Nun ja, sie konnte jedenfalls nicht behaupten, er hätte sie nicht gewarnt, dachte er, als er sich an die Abende erinnerte, als sie an ihrem Esstisch gesessen und Wein – oder in seinem Fall Bier – getrunken hatten. Aber selbst damals, ganz zu Beginn, als sie noch vorsichtig optimistisch war, hatte sie ihn unwillentlich wissen lassen, dass er in ihrem Haus eher geduldet als willkommen war. Und wenn sie ihn ansah, falls sie ihn überhaupt eines Blickes würdigte, zuckte unwillkürlich ihre hübsche kleine Stupsnase, als habe sie einen unangenehmen Geruch gewittert.
Dabei war sie die Letzte, die auf irgendwen herabblicken konnte, dachte er, während sich seine Augen langsam an die Dunkelheit gewöhnten, sodass er das kleine Sofa und den Couchtisch aus Glas in der Mitte des Zimmers ausmachen konnte. Das musste man ihr lassen – sie hatte das Haus nett hergerichtet. Was sagten noch immer alle über sie? Sie hatte Geschmack. Ja, das stimmte. Geschmack. Wenn sie dazu auch noch halbwegs ordentlich kochen könnte, höhnte er, als er an die grässlichen vegetarischen Gerichte dachte, die sie einem als Abendessen verkauft hatte. Verdammt, sogar der Gefängnisfraß war besser gewesen als dieser gotterbärmliche Mist. Kein Wunder, dass sie keinen Mann gefunden hatte.
Obwohl er diesbezüglich auch so seine Vermutungen hatte.
Er ging in den winzigen, ans Wohnzimmer angrenzenden Essbereich und strich mit der Hand über die hohen Rückenlehnen mehrerer stoffbezogener Stühle, die um einen ovalen Glastisch gruppiert waren. Jede Menge Glas in diesem Haus, dachte er und streckte die Finger in seinen Latexhandschuhen. Er würde jedenfalls keine verräterischen Spuren hinterlassen.
Wer sagte, dass er immer blindlings losschlug? Wer sagte, dass er keinen Plan hatte?
Er blickte in die Küche zu seiner Rechten und überlegte, ob er im Kühlschrank nachsehen und sich vielleicht ein Bier nehmen sollte, wenn sie noch welches vorrätig hielt. Wahrscheinlich nicht, nachdem er nicht mehr zu ihren regelmäßigen Besuchern zählte. Er war der Einzige, der hier je Bier getrunken hatte. Die anderen Gäste blieben störrisch bei Chardonnay und Merlot oder wie die Plörre hieß, die sie ausschließlich tranken. Für ihn schmeckte das Zeug alles gleich – vage nach Essig und Metall. Er bekam davon nur Kopfschmerzen. Vielleicht kamen die aber auch von den Leuten, die sie eingeladen hatte. Er zuckte die Achseln, als er an die verstohlenen Blicke dachte, die sie sich zugeworfen hatten, wenn sie glaubten, er würde es nicht sehen. Er ist bloß ein Ausrutscher, hatten diese Blicke gesagt, in kleinen Dosen ja ganz amüsant, ansonsten aber nur ein müdes Lächeln wert. Er würde sich ohnehin nicht lange genug halten, als dass es von Belang wäre.
Aber er war geblieben.
Es war von Belang.
Und nun bin ich zurückgekommen, dachte er, und ein brutales Lächeln zerrte an seinen Mundwinkeln und den vollen Lippen.
Eine störrische Strähne seiner langen braunen Haare fiel ihm in die Stirn und ins Auge. Ungeduldig strich er sie hinter sein Ohr und ging den schmalen Flur zu dem Schlafzimmer auf der Rückseite des ordentlichen Bungalows entlang. Als er an der kleinen Kammer vorbeikam, wo sie ihre Yogaübungen machte und meditierte, stieg ihm ein leichter Weihrauchduft in die Nase, der an den Wänden klebte wie der Geruch von frischer Farbe. Sein Grinsen wurde breiter. Für jemanden, der mit aller Macht innere Ruhe finden wollte, war sie erstaunlich reizbar, stets bereit, über irgendetwas völlig Nebensächliches zu streiten. Sie nahm Anstoß, wo keine Kränkung beabsichtigt war, und ging ihm bei der leisesten Provokation an die Kehle. Obwohl es ihm durchaus Spaß gemacht hatte, sie zu provozieren.
Ihre Schlafzimmertür stand offen, sodass er vom Flur die Umrisse ihrer schlanken Hüfte unter der dünnen weißen Baumwolldecke ausmachen konnte. Er fragte sich, ob sie unter der Decke nackt war und was er tun würde, wenn sie es war. Nicht dass er sich in dieser Hinsicht für sie interessiert hätte. Für seinen Geschmack war sie ein wenig zu durchtrainiert und fragil, als könnte sie beim leichtesten Druck unter seinen Händen zerbrechen. Er mochte die Frauen weicher, fülliger und verwundbarer. Er mochte etwas, das man packen und in das man seine Zähne graben konnte. Trotzdem, wenn sie nackt war …
War sie nicht. Sobald er das Zimmer betreten hatte, sah er die blauen und weißen Streifen ihres Schlafanzugoberteils. Er hätte es sich eigentlich denken können, dass sie einen Männerpyjama trug. Jedenfalls überraschte es ihn nicht. Sie hatte sich schon immer eher wie ein Mann gekleidet und nicht wie ein Mädchen. Wie eine Frau, hörte er unweigerlich ihren Einspruch in seinem Kopf, als er sich dem großen französischen Bett näherte. Passend für eine Königin, dachte er, als er auf sie herabstarrte. Auch wenn sie in diesem Moment nicht besonders hoheitsvoll aussah. Sie lag auf der linken Seite halb in der Embryonalstellung zusammengerollt, ihre sonnengebräunte Haut wirkte im Schlaf blass, ihr kinnlanges Haar klebte an ihrer rechten Wange, die Spitzen ragten in ihren offen stehenden Mund.
Wenn sie nur gelernt hätte, diesen großen Mund zu halten.
Dann würde er heute Nacht vielleicht jemand anderen besuchen.
Oder er müsste womöglich niemanden besuchen.
Das letzte Jahr wäre vielleicht gar nicht passiert.
Nur dass es eben passiert war, dachte er, ballte die Fäuste und öffnete sie wieder. Und es war vor allem deshalb so gekommen, weil die dumme Gracie ihre dummen Gedanken und Ansichten nicht für sich behalten konnte. Sie war die Anstifterin gewesen, diejenige, die alle gegen ihn aufgestachelt hatte. Alles, was geschehen war, war ihre Schuld. Deshalb schien es nur passend, dass sie heute Nacht auch diejenige war, die es wieder gutmachen würde.
Er blickte zum Fenster auf der anderen Seite des Raumes und sah die Mondsichel, die zwischen den Lamellen der weißen Jalousie hindurchschimmerte. Draußen malte der Wind mit surrealem Pinselstrich ein Bild der Nacht, ein wahlloses Durcheinander von Farben und Formen; drinnen war alles still und friedlich. Einen Moment lang überlegte er, ob er sie ungestört weiterschlafen lassen sollte. Er würde wahrscheinlich auch so finden, wonach er suchte. Vermutlich fand sich die Information, auf die er aus war, in einer Seitenschublade des antiken Eichenholzschreibtischs, der zwischen Kommode und Fenster geklemmt war. Oder sicher in ihrem Laptop gespeichert. So oder so, er wusste, dass alles, was er wollte, griffbereit lag. Er musste es nur nehmen und wieder in der Nacht verschwinden, ohne dass jemand etwas bemerkte.
Aber wo blieb dabei der Spaß?
Er schob seine rechte Hand in die Tasche und tastete nach der harten Klinge seines Messers, die für den Augenblick noch sicher in dem Holzgriff schlummerte. Er würde sie zücken, wenn die Zeit gekommen war. Aber vorher gab es noch viel zu tun. Er konnte die Vorstellung ebenso gut beginnen lassen, dachte er und ließ sich vorsichtig auf dem Bett nieder. Die Matratze gab nach, und seine Hüfte streifte die ihre. Sie drehte sich instinktiv zum ihm um. »Hallo, Gracie«, gurrte er mit einer Stimme, die so sanft war wie weiches Fell. »Zeit zum Aufwachen, Gracie-Girl.«
Sie stöhnte leise, ohne sich zu rühren.
»Gracie«, wiederholte er lauter.
»Hm«, murmelte sie, hielt die Augen jedoch stur geschlossen.
Sie weiß, dass ich hier bin, dachte er. Sie spielt bloß mit mir. »Gracie«, bellte er.
Sie riss die Augen auf.
Und dann passierte, so schien es, alles auf einmal. Sie war wach, schrie und versuchte, sich aufzurichten, das grässliche katzenartige Gejaule schlug ihm auf die Ohren und hallte von den Wänden wider. Instinktiv schnellte seine Hand vor, um sie zum Schweigen zu bringen, seine Finger schlossen sich um ihren Hals, und ihr Schreien wurde unter dem stärker werdenden Druck auf ihren Kehlkopf zu einem Wimmern. Sie rang keuchend nach Luft, als er sie mit einem Arm mühelos hochhob und an die Wand hinter ihrem Bett drückte.
»Halt’s Maul«, befahl er ihr, während sie die Zehen ausstreckte, um Stand auf dem Bett zu finden. Mit den Fingern zerrte sie an seinen Handschuhen in dem vergeblichen Bemühen, sich aus seinem unnachgiebigen Griff zu befreien. »Willst du jetzt wohl die Klappe halten?«
Sie riss ihre Augen noch weiter auf.
»Was?«
Er spürte, wie sie versuchte, eine Antwort zu krächzen, aber sie brachte nur einen abgewürgten Schrei heraus.
»Ich nehme das mal als Ja«, sagte er, lockerte langsam seinen Griff und beobachtete, wie sie an der Wand auf ihr Kissen zurücksank. Er gluckste, als sie würgend nach Luft rang. Ihr Schlafanzugoberteil war hochgerutscht, und er konnte ihre einzelnen Wirbel ausmachen. Es wäre so leicht, ihr einfach das Rückgrat zu brechen, dachte er und genoss die Vorstellung, während er ihr Haar packte und ihren Kopf herumriss, sodass sie ihn direkt ansehen musste. »Hallo, Gracie«, sagte er und wartete auf das verächtliche Nasenzucken. »Was ist los? Hab ich dich aus einem schönen Traum gerissen?«
Sie sagte nichts, sondern starrte ihn nur angstvoll und ungläubig an.
»Überrascht, mich zu sehen, was?«
Ihr Blick zuckte zur Schlafzimmertür.
»Ich denke, den Gedanken solltest du am besten gleich vergessen«, sagte er ruhig. »Es sei denn, du willst mich wirklich wütend machen.« Er machte eine Pause. »Du erinnerst dich doch noch, wie ich bin, wenn ich wirklich wütend bin, oder nicht, Gracie?«
Sie schlug die Augen nieder.
»Sieh mich an.« Wieder packte er sie an den Haaren und riss diesmal ihren Kopf so heftig in den Nacken, dass ihre Kehle wie eine Faust hervortrat.
»Was willst du?«, stieß sie heiser hervor.
Als Antwort zog er noch fester an ihren Haaren. »Hab ich gesagt, dass du sprechen darfst? Hab ich das gesagt?«
Sie versuchte, den Kopf zu schütteln, doch sein Griff war zu fest.
»Ich nehme das mal als Nein.« Er ließ sie los, und ihr Kopf fiel auf ihre Brust, als hätte man sie enthauptet. Sie weinte jetzt, was ihn überraschte. Tränen hatte er nicht erwartet. »Und, wie geht’s, wie steht’s?«, fragte er, als wäre das eine völlig alltägliche Frage. »Du darfst antworten«, sagte er, als sie nicht reagierte.
»Ich weiß nicht, was du hören willst«, erwiderte sie nach einer langen Pause.
»Ich habe dich gefragt, wie es so geht und steht«, wiederholte er. »Die Antwort darauf wirst du doch wohl wissen.«
»Alles bestens.«
»Ach ja? Wie kommt’s?«
»Bitte. Ich kann nicht …«
»Klar kannst du. Man nennt es Unterhaltung. Es geht ungefähr so: Ich sage etwas, und dann sagst du etwas. Wenn ich dir eine Frage stelle, gibst du eine Antwort. Und wenn diese Antwort nicht zu meiner Befriedigung ausfällt, muss ich dir leider wehtun.«
Ein unwillkürlicher Schrei drang aus ihrer Kehle.
»Meine erste Frage war also, wie es dir so geht, und deine Antwort war ein ziemlich fantasieloses ›Alles bestens‹. Daraufhin habe ich gefragt: ›Wie kommt’s?‹ Und jetzt bist du wieder dran.« Er setzte sich aufs Bett und beugte sich vor. »Überrasch mich.« Sie starrte ihn an, als ob er komplett den Verstand verloren hätte, ein Blick, den er schon oft gesehen und der ihn jedes Mal wütend gemacht hatte.
»Ich weiß nicht, was ich sagen soll.«
Er bemerkte einen Hauch von Trotz in ihrer Stimme, beschloss jedoch, ihn fürs Erste nicht zu beachten. »Also gut. Fangen wir mit der Arbeit an. Wie läuft es da?«
»Okay.«
»Bloß okay? Ich dachte, du unterrichtest für dein Leben gern.«
»Ich habe mir in diesem Jahr ein Sabbatjahr genommen.«
»Ein Sabbatjahr? Im Ernst? Ich wette, du denkst, ich weiß nicht, was das heißt.«
»Ich habe dich nie für dumm gehalten, Ralph.«
»Nicht? Wie man sich täuschen kann.«
»Was machst du hier?«
Er lächelte und schlug ihr dann mit der offenen Hand so hart ins Gesicht, dass sie auf das Kissen zurückfiel. »Hab ich gesagt, dass du mit Fragen dran bist? Nein, ich glaube, das habe ich nicht getan. Also setz dich hin und halt’s Maul«, brüllte er, als sie das Gesicht in den Händen vergrub. »Hast du mich gehört? Ich möchte es dir nicht noch einmal erklären.«
Sie rappelte sich in eine sitzende Position hoch und hielt eine zitternde Hand vor ihre rote Wange, wo seine Hand jeden Hauch von Trotz ausradiert hatte.
»Oh, und nenn mich nicht Ralph. Der Name hat mir nie gefallen. Ich habe ihn geändert, sobald ich aus der Haft entlassen worden bin.«
»Du bist entlassen worden?«, murmelte sie, zuckte zusammen und wich zurück, als wollte sie sich vor weiteren Schlägen schützen.
»Sie mussten mich freilassen. Ich mag gar nicht aufzählen, wie viele Fehler der Staatsanwaltschaft unterlaufen sind.« Er lächelte. »Mein Anwalt hat das Verfahren eine echte Justizposse genannt, und die Richter, die über seinen Revisionsantrag zu befinden hatten, mussten ihm einfach zustimmen. Wo waren wir stehen geblieben? Ach ja, dein Sabbatjahr. Das klingt ziemlich langweilig. Glaube nicht, dass ich noch mehr davon hören will. Was ist mit deinem Liebesleben?«
Sie schüttelte den Kopf.
»Was soll das heißen? Dass du kein Liebesleben hast oder dass du nicht mit mir darüber reden willst?«
»Da gibt es nichts zu erzählen.«
»Du bist mit niemandem zusammen?«
»Nein.«
»Ich frag mich, warum mich das nicht überrascht.«
Sie sagte nichts, sondern blickte zum Fenster.
»Bald kommt ein Gewitter«, sagte er. »Aber sonst kommt’s hier wohl keinem, was?« Er lächelte das jungenhafte Lächeln, das er stundenlang vor dem Spiegel geübt hatte und mit dessen Hilfe er noch jedes Mädchen rumgekriegt hatte, das er wollte. Ganz egal wie heftig sie sich sträubten, diesem Lächeln konnten sie am Ende nicht lange widerstehen. Gracie war für seinen Charme natürlich immer unzugänglich geblieben. Wenn er sie angelächelt hatte, hatte sie durch ihn hindurchgeblickt, als wäre er gar nicht da. »Wann bist du denn zum letzten Mal flachgelegt worden, Gracie-Girl?«
Sofort wich sie in ängstlicher Abwehrhaltung zurück.
»Ich meine, du bist doch eine einigermaßen attraktive Frau. Und du bist jung. Obwohl du nicht jünger wirst, was? Wie alt bist du überhaupt, Gracie?«
»Dreiunddreißig.«
»Tatsächlich? Älter als ich? Das habe ich nicht gewusst.« Er schüttelte in gespielter Verwunderung den Kopf. »Ich wette, es gibt jede Menge Dinge, die ich nicht von dir weiß.« Er streckte die Hand aus und öffnete den obersten Knopf ihres Pyjamaoberteils.
»Nicht«, sagte sie, ohne sich zu rühren.
Er machte den zweiten Knopf auf. »Was nicht?« Sie konnte nicht einmal bitte sagen, dachte er. Typisch.
»Das willst du doch nicht tun.«
»Was ist los, Gracie? Glaubst du, ich bin nicht gut genug für dich?« Beinahe mühelos riss er die restlichen Knöpfe auf und zog sie an beiden Enden des Kragens an sich. »Weißt du, was ich glaube, Gracie? Ich glaube, du denkst, kein Mann ist gut genug für dich. Vielleicht sollte ich dir beweisen, dass du dich irrst.«
»Nein, hör mal, das ist doch Wahnsinn. Du wirst wieder im Gefängnis landen. Das willst du doch nicht. Du hast eine zweite Chance bekommen. Du bist ein freier Mann. Warum willst du das aufs Spiel setzen?«
»Weiß nicht. Vielleicht weil du in deinem kleinen Lesbenpyjama so verdammt niedlich aussiehst.«
»Bitte. Es ist noch nicht zu spät. Du kannst immer noch gehen …«
»Oder vielleicht auch, weil ich ohne dich nicht die letzten zwölf Monate im Gefängnis gesessen hätte.«
»Du kannst mir doch nicht die Schuld dafür geben, was passiert ist …«
»Warum nicht?«
»Weil ich nichts damit zu tun hatte.«
»Ach wirklich? Du hast nicht alle gegen mich aufgehetzt?«
»Das musste ich gar nicht.«
»Nein, das musstest du nicht. Du konntest es nur einfach nicht lassen, was? Und schau dir an, was passiert ist. Ich habe alles verloren. Meinen Job. Meine Familie. Meine Freiheit.«
»Und du hattest mit all dem nichts zu tun«, stellte sie bitter und mit wieder erwachtem Trotz in der Stimme fest.
»Oh, ich will nicht sagen, dass ich völlig ohne jede Schuld bin. Ich bin ein bisschen jähzornig, das gebe ich zu. Manchmal verliere ich die Beherrschung.«
»Du hast sie geschlagen, Ralph. Tagaus, tagein. Jedes Mal, wenn ich sie getroffen hatte, hatte sie frische Blutergüsse und Prellungen.«
»Sie war eben ungeschickt. Was kann ich dafür, wenn sie ständig irgendwo dagegengelaufen ist?«
Gracie schüttelte den Kopf.
»Wo ist sie?«
»Was?«
»Sobald ich draußen war, bin ich schnurstracks nach Hause gefahren. Und wen treffe ich dort an? Einen Haufen Schwule, die sich in meiner Wohnung ausgebreitet haben, das treffe ich an. Und als ich sie frage, was aus der Vormieterin geworden ist, klimpern sie mit ihren mascaraverschmierten Wimpern und sagen, sie hätten absolut keine Ahnung. Absolut keine Ahnung«, wiederholte er eine glatte Oktave höher. »Genauso hat es mir die kleine dünne Schwuchtel erklärt, als ob er die beschissene Queen von England wäre. Ich hätte ihm beinahe gleich eine verpasst.« Mit der einen Hand packte er ihren Kragen fester, mit der anderen zog er das Messer aus der Tasche und ließ mit einem Daumendruck auf einen kleinen Knopf am Griff die Klinge herausschnappen. »Sag mir, wo sie ist, Gracie.«
Sie wehrte sich jetzt, strampelte panisch mit den Beinen und versuchte, ihn mit rudernden Armen zu treffen. »Ich weiß nicht, wo sie ist.«
Wieder gruben sich seine Finger in die weiche Haut ihres Halses. »Sag mir, wo sie ist, oder ich schwöre, ich breche dir deinen beschissenen Hals.«
»Sie hat Miami verlassen, direkt nachdem du ins Gefängnis gekommen bist.«
»Wohin ist sie gegangen?«
»Ich weiß es nicht. Sie ist weggezogen. Keiner weiß, wohin.«
Er warf sie auf den Rücken, hockte sich rittlings auf sie und schnitt mit dem Messer den Gummizug ihrer Pyjamahose durch, während sich seine andere Hand zu einem tödlichen Griff um ihren Hals schloss. »Ich zähle bis drei, und dann sagst du mir, wo sie ist. Eins … zwei …«
»Bitte tu das nicht.«
»Drei.« Er drückte ihr die Klinge an den Hals und zerrte ihr die Schlafanzughose herunter.
»Nein. Bitte. Ich sag es dir. Ich sag es dir ja.«
Lächelnd lockerte er seinen Griff, sodass sie eben wieder nach Luft schnappen konnte, und hielt ihr das Messer vor die Nase. »Wo ist sie?«
»Sie ist nach Kalifornien gegangen.«
»Nach Kalifornien?«
»Um in der Nähe ihrer Mutter zu sein.«
»Nein. Das würde sie nie tun. Sie weiß genau, dass ich darauf als Erstes kommen würde.«
»Sie ist vor drei Monaten weggezogen. Sie hat gedacht, nach all der Zeit wäre sie sicher, und sie wollte so weit wie möglich von Florida weg.«
»Das ist sicher wahr.« Er griff nach dem Reißverschluss seiner Hose. »Genauso wie ich mir sicher bin, dass du lügst.«
»Nein, ich lüge nicht.«
»Klar lügst du. Und das ziemlich schlecht.« Er setzte die Spitze der Klinge unter ihrem Auge an und zog sie bis zu ihrem Kinn herunter.
»Nein!«, kreischte sie und warf sich hin und her, als er sich zwischen ihre Beine drängte, sodass Blut aus der Schnittwunde in ihrem Gesicht auf ihr weißes Kopfkissen tropfte. »Ich sag dir die Wahrheit. Ich schwöre, ich sag dir die Wahrheit.«
»Warum sollte ich dir jetzt noch irgendwas glauben, was du mir erzählst?«
»Weil ich es dir beweisen kann.«
»Ach ja? Wie denn?«
»Weil ich es aufgeschrieben habe.«
»Wo?«
»In meinem Adressbuch.«
»Und das befindet sich wo genau?«
»In meiner Handtasche.«
»Ich verliere hier langsam die Geduld, Gracie.«
»Meine Handtasche ist im Kleiderschrank. Wenn du mich aufstehen lässt, hole ich sie für dich.«
»Was hältst du davon, wenn wir sie zusammen holen?« Er stieß sich von ihr ab, zog seinen Reißverschluss hoch und zerrte sie vom Bett Richtung Kleiderschrank. Sie versuchte, ihre Schlafanzughose festzuhalten, während er die Kleiderschranktür aufriss und den Inhalt überflog. Eine Reihe Blusen mit buntem Muster, ein halbes Dutzend Hosen, ein paar teuer aussehende Jacken, mindestens zehn Paar Schuhe und mehrere Lederhandtaschen. »Welche?« Er griff schon ins oberste Regal.
»Die orangefarbene.«
Mit einer Handbewegung schleuderte er die orangefarbene Tasche auf den Boden. »Mach sie auf.« Er stieß sie auf die Knie. Blut tropfte von ihrer Wange auf das helle Leder, als sie an dem Verschluss der Tasche herumfummelte. Ein weiterer Tropfen fiel auf den weichen weißen Florteppich. »Und jetzt gib mir das verdammte Adressbuch.«
Wimmernd befolgte sie seine Anweisung.
Er schlug das Buch auf und blätterte die Seiten durch, bis er den gesuchten Namen gefunden hatte. »Sie ist also doch nicht nach Kalifornien gezogen«, stellte er lächelnd fest.
»Bitte«, schluchzte sie leise. »Jetzt hast du doch, was du wolltest.«
»Was für ein Straßenname ist denn das? Mad River Road«, las er mit übertriebener Betonung vor.
»Bitte«, sagte sie noch einmal. »Geh einfach.«
»Du willst, dass ich gehe? Hast du das gesagt?«
Sie nickte.
»Du willst, dass ich gehe, damit du deine Freundin anrufen und warnen kannst, sobald ich weg bin?«
Sie schüttelte den Kopf. »Das würde ich nicht machen.«
»Natürlich nicht. Genauso wenig, wie du die Polizei alarmieren würdest, was?«
»Ich rufe niemanden an, ich schwöre es.«
»Wirklich nicht? Wieso kann ich das nur nicht recht glauben?«
»Bitte …«
»Ich denke, ich habe keine andere Wahl, Gracie. Ich meine, einmal abgesehen von der Tatsache, dass ich mich fast genauso darauf freue, dich umzubringen, wie ich mich schon darauf freue, sie zu töten, sehe ich wirklich nicht, was mir anderes übrig bleibt. Oder was meinst du?« Er zog sie grob auf die Füße und setzte ihr das Messer an den Hals. »Wohlan, gute Nacht, Gracie.«
»Nein!«, kreischte sie, schlug mit aller Kraft aus und rammte ihren Ellenbogen gegen seine Brust, sodass ihm die Luft wegblieb und sie sich seinem Griff entwinden konnte. Sie rannte in den Flur und hatte die Haustür beinahe erreicht, als sich die Zehen ihres rechten Fußes in dem Pyjamaunterteil verfingen, sie ins Stolpern geriet und der Länge nach auf das harte Parkett schlug. Doch sie gab noch nicht auf, sondern krabbelte weiter und schrie aus Leibeskräften, auf dass irgendjemand sie hörte und ihr zur Hilfe kam.
Amüsiert beobachtete er, wie sie nach dem Türknauf tastete, weil er wusste, dass er reichlich Zeit hatte, bevor sie sich endgültig aufgerappelt hatte. Sie war auf jeden Fall hartnäckig, dachte er nicht ohne Bewunderung. Und ziemlich kräftig für ein so dünnes Mädchen. Nicht zu vergessen, eine treue Freundin. Obwohl sie, als es ernst wurde, lieber ihre Freundin verraten hatte, als seine zugegebenermaßen nicht übermäßig romantischen Annäherungsversuche zu ertragen. Also vielleicht doch keine so gute Freundin. Nein, sie hatte ihr Schicksal verdient. Sie hatte es geradezu herausgefordert.
Er würde ihr allerdings nicht die Kehle durchschneiden, entschied er, schob das Messer wieder in die Tasche und packte sie, als ihre Hand gerade den Türknauf gefasst hatte. Nein, das machte viel zu viel Dreck und war überdies unnötig riskant. Alles wäre voller Blut, und jeder würde sofort wissen, dass ein Verbrechen geschehen war. Und dann würde es nicht allzu lange dauern, bevor er als Verdächtiger gesucht wurde, vor allem wenn bekannt wurde, dass er aus dem Gefängnis entlassen worden war, und die Polizei zwei und zwei zusammen zählte.
Sie wehrte sich kratzend und tretend und flehte ihn, als seine Hände sich um ihren Hals schlossen, mit ihren grünen Augen an, es nicht zu tun. Außerdem kreischte sie wie wild, was er im Eifer des Gefechts jedoch kaum wahrnahm. Er wollte die Sache mit den Händen zu Ende zu bringen. Es war so persönlich, so konkret. Es gab nichts Befriedigenderes, als unmittelbar zu spüren, wie das Leben aus einem anderen Körper wich.
Dass sie ein Sabbatjahr genommen hatte, war ein unerwartetes Glück für ihn. Es konnte Tage oder sogar Wochen dauern, bis irgendjemand sie als vermisst meldete, obwohl er wusste, dass er sich darauf nicht verlassen durfte. Gracie hatte jede Menge Freundinnen, und vielleicht war sie morgen mit einer von ihnen zum Essen verabredet. Er durfte also nicht allzu übermütig werden. Je eher er der Mad River Road einen Besuch abstattete, desto besser.
»Ich dachte, wir machen eine kleine Spazierfahrt an die Küste«, erklärte er Gracie, deren Augen mittlerweile aus ihrem Kopf zu quellen drohten. »Ich werfe dich unterwegs einfach in einen Sumpf, dann können sich die Krokodile an dir vergnügen.«
1
Jamie Kellogg hatte einen Plan. Der Plan war relativ einfach. Er bestand darin, in die nächste einigermaßen anständig aussehende Bar zu gehen, sich in eine dunkle Ecke zu setzen, wo keiner sehen konnte, dass sie geweint hatte, und ihren Kummer in ein paar Weißweinschorlen zu ertränken. Nicht so viele, dass sie davon betrunken oder auch nur beschwipst wurde, denn sie hatte schließlich noch die lange Rückfahrt nach Stuart vor sich. Sie musste ihre fünf Sinne beisammen halten und durfte auf keinen Fall riskieren, am nächsten Morgen verkatert zu sein. Nicht, wenn Mrs. Starkey ihr im Nacken saß wie ein Albatross.
Sie blickte die beinahe menschenleere Straße hinunter. In dieser Gegend eine einigermaßen vernünftige Kneipe zu finden, war relativ aussichtslos, obwohl die unmittelbare Nähe zu einem Krankenhaus doch die perfekte Lage gewesen wäre. Sie blickte sich noch einmal zu dem flachen Klinikbau um, dem Samariter-Krankenhaus, und verzog bei dem Gedanken an die Szene, die sich gerade auf der dortigen Intensivstation abgespielt hatte, das Gesicht. Erzähl uns nicht, dass dich das überrascht, konnte sie ihre Schwester und ihre Mutter in ihr Ohr flüstern hören, in perfekter Harmonie miteinander wie immer oder wie sie es gewesen waren, als ihre Mutter noch lebte.
»Natürlich war ich überrascht«, murmelte Jamie, ohne die Lippen zu bewegen. »Woher sollte ich es wissen?« Eine plötzliche Böe trug ihre Frage in die warme Abendluft davon. Wenigstens hatte es endlich aufgehört zu regnen. In den vergangenen zwei Tagen waren an der Ostküste Floridas heftige Gewitter niedergegangen, sodass einige Straßen, darunter die, in der sie wohnte, überflutet worden waren. Ja, ich weiß, das ist der Preis dafür, dass ich unbedingt eine Wohnung mit Blick aufs Wasser haben wollte, aber es ist doch nur ein kleines Bächlein. Ich wohne schließlich nicht in einem überteuerten Apartment an der Strandpromenade wie meine jüngere Schwester. Entschlossen stapfte sie auf den kleinen Parkplatz neben dem Krankenhaus, während sie im Kopf mit ihrer Schwester und ihrer kürzlich verstorbenen Mutter weiterstritt. Wer hätte auch gedacht, dass der verdammte Fluss über die Ufer tritt?
Das ist genau dein Problem, begann ihre Mutter.
Du denkst nicht nach, beendete ihre Schwester den Gedanken.
»Und ihr traut mir zu wenig zu«, flüsterte Jamie und setzte sich hinter das Steuer ihres alten blauen Thunderbird, das Einzige, was ihr nach ihrer Scheidung im vergangenen Jahr geblieben war. Sie fuhr vom Parkplatz herunter und hoffte, vor der Auffahrt zur Autobahn noch ein passendes Lokal zu finden.
Ihre Wohnung lag zum Glück im ersten Stock des dreigeschossigen Hauses, sodass ihr der Wasserschaden erspart geblieben war, der die weniger glücklichen Bewohner des Erdgeschosses getroffen hatte. Apropos Wasser, dachte sie, als sie im Rückspiegel ihre angeblich wasserfeste Wimperntusche überprüfte und dankbar feststellte, dass ihre Tränen keine bleibenden Spuren hinterlassen hatten. Stattdessen blickten ihre großen braunen Augen beinahe heiter gelassen zurück. Sonnengebleichte schulterlange Haare rahmten ein hübsches ovales Gesicht, in dem erstaunlicherweise nichts von ihrem inneren Aufruhr zu lesen war. Wessen tolle Idee war es überhaupt gewesen, ihn zu überraschen? Hatte er nicht mehrfach erklärt, dass er Überraschungen hasste?
Einem Impuls folgend bog sie links auf den Dixie Highway und fuhr Richtung Süden. Dann würde sie hinterher zwar einen längeren Rückweg haben, aber die City von West Palm Beach war nur ein paar Straßen entfernt, und die Lokale entlang der Clematis Street waren bestimmt einladender als die Bars am Palm Beach Lakes Boulevard. Und sie konnte, wenn es ihr in einem Laden nicht gefiel, einfach zum nächsten weitergehen, ohne dafür wieder ins Auto steigen zu müssen.
In der Datura Street fuhr ein hellroter Mercedes aus einer Parklücke, und Jamie setzte ihren alten blauen Thunderbird in den frei gewordenen Platz, sorgfältig darauf bedacht, eng am Randstein zu parken. Sie stieg aus, suchte in ihren Taschen nach Kleingeld und warf mehr Münzen als nötig in die Parkuhr. Sie hatte nicht vor, lange zu bleiben.
Als Jamie in die Clematis Street bog, kam ihr ein eng umschlungenes, an den Hüften scheinbar zusammengeschweißtes junges Paar entgegen. Die goldenen Stöckelschuhe des schlanken Mädchens klapperten laut über den Bürgersteig. Kurz vor der Straßenecke blieben sie stehen, um sich zu küssen, bevor sie bei Rot über die Ampel gingen. Auf dem Weg nach Hause, wo sie glücklich lebten bis ans Ende ihrer Tage, dachte Jamie und sah ihnen nach, bis sie in der Dunkelheit verschwunden waren. Statt Glück bis an ihr Lebensende würde sie sich schon mit einer Nacht voller Lügen zufrieden geben.
Für einen Mittwochabend war es im Watering Hole ziemlich voll. Jamie sah auf die Uhr. Sieben Uhr, Abendessenzeit, Anfang Mai. Warum sollte der Laden nicht voll sein? Es war ein beliebtes Lokal in einer schicken Straße, und auch wenn die so genannte Saison streng genommen vorbei war, gab es immer noch genug überwinternde Pensionäre, die zögerten, ihre Sachen zu packen und für den Sommer heim in den Norden zu fahren. Genau das sollte sie am besten machen, dachte sie. Einfach ihre paar Habseligkeiten zusammenpacken, auf die Rückbank ihres Wagens werfen und dann zusehen, dass sie die Stadt möglichst schnell hinter sich ließ. Wieder einmal.
Wer würde sie schon vermissen? Ihre Familie bestimmt nicht. Ihre Mutter war vor acht Wochen gestorben; ihr Vater lebte mit seiner vierten Frau irgendwo in New Jersey. Er hatte – unglaublich, aber wahr – zwei Joans geheiratet, eine Joanne und jetzt eine ehemalige Stewardess namens Joanna, die mit 36 nur sieben Jahre älter war als Jamie. Und ihre Schwester wäre wahrscheinlich sogar froh, wenn sie sie nicht mehr sehen müsste. (»Du bist schlimmer als meine Kinder«, hatte Cynthia gesagt, als Jamie sie zwei Tage zuvor angerufen hatte, um über den Dauerregen zu klagen.) Jamies Job als Schadensreguliererin bei einer Versicherungsfirma war langweilig und ohne jede Perspektive, ihre Chefin war eine unfreundliche Frau, die ständig wegen irgendwas auf hundertachtzig war. Jamie hätte schon vor Monaten gekündigt, wenn sie die Stelle nicht überhaupt nur auf Empfehlung von Cynthias Mann Todd bekommen hätte. Was ist bloß mit dir los? Kannst du nicht mal bei irgendwas bleiben?, konnte sie ihre Schwester tadeln hören, gefolgt von einem: Ich hätte es wissen müssen. Du und deine Flatterhaftigkeit. Des Weiteren gefolgt von: Wann hörst du endlich auf herumzudaddeln und fängst an, Verantwortung zu übernehmen? Um schließlich in Grund und Boden gerammt zu werden mit: Wer schmeißt schon kurz vor dem Examen das Studium, um irgendeinen Idioten zu heiraten, den sie kaum kennt? Und falls sie dann immer noch atmete: Du weißt, dass ich es nur gut mit dir meine. Es wird höchste Zeit, dass du dich der Realität stellst und dein Leben selbst in die Hand nimmst. Wirst du jemals so weit sein?
Jamie zog einen Hocker an der langen Bar vor und machte dem Barkeeper ein Zeichen, dass sie bestellen wollte. Warte nur, bis Cynthia von dem heutigen Fiasko erfährt, dachte sie und entschied sich kühn, anstatt der üblichen Weißweinschorle ein Glas offenen Burgunder zu bestellen. Sie spähte ins Halbdunkel und nahm den großen Raum mit einem Blick in sich auf. Er war lang und rechteckig mit einer Terrasse zur Straße hin. Eine Reihe gepolsterter Bänke säumte die Backsteinwand gegenüber dem Tresen, in der Mitte und im vorderen Teil standen ein Dutzend Tische. Der geflieste Fußboden verstärkte den Lärm der Gäste, überwiegend junge Frauen wie sie selbst.
Wo waren all die Männer, fragte Jamie sich gedankenverloren. An einem der Tische saßen ein paar Mitvierziger, die über ein neues Firmenlogo debattierten und nicht einmal aufgeblickt hatten, als sie sich in ihrer engen, tief sitzenden Jeans und ihrem noch engeren pinkfarbenen Pulli an ihnen vorbeigedrängt hatte. Und dann war da noch ein trübsinnig aussehender Mann mit einem ungepflegten Tom-Selleck-Schnauzer. Mehr Auswahl gab es nicht. Zumindest noch nicht. Jamie sah erneut auf die Uhr, obwohl seit dem letzten Mal kaum ein paar Minuten vergangen waren. Wahrscheinlich war es für Männer noch zu früh zum Ausgehen, vermutete sie. Um sieben Uhr würde sich ein Mann noch verpflichtet fühlen, eine Frau zum Abendessen einzuladen. Später müsste er ihr lediglich ein paar Drinks spendieren.
Der Barkeeper kam mit ihrer Bestellung. »Zum Wohl.«
Jamie nahm das Glas und trank hastig einen Schluck Wein.
»Harten Tag gehabt?«
»Mein Freund liegt im Krankenhaus«, antwortete Jamie und kam sich sofort ziemlich dämlich vor. Sie schüttete dem Barkeeper ihr Herz aus, Himmel noch mal. Aber wenn sie ihre traurige Leidensgeschichte dem Barkeeper erzählte, käme sie vielleicht nicht in Versuchung, sie ihrer Schwester zu erzählen. Und vielleicht würde der Barkeeper, der groß und niedlich war mit einer interessanten Narbe unter dem rechten Auge, sie später bitten zu warten, bis seine Schicht zu Ende war, und sie würden sich zusammen an den Brunnen am Ende der Straße setzen, und er würde sich als sensibel, witzig, intelligent und alles Mögliche erweisen … »Verzeihung. Haben Sie etwas gesagt?«
»Ich habe Sie gefragt, ob Ihr Freund krank ist.«
»Nein, er hatte auf der Arbeit einen Unfall und musste operiert werden.«
»Wirklich? Was für einen Unfall denn?«
»Er ist auf dem Weg zum Klo über einen Teppich gestolpert und hat sich den Knöchel gebrochen.« Sie lachte. Wie lächerlich war das!
»Echt Kacke«, meinte der Barkeeper.
Jamie lächelte, nahm einen großen Schluck Rotwein und wartete, bis der Barkeeper sich entfernt hatte, bevor sie wieder aufblickte. So viel zum Thema witzig und intelligent, dachte sie. Egal wie einsam und verzweifelt sie auch sein mochte, sie würde nie mit einem Typen ausgehen, der Echt Kacke sagte.
Sie warf einen verstohlenen Blick zu dem Mann mit dem Tom-Selleck-Schnurrbart, der schützend über seinem Drink kauerte. Er sah kurz auf, bemerkte ihren Blick und wandte sich mit scheinbar demonstrativem Desinteresse ab. »Der Schnurrbart sieht sowieso falsch aus«, murmelte Jamie in ihr Glas, für einen Moment fasziniert von ihrem Spiegelbild in der dunkelvioletten Flüssigkeit.
Im nächsten Moment sah sie sich die Eingangstreppe des Samariter-Krankenhauses hinaufgehen und eine äußerst gut aussehende Schwarze an der Rezeption nach der Zimmernummer von Tim Rannells fragen. »Er sollte heute Morgen am Knöchel operiert werden«, erklärte sie der Frau und packte das Geschenk, das sie für ihn mitgebracht hatte, fester, sodass die Plastiktüte zerknitterte.
Die Frau gab die Angaben in einen Computer ein, und ein besorgter Ausdruck legte sich auf ihre hübschen Gesichtszüge. »Ich fürchte, Mr. Rannells ist in die Intensivstation verlegt worden.«
»In die Intensivstation? Wegen eines gebrochenen Knöchels?«
»Mehr kann ich Ihnen auch nicht sagen.«
Die Frau beschrieb Jamie den Weg, aber die Tür zur Intensivstation im zweiten Stock war verschlossen, und niemand reagierte auf ihr Klingeln, sodass Jamie etliche Minuten in dem sterilen Wartebereich auf und ab lief und sich fragte, wie ein gesunder 35-jähriger Mann, der wegen einer kleineren Operation ins Krankenhaus eingeliefert worden war, auf der Intensivstation landen konnte.
»Sie können sich auch ruhig setzen«, sagte eine Frau mittleren Alters mit blasser weißer Haut und müden blauen Augen, die auf einem der orangefarbenen Plastikstühle an der nackten Wand saß. »Ich glaube, die sind da drin ziemlich beschäftigt.«
»Warten Sie schon lange?«
»Ich warte eigentlich nur auf eine Freundin.« Sie ließ das People-Magazin, in dem sie gelesen hatte, in den Schoß sinken. »Sie ist da drinnen bei ihrer Tochter, die einen Autounfall hatte. Sie sind sich noch nicht sicher, ob sie durchkommt.«
»Wie furchtbar.« Jamie blickte sich um, aber es tat sich nichts. »Mein Freund sollte heute Morgen operiert werden«, sagte sie unaufgefordert. »Irgendwie ist er dann hier gelandet.« Sie ging wieder zu dem Klingelknopf und drückte ihn mehrmals rasch hintereinander.
»Ja?«, ertönte Sekunden später eine Stimme. »Was kann ich für Sie tun?«
»Ich heiße Jamie Kellogg. Ich möchte zu Tim Rannells«, brüllte Jamie in die Gegensprechanlage.
»Sind Sie eine Verwandte von Mr. Rannells?«
»Sie sagen besser ja«, riet ihr die Frau auf dem Plastikstuhl. »Sonst lässt man Sie nicht rein.«
»Ich bin seine Schwester«, sagte Jamie, ohne zu überlegen. Wahrscheinlich weil ihre eigene Schwester ständig in ihren Gedanken herumgeisterte. Sie lag ihr schon seit Wochen in den Ohren, dass sie vorbeikommen und mit ihr gemeinsam den Nachlass ihrer Mutter durchgehen sollte.
»Bitte nehmen Sie noch ein paar Minuten Platz«, sagte die Stimme und schaltete sich ab.
Jamie wandte sich wieder der Frau auf dem Stuhl zu. »Vielen Dank für den Tipp.«
»So sind halt die Regeln«, meinte sie achselzuckend. »Ich heiße übrigens Marilyn.«
»Jamie«, stellte Jamie sich vor. »Ich wünschte, jemand könnte mir sagen, was eigentlich los ist.« Sie starrte auf den Klingelknopf. »Sie glauben doch nicht, dass etwas Schreckliches passiert ist, oder?« Eine dumme Frage, wie ihr sofort klar wurde, was sie jedoch nicht davon abhielt, eine weitere zu stellen. »Oder dass er gestorben sein könnte?«
»Ich bin sicher, es wird jede Minute jemand kommen«, sagte Marilyn.
»Ich meine, er ist bloß wegen eines gebrochenen Knöchels eingeliefert worden.«
»Versuchen Sie, ruhig zu bleiben.«
Jamie lächelte, obwohl ihr schon Tränen in den Augen standen. Ihre Mutter hatte sie auch ständig ermahnt, ruhig zu bleiben. »Das hat meine Mutter auch immer gesagt«, wiederholte sie laut. »Sie meinte, ich wäre zu impulsiv und unbesonnen, ich würde dazu neigen, voreilige Schlüsse zu ziehen.«
»Na, das sind ja viele große Worte.«
»Meine Mutter war Richterin.«
»Klingt so, als würde es ihr Spaß machen, Leute zu verurteilen.«
Irritiert von Marilyns Bemerkung lehnte Jamie sich zurück. Sonst erinnerten sie die Leute ständig daran, was für eine großartige Frau ihre Mutter gewesen war. Sie war überrascht, nicht nur über den ungefragten Kommentar der Frau, sondern auch darüber, wie gut ihr diese Bemerkung tat.
»Tut mir Leid, ich hoffe, ich habe Sie nicht gekränkt.«
»Nein, überhaupt nicht.«
Die Frau wandte sich wieder der Zeitschrift auf ihrem Schoß zu.
»Ich habe auch eine Schwester«, fuhr Jamie unaufgefordert fort. »Sie ist ziemlich genau so, wie ich hätte sein sollen – Anwältin, verheiratet, zwei Kinder … perfekt eben.«
»Eine perfekte Nervensäge, meinen Sie.«
Jamie lächelte. Je mehr Marilyn redete, desto sympathischer wurde sie ihr. »Sie ist schon in Ordnung. Nur manchmal ist es schwer, weil ich die große Schwester bin. Sie sollte eigentlich zu mir aufblicken und nicht umgekehrt.«
Jamie wartete darauf, dass Marilyn sagte, ihre Schwester würde bestimmt auch zu ihr aufblicken, was, auch wenn es nicht wahr war, schön zu hören gewesen wäre, aber die Frau schwieg. Plötzlich ging die Tür zur Intensivstation auf, und eine gut aussehende Frau in schwarzer Hose und gelbem Pullover betrat mit grimmiger Miene den Wartebereich. Sie war mindestens fünf Zentimeter größer und einige Jahre älter als Jamie, und mit ihren kinnlangen, ein wenig zu schwarzen Haaren und dem zu roten Lippenstift wirkte sie auf eine aggressive Art attraktiv.
»Wer von Ihnen ist Jamie Kellogg?«
Jamie sprang auf. »Ich bin Jamie.«
»Sie sind Tim Rannells’ Schwester?«
War das Tims Ärztin, fragte Jamie sich und dachte, dass die Frau im Umgang mit Patienten und ihren Angehörigen unbedingt bessere Manieren an den Tag legen sollte. »Genau genommen seine Halbschwester«, hörte Jamie sich sagen und biss sich auf die Unterlippe, um diese Lüge nicht noch weiter auszuschmücken. Hatte ihre Mutter ihr nicht immer erklärt, dass man an der Menge der Details, die unaufgefordert zu berichten sich ein Zeuge gedrängt fühlte, erkennen konnte, ob er oder sie log.
»Tim hat keine Schwester. Auch keine Halbschwester«, sagte die Frau, und Jamie spürte, wie sämtliche Farbe aus ihrem Gesicht wich. »Also wer sind Sie?«
»Wer sind Sie?«, fragte Jamie zurück.
»Ich bin Eleanor Rannells. Tims Frau.«
Die Worte trafen Jamie wie eine riesige Faust, die alle Luft aus ihrer Lunge presste, sodass sie sich nur mühsam auf den Beinen halten konnte.
»Und ich frage Sie noch einmal: Wer zum Teufel sind Sie?«
»Ich bin eine Kollegin Ihres Mannes«, sagte Jamie und hätte sich beim letzten Wort fast verschluckt. »Das ist Marilyn«, sagte sie und wies auf die Frau auf dem orangefarbenen Plastikstuhl, die sofort ihre Zeitschrift fallen ließ und aufsprang.
»Angenehm«, sagte Marilyn und streckte die Hand aus.
»Sie arbeiten bei Allstate?«
»Ich bin Schadensreguliererin«, sagte Jamie. »Marilyn arbeitet in der Lohnbuchhaltung.«
»In der Lohnbuchhaltung«, bestätigte Marilyn.
»Das verstehe ich nicht. Was machen Sie hier? Und warum behaupten Sie, Tims Schwester zu sein?«
»Wir haben von Tims Unfall gehört«, erklärte Jamie. »Und da dachten wir, wir schauen mal vorbei und sehen, wie es ihm geht. Wir haben ihm ein Geschenk mitgebracht. Den neuen John Grisham.«
Eleanor nahm das Buch und klemmte es unter ihren Arm.
»Offenbar lässt man nur Verwandte auf die Intensivstation«, füllte Marilyn die entstandene Pause. »Also …«
»Also sind Sie zu der Schwester geworden, die Tim nie hatte«, sagte Eleanor zu Jamie.
Im Gegensatz zu der Frau, die er sehr wohl hatte, dachte Jamie und fragte sich, ob Eleanor ihnen irgendetwas von all dem abkaufte oder nur zu höflich war, um eine Szene zu machen. »Wie geht es ihm?«
»Er hat schlecht auf das Narkosemittel reagiert. Ein paar Minuten hing es am seidenen Faden, aber jetzt sieht es so aus, als wäre er außer Lebensgefahr. Aber er darf keinen Besuch empfangen.«
»Richten Sie ihm bitte unsere Grüße aus«, sagte Marilyn.
»Das werde ich tun.« Eleanor tätschelte das Buch unter ihrem Arm. »Und vielen Dank für das Buch. John Grisham ist sein Lieblingsautor. Woher wussten Sie das?«
»Bloß gut geraten«, sagte Jamie und sah zu, wie die Tür der Intensivstation hinter der Frau ihres Freundes ins Schloss fiel.
»Alles in Ordnung?«, fragte Marilyn irgendwo neben ihr.
»Er ist verheiratet.«
»Offensichtlich.«
»Er ist verheiratet!«
»Soll ich Ihnen ein Glas Wasser holen?«
»Wir sind seit vier Monaten zusammen? Woher hätte ich wissen sollen, dass er verheiratet ist?«
»Glauben Sie mir«, sagte Marilyn. »Das passiert uns allen mal.«
»Ich bin so blöd!«, jammerte Jamie.
»Sie sind nicht blöd, sondern bloß auf den falschen Kerl reingefallen.«
»Das ist nicht das erste Mal.«
»Nein, und es wird wahrscheinlich auch nicht das letzte Mal bleiben. Seien Sie nicht so streng mit sich selbst.«
»Der verlogene Mistkerl!« Jamie brach in eine Flut wütender Tränen aus.
»So ist es richtig. Das hört sich schon viel besser an.«
»Was soll ich denn jetzt machen?«
»Ich sag Ihnen, was Sie nicht machen sollen: Weinen Sie Typen wie ihm nicht mehr hinterher.« Sanft wischte Marilyn mit den Fingern die Tränen aus Jamies Gesicht. »Sie sind eine süße und liebenswerte junge Frau, und Sie werden im Handumdrehen einen Neuen finden. Jetzt fahren Sie nach Hause, gießen sich ein Glas Wein ein und lassen ein schönes heißes Schaumbad einlaufen. Danach werden Sie sich schon viel besser fühlen, das verspreche ich Ihnen.«
Jamie lächelte unter Tränen.
»Und hören Sie auf zu weinen. Sonst verläuft noch Ihre Wimperntusche.«
»Danke, dass Sie mich eben gerettet haben.«
»Es hat mir Spaß gemacht. Und jetzt gehen Sie. Raus hier.«
Jamie ging in Richtung der Fahrstühle, blieb dann aber stehen und drehte sich noch einmal um. »Ich hoffe, alles wird gut mit der Tochter Ihrer Freundin.«
»Danke.«
»Verzeihung, was?«, fragte Jamie, nachdem sie der Barkeeper zurück in die Gegenwart gerissen hatte.
»Ich sagte, der Herr am anderen Ende des Tresens fragt, ob er Sie zu einem Drink einladen darf.«
Wieso das denn, wunderte sich Jamie. Er hatte sie kaum eines Blickes gewürdigt, als sie sich gesetzt hatte. Und seine ganze Haltung hatte etwas düster Geheimnisvolles, so als wollte er etwas verbergen. Ein weiterer Mann mit Geheimnissen war das Letzte, was sie gebrauchen konnte. Aber der Mann mit dem Tom-Selleck-Schnurrbart war verschwunden, und auf seinem Platz saß ein glatt rasierter Mann mit extrem kurz geschorenen Haaren und einem schrägen Lächeln.
Jamie stellte sich Tim Rannells in seinem Krankenhausbett vor, daneben seine Frau, die ihm aus dem Geschenk vorlas, das Jamie ihm mitgebracht hatte. Kurz darauf gesellten sich noch Jamies Schwester Cynthia und ihre Mutter an ihre Seite, und die drei schüttelten gemeinsam missbilligend den Kopf in Jamies Richtung. Wie kannst du etwas so Törichtes auch nur in Erwägung ziehen, wollten sie unisono wissen.
2
»Und darf ich dich jetzt zum Essen einladen?«
Jamie lachte, raffte die Decke um ihre nackten Brüste und starrte den gutaussehenden Fremden an, den sie erst in ihre Wohnung und dann in ihr Bett eingeladen hatte. Er hatte weiche volle Lippen, eine feine, beinahe perfekte Nase und die blauesten Augen, die sie je gesehen hatte. Wie konnte ich nur so viel Glück haben, dachte sie. Sie, die stets von einer Katastrophe in die nächste, von einer verhängnisvollen Beziehung in die andere stolperte, war irgendwie auf den perfekten Mann getroffen. Ausgerechnet in einer Kneipe, in einem Anfall von Verzweiflung. Und er hatte sich nicht nur als noch attraktiver herausgestellt, als es ihr im düsteren Licht der Bar erschienen war, er hatte nicht nur den perfekt gemeißelten Körper eines griechischen Gottes – als er sein Hemd ausgezogen hatte, hatte ihr beinahe der Atem gestockt -, sondern er hatte sich auch als überraschend großzügiger und aufmerksamer Liebhaber erwiesen, dem ihr Vergnügen genauso wichtig gewesen war wie sein eigenes. Die letzten paar Stunden hatten sie immer und immer wieder miteinander geschlafen, und ihr Körper schmerzte buchstäblich vor Lust. Sie spürte das kribbelnde Wohlbehagen zwischen ihren Beinen und zog sich die Decke bis ins Gesicht, um ein selbstzufriedenes Grinsen zu verbergen. Sofort stieg ihr sein sauberer, männlicher Duft in die Nase. Er war überall – auf ihren Laken, ihrem Kopfkissen, an ihren Fingerspitzen und den Falten ihrer Haut. Es war ein wunderbarer Geruch, entschied sie, lehnte sich an das Kopfbrett und holte tief Luft. Alles an dem Mann war wunderbar. Sogar sein Name. Brad, wiederholte sie stumm. Brad Fisher. Jamie Fisher, ertappte sie sich. Mensch, Mädchen, fang gar nicht erst mit dem Blödsinn an. Das gibt doch jedes Mal nur Ärger. Immer schön langsam. »Willst du mich wirklich zum Essen einladen?«
»Das habe ich dir doch schon früher angeboten«, erinnerte er sie.
Es stimmte. Nach der ersten Runde Getränke hatte er tatsächlich vorschlagen, dass sie gemeinsam etwas essen gingen. Sie hatte abgelehnt. Sie müsse am nächsten Morgen früh auf der Arbeit sein, hatte sie erklärt, hin und her gerissen zwischen dem Impuls, wegzulaufen oder sich ihm in die Arme zu werfen.
»Na, dann lass mich dich wenigstens noch auf einen Drink einladen«, hatte er angeboten und sofort fast wie bei einem Zaubertrick ein neues Glas Wein in der Hand gehalten. Jamie blickte auf den Wecker neben dem knapp zwei Meter breiten Bett, das beinahe das gesamte Schlafzimmer einnahm. Das Bett war eine ihrer krasseren Neuerwerbungen der letzten Zeit. Sie hatte es nur gekauft, weil Tim ihr erklärt hatte, dass er mehr Platz zum Schlafen brauchte. Das war jedenfalls seine Ausrede dafür gewesen, dass er nie bei ihr übernachtete. Sie hatte daraufhin ihr schmales Doppelbett verkauft und es durch dieses teure Ungetüm ersetzt. Doch selbst als sie ihn damit überraschte – hatte er ihr nicht erklärt, dass er Überraschungen hasste? -, fand Tim weiterhin Entschuldigungen, warum er vor Mitternacht gehen musste: ein Arzttermin in Fort Lauderdale, eine Erkältung in den Knochen. Warum war sie nicht misstrauisch geworden? Was war bloß mit ihr los? Konnte sie nach allem, was sie in den letzten paar Jahren durchgemacht hatte, immer noch so naiv sein?
Blöd traf es wohl eher.
Ihre Schwester hatte sie noch gewarnt, dass ihr Schlafzimmer für ein Bett dieser Größe zu klein war, und sie hatte natürlich wieder mal Recht gehabt. Das Bett erdrückte seine Umgebung und ließ auf beiden Seiten höchstens 30 Zentimeter freien Platz bis zur Wand, sodass sich zwei Personen kaum gleichzeitig im Zimmer bewegen konnten.
»Was ist los?«, fragte Brad sie.
»Warum denkst du, dass irgendwas ist?«
Brad zuckte mit den Schultern und legte einen Finger auf seine fast perfekte Nase. »Du sahst auf einmal so traurig aus.«
»Wirklich?«
Ein schräges Lächeln, das zu gleichen Teilen Unschuld und Übermut ausstrahlte, schlich sich auf seine attraktiven Gesichtszüge. »Woran hast du gedacht?«
Jamie unterdrückte den Drang, ihm alles zu erzählen, ihr Herz auszuschütten. Stattdessen sagte sie: »Ich habe überlegt, welches Restaurant um diese Zeit noch geöffnet hat.«
»Wie wär’s mit einem Lieferservice?«
»Klingt super.«
»Pizza?«
»Klasse!« Erstaunlich, wie einfach das Leben sein konnte, dachte sie, während sie die Nummer des nächsten Pizzaservice auswendig herunterleierte. »Ich gehe nicht so oft aus«, sagte sie und spürte, wie sie rot wurde.
Brad streckte sich über ihren Körper hinweg nach dem Telefon, das neben dem Wecker auf einem winzigen weißen Plastiktisch stand. Dabei streifte sein muskulöser Unterarm ihre Brüste und löste damit in ihrem ganzen Körper eine Gefühlslawine aus, die sie zu begraben drohte. Sie strengte sich an weiterzuatmen, während er die Nummer eintippte und eine große Pizza bestellte. »Mit Salami und Pilzen, wenn das okay für dich ist?«, fragte er und streichelte ihre Brüste unter der Decke. Sie spürte, wie ihr der Atem stockte. »Dauert eine halbe Stunde«, sagte er. Er legte den Hörer auf die Gabel und stützte sich auf einen Ellenbogen. »Wenn es länger geht, kriegen wir die Pizza umsonst«, fügte er mit einem schelmischen Grinsen hinzu.
Irgendjemand sollte dieses Lächeln in Flaschen abfüllen, dachte sie.
»Und wie fühlst du dich?«, fragte er.
»Großartig. Und du?«
»Hab mich nie besser gefühlt. Ich bin auf jeden Fall froh, dass ich vor dem Nachhauseweg noch einen Drink genommen habe.«
»Und wo genau bist du zu Hause?«, fragte Jamie und hoffte, dass es nicht zu weit entfernt war und er nicht die Pizza herunterschlingen und sich eilig aus dem Staub machen würde.
Tut mir Leid, ich habe morgen früh eine Besprechung, einen Arzttermin in Fort Lauderdale, eine Erkältung in den Knochen.
»Im Grunde habe ich zurzeit gar kein richtiges Zuhause«, erklärte er ihr. »Die letzten paar Wochen habe ich im Breakers gewohnt.«
»Du wohnst im Breakers?« Das Breakers war das vornehmste und wahrscheinlich auch teuerste aller Luxushotels in Palm Beach.
»Es ist nur noch für eine Weile. Bis ich entschieden habe, was ich als Nächstes machen soll.«
»Womit?«
Brad lächelte, aber dieses Lächeln hatte nichts Schelmisches mehr, sondern wirkte älter und verhaltener. »Wie abgedroschen würde es sich anhören, wenn ich sagte ›mit meinem Leben‹.«
»Es klingt überhaupt nicht abgedroschen«, widersprach Jamie, obwohl das nicht stimmte. Ein bisschen abgedroschen klang es schon. Ihre Schwester Cynthia würde solche Gedanken auf jeden Fall banal finden. Andererseits würde Cynthia gar nicht erst einen attraktiven Fremden aufgabeln. Sie hätte sich von ihm nie auf einen Drink einladen lassen und ihn schon gar nicht mit in ihre Wohnung genommen, um sich ihm auf dem riesigen Doppelbett hinzugeben, das sie gekauft hatte, um ihrem verheirateten Liebhaber zu gefallen. Nein, Cynthia war viel zu vernünftig, um sich auch nur im Entferntesten auf so etwas einzulassen. Schließlich hatte sie Todd in der neunten Klasse getroffen, im zweiten Jahr an der Uni geheiratet und ihm noch vor Abschluss ihres Jurastudiums zwei Kinder geboren.
»Du musst praktischer denken«, hatte sie Jamie erklärt. »Wenn du dein Studium nicht abgebrochen hättest, hätten wir jetzt schon unsere eigene Kanzlei.«
»Das Problem ist nur, dass ich keine Anwältin sein will.«
»Du bist zu romantisch – das ist das Problem.«
»Du bist verheiratet. Oder?«, fragte Jamie Brad, obwohl sie die Antwort schon wusste. Natürlich war Brad Fisher verheiratet. Er machte wahrscheinlich nur eine Krise durch. Warum sollte er sonst im Breakers wohnen? Er und seine Frau hatten sich gestritten, er war vorübergehend ausgezogen, damit sich beide beruhigen und wieder zur Vernunft kommen konnten, was er wahrscheinlich auch tun würde, sobald er seine Pizza gegessen hatte.
»Verheiratet?« Lachend schüttelte Brad den Kopf. »Nein. Natürlich nicht.«
»Nicht?«
»Wäre ich sonst hier?«
»Ich weiß nicht. Wärst du?«
»Ich wohne im Breakers, weil der Mietvertrag für meine Wohnung abgelaufen ist, ich gerade meine Firma verkauft habe und jetzt beruflich an einer Art Scheideweg stehe …«
Was für ein Scheideweg? »Was machst du denn beruflich?«, fragte sie laut.
»Ich bin in der Kommunikationsbranche.«
Jamie fand es ironisch, dass ein Wort wie Kommunikation derart schwammig sein konnte, dass es praktisch bedeutungslos war. »Geht es vielleicht ein bisschen genauer?«
»Ich bin Computerprogrammierer«, erklärte er. »Außerdem habe ich eine Software entwickelt, durch die ein paar wichtige Typen im Silicon Valley auf mich aufmerksam geworden sind. Sie haben mir ein großzügiges Übernahmeangebot gemacht.«
»Das du angenommen hast?«
»Hey, ich bin vielleicht ein Computerfreak, aber bestimmt kein Idiot.«
Jamie glaubte nicht, dass irgendjemand Brad Fisher je als Freak oder Idiot bezeichnet hatte. Konnte der Mann überhaupt noch attraktiver sein, fragte sie sich und dachte, dass er tatsächlich mit jeder Minute besser wurde. Er war nicht nur umwerfend, sexy und ein fabelhafter Liebhaber, sondern auch noch irgendein genialer Erfinder. Außerdem war er ledig, fuhr ein schickes Auto und musste sich um Geld keinerlei Sorgen machen. Jedenfalls war er wohlhabend genug, um im Breakers zu wohnen, bis er entschieden hatte, was er mit seinem Leben anfangen wollte. Viel besser konnte es gar nicht werden, entschied Jamie. »Also ich muss gestehen, dass ich in puncto Computer praktisch Analphabetin bin«, sagte sie, damit man ihre Gedanken nicht von ihrem Gesicht ablesen konnte. »Mein Computer bei der Arbeit stürzt ständig ab. Es ist wirklich nervig.«
»Was machst du denn?«
»Ich bin Schadensreguliererin bei Allstate.«
Er nickte und sah sie aus seinen saphirblauen Augen an.
»Einmal habe ich einen ganzen Arbeitstag verloren«, redete sie weiter, bemüht, nicht ins Plappern zu verfallen, »und meine Vorgesetzte hat mich gezwungen, länger zu bleiben und alles noch einmal einzugeben. Ich habe bis Mitternacht dort gesessen.«
»Muss ja ziemlich wichtig gewesen sein.«
»Nichts, was nicht auch bis zum nächsten Morgen hätte warten können. Aber Mrs. Starkey hat behauptet, ich müsse etwas falsch gemacht haben, weil sonst niemand im Büro je Probleme mit Computerabstürzen gehabt hätte, und dass es meine Verantwortung wäre und erledigt werden müsse, deshalb …« Sie plapperte. Sie musste aufhören und zwar sofort, bevor sie alles kaputtmachte.
»Du bist geblieben und hast es erledigt.«
Jamie atmete tief ein und langsam wieder aus. »So knapp war ich noch nie davor zu kündigen.«
»Hört sich an, als wärst du schon ein paar Mal kurz davor gewesen.«
»Im Grunde jeden Tag.«
»So sehr hasst du deinen Job?«
»Es ist jedenfalls nicht das, was ich mir für den Rest meines Lebens vorgestellt hatte.«
»Was hast du dir denn vorgestellt?«
»Du lachst mich auch bestimmt nicht aus?«
»Warum sollte ich dich auslachen?«, fragte er.