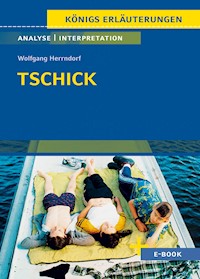9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2011
Zwei Jungs. Ein geknackter Lada. Eine Reise voller Umwege durch ein unbekanntes Deutschland. Mutter in der Entzugsklinik, Vater mit Assistentin auf Geschäftsreise: Maik Klingenberg wird die großen Ferien allein am Pool der elterlichen Villa verbringen. Doch dann kreuzt Tschick auf. Tschick, eigentlich Andrej Tschichatschow, kommt aus einem der Asi-Hochhäuser in Hellersdorf, hat es von der Förderschule irgendwie bis aufs Gymnasium geschafft und wirkt doch nicht gerade wie das Musterbeispiel der Integration. Außerdem hat er einen geklauten Wagen zur Hand. Und damit beginnt eine unvergessliche Reise ohne Karte und Kompass durch die sommerglühende deutsche Provinz. «Auch in fünfzig Jahren wird dies noch ein Roman sein, den wir lesen wollen. Aber besser, man fängt gleich damit an.» (Felicitas von Lovenberg, Frankfurter Allgemeine Zeitung).
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 294
Ähnliche
Wolfgang Herrndorf
Tschick
Roman
Über dieses Buch
Zwei Jungs. Ein geknackter Lada. Eine Reise voller Umwege durch ein unbekanntes Deutschland.
Mutter in der Entzugsklinik, Vater mit Assistentin auf Geschäftsreise: Maik Klingenberg wird die großen Ferien allein am Pool der elterlichen Villa verbringen. Doch dann kreuzt Tschick auf. Tschick, eigentlich Andrej Tschichatschow, kommt aus einem der Asi-Hochhäuser in Hellersdorf, hat es von der Förderschule irgendwie bis aufs Gymnasium geschafft und wirkt doch nicht gerade wie das Musterbeispiel der Integration. Außerdem hat er einen geklauten Wagen zur Hand. Und damit beginnt eine unvergessliche Reise ohne Karte und Kompass durch die sommerglühende deutsche Provinz.
«Auch in fünfzig Jahren wird dies noch ein Roman sein, den wir lesen wollen. Aber besser, man fängt gleich damit an.» (Felicitas von Lovenberg, Frankfurter Allgemeine Zeitung).
Vita
Wolfgang Herrndorf, 1965 in Hamburg geboren und 2013 in Berlin gestorben, hat ursprünglich Malerei studiert. 2002 erschien sein Debütroman «In Plüschgewittern», 2007 der Erzählband «Diesseits des Van-Allen-Gürtels». Es folgten die Romane «Tschick» (2010), «Sand» (2011), ausgezeichnet mit dem Preis der Leipziger Buchmesse, sowie posthum das Tagebuch «Arbeit und Struktur» (2013) und der unvollendete Roman «Bilder deiner großen Liebe» (2014). 2023 wurde die Biographie «Herrndorf» von Tobias Rüther veröffentlicht.
Impressum
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, Februar 2011
Copyright © 2010 by Rowohlt · Berlin Verlag GmbH, Berlin
Covergestaltung any.way, Barbara Hanke/Cordula Schmidt, nach einem Entwurf von ANZINGER WÜSCHNER RASP, München
Coverabbildung plainpicture/Andreas Körner; Foto der Autorin: Steffi Roßdeutscher
ISBN 978-3-644-10781-6
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Meinen Freunden
Dawn Wiener: I was fighting back.
Mrs. Wiener: Who ever told you to fight back?
Todd Solondz, Welcome to the Dollhouse
1
Als Erstes ist da der Geruch von Blut und Kaffee. Die Kaffeemaschine steht drüben auf dem Tisch, und das Blut ist in meinen Schuhen. Um ehrlich zu sein, es ist nicht nur Blut. Als der Ältere «vierzehn» gesagt hat, hab ich mir in die Hose gepisst. Ich hab die ganze Zeit schräg auf dem Hocker gehangen und mich nicht gerührt. Mir war schwindlig. Ich hab versucht auszusehen, wie ich gedacht hab, dass Tschick wahrscheinlich aussieht, wenn einer «vierzehn» zu ihm sagt, und dann hab ich mir vor Angst in die Hose gepisst. Maik Klingenberg, der Held. Dabei weiß ich gar nicht, warum jetzt die Aufregung. War doch die ganze Zeit klar, dass es so endet. Tschick hat sich mit Sicherheit nicht in die Hose gepisst.
Wo ist Tschick überhaupt? Auf der Autobahn hab ich ihn noch gesehen, wie er auf einem Bein ins Gebüsch gehüpft ist, aber ich schätze mal, sie haben ihn auch gekriegt. Mit einem Bein kommt man nicht weit. Fragen kann ich die Polizisten natürlich nicht. Weil, wenn sie ihn nicht gesehen haben, ist es logisch besser, gar nicht damit anzufangen. Vielleicht haben sie ihn ja nicht gesehen. Und von mir erfahren sie’s mit Sicherheit nicht. Da können sie mich foltern. Obwohl die deutsche Polizei, glaube ich, niemanden foltern darf. Das dürfen die nur im Fernsehen und in der Türkei.
Aber vollgeschifft und blutig auf der Station der Autobahnpolizei sitzen und Fragen nach den Eltern beantworten ist auch nicht gerade der ganz große Bringer. Vielleicht wäre Foltern sogar ganz angenehm, dann hätte ich wenigstens einen Grund für meine Aufregung.
Das Beste ist Klappe halten, hat Tschick gesagt. Und das seh ich genauso. Jetzt, wo eh alles egal ist. Und mir ist alles egal. Na ja, fast alles. Tatjana Cosic zum Beispiel ist mir natürlich nicht egal. Obwohl ich jetzt schon ziemlich lange nicht mehr an sie gedacht habe. Aber wo ich auf diesem Hocker hier sitze und draußen die Autobahn vorbeirauscht und der ältere Polizist steht seit fünf Minuten an der Kaffeemaschine dahinten und füllt Wasser ein und kippt es wieder aus, drückt auf den Schalter und schaut das Gerät von unten an, während jeder Depp sehen kann, dass der Stecker vom Verlängerungskabel nicht drin ist, da muss ich wieder an Tatjana denken. Denn genau genommen wäre ich nicht hier, wenn es Tatjana nicht gäbe. Obwohl sie mit der ganzen Sache nichts zu tun hat. Ist das unklar, was ich da rede? Ja, tut mir leid. Ich versuch’s später noch mal. Tatjana kommt in der ganzen Geschichte überhaupt nicht vor. Das schönste Mädchen der Welt kommt nicht vor. Auf der ganzen Reise hab ich mir immer vorgestellt, dass sie uns sehen kann. Wie wir oben aus dem Kornfeld rausgucken. Wie wir mit dem Bündel Schläuche auf dem Müllberg stehen wie die letzten Trottel … Ich hab mir immer vorgestellt, Tatjana steht hinter uns und sieht, was wir sehen, und freut sich, wie wir uns freuen. Aber jetzt bin ich froh, dass ich mir das nur vorgestellt hab.
Der Polizist zieht ein grünes Papierhandtuch aus einem Handtuchspender und gibt es mir. Was soll ich damit? Den Boden aufwischen? Er fasst mit zwei Fingern an seine Nase und sieht mich an. Ach so. Nase schnäuzen. Ich schnäuze mir die Nase, er lächelt freundlich. Das mit der Folter kann ich mir wohl abschminken. Aber wohin jetzt mit dem Taschentuch? Ich schaue suchend auf dem Boden herum. Die ganze Station ist mit grauem Linoleum ausgelegt, genau das gleiche wie in den Gängen zu unserer Turnhalle. Es riecht auch ein bisschen so. Pisse, Schweiß und Linoleum. Ich sehe Wolkow, unseren Sportlehrer, im Trainingsanzug durch die Gänge federn, siebzig Jahre, durchtrainiert: Auf geht’s, Jungs! Hopp, hopp! Das Geräusch seiner schmatzenden Schritte auf dem Boden, fernes Gekicher aus der Mädchenumkleide und Wolkows Blick dorthin. Ich sehe die hohen Fenster, die Bänke, die Ringe an der Decke, an denen nie geturnt wurde. Ich sehe Natalie und Lena und Kimberley durch den Seiteneingang der Halle kommen. Und Tatjana in ihrem grünen Trainingsanzug. Ich sehe ihr verschwommenes Spiegelbild auf dem Hallenboden, die Glitzerhosen, die die Mädchen jetzt immer tragen, die Oberteile. Und dass neuerdings die Hälfte von ihnen in dicken Wollpullovern turnt, und mindestens drei haben immer ein Attest vom Arzt. Hagecius-Gymnasium Berlin, achte Klasse.
«Ich dachte, fünfzehn?», sage ich, und der Polizist schüttelt den Kopf.
«Nee, vierzehn. Vierzehn. Was ist mit dem Kaffee, Horst?»
«Kaffee ist kaputt», sagt Horst.
Ich möchte meinen Anwalt sprechen.
Das wäre der Satz, den ich jetzt wahrscheinlich sagen müsste. Das ist der richtige Satz in der richtigen Situation, wie jeder aus dem Fernsehen weiß. Aber das sagt sich so leicht: Ich möchte meinen Anwalt sprechen. Würden die sich wahrscheinlich totlachen. Das Problem ist: Ich habe keine Ahnung, was dieser Satz bedeutet. Wenn ich sage, ich möchte meinen Anwalt sprechen, und sie fragen: «Wen möchtest du sprechen? Deinen Anwalt?» – was soll ich dann antworten? Ich hab in meinem Leben noch keinen Anwalt gesehen, und ich weiß auch nicht, wozu ich einen brauche. Ich weiß nicht mal, ob Rechtsanwalt dasselbe ist wie Anwalt. Oder Staatsanwalt. So was Ähnliches wie ein Richter, nehme ich an, nur dass er auf meiner Seite steht und mehr Ahnung von Gesetzen hat als ich. Aber mehr Ahnung von Gesetzen als ich hat hier praktisch jeder, der im Raum ist. Jeder Polizist vor allem. Und die könnte ich natürlich fragen. Aber ich wette, wenn ich den Jüngeren frage, ob ich jetzt so eine Art Anwalt brauchen könnte, dann dreht der sich zu seinem Kollegen um und ruft: «Hey, Horst! Horschti! Komm mal her! Unser Held hier will wissen, ob er einen Anwalt braucht! Guck dir das an. Blutet den ganzen Boden voll, pisst sich in die Hosen wie ein Weltmeister und – will seinen Anwalt sprechen!» Hahaha. Da lachen die sich natürlich kaputt. Und ich finde, es geht mir schlecht genug, ich muss mich nicht auch noch zum Obst machen. Was passiert ist, ist passiert. Mehr kommt jetzt nicht. Da kann auch der Anwalt nichts mehr ändern. Weil, dass wir Mist gebaut haben, könnte nur ein Geisteskranker abzustreiten versuchen. Was soll ich sagen? Dass ich die ganze Woche zu Hause am Pool gelegen hab, fragen Sie die Putzfrau? Dass die Schweinehälften wie Regen vom Himmel gefallen sind? Viel kann ich jetzt wirklich nicht mehr tun. Ich könnte noch gen Mekka beten und mir in die Hosen kacken, sonst sind nicht mehr viele Optionen offen.
Der Jüngere, der eigentlich ganz nett aussieht, schüttelt den Kopf und wiederholt: «Fünfzehn ist Quatsch. Vierzehn. Mit vierzehn bist du strafmündig.»
Wahrscheinlich sollte ich jetzt Schuldgefühle haben und Reue und alles, aber, ehrlich gesagt, ich fühle überhaupt nichts. Mir ist einfach nur wahnsinnig schwindlig. Ich kratze mich unten an meiner Wade. Nur da, wo früher meine Wade war, ist jetzt nichts mehr. Ein violetter Streifen Schleim bleibt an meiner Hand kleben. Das ist nicht mein Blut, hatte ich vorhin gesagt, als sie mich gefragt hatten. Lag ja genug anderer Schleim auf der Straße, um den man sich kümmern konnte, und ich dachte wirklich, dass das nicht mein Blut ist. Aber wenn das nicht mein Blut ist, wo ist denn jetzt meine Wade, frage ich mich?
Ich ziehe das Hosenbein hoch und gucke drunter. Dann habe ich noch genau eine Sekunde, um mich zu wundern. Wenn ich das im Film sehen müsste, würde mir mit Sicherheit übel, denke ich, und tatsächlich wird mir jetzt übel, auf dieser Station der Autobahnpolizei, was ja auch irgendwie beruhigend ist. Für einen kurzen Moment sehe ich noch mein Spiegelbild auf dem Linoleum auf mich zukommen, und dann knallt es, und ich bin weg.
2
Der Arzt macht den Mund auf und zu wie ein Karpfen. Es dauert ein paar Sekunden, bis Worte rauskommen. Der Arzt schreit. Warum schreit denn jetzt der Arzt? Er schreit die kleine Frau an. Dann mischt sich der Uniformierte ein, eine blaue Uniform. Ein Polizist, den ich noch nicht kenne. Er weist den Arzt zurecht. Woher weiß ich überhaupt, dass das ein Arzt ist? Er trägt einen weißen Kittel. Könnte also auch ein Bäcker sein. Aber in der Kitteltasche hat er eine Metalltaschenlampe und so ein Horchding. Was soll ein Bäcker mit dem Horchding, Brötchen abhorchen? Wird schon ein Arzt sein. Und dieser Arzt zeigt jetzt auf meinen Kopf und brüllt. Ich taste unter der Bettdecke herum, wo meine Beine sind. Sie sind nackt. Fühlen sich auch nicht mehr bepisst an oder blutig. Wo bin ich denn hier?
Ich liege auf dem Rücken. Oben ist alles gelb. Blick zur Seite: große, dunkle Fenster. Andere Seite: weißer Plastikvorhang. Krankenhaus, würde ich sagen. Das passt ja auch zum Arzt. Und klar, die kleine Frau trägt auch einen Kittel und einen Schreibblock. Und welches Krankenhaus, vielleicht die Charité? Nee, keine Ahnung. Ich bin ja nicht in Berlin. Mal fragen, denke ich, aber niemand beachtet mich. Weil, dem Polizisten gefällt das nämlich nicht, wie er da von dem Arzt angeschrien wird, und er schreit zurück, aber da schreit dann der Arzt noch lauter – und da merkt man interessanterweise, wer hier das Sagen hat. Das Sagen hat nämlich eindeutig der Arzt und nicht der Polizist, und ich bin so erschöpft und auch irgendwie glücklich und müde, ich bin von innen wie mit Glück ausgepolstert und schlafe wieder ein, ohne ein Wort zu sagen. Das Glück, stellt sich später raus, heißt Valium. Es wird mit großen Spritzen verteilt.
Als ich das nächste Mal aufwache, ist alles hell. In den großen Fenstern steht die Sonne. An meinen Fußsohlen wird herumgekratzt. Aha, schon wieder ein Arzt, ein anderer diesmal, und eine Krankenschwester hat er auch wieder dabei. Keine Polizisten. Nur dass der Arzt so an meinen Füßen kratzt, ist nicht angenehm. Warum kratzt der denn so?
«Er ist aufgewacht», bemerkt die Krankenschwester. Nicht sehr geistreich.
«Ah, aha.» Der Arzt schaut mich an. «Wie geht es dir?»
Ich will etwas sagen, aber aus meinem Mund kommt nur: «Pfff.»
«Wie geht es dir? Weißt du, wie du heißt?»
«Pfff-fäh?»
Was ist das denn für eine Frage? Halten die mich für meschugge? Ich schaue den Arzt an, und er schaut mich an, und dann beugt er sich über mich und leuchtet mir mit einer Taschenlampe in die Augen. Ist das ein Verhör? Soll ich meinen Namen gestehen oder was? Ist das hier das Folterkrankenhaus? Und wenn, kann er dann bitte mal kurz aufhören, meine Augenlider hochzuziehen, oder wenigstens so tun, als würde er sich für meine Antwort interessieren? Allerdings antworte ich gar nicht. Weil, während ich noch überlege, ob ich Maik Klingenberg sagen soll oder einfach nur Maik oder Klinge oder Attila der Hunnenkönig – das sagt mein Vater immer, wenn er Stress hat, wenn er den ganzen Tag wieder nur Hiobsbotschaften gehört hat, dann trinkt er zwei Jägermeister und meldet sich am Telefon mit Attila der Hunnenkönig –, ich meine, während ich noch am Überlegen bin, ob ich überhaupt etwas sagen soll oder ob man sich das nicht letztlich sparen kann in dieser Situation, redet der Arzt schon irgendwas von «vier hiervon» und «drei davon», und ich schlafe wieder ein.
3
Über Krankenhäuser kann man ja viel sagen, aber nicht, dass es da nicht schön ist. Ich bin immer wahnsinnig gern im Krankenhaus. Man macht den ganzen Tag nichts, und dann kommen die Krankenschwestern. Die Schwestern sind alle superjung und superfreundlich. Und sie tragen diese dünnen weißen Kittel, die ich so toll finde, wo man immer gleich sieht, was für Unterwäsche sie anhaben. Warum ich das so toll finde, weiß ich übrigens auch nicht. Weil, wenn jemand mit so einem Kittel auf der Straße rumlaufen würde, würde ich das albern finden. Aber im Krankenhaus ist es toll. Meine Meinung. Das ist ein bisschen wie in Mafiafilmen, wo einen die Gangster immer eine Minute schweigend angucken, bevor sie antworten. «Hey!» Eine Minute Schweigen. «Sieh mir in die Augen!» Fünf Minuten Schweigen. Im richtigen Leben ist das albern. Aber wenn man bei der Mafia ist, eben nicht.
Meine Lieblingskrankenschwester kommt aus dem Libanon und heißt Hanna. Hanna hat kurzes schwarzes Haar und trägt normale Unterwäsche. Und das ist auch toll: normale Unterwäsche. Diese andere Unterwäsche sieht ja auch immer ein bisschen traurig aus. Bei den meisten. Wenn man nicht gerade die Figur von Megan Fox hat, kann das ziemlich verzweifelt aussehen. Ich weiß nicht. Vielleicht bin ich auch pervers: Ich steh auf normale Unterwäsche.
Hanna ist eigentlich auch erst Schwesternschülerin, also in der Ausbildung oder so, und wenn sie in mein Zimmer kommt, streckt sie immer zuerst den Kopf um die Ecke und klopft dann mit zwei Fingern an den Türrahmen, das finde ich sehr, sehr höflich, und sie denkt sich jeden Tag einen neuen Namen für mich aus. Erst hieß ich Maik, dann Maiki, dann Maikipaiki, wo ich schon dachte: Alter Finne. Aber das war noch nicht das Ende. Dann hieß ich Michael Schumacher, dann Attila der Hunnenkönig, dann Schweinemörder und zuletzt sogar der kranke Hase. Allein deshalb würde ich am liebsten noch ein Jahr in diesem Krankenhaus bleiben.
Hanna wechselt jeden Tag meinen Verband. Das tut ziemlich weh, und Hanna tut es auch weh, wie man an ihrem Gesicht sehen kann.
«Hauptsache, dir macht’s Spaß», sagt sie dann immer, wenn sie fertig ist, und ich sage dann immer, dass ich sie später wahrscheinlich einmal heiraten werde oder so was. Aber leider hat sie schon einen Freund. Manchmal kommt sie auch einfach so und setzt sich an mein Bett, weil ich ja sonst praktisch keinen Besuch kriege, und es sind richtig gute Unterhaltungen, die wir da führen. Richtige Erwachsenenunterhaltungen. Mit Frauen wie Hanna ist es immer unfassbar viel leichter, sich zu unterhalten, als mit Mädchen in meinem Alter. Falls mir jemand erklären kann, warum das so ist, kann er mich übrigens gern anrufen, weil, ich kann es mir nämlich nicht erklären.
4
Der Arzt ist weniger unterhaltsam. «Das ist nur ein Stück Fleisch», sagt er, «Muskel», sagt er, «ist nicht schlimm, das wächst nach. Bleibt vielleicht ’ne kleine Delle oder Narbe», sagt er, «das sieht dann sexy aus», und das sagt er jeden Tag. Jeden Tag guckt er sich den Verband an und erzählt genau das Gleiche, dass da ’ne Narbe bleibt, dass das nicht schlimm ist, dass das später mal aussieht, als wär ich im Krieg gewesen. «Als wärst du im Krieg gewesen, junger Mann, da stehen die Frauen drauf», sagt er, und es soll wohl irgendwie tiefsinnig sein, aber ich versteh den Tiefsinn nicht, und dann zwinkert er mich an, und meistens zwinker ich zurück, obwohl ich’s nicht verstehe. Schließlich hat der Mann mir geholfen, da helfe ich ihm auch.
Später werden unsere Gespräche besser, vor allem, weil sie ernster werden. Beziehungsweise, es ist eigentlich nur ein Gespräch. Als ich wieder humpeln kann, holt er mich in sein Zimmer, in dem ausnahmsweise mal ein Schreibtisch steht und kein medizinisches Gerät, und da sitzen wir uns dann gegenüber wie Firmenchefs, die den nächsten Deal eintüten. Auf dem Tisch steht ein menschlicher Oberkörper aus Plastik, wo man die Organe rausnehmen kann. Der Dickdarm sieht aus wie ein Gehirn, und vom Magen blättert die Farbe ab.
«Ich muss mal mit dir reden», sagt der Arzt, und das ist logisch der dümmste Gesprächsanfang, den ich kenne. Und dann warte ich, dass er mit Reden anfängt, aber das gehört zu diesem Anfang leider dazu, dass man sagt, ich muss mal mit dir reden, und dann erst mal nicht redet. Der Arzt starrt mich also an, senkt dann seinen Blick und klappt einen grünen Pappordner auf. Oder klappt ihn nicht auf, sondern öffnet ihn, wie ich mir vorstelle, dass er einem Patienten die Bauchdecke aufschneidet. Sehr umsichtig, sehr kompliziert, sehr ernst. Der Mann ist Chirurg. Glückwunsch.
Was danach kommt, ist schon weniger interessant. Im Grunde will er nur wissen, wo meine Kopfwunde herkommt, vorne rechts. Auch wo die anderen Wunden herkommen – von der Autobahn, wie gesagt, okay, das wusste er schon –, aber die Kopfwunde, da bin ich vom Stuhl gefallen, auf der Station der Autobahnpolizei.
Der Arzt legt die Hände an den Fingerspitzen zusammen. Ja, so würde das da auch im Bericht drinstehen: vom Stuhl gefallen. Auf der Polizeistation.
Er nickt. Ja.
Ich nicke auch.
«Wir sind hier unter uns», sagt er nach einer Weile.
«Ist mir klar», sage ich wie der letzte Blödmann und zwinkere erst dem Arzt zu und dann zur Sicherheit auch noch mal dem Plastikoberkörper.
«Du kannst hier über alles sprechen. Ich bin dein Arzt, und das heißt in diesem Fall, ich habe eine Schweigepflicht.»
«Ja, gut», sage ich. So was Ähnliches hatte er mir vor ein paar Tagen schon mal angedeutet, ich hab’s jetzt begriffen. Der Mann hat eine Schweigepflicht, und er erwartet jetzt, dass ich ihm etwas erzähle, damit er davon schweigen kann. Aber was? Wie übertrieben geil es ist, sich vor Angst in die Hose zu pissen?
«Es ist ja nicht nur die Handlungsweise. Das ist eine Verletzung der Aufsichtspflicht. Die hätten sich nicht auf deine Angaben verlassen dürfen, verstehst du? Die hätten nachgucken und vor allem sofort den Arzt rufen müssen. Weißt du, wie kritisch das war? Und du sagst, du bist vom Stuhl gefallen?»
«Ja.»
«Es tut mir leid, aber wir Ärzte sind misstrauische Menschen. Ich meine, die wollten doch einiges von dir. Und ich als dein behandelnder Arzt …»
Ja, ja. Himmel. Schweigepflicht. Schon klar. Aber was will er denn jetzt wissen? Wie man vom Stuhl fällt? Seitlich runter und dann plumps? Er schüttelt erst lange den Kopf, dann macht er eine winzige Bewegung mit der Hand – und da erst wird mir klar, worauf er hinauswill. Mein Gott, steht bei mir einer auf der Leitung. Immer diese Scheißpeinlichkeit. Warum redet er nicht Klartext?
«Nee, nee!», rufe ich und winke mit den Händen in der Luft herum, als würde ich riesige Fliegenschwärme abwehren. «Alles korrekt! Ich hab auf dem Stuhl gesessen und mein Hosenbein hochgemacht, und dann hab ich das gesehen und dann Schwindel und rums. Keine Fremdeinwirkung.» Gutes Wort. Kenn ich aus dem Tatort.
«Also sicher?»
«Sicher. Ja. Und die Polizisten total nett. Ich hab sogar ein Wasser gekriegt und ein Taschentuch. Nur eben Schwindel und dann seitlich runter.» Ich richte mich vor dem Schreibtisch auf und lasse mich schauspielerisch hochbegabt zweimal halb nach rechts kippen.
«Gut», sagt der Arzt langsam.
Er kritzelt etwas auf ein Papier.
«Wollt ich nur wissen. Trotzdem unverantwortlich. Blutverlust … hätte man wirklich … sieht auch nicht so aus.»
Er schließt den grünen Ordner und schaut mich lange an. «Und ich weiß ja nicht, geht mich vielleicht auch nichts an – aber das würde mich jetzt doch mal interessieren. Du musst nicht antworten, wenn du nicht magst. Aber – was wolltet ihr denn da eigentlich? Oder wohin?»
«Keine Ahnung.»
«Wie gesagt, du musst es nicht sagen. Ich frag nur interessehalber.»
«Ich würd’s Ihnen sagen. Aber wenn ich’s Ihnen sage, glauben Sie’s eh nicht. Glaube ich.»
«Ich glaub dir alles.» Er lächelt freundlich. Kumpelhaft.
«Es ist albern.»
«Was ist schon albern?»
«Das ist … na ja. Wir wollten in die Walachei. Sehen Sie, Sie finden’s doch albern.»
«Ich find’s nicht albern, ich hab’s nur nicht verstanden. Wohin?»
«In die Walachei.»
«Wo soll das sein?» Er sieht mich interessiert an, und ich spüre, dass ich rot werde. Wir vertiefen das dann nicht weiter. Zum Schluss geben wir uns noch die Hand wie erwachsene Menschen, und ich bin irgendwie froh, dass ich seine Schweigepflicht nicht überstrapazieren musste.
5
Ich hatte nie einen Spitznamen. Ich meine, an der Schule. Aber auch sonst nicht. Mein Name ist Maik Klingenberg. Maik. Nicht Maiki, nicht Klinge und der ganze andere Quatsch auch nicht, immer nur Maik. Außer in der Sechsten, da hieß ich mal kurz Psycho. Das ist auch nicht der ganz große Bringer, wenn man Psycho heißt. Aber das dauerte auch nicht lang, und dann hieß ich wieder Maik.
Wenn man keinen Spitznamen hat, kann das zwei Gründe haben. Entweder man ist wahnsinnig langweilig und kriegt deshalb keinen, oder man hat keine Freunde. Wenn ich mich für eins von beiden entscheiden müsste, wär’s mir, ehrlich gesagt, lieber, keine Freunde zu haben, als wahnsinnig langweilig zu sein. Weil, wenn man langweilig ist, hat man automatisch keine Freunde, oder nur Freunde, die noch langweiliger sind als man selbst.
Es gibt aber auch noch eine dritte Möglichkeit. Es kann sein, dass man langweilig ist und keine Freunde hat. Und ich fürchte, das ist mein Problem. Jedenfalls seit Paul weggezogen ist. Paul war mein Freund seit dem Kindergarten, und wir haben uns fast jeden Tag getroffen, bis seine endbescheuerte Mutter beschlossen hat, dass sie lieber im Grünen wohnen will.
Das war ungefähr zu der Zeit, als ich aufs Gymnasium kam, und das hat alles nicht leichter gemacht. Ich hab Paul dann fast gar nicht mehr gesehen. Das war immer eine halbe Weltreise mit der S-Bahn da raus und dann noch sechs Kilometer mit dem Fahrrad. Außerdem hat Paul sich verändert da draußen. Seine Eltern hatten sich scheiden lassen, und da ist er dann abgedreht. Ich meine, richtig abgedreht. Paul wohnt jetzt praktisch im Wald mit seiner Mutter und versumpft. Er hatte schon immer diese Tendenz zum Versumpfen. Man musste ihn immer antreiben. Aber da draußen hat ihn keiner mehr angetrieben, und er ist völlig versumpft. Wenn ich mich richtig erinnere, hab ich ihn auch höchstens drei Mal besucht. Es war jedes Mal so deprimierend, dass ich da nie wieder hinwollte. Paul hat mir das Haus gezeigt und den Garten und den Wald und einen Hochsitz im Wald, auf dem hat er immer gesessen, Tiere beobachten. Nur dass es da natürlich gar keine Tiere gab. Alle zwei Stunden flog ein Spatz vorbei. Und darüber hat er auch noch Buch geführt. Das war in dem Frühjahr, als gerade GTA IV rauskam, aber das hat Paul überhaupt nicht mehr interessiert. Nur noch diese Viecher. Einen ganzen Tag lang musste ich mit ihm auf seinem Hochsitz sitzen, und dann wurde es selbst mir zu blöd. Ich hab auch einmal heimlich sein Buch durchgeblättert, um zu gucken, was da sonst noch drinstand, weil, da stand noch ziemlich viel anderes Zeug drin. Sachen über seine Mutter standen dadrin und Sachen in Geheimschrift, und es gab Zeichnungen von nackten Frauen, ganz schreckliche Zeichnungen. Also nichts gegen nackte Frauen, nackte Frauen sind toll. Aber diese Zeichnungen waren nicht toll, die waren einfach nur endbescheuert, und dazwischen immer in Schönschrift Tierbeobachtungen und Wetterbeobachtungen. Am Ende hatte Paul Wildschweine und Luchse und Wölfe gesehen, Wölfe mit Fragezeichen, und ich hab gesagt: «Das ist hier der Stadtrand von Berlin – Luchse und Wölfe, bist du dir ganz sicher?» Und er hat mir das Buch aus der Hand gerissen und mich angeguckt, als ob ich der Bekloppte wäre. Und danach haben wir uns nicht mehr so oft gesehen. Drei Jahre ist das her. Das war einmal mein bester Freund.
Auf dem Gymnasium habe ich dann erst mal niemanden kennengelernt. Ich bin nicht wahnsinnig gut im Kennenlernen. Und das war auch nie das ganz große Problem für mich. Bis Tatjana Cosic kam. Oder bis ich sie bemerkte. Denn natürlich war Tatjana schon immer in meiner Klasse. Aber bemerkt hab ich sie erst in der Siebten. Warum, weiß ich nicht. Aber in der Siebten hatte ich sie auf einmal voll auf dem Schirm, da fing das ganze Elend an. Und ich sollte jetzt wahrscheinlich langsam mal anfangen, Tatjana zu beschreiben. Weil sonst alles, was danach kommt, unverständlich ist.
Tatjana heißt mit Vornamen Tatjana und mit Nachnamen Cosic. Sie ist vierzehn Jahre alt und 1,65 m groß, und ihre Eltern heißen mit Nachnamen ebenfalls Cosic. Wie sie mit Vornamen heißen, weiß ich nicht. Sie kommen aus Serbien oder Kroatien, jedenfalls kommt der Name daher, und sie wohnen in einem weißen Mietshaus mit vielen Fenstern – badabim, badabong. Schon klar: Ich kann hier noch lange rumschwafeln, aber das Erstaunliche ist, dass ich überhaupt nicht weiß, wovon ich rede. Ich kenne Tatjana nämlich überhaupt nicht. Ich weiß über sie, was jeder weiß, der mit ihr in eine Klasse geht. Ich weiß, wie sie aussieht, wie sie heißt und dass sie gut in Sport und Englisch ist. Und so weiter. Dass sie 1,65 groß ist, weiß ich vom Tag der Schuluntersuchung. Wo sie wohnt, weiß ich aus dem Telefonbuch, und mehr weiß ich praktisch nicht. Und ich könnte logisch noch ihr Aussehen ganz genau beschreiben und ihre Stimme und ihre Haare und alles. Aber ich glaube, das ist überflüssig. Weil, kann sich ja jeder vorstellen, wie sie aussieht: Sie sieht super aus. Ihre Stimme ist auch super. Sie ist einfach insgesamt super. So kann man sich das vorstellen.
6
Und jetzt hab ich immer noch nicht erklärt, warum sie mich Psycho genannt haben. Denn, wie gesagt, für kurze Zeit hieß ich auch Psycho. Keine Ahnung, was das sollte. Also schon klar: Das sollte bedeuten, dass ich sie nicht alle beisammenhab. Aber da hätten meiner Meinung nach ein paar andere viel eher so heißen können. Frank hätte so heißen können, oder Stöbcke mit seinem Feuerzeug, die sind auf jeden Fall gestörter als ich. Oder der Nazi. Aber der Nazi hieß schon Nazi, der brauchte keinen Namen mehr. Und natürlich hatte das auch einen speziellen Grund, warum ausgerechnet ich so hieß. Dieser Grund war ein Deutschaufsatz bei Schürmann, sechste Klasse. Thema Reizwortgeschichte. Falls jemand nicht weiß, was das ist, Reizwortgeschichte geht so: Man bekommt vier Wörter, zum Beispiel «Zoo», «Affe», «Wärter» und «Mütze», und dann muss man eine Geschichte schreiben, in der ein Zoo, ein Affe, ein Wärter und eine Mütze vorkommen. Wahnsinnig originell. Der reine Schwachsinn. Die Wörter, die Schürmann sich ausgedacht hatte, waren «Urlaub», «Wasser», «Rettung» und «Gott». Was schon mal deutlich schwieriger war als mit dem Zoo und dem Affen, und die Hauptschwierigkeit war natürlich Gott. Bei uns gab es nur Ethik, und in der Klasse waren sechzehn Atheisten inklusive mir, und auch die, die Protestanten waren, die haben nicht wirklich an Gott geglaubt. Glaube ich. Jedenfalls nicht so, wie Leute daran glauben, die wirklich an Gott glauben, die keiner Ameise was zuleide tun können oder sich riesig freuen, wenn einer stirbt, weil er dann in den Himmel kommt. Oder die mit einem Flugzeug ins World Trade Center krachen. Die glauben wirklich an Gott. Und deshalb war dieser Aufsatz ziemlich schwierig. Die meisten haben sich erst mal an dem Wort Urlaub festgehalten. Da rudert die Kleinfamilie an der Côte d’Azur rum, und dann geraten sie vollkommen überraschend in einen höllischen Sturm und rufen «o Gott» und werden gerettet und so. Und so was hätte ich natürlich auch schreiben können. Aber als ich über diesem Aufsatz saß, fiel mir als Erstes ein, dass wir die letzten drei Jahre schon nicht mehr in den Urlaub gefahren waren, weil mein Vater die ganze Zeit seinen Bankrott vorbereitete. Was mich nie gestört hatte, so gern bin ich mit meinen Eltern auch wieder nicht in Urlaub gefahren.
Stattdessen hatte ich den ganzen letzten Sommer in unserem Keller gehockt und Bumerangs geschnitzt. Ein Lehrer von mir, einer aus der Grundschule, hat mir das beigebracht. Das war der totale Fachmann im Bumerangbereich. Bretfeld hieß der, Wilhelm Bretfeld. Der hat sogar ein Buch darüber geschrieben. Sogar zwei Bücher. Das habe ich aber erst mitgekriegt, als ich schon aus der Grundschule raus war. Da hab ich den alten Bretfeld noch mal auf einer Wiese getroffen. Der stand praktisch direkt hinter unserem Haus auf der Kuhwiese und hat seine Bumerangs geworfen, selbstgeschnitzte Bumerangs – und das war auch wieder so eine Sache, wo ich nicht wusste, dass das funktioniert. Wo ich dachte, das gibt’s nur im Film, dass die wirklich zu einem zurückkommen. Aber Bretfeld war der Vollprofi, und der hat es mir dann gezeigt. Ich fand das wahnsinnig beeindruckend. Auch dass er seine Bumerangs alle selbst geschnitzt und bemalt hat. «Alles, was vorne rund und hinten spitz ist, fliegt», hat Bretfeld gesagt, und dann hat er mich über seine Brille hinweg angeguckt und gefragt: «Wie heißt du noch mal? Ich kann mich nicht an dich erinnern.» Was mich aber am meisten umgehauen hat, war dieser Langzeitflugbumerang. Das war ein von ihm selbst entwickelter Bumerang, der konnte minutenlang fliegen, und den hat er erfunden. Überall auf der Welt, wenn heute jemand einen Langzeitflugbumerang wirft und der bleibt fünf Minuten in der Luft, dann wird ein Foto gemacht, und dann steht da: basierend auf einem Design von Wilhelm Bretfeld. Der ist also praktisch weltbekannt, dieser Bretfeld. Und der steht da letzten Sommer auf der Kuhwiese hinter unserem Haus und zeigt mir das. Wirklich ein guter Lehrer. Das hatte ich auf der Grundschule gar nicht bemerkt.
Jedenfalls hab ich die ganzen Sommerferien im Keller gesessen und geschnitzt. Und das waren tolle Sommerferien, viel besser als Urlaub. Meine Eltern waren fast nie zu Hause. Mein Vater fuhr von Gläubiger zu Gläubiger, und meine Mutter war auf der Beautyfarm. Und da hab ich dann eben auch den Aufsatz drüber geschrieben: Mutter und die Beautyfarm. Reizwortgeschichte von Maik Klingenberg.
In der nächsten Stunde durfte ich sie vorlesen. Oder musste. Ich wollte ja nicht. Svenja war zuerst dran, und die hat diesen Quatsch mit der Côte d’Azur vorgelesen, den Schürmann wahnsinnig toll fand, und dann hat Kevin noch mal das Gleiche vorgelesen, nur dass die Côte d’Azur jetzt die Nordsee war, und dann kam ich. Mutter auf der Schönheitsfarm. Die ja nicht wirklich eine Schönheitsfarm war. Obwohl meine Mutter tatsächlich immer etwas besser aussah, wenn sie von dort zurückkam. Aber eigentlich ist es eine Klinik. Sie ist ja Alkoholikerin. Sie hat Alkohol getrunken, solange ich denken kann, aber der Unterschied ist, dass es früher lustiger war. Normal wird vom Alkohol jeder lustig, aber wenn das eine bestimmte Grenze überschreitet, werden die Leute müde oder aggressiv, und als meine Mutter dann wieder mit dem Küchenmesser durch die Wohnung lief, stand ich mit meinem Vater oben auf der Treppe, und mein Vater hat gefragt: «Wie wär’s mal wieder mit der Beautyfarm?» Und so fing der Sommer an, als ich in der Sechsten war.
Ich mag meine Mutter. Ich muss das dazusagen, weil das, was jetzt kommt, vielleicht kein supergutes Licht auf sie wirft. Aber ich hab sie immer gemocht, und ich mag sie noch. Sie ist nicht so wie andere Mütter. Das mochte ich immer am meisten. Sie kann zum Beispiel sehr witzig sein, das kann man ja von vielen Müttern nicht gerade behaupten. Und dass das Schönheitsfarm hieß, das war eben auch nur so ein Witz von meiner Mutter.
Früher hat meine Mutter viel Tennis gespielt. Mein Vater auch, aber nicht so gut. Der eigentliche Crack in der Familie war meine Mutter. Als sie noch fit war, hat sie jedes Jahr die Vereinsmeisterschaften gewonnen. Und auch mit einer Flasche Wodka intus hat sie die noch gewonnen, aber das ist eine andere Geschichte. Jedenfalls war ich schon als Kind immer mit ihr auf dem Platz. Meine Mutter hat auf der Vereinsterrasse gesessen und Cocktails getrunken mit Frau Weber und Frau Osterthun und Herrn Schuback und dem ganzen Rest. Und ich hab unterm Tisch gesessen und mit Autos gespielt, und die Sonne hat geschienen. In meiner Erinnerung scheint im Tennisclub immer die Sonne. Ich schaue mir den roten Staub auf fünf Paar weißen Tennisschuhen an, ich sehe die Unterwäsche unter den knappen Tennisröcken, und ich sammle die Kronkorken ein, die von oben runterfallen und in die man mit Kugelschreiber reinmalen kann. Ich darf fünf Eis essen am Tag und zehn Cola trinken und alles beim Wirt anschreiben lassen. Und dann sagt Frau Weber oben: «Nächste Woche wieder um sieben, Frau Klingenberg?»
Und meine Mutter: «Sicher.»
Und Frau Weber: «Da bring ich dann diesmal die Bälle.»
Und meine Mutter: «Sicher.»
Und so weiter und so weiter. Immer genau das gleiche Gespräch. Wobei der Witz war, dass Frau Weber nie Bälle mitbrachte, da war sie zu geizig für.
Ab und zu gab es aber auch eine andere Unterhaltung. Die ging so:
«Nächste Woche wieder Samstag, Frau Klingenberg?»
«Kann ich nicht, da fahr ich weg.»
«Aber hat Ihr Mann nicht Medenspiele?»
«Ja, er fährt ja auch nicht weg. Ich fahr weg.»
«Ach, wo fahren Sie denn hin?»
«Auf die Beautyfarm.»
Und dann kam immer, immer, immer von irgendwem am Tisch, der das noch nicht kannte, die wahnsinnig geistreiche Bemerkung: «Das haben Sie doch gar nicht nötig, Frau Klingenberg!»
Und meine Mutter hat ihren Brandy Alexander runtergekippt und gesagt: «War ein Witz, Herr Schuback. Ist ’ne Entzugsklinik.»
Dann sind wir Hand in Hand vom Tennisplatz nach Hause, weil meine Mutter nicht mehr Auto fahren konnte. Ich hab ihre schwere Sporttasche getragen, und sie hat zu mir gesagt: «Du kannst nicht viel von deiner Mutter lernen. Aber das kannst du von deiner Mutter lernen. Erstens, man kann über alles reden. Und zweitens, was die Leute denken, ist scheißegal.» Das hat mir sofort eingeleuchtet. Über alles reden. Und scheiß auf die Leute.