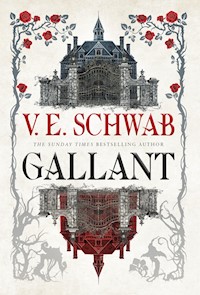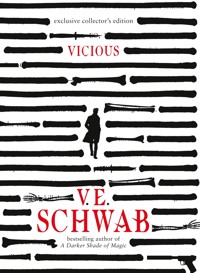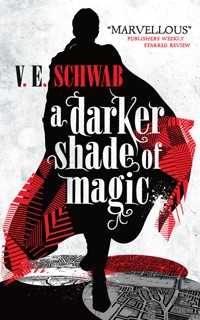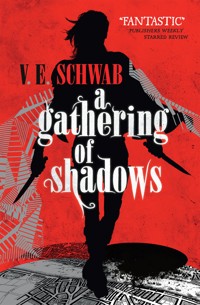9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Weltenwanderer
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2017
›Vier Farben der Magie‹ ist der erste Band von V. E. Schwabs großer Fantasy-Trilogie um den Magier und Weltenwanderer Kell und um Delilah Bard, ihres Zeichens Diebin und Trickbetrügerin. Es gibt Vier Farben der Magie: Im roten London befindet sie sich im Gleichgewicht mit dem Leben. Im weißen London wird die Magie versklavt, kontrolliert, unterdrückt. Dem grauen London ist sie fast abhandengekommen. Und im schwarzen London hat sie das Leben selbst vertilgt. Als einer der wenigen Antari springt Kell zwischen den verschiedenen Welten hin und her. Doch er führt ein Doppelleben: Er ist Botschafter der Könige, aber auch ein Schmuggler. Eines Tages wird ihm als Bezahlung für einen außergewöhnlichen Botengang ein schwarzer Stein zugesteckt. Dass es sich um ein mächtiges magisches Artefakt handelt, merkt er erst, als er sich von einem gefährlichen Feind verfolgt sieht, der ihm das gute Stück abjagen möchte und dabei vor keinem Mittel zurückschreckt. Auf der Flucht trifft der Magier die gewitzte Diebin Delilah Bard, die Kell zunächst ausraubt, ihm dann aber hilft. Allerdings erwartet sie eine Gegenleistung von ihm ... »›Vier Farben der Magie‹ hat alle Merkmale eines absoluten Fantasy-Klassikers: eine packende Geschichte, denkwürdige Figuren und eine phantastische, aber glaubhafte Welt. Das Buch ist ein Schatz.« (Deborah Harkness)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 575
Ähnliche
V. E. Schwab
Vier Farben der Magie
Roman
Aus dem Amerikanischen von Petra Huber
FISCHER digiBook
Inhalt
Für all jene,die von fremderen Welten träumen.
»Denn dies ist das Dilemma der Magie: Sie ist keine Frage der Stärke, sondern des Gleichgewichts.
Fehlt es uns an Macht, so erweisen wir uns als schwach. Besitzen wir ihrer aber zu viel, so verwandeln wir uns in etwas gänzlich Anderes.«
Thieren Serense, Hohepriester des Londoner Heiligtums
EinsDer Reisende
I
Kell trug einen ganz besonderen Mantel.
Dieser hatte nicht nur eine Seite, wie es sich gehört, oder zwei, was schon ungewöhnlich gewesen wäre, sondern gleich mehrere. Was natürlich ganz und gar unmöglich war.
Immer wenn Kell ein London verließ und ein anderes betrat, zog er als Erstes seinen Mantel aus und wendete ihn ein-, zwei- oder bisweilen sogar dreimal, bis er die Seite fand, die er gerade brauchte. Nicht alle davon waren besonders elegant, doch jede erfüllte einen bestimmten Zweck. Manche ließen ihn in der Menge verschwinden, andere wiederum zogen die Aufmerksamkeit auf sich. Und eine davon – sie mochte er besonders gern – war einfach nur so da.
Als Kell durch die Wand des Palasts getreten und in den Vorraum gelangt war, brauchte er einen Moment, um sein Gleichgewicht wiederzufinden – das Wandern zwischen den Welten hatte seinen Preis; dann ließ er sich den roten Mantel mit dem hohen Kragen von den Schultern gleiten und wendete ihn, bis er in eine schlichte schwarze Jacke gehüllt war – nun ja, so schlicht, wie eine Jacke mit silbernem Innenfutter und zwei Reihen schimmernder Silberknöpfe eben sein konnte. Nur weil er auf seinen Reisen weniger auffällige Farben vorzog (er wollte die Mitglieder des hier herrschenden Königshauses schließlich nicht beschämen und keine unnötige Aufmerksamkeit auf sich ziehen), hieß das noch lange nicht, dass er auf alle Eleganz verzichten musste.
Immer diese Könige!, ging es Kell durch den Kopf, während er die Jacke zuknöpfte. Manchmal dachte er schon wie Rhy.
An der Wand hinter ihm war der geisterhafte Abdruck, den er bei seiner Ankunft verursacht hatte, kaum mehr zu erkennen. Flüchtig wie ein Fußabdruck im Sand.
Er machte sich nie die Mühe, die Tür von dieser Seite zu markieren, weil er ohnehin nicht auf demselben Weg zurückreiste. Windsors Entfernung vom Grauen London war schrecklich ungünstig, da Kell sich bei seinen Reisen nur zwischen genau demselben Ort in der einen und der anderen Welt bewegen konnte. Und da es in der Roten Stadt kein Schloss Windsor gab, war Kell gerade durch die Steinwand eines prächtigen Innenhofs getreten, der einem wohlhabenden Bürger von Disan gehörte. Was im Großen und Ganzen ein nettes kleines Städtchen war.
Was sich von Windsor nun wirklich nicht behaupten ließ.
Beeindruckend, zweifellos. Aber ganz bestimmt nicht nett.
An der Wand stand ein Marmortisch, auf dem wie immer eine Schüssel mit Wasser auf Kell wartete. Er wusch seine blutige Hand und die Münze, eine silberne Krone, die er für den Durchgang benutzt hatte; dann zog er sich die Schnur, an der die Münze befestigt war, wieder über den Kopf und verbarg sie unter seinem Hemd. In der Halle nebenan konnte er leises Fußgetrappel und das Gemurmel der Diener und Wachen hören. Er hatte den Vorraum gewählt, um nicht von ihnen gesehen zu werden – denn wie er nur zu gut wusste, war der Prinzregent über seine Besuche alles andere als erfreut. Und Kell wollte unbedingt vermeiden, dass er von seiner Anwesenheit erfuhr.
Kell warf einen raschen Blick in den Spiegel, der in einem vergoldeten Rahmen über dem Becken hing. Er machte sich nicht die Mühe, sein Haar zurückzustreichen, das ihm in einer rotbraunen Strähne über das rechte Auge fiel. Doch er nahm sich die Zeit, die Schultern seiner Jacke zurechtzuzupfen, bevor er die Tür durchschritt, um seinen Gastgeber zu begrüßen.
Drinnen war es drückend heiß, da die Fenster trotz des herrlichen Oktoberwetters verriegelt waren und im Kamin ein helles Feuer loderte.
Vor dem Kamin saß George III. – gehüllt in ein weites Gewand, das seinen Greisenkörper noch gebrechlicher erscheinen ließ, ein unberührtes Tablett mit Tee vor sich. Als Kell eintrat, umklammerte der König die Armlehnen seines Sessels.
»Wer ist da?«, rief er, ohne sich umzudrehen. »Räuber? Gespenster?«
»Gespenster würden Euch wohl kaum einer Antwort würdigen, Majestät«, gab Kell sich zu erkennen.
Das Gesicht des siechen Königs verzog sich zu einem Grinsen, das seine verfaulten Zähne entblößte. »Meister Kell«, sagte er. »Ihr habt mich warten lassen.«
»Nur einen Monat«, sagte Kell und trat näher.
König George kniff seine blinden Augen zusammen. »Das muss doch länger her sein.«
»Ich versichere Euch, das ist nicht der Fall.«
»Für Euch mag das ja stimmen«, sagte der König. »Doch die Zeit verstreicht anders für die Blinden und Verrückten.«
Kell lächelte. Der König war heute in ausgezeichneter Form. Was beileibe nicht immer so war – Kell konnte sich nie sicher sein, in was für einem Zustand er ihn antreffen würde. Vermutlich kam es dem König wirklich so vor, als sei bereits mehr als ein Monat seit Kells letztem Besuch vergangen; damals waren die Nerven seiner Majestät überreizt gewesen, und Kell war es gerade noch gelungen, ihn so weit zu besänftigen, dass er ihm seine Botschaft übermitteln konnte.
»Vielleicht ist es ja schon ein Jahr her«, fuhr der König fort, »und nicht erst einen Monat.«
»Ach, wir schreiben noch dasselbe Jahr.«
»Und das wäre?«
Kell runzelte die Stirn. »Achtzehnhundertneunzehn«, sagte er.
Das Gesicht des Königs verdüsterte sich kurz, dann schüttelte er nur den Kopf und sagte: »Zeit«, als wäre dieses eine Wort an allem Elend der Welt schuld. »Setzt Euch«, fuhr er fort und machte eine unbestimmte Geste in den Raum hinein. »Irgendwo muss hier noch ein Stuhl sein.«
Doch da war keiner. Das Zimmer war geradezu erschreckend karg eingerichtet, und Kell hegte keinerlei Zweifel daran, dass die Türen zur Halle nur von außen zu öffnen und zu schließen waren.
Der König streckte ihm eine seiner knotigen Hände entgegen. Man hatte ihm die Ringe abgenommen, damit er sich nicht verletzen konnte, und seine Fingernägel so kurz wie nur möglich geschnitten.
»Gebt mir den Brief!«, sagte er, und für einen kurzen Moment erhaschte Kell einen Blick auf den majestätischen König George von einst.
Kell tastete die Taschen seiner Jacke ab und merkte, dass er vergessen hatte, die Briefe herauszunehmen, bevor er sich umgekleidet hatte. Er ließ sich den Mantel von den Schultern gleiten und war einen Moment lang wieder in Rot gehüllt. Dann durchstöberte er die vielen Falten, bis er auf den Umschlag stieß, den er dem König in die ausgestreckte Hand legte. George betastete sogleich behutsam den Brief und insbesondere das wächserne Siegel mit dem Emblem des Roten Thrones, einen Kelch vor der aufgehenden Sonne. Dann hielt er sich das Papier unter die Nase und atmete tief ein.
»Rosen«, seufzte er sehnsüchtig.
Damit meinte er den Duft der Magie. Kell war der leichte Wohlgeruch des Roten Londons, der seiner Kleidung anhaftete, nie aufgefallen; doch auf jeder seiner Reisen sprach ihn irgendjemand auf den Duft frisch geschnittener Blumen an. Die einen sagten, er rieche nach Tulpen. Andere wiederum erwähnten Lilien, Chrysanthemen oder auch Pfingstrosen. Doch der König von England sprach immer nur von Rosen. Kell war froh, dass ihn ein angenehmer Geruch umgab, auch wenn er ihn selbst nicht wahrnahm. Das Graue London roch für ihn nach Rauch, das Weiße London nach Blut; doch das Rote London trug für ihn den Duft der Heimat.
»Öffnet ihn für mich«, gebot ihm der König. »Aber passt auf das Siegel auf.«
Kell kam dem Befehl nach und zog ein einzelnes Blatt aus dem Umschlag. Ausnahmsweise war er froh, dass der König erblindet war und nicht sehen konnte, wie kurz der Brief war. Lediglich drei Zeilen, nicht mehr als ein höfliches Zugeständnis an einen siechen Monarchen.
»Er ist von meiner Königin«, erläuterte Kell.
Der König nickte. »Lest!«, befahl er Kell und bemühte sich, seinem Gesicht einen gebieterischen Ausdruck zu verleihen, der jedoch in erschreckendem Gegensatz zu seiner Gebrechlichkeit und der stockenden Greisenstimme stand. »Na los!«
Kell schluckte. »Grüße an seine Majestät, König George III.«, las er vor, »von der Regentin des Nachbarlandes.«
Die Königin sprach nicht vom Roten Thron oder vom Roten London (obwohl die Stadt, die ganz in das satte, alles durchdringende Licht des Flusses gehüllt war, purpurn schimmerte), da das nicht ihrer Art zu denken entsprach. Für sie – wie auch für die meisten anderen Menschen – gab es kaum eine Notwendigkeit, zwischen den Städten zu unterscheiden. Wenn die Herrscher miteinander korrespondierten, nannten sie einander nur »die Anderen« oder »die Nachbarn«; oder sie gaben einander – insbesondere, wenn vom Weißen London die Rede war – weitaus weniger schmeichelhafte Namen.
Nur die Wenigen, die zwischen den Welten wanderten, mussten sich etwas einfallen lassen, um die Städte unterscheiden zu können. Und so hatte Kell – in Anlehnung an jene verlorene Stadt, die gemeinhin als das Schwarze London bekannt war – jeder der verbleibenden Städte eine Farbe gegeben.
Grau für die Stadt ohne Magie.
Rot für das glänzende Reich.
Weiß für die sterbende Welt.
In Wahrheit gab es kaum eine Ähnlichkeit zwischen den Städten (und noch weniger zwischen den sie umgebenden Ländern). Warum sie alle London genannt wurden, war und blieb ein Geheimnis. Die vorherrschende Theorie besagte, eine der Städte habe den Namen vor langer Zeit angenommen, noch bevor die Türen versiegelt worden waren. Keine Einigung herrschte jedoch darüber, welche der Städte den Namen zuerst für sich beansprucht hatte.
»Wir hoffen, dass Ihr Euch guter Gesundheit erfreut«, las Kell vor, »und dass die Jahreszeit in Eurer Stadt so angenehm ist wie hier bei uns.«
Kell hielt inne. Es gab nichts mehr vorzulesen, außer der Unterschrift. König George rang die Hände.
»Ist das alles?«, fragte er.
Kell zögerte. Schließlich verneinte er und faltete den Brief zusammen. »Das ist erst der Anfang.«
Er räusperte sich und ging im Zimmer umher, um seine Gedanken zu sammeln und in den Worten der Königin sprechen zu können. »›Danke, dass Ihr Euch nach meiner Familie erkundigt‹, schreibt sie des Weiteren. ›Mein Gemahl und ich sind wohlauf. Prince Rhy hingegen versteht es wie eh und je, uns ebenso sehr zu beeindrucken wie in Rage zu versetzen; aber zumindest hat er sich schon einen Monat lang keine Knochen mehr gebrochen oder sich unpassend verlobt. Wir verdanken es allein Kell, dass weder das eine noch das andere – oder gar beides – geschehen ist.‹«
Kell war fest entschlossen, die Königin seine Verdienste in aller Ausführlichkeit preisen zu lassen, doch in diesem Moment schlug die Wanduhr fünfmal. Kell stieß einen unterdrückten Fluch aus. Wie spät es schon war!
Daher schloss er eilig: »›Bis zum Eintreffen meines nächsten Briefes wünsche ich Euch Glück und Wohlergehen. In Zuneigung – Emira, Königin von Arnes.‹«
Kell wartete auf eine Reaktion des Königs, aber da dessen blinde Augen starr in die Ferne gerichtet waren, fürchtete er, ihn nicht mehr erreichen zu können. Kell legte den Brief auf das Teetablett und war bereits auf dem Weg zur Wand, als er George murmeln hörte: »Ich habe keine Antwort für sie.«
»Macht Euch keine Gedanken«, sagte Kell sanft. Der König war bereits seit Jahren nicht mehr in der Lage, Briefe zu schreiben. Bisweilen versuchte er bei Kells allmonatlichen Besuchen, die Feder in unleserlichem Gekritzel über das Pergament zu führen; dann wieder bestand er darauf, dass Kell für ihn schrieb. Zumeist aber teilte er seinem Gast die Botschaft für die Königin mündlich mit, und dieser versprach, sie sich gewissenhaft einzuprägen.
»Leider fehlte mir die Zeit dafür«, fügte der König hinzu und versuchte damit, einen Rest seiner Würde zu bewahren.
Kell half ihm dabei. »Ich verstehe«, sagte er. »Ich werde der königlichen Familie Eure Grüße ausrichten.«
Kell wandte sich wieder zum Gehen, als der König ihn erneut rief.
»Wartet!«, sagte er. »Kommt zurück!«
Kell blieb stehen und warf einen Blick auf die Uhr. Verflixt, wie spät es schon war! Er sah den Prinzregenten vor sich, wie er an seinem Tisch im St.-James-Palast saß und vor Wut kochend die Armlehnen seines Sessels umklammerte. Bei dem Gedanken musste Kell lächeln, und er wandte sich wieder dem König zu, der soeben mit unbeholfenen Fingern einen winzigen Gegenstand aus seinem Gewand zog.
Eine Münze.
»Der Zauber hat bereits nachgelassen«, sagte der König und barg das Metallstück in seinen vom Alter gezeichneten Händen, als handle es sich um eine zerbrechliche Kostbarkeit. »Ich kann ihn schon nicht mehr spüren. Auch nicht mehr riechen.«
»Es ist eine Münze wie jede andere, Majestät.«
»Keineswegs. Und das wisst Ihr ganz genau«, brummte der alte König. »Zeigt mir, was Ihr in den Taschen habt.«
Kell seufzte. »Ihr bringt mich noch in Schwierigkeiten.«
»Nun seid doch nicht so«, beharrte der König. »Es bleibt unser kleines Geheimnis.«
Kell griff in seine Jackentasche. Bei seinem allerersten Besuch hatte er König George als Beweis dafür, wer er war und woher er kam, eine Münze gegeben. Jeder Herrscher wusste von den anderen London und gab dieses Wissen an seinen Erben weiter; doch zu jener Zeit hatte bereits seit vielen Jahren kein Reisender mehr das Graue London besucht. König George hatte den schmächtigen Jungen nur eines kurzen Blickes gewürdigt, die Augen zusammengekniffen und seine feiste Hand ausgestreckt. Woraufhin Kell ihm die Münze gereicht hatte; einen Lin, der fast genauso aussah wie ein Graulondoner Schilling, nur dass ihn statt des Konterfeis eines Königs ein roter Stern zierte. Der König umschloss die Münze mit den Fingern und hielt sie sich unter die Nase, um ihren Duft einzuatmen. Dann lächelte er, steckte den Lin in seine Manteltasche und hieß Kell eintreten.
Seither bat der König Kell bei jedem Besuch um ein neues, noch taschenwarmes Geldstück, da der Zauber angeblich nachgelassen habe. Kell wiederholte jedes Mal, dass das verboten sei (was auch stimmte). Woraufhin der König unweigerlich sagte, es werde ihr kleines Geheimnis bleiben, und Kell mit einem Seufzer einen neuen Lin aus der Tasche zog.
Auch diesmal nahm er den Lin, den ihm der König entgegenhielt, und drückte ihm eine frische Münze in die Hand, die er dann sanft mit den knotigen Fingern des Greises umschloss.
»Ja, ja«, flüsterte der gebrechliche König der Münze zärtlich zu.
»Passt auf Euch auf«, sagte Kell und wandte sich wieder zum Gehen.
»Ja, ja«, antwortete der König, während sein Blick sich wieder in der Ferne verlor.
Kell ging in eine Ecke des Zimmers, wo Vorhänge in schweren Falten hingen, und schob den Stoff zur Seite. Auf der gemusterten Tapete kam ein Zeichen zum Vorschein – ein schlichter, von einem Strich durchzogener Kreis, den er vor einem Monat mit seinem Blut gezeichnet hatte. An einer anderen Wand, in einem anderen Zimmer eines anderen Palasts befand sich das gleiche Zeichen; die Symbole waren wie die beiden Klinken einer Tür.
Wenn Kell sich zwischen den Welten bewegte, reichten sein Blut und ein Gegenstand aus der Welt, in die er reisen wollte, aus. An einen bestimmten Ort brauchte er dabei nicht zu denken, denn wo immer er sich gerade befand, kam er auch in der anderen Welt an. Um aber eine Tür innerhalb einer Welt zu schaffen, mussten beide Seiten mit genau demselben Zeichen markiert sein. Die bloße Ähnlichkeit der Symbole reichte nicht aus, wie Kell selbst einst schmerzhaft am eigenen Leib erfahren hatte.
Das Zeichen an der Wand war zwar noch deutlich zu erkennen, lediglich die Ränder waren ein wenig verschmiert. Doch das spielte keine Rolle – er musste es erneuern.
Kell krempelte einen Ärmel hoch und holte das Messer hervor, das er an die Innenseite seines Unterarms festgeschnallt trug. Es war ein exquisit gearbeiteter Dolch mit silberner Klinge und Griff, in den die Initialen K.L. eingraviert waren.
Das Messer war das einzige Erinnerungsstück an sein früheres Leben – ein Leben, das ihm inzwischen fremd war, an das er sich kaum noch erinnerte.
Kell setzte die Schneide auf die Außenseite seines Unterarms. Einen Schnitt hatte er sich heute bereits zugefügt, um die Tür zu öffnen, durch die er vorher getreten war. Nun zog er die Klinge ein zweites Mal über den Arm, woraufhin rubinrotes Blut aus der Wunde quoll. Er steckte das Messer zurück in die Scheide, berührte den Schnitt mit den Fingern und erneuerte den Kreis und die Linie. Anschließend zog Kell den Ärmel über die Wunde – er würde die Schnitte behandeln, sobald er wieder zu Hause war – und warf einen letzten Blick auf den vor sich hinbrabbelnden König; erst dann legte er seine Hand auf das Zeichen an der Wand.
Ein magisches Summen erklang.
»As Tascen«, sagte Kell. Durchschreite.
Ein Beben durchlief die gemusterte Tapete, dann gab sie unter seiner Berührung nach. Kell machte einen Schritt und trat durch die Wand.
II
Zwischen zwei Schritten verwandelte sich das trostlose Schloss Windsor in den eleganten St.-James-Palast. Das winzige, stickige Zimmer wich farbenfrohen Wandteppichen und poliertem Silber, und das Gebrabbel des verrückten Königs wurde von dem düsteren Schweigen eines Mannes abgelöst, der an der Kopfseite eines reichverzierten Tisches saß. Er hielt einen Weinkelch umklammert und zog eine bitterböse Miene.
»Ihr kommt spät«, bemerkte der Prinzregent.
»Verzeiht«, erwiderte Kell mit einer knappen Verbeugung. »Ich hatte noch etwas zu erledigen.«
Der Prinzregent setzte den Kelch ab. »Ich dachte, Ihr hättet den Auftrag, mich aufzusuchen, Meister Kell.«
Kell richtete sich auf. »Hoheit, mein Befehl lautet, zuerst nach dem König zu sehen.«
»Ihr solltet ihn nicht zu sehr verwöhnen«, erwiderte der Prinzregent, der ebenfalls George hieß (Kell fand die im Grauen London verbreitete Gepflogenheit, die Söhne nach ihren Vätern zu benennen, ebenso überflüssig wie verwirrend), mit einer abfälligen Handbewegung. »Das hebt nur seine Stimmung.«
»Ist das denn so schlecht?«
»Nun, in seinem Fall schon. Er kommt dann nur auf dumme Gedanken. Tanzt auf dem Tisch und redet wirres Zeug über Magie und andere London. Was für ein Kunststück habt Ihr ihm diesmal vorgeführt? Ihm in den Kopf gesetzt, er könne fliegen?«
Diesen Fehler hatte Kell nur ein einziges Mal gemacht. Bei seinem nächsten Besuch hatte er dann erfahren müssen, dass der König von England fast aus einem Fenster, noch dazu im dritten Stock, spaziert war.
»Seid versichert, dass ich ihm nichts dergleichen gezeigt habe.«
Prinz George zwickte sich in den Nasenrücken. »Er kann seine Zunge nicht mehr im Zaum halten. Daher darf er seine Gemächer nicht verlassen.«
»Ihr habt ihn also eingesperrt?«
Prinz George ließ eine Hand über die vergoldete Tischkante gleiten. »Schloss Windsor ist ein höchst ehrenwerter Aufenthaltsort.«
Auch ein ehrenwertes Gefängnis ist und bleibt ein Gefängnis, dachte Kell und zog einen zweiten Brief aus der Manteltasche. »Euer Schreiben«, sagte er.
Der Prinzregent bot seinem Besuch keinen Stuhl an, während er den Brief las (er hatte noch nie angemerkt, dass die Nachrichten nach Blumen dufteten); dann zog er eine bereits begonnene Antwort aus seiner Jackentasche und ging daran, sie fertigzuschreiben. Dabei ließ er sich sichtlich Zeit, um seinen Gast zu ärgern. Kell aber ließ sich nicht im Geringsten aus der Ruhe bringen; um sich die Zeit zu vertreiben, trommelte er mit den Fingern auf die Kante des vergoldeten Tisches. Immer wenn er beim Zeigefinger anlangte, verlosch eine der vielen Kerzen im Zimmer.
»Hier scheint’s zu ziehen«, murmelte Kell zerstreut, während der Prinzregent die Schreibfeder noch fester umklammerte. Bis er mit seiner Antwort fertig war, hatte er zwei Federn zerbrochen und machte ein höchst verdrießliches Gesicht; sein Besucher hingegen war blendend gelaunt.
Kell streckte die Hand aus, doch der Prinz machte keinerlei Anstalten, ihm den Brief zu geben. Stattdessen stand er abrupt auf. »Ich bin ganz steif vom langen Sitzen. Geht ein paar Schritte mit mir.«
Kell hatte nicht die geringste Lust dazu; da er aber schlecht mit leeren Händen zurückkommen konnte, stimmte er widerwillig zu. Vorher griff er sich allerdings noch die Schreibfeder vom Tisch, die der Prinz zuletzt benutzt hatte, und ließ sie in seinem Mantel verschwinden.
»Werdet Ihr sofort zurückkehren?«, fragte Prinz George, während er Kell einen Gang hinunter zu einer unauffälligen, halb hinter einem Vorhang verborgenen Tür führte.
»Bald«, antwortete Kell, der einen Schritt hinter dem Prinzregenten ging. In der Halle hatten sich zwei Mitglieder der königlichen Garde zu ihnen gesellt und folgten ihnen nun wie Schatten. Kell spürte ihre Blicke in seinem Rücken und fragte sich, was die Wachen wohl über ihn wissen mochten. Die Herrscher waren natürlich immer eingeweiht, aber wie viel sie ihren Untergebenen mitteilten, blieb ihnen überlassen.
»Ich dachte, Ihr hättet hier nichts mehr zu tun«, sagte der Prinz.
»Mir liegt viel an Eurer Stadt«, antwortete Kell leichthin. »Und ich wollte mich bei einem Spaziergang noch ein wenig von der anstrengenden Arbeit erholen. Dann reise ich zurück.«
Der Prinz presste die Lippen grimmig zusammen. »Ich fürchte, die Luft hier ist nicht so wohltuend wie draußen auf dem Lande. Wie pflegt Ihr unsere Stadt noch zu nennen? … Das Graue London? Dieser Tage ist der Name nur allzu passend. Bleibt zum Abendessen!« Er pflegte fast jeden seiner Sätze mit einem Ausrufezeichen zu beenden, sogar die Fragen. Rhy hatte dieselbe Angewohnheit – vielleicht, dachte Kell, folgte das daraus, wenn man nie ein Nein zu hören bekam.
»Hier wird es Euch an nichts mangeln«, beharrte der Prinz. »Ihr könnt es Euch bei Wein und angenehmer Gesellschaft wohlergehen lassen.«
Dieser Vorschlag schien freundlich gemeint, doch der Prinzregent tat niemals etwas aus reiner Freundlichkeit.
»Ich kann nicht bleiben«, sagte Kell.
»Ich bestehe darauf«, beharrte der Prinz. »Die Tafel ist bereits gedeckt.«
Welche Gäste er wohl erwartet?, fragte sich Kell. Und was wollte der Prinzregent eigentlich von ihm? Ihn vorführen? Diesen Verdacht hegte Kell nicht zum ersten Mal, insbesondere da George der Jüngere eine Abneigung gegen Geheimnisse und eine Vorliebe für alles Aufsehenerregende hatte. Doch trotz seiner Fehler war der Prinzregent alles andere als ein Narr – und nur ein Narr hätte jemandem wie Kell die Möglichkeit gegeben, Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Das Wissen um die Magie war im Grauen London bereits vor langer Zeit verlorengegangen; und Kell hatte nicht die geringste Absicht, es der Stadt wieder ins Gedächtnis zu rufen.
»Zu gütig von Euch, Hoheit, aber lieber bleibe ich ein Geist, als mich hier zur Schau stellen zu lassen.« Kell legte den Kopf in den Nacken, wodurch ihm das Haar aus dem Gesicht fiel und neben seinem linken eisblauen Auge auch das rechte zum Vorschein kam. Es war von einem tiefen Schwarz, das nicht nur seine Pupille, sondern auch seinen Augapfel umfasste – es wirkte ganz und gar nicht menschlich. Denn es bestand aus reiner Magie – und war das Mal eines Blutmagiers; eines Antari.
Kell genoss die Mischung von Vorsicht, Unbehagen und … Angst, die er in den Augen des Prinzregenten sah, als dieser versuchte, seinem Blick standzuhalten.
»Wisst Ihr, warum unsere Welten einst voneinander getrennt wurden, Hoheit?« Ohne die Antwort des Prinzen abzuwarten, fuhr er fort: »Um die Eure zu schützen. Denn vor Urzeiten gab es noch Türen zwischen Eurer Welt, der meinen und auch den anderen Welten, die jeder, in dessen Adern auch nur ein Hauch von Magie floss, durchschreiten konnte. Wie auch die Magie selbst. Nun ist es aber so«, fügte Kell hinzu, »dass sowohl die Willensstarken als auch die Schwachen eine leichte Beute für die Magie sind; und daher fiel eine der Welten dem Unheil anheim. Ihre Bewohner nährten sich von der Magie und diese sich von ihnen, bis sie sie mit Haut und Haar, Geist und Seele verschlang.«
»Das Schwarze London«, flüsterte der Prinzregent.
Kell nickte. Dieser Name stammte nicht von ihm. Jeder – zumindest in der Roten und der Weißen Stadt wie auch die Wenigen im Grauen London, die überhaupt noch etwas wussten – kannte die Legende von der Schwarzen Stadt. Sie war in aller Munde als Gutenachtgeschichte, als Märchen und als mahnende Erinnerung an eine Stadt – sowie eine untergegangene Welt.
»Wisst Ihr, was das Schwarze London und das Eure gemeinsam haben, Hoheit?« Die Augen des Prinzregenten verengten sich, doch er ließ Kell weitersprechen. »Beiden Städten mangelt es am richtigen Maß«, erläuterte Kell. »Und beide hungern nach Macht. Eure Stadt ist nur deshalb noch nicht untergegangen, weil man die Türen zwischen den Welten versiegelt hat. Und weil sie gelernt hat, zu vergessen. Ihr wollt gewiss nicht, dass sie sich wieder erinnert.« Kell erwähnte nicht, dass die Magie im Roten London in Strömen floss, während sie im Grauen London fast völlig versiegt war. Er wollte den Prinzregenten zur Vernunft bringen; und das war ihm offensichtlich gelungen – denn als Kell seine Hand erneut ausstreckte, reichte ihm dieser den Brief ohne Zögern oder Widerrede. Kell steckte das Pergament zu der entwendeten Schreibfeder in seine Tasche.
»Erneut habe ich Euch für Eure Gastfreundschaft zu danken«, sagte er und machte eine übertriebene Verbeugung.
Mit nur einem Fingerschnippen rief der Prinzregent eine der Wachen herbei. »Sorgt dafür, dass Master Kell sich nicht verläuft.« Dann wandte er sich ohne ein Wort des Abschieds ab und schritt davon.
Die königlichen Soldaten begleiteten Kell bis zum Rande des Parks. Hinter ihm ragte der St.-James-Palast auf, vor ihm erstreckte sich die Graue Stadt. Kell atmete tief ein und schmeckte den Rauch, der die Luft durchtränkte. Am liebsten wäre er gleich nach Hause zurückgekehrt, doch er hatte vorher noch etwas zu erledigen. Und nach der Begegnung mit dem siechen Monarchen und dem arroganten Prinzregenten brauchte er dringend etwas zu trinken. Also strich er seine Ärmel glatt, richtete den Mantelkragen auf und machte sich auf in das Herz der Stadt.
Sein Weg führte Kell durch den St.-James-Park, einen beschaulichen Trampelpfad entlang, der einem langgezogenen See folgte. Die Sonne versank gerade hinter dem Horizont, die Luft war frisch, und eine herbstliche Brise umspielte den Saum seines schwarzen Mantels. Bald kam er zu einer Fußgängerbrücke, die das Gewässer überquerte. Als er sie betrat, konnte er das leise Trappeln seiner Stiefel auf den Holzplanken hören. Kell blieb ganz oben stehen, den Rücken dem von Laternen erhellten Buckingham-Palast zugewandt und den Blick zur Themse gerichtet. Die Ellbogen auf das Geländer gestützt, sah er auf das Wasser hinunter, das mit einem sanften Rauschen unter den Holzplanken hindurchfloss. Er spreizte seine Finger gedankenverloren, woraufhin das Wasser zum Stillstand kam und sich beruhigte.
Kell betrachtete sich in der Oberfläche, die glatt wie ein Spiegel unter ihm lag.
»So hübsch bist du nun auch wieder nicht«, pflegte Rhy zu sagen, wenn er Kell bei einem Blick in den Spiegel ertappte.
»Ich kann nicht genug von mir bekommen«, antwortete Kell dann jedes Mal, obwohl er gar nicht sich als Ganzes betrachtete, sondern nur sein rechtes Auge. Sogar im Roten London, wo die Magie allgegenwärtig war, hob es ihn aus der Menge hervor, machte ihn zum Außenseiter.
Als ein glockenhelles Lachen zu seiner Rechten erklang, gefolgt von einem Ächzen und ein paar anderen, undeutlicheren Geräuschen, entspannten sich Kells Finger, und das Wasser begann wieder zu fließen. Kell setzte seinen Weg fort, bis er an das Ende des Parks gelangte und die Straßen der Stadt vor ihm lagen. Schließlich sah er die Türme der Westminster Abbey vor sich aufragen; Kell, der die Kirche mochte, nickte ihr zu wie einem alten Freund. Trotz des allgegenwärtigen Rußes und Schmutzes, der Unordnung und der Armut besaß das Graue London etwas, das seinem roten Nachbarn völlig fehlte: Widerstandskraft gegen den Wandel; eine Wertschätzung des Beständigen und der Anstrengung, die es kostete, das Alte zu bewahren.
Wie viele Jahre hatte man wohl an der Westminster Abbey gebaut? Wie lange würde die Kirche noch stehen? Im Roten London änderte sich der Geschmack mit jeder Jahreszeit; im Zuge dessen wurden Gebäude errichtet, wieder abgerissen und in einer anderen Gestalt neu erbaut. Mithilfe von Magie war das ganz einfach. Manchmal, schoss es Kell durch den Kopf, auch zu einfach.
Zu Hause befiel ihn oft das Gefühl, in der einen Stadt ins Bett zu gehen und in einer ganz anderen wieder aufzuwachen.
Hier aber wartete die Westminster Abbey stets auf ihn und hieß ihn willkommen.
Er setzte seinen Weg fort, an der himmelwärts ragenden Steinkirche vorbei, durch Straßen, in denen sich zahlreiche Fuhrwerke drängten, und folgte einer Gasse, die an der moosigen Steinmauer des Dean’s Yard entlangführte. Die Gasse verengte sich immer weiter, bis sie schließlich vor einer Schenke endete.
Hier blieb Kell stehen und ließ sich den Mantel von den Schultern gleiten. Er wendete ihn erneut von rechts nach links und trug nun anstelle der schwarzen Jacke mit den Silberknöpfen einen unauffälligen, schäbigen braunen Kittel mit hohem Kragen, ausgefransten Säumen und abgewetzten Ellenbogen. Er versicherte sich, dass sich noch alles in seinen Taschen befand, dann öffnete er die Tür.
III
Der Steinwurf war eine merkwürdige kleine Schenke.
Sie hatte schmuddelige Wände und einen fleckigen Boden. Auch wusste Kell ganz genau, dass der Wirt die Getränke verwässerte; und dennoch kehrte er unweigerlich hierher zurück.
So heruntergekommen der Steinwurf und seine noch schäbigeren Gäste auch sein mochten – Kell fand die Schenke unglaublich faszinierend. Denn war es nun Schicksal oder nur ein glücklicher Zufall – der Steinwurf war immer da. Natürlich änderte sich der Name und auch die ausgeschenkten Getränke – aber im Grauen, Roten wie auch Weißen London stand an genau derselben Stelle eine Schenke. Zwar handelte es sich nicht um eine Quelle im eigentlichen Sinne, wie die Themse, Stonehenge oder Dutzende anderer, weniger bekannter Horte der Magie, aber nichtsdestoweniger war dieser Ort etwas Besonderes. Ein Phänomen. Ein Fixpunkt.
Und da Kell hier seine Geschäfte abzuwickeln pflegte (egal, ob draußen auf dem Schild nun Steinwurf, Untergehende Sonne oder Verbrannter Knochen zu lesen stand), machte das auch ihn zu einer Art Fixpunkt.
Kaum jemand hätte die Poesie dieses Gedankens zu schätzen gewusst – mit Ausnahme von Holland vielleicht (falls man in seinem Falle überhaupt von Verständnis sprechen konnte).
Aber auch ganz nüchtern betrachtet, war der Steinwurf der perfekte Ort, um Geschäfte zu machen. Die wenigen Graulondoner, allesamt skurrile Gestalten, die noch an die Magie glaubten und gelegentlich ein Flüstern oder einen Hauch davon erhaschten, wurden von dem Gefühl hierher gelockt, dass da noch mehr, etwas Anderes war. Auch Kell konnte sich dem nicht entziehen; mit dem Unterschied, dass er ganz genau wusste, was die anderen antrieb.
Natürlich war es nicht nur der subtile, markdurchdringende Sog der Macht, der die Anhänger der Magie in den Steinwurf lockte; auch nicht das Versprechen von mehr, von etwas Anderem. Auch Kell selbst zog sie magnetisch an; oder besser gesagt, das Gerücht von seiner Anwesenheit. Gerüchte besaßen ihren eigenen Zauber, und im Steinwurf war die Kunde vom »Magier«, der regelmäßig die Schenke besuchte, in aller Munde, ganz wie das verwässerte Bier, das hier ausgeschenkt wurde.
Kell musterte die bernsteinfarbene Flüssigkeit in seinem Becher.
»N’Abend, Kell«, sagte Barron und schenkte Kell nach.
»N’Abend, Barron«, antwortete Kell.
Mehr Worte hatten sie noch nie miteinander gewechselt.
Der Besitzer der Schenke besaß die Statur einer Ziegelmauer (hätte eine Mauer einen Bart getragen) – er war hoch, breit und von beeindruckender Standfestigkeit. Ohne Zweifel hatte Barron in seinem Leben schon viele seltsame Dinge erlebt, darüber aber nie seine Gelassenheit verloren.
Und falls doch, wusste er es für sich zu behalten.
Die Wanduhr hinter der Theke schlug sieben Uhr, woraufhin Kell einen kleinen Gegenstand aus der Tasche seiner schäbigen braunen Jacke zog – ein ungefähr handtellergroßes Holzkästchen mit einem simplen Metallverschluss. Als Kell diesen löste und den Deckel mit dem Daumen zurückschob, verwandelte es sich in ein Spielbrett mit fünf Vertiefungen für jedes der Elemente.
In der ersten Vertiefung lag ein Klümpchen Erde.
In der zweiten ein Löffel voll Wasser.
In der dritten war, anstelle von Luft, ein Fingerhut voll Sand.
In der vierten befand sich ein Tropfen hochentflammbaren Öls.
Und in der fünften und letzten Vertiefung lag ein winziges Stück Knochen.
In Kells Welt waren das Kästchen und sein Inhalt weit mehr als nur ein Spielzeug – Kinder konnten mit seiner Hilfe herausfinden, von welchem der Elemente sie angezogen wurden und umgekehrt. Die meisten wurden seiner schnell überdrüssig und wandten sich, je weiter ihre magischen Fähigkeiten heranreiften, dem Üben von Zaubersprüchen oder komplexeren Varianten des Spiels zu. Aufgrund seiner großen Verbreitung und einfachen Handhabung war es in nahezu jedem Rotlondoner Haushalt zu finden. Das Gleiche galt (so vermutete Kell zumindest) für sämtliche umliegende Dörfer. Hier hingegen, in einer Stadt ohne Magie, stellte es eine echte Rarität dar, und Kell war sich sicher, dass sein Kunde es zu schätzen wissen würde; zumal es sich bei ihm um einen Sammler handelte.
Im Grauen London gab es nur zwei Arten von Menschen, die mit Kell handeln wollten: Sammler und Enthusiasten.
Die Sammler waren meistens ebenso reich wie gelangweilt und zeigten kein Interesse für die Magie an sich – keiner von ihnen hätte den Unterschied zwischen einer Heilrune und einem Bindezauber zu sagen gewusst –, und Kell war überglücklich, wenn er mit ihnen handelseinig wurde.
Die Enthusiasten hingegen waren eine richtige Plage. Sie hielten sich für echte Magier und wollten zauberkräftige Gegenstände erwerben, nicht etwa, um sich an ihrem Besitz erfreuen oder sie ganz einfach zur Schau stellen zu können, sondern um sie zu verwenden. Kell hatte für die Enthusiasten nichts übrig – zum einen hielt er ihre Bemühungen für reine Zeitverschwendung, zum anderen kam er sich wie ein Verräter vor, wenn er sie unterstützte –; und deshalb sank seine Laune erheblich, als sich jemand neben ihn setzte, und er statt des Sammlers, mit dem er verabredet war, einen Unbekannten vor sich sah.
»Ist hier noch frei?«, fragte dieser, obwohl er bereits Platz genommen hatte.
»Lasst mich in Ruhe«, sagte Kell gleichmütig.
Doch der junge Mann ließ sich nicht vertreiben.
Kell sah auf den ersten Blick, dass er es mit einem Enthusiasten zu tun hatte. Der Unbekannte war so schlaksig wie unbeholfen und seine Jacke ein klein wenig zu kurz geraten; als er seine langen Arme auf die Theke legte, rutschte der Ärmel ein wenig zurück, so dass eine Tätowierung zum Vorschein kam – eine ungelenk gezeichnete Rune der Macht, die die Magie an den Körper binden sollte.
»Stimmt es, was die so sagen?«, beharrte der Enthusiast.
»Kommt darauf an, wer ›die‹ sind und was sie sagen«, entgegnete Kell und schob den Deckel und den Verschluss des Kästchens wieder zu. Er hatte dieses Spielchen schon unzählige Male gespielt. Aus dem Winkel seines linken Auges sah er, wie sich auf den Lippen des jungen Enthusiasten eine passende Antwort formte. Mit einem Sammler wäre Kell wohl weniger schroff umgegangen; doch jemand, der sich in tiefe Gewässer wagte und so tat, als könne er schwimmen, hatte keinen Rettungsring verdient.
»Dass Ihr gewisse Dinge bei Euch tragt«, sagte der Enthusiast und ließ den Blick unruhig durch die Schenke wandern. »Dinge aus anderen Welten.«
Kell nippte nur an seinem Getränk, doch der Enthusiast fasste sein Schweigen als Zustimmung auf.
»Ich sollte mich wohl vorstellen«, fuhr der junge Mann fort. »Edward Archibald Tuttle der Dritte. Aber alle nennen mich Ned.« Kell hob eine Augenbraue. Ganz offensichtlich erwartete der Enthusiast, dass Kell sich seinerseits vorstellte; aber da der junge Mann bereits zu wissen schien, wen er vor sich hatte, sparte Kell sich alle Förmlichkeiten und sagte nur: »Was wollt Ihr von mir?«
Edward Archibald – Ned – wand sich auf dem Barhocker und beugte sich verschwörerisch vor. »Ich suche ein wenig Erde.«
Kell kippte sein Bierglas in Richtung der Tür. »Im Park gibt’s jede Menge davon.«
Der junge Mann gab ein leises, unbehagliches Lachen von sich. Kell trank sein Bier aus. Ein wenig Erde. Das war alles andere als eine kleine Bitte. Die meisten Enthusiasten wussten, dass die Magie in ihrer Welt so gut wie versiegt war; viele glaubten jedoch, durch den Besitz irgendeines Gegenstands aus einer anderen Welt auf die Magie ebendieser Welt zugreifen zu können.
Einst war das tatsächlich so gewesen; damals standen die Zugänge zu den Quellen offen und die Magie konnte ungehindert zwischen den Welten fließen. Und jeder, der auch nur einen Hauch magischer Kräfte und einen Gegenstand aus einer anderen Welt besaß, konnte sich dieser Kraft bedienen; und sich mit dessen Hilfe frei von einem London in das andere bewegen.
Doch diese Zeit war schon längst vorüber.
Die Türen gab es nicht mehr; sie waren schon vor Jahrhunderten zerstört worden, nachdem das Schwarze London untergegangen war und mit ihm eine ganze Welt; allein die Geschichten waren geblieben. Und jetzt besaßen nur noch die Antari die Macht, neue Türen zu schaffen, und auch nur sie konnten diese durchschreiten. Es hatte stets nur wenige von ihnen gegeben, doch niemand hatte gewusst, wie wenige – bis die Türen versiegelt worden waren und die Zahl der Blutmagier weiter geschrumpft war. Niemand kannte die Quelle ihrer Magie (die nicht von Generation zu Generation weitergegeben wurde), doch eines war gewiss: Je länger die Welten voneinander getrennt waren, desto weniger Antari wanderten zwischen ihnen umher.
Heute waren Kell und Holland wohl die letzten Vertreter einer rasch aussterbenden Spezies.
»Was ist?«, bedrängte ihn Ned. »Habt Ihr Erde für mich oder nicht?«
Kells Blick glitt zu der am Handgelenk des Enthusiasten prangenden Tätowierung. Wie so viele Grauweltler schien auch Ned nicht zu begreifen, dass ein Zauber nur so stark war wie der, der ihn anwendete. Wie stark mochte Edward Archibald Tuttle wohl sein?
Mit der Andeutung eines Lächelns schob Kell dem jungen Mann das Holzkästchen zu. »Wisst Ihr, was das ist?«
Ned ergriff das Kästchen so behutsam, als könnte es jederzeit in Flammen aufgehen (und einen Moment lang spielte Kell tatsächlich mit dem Gedanken, das Spiel anzuzünden, doch er riss sich zusammen). Der Enthusiast befingerte das Kästchen, bis seine Finger schließlich den Verschluss fanden und das Spielbrett offen auf der Theke vor ihm lag. Die fünf Elemente glitzerten im flackernden Licht der Schenke.
»Ich mache Euch einen Vorschlag«, sagte Kell. »Sucht Euch ein Element aus. Gelingt es Euch, es aus seiner Vertiefung zu bewegen – natürlich ohne es zu berühren –, dann sollt Ihr das bisschen Erde haben.«
Ned runzelte die Stirn und dachte angestrengt nach, dann deutete er abrupt mit dem Finger auf das Wasser. »Das da.«
Wenigstens ist er nicht so dumm, es mit dem Knochen zu versuchen, dachte Kell. Luft, Erde und Wasser waren am leichtesten zu beherrschen – sogar Rhy, in dessen Blut kaum Magie floss, war dazu in der Lage. Feuer war schon schwieriger; das Knochenstück aber war bei weitem am schwersten zu bewegen – und das aus gutem Grund. Denn wer Knochen beherrschte, konnte auch Körper kontrollieren. Und das galt – selbst im Roten London – als eine der mächtigsten Kräfte, die man besitzen konnte.
Kell beobachtete, wie Ned die Hand über das Spielbrett hielt. Dann begann er, dem Wasser etwas zuzuflüstern – es mochte Latein sein oder einfach nur wirres Zeug, ganz gewiss jedoch war es kein königliches Englisch. Kells Mundwinkel zuckten. Die Elemente besaßen keine eigene Sprache – oder besser gesagt, waren sie aller Zungen mächtig. Denn die Worte selbst spielten kaum eine Rolle, halfen dem Sprecher vor allem, sich zu konzentrieren, eine Verbindung aufzubauen und Zugang zur Macht zu bekommen. Nicht das Wort zählte also, sondern die Absicht dahinter. Der Enthusiast hätte sich also (nicht, dass es ihm etwas genützt hätte) in simplem Englisch an das Wasser wenden können; stattdessen murmelte er unentwegt in einer Phantasiesprache vor sich hin. Und ließ dabei die Hand im Uhrzeigersinn über dem Spielbrett kreisen.
Mit einem Seufzer stützte Kell den Ellbogen auf die Theke und legte den Kopf in die Hand, während Ned, dessen Gesicht immer röter wurde, sich vergebens abmühte.
Nach einiger Zeit lief eine Welle durch das Wasser (möglicherweise hatte Kell gegähnt oder der Enthusiast die Theke gepackt), dann lag die Oberfläche wieder unbewegt da.
Ned starrte auf das Brett, und die Adern an seinen Schläfen traten hervor. Plötzlich ballte er die Hände – Kell fürchtete schon, er könnte das Spiel zerschmettern –, doch der Enthusiast ließ die Faust krachend neben dem kleinen Brett auf die Theke sausen.
»Nun ja«, sagte Kell.
»Das Ding ist manipuliert«, knurrte Ned.
Kell hob den Kopf von seiner Hand. »Wirklich?«, fragte er. Er spreizte die Finger kaum merklich, woraufhin der Erdklumpen aus der Vertiefung schwebte und sich wie von selbst auf seiner Handfläche niederließ. »Seid Ihr Euch da sicher?«, fragte Kell, als der Sand, von einem leichten Windstoß ergriffen, durch die Luft wirbelte und sein Handgelenk umkreiste. »Kann sein …« Das Wasser formte sich zu einem Tropfen, schwebte ebenfalls empor und plumpste, ein winziger Eisklumpen, in Kells Handfläche. »Kann aber auch nicht sein …«, fügte er hinzu, während das Öl in seiner Vertiefung in Flammen aufging.
»Oder …«, sagte Kell, als der Knochen emporschwebte, »könnte es daran liegen, dass Ihr nicht einmal den kleinsten Funken Magie in Euch habt.«
Ned starrte auf die fünf Elemente, die ihre Bahnen um Kells Hand zogen. Kell konnte Rhy schimpfen hören: Du verdammter Angeber. Dann ließ er die Elemente genauso beiläufig, wie er sie zum Schweben gebracht hatte, zurück auf das Spielbrett fallen. Die Erde landete mit einem dumpfen Geräusch, das Eis mit einem Klirren in seiner Vertiefung; der Sand sammelte sich lautlos, und das im Öl züngelnde Flämmchen erstarb. Kell betrachtete nachdenklich den Knochen, der als letztes der Elemente zwischen ihnen schwebte. Dabei spürte er die gierigen Blicke des Enthusiasten auf sich gerichtet.
»Was wollen Sie dafür?«, fragte er.
»Der steht nicht zum Verkauf«, antwortet Kell; dann fügte er hinzu: »Zumindest nicht an Euch.«
Ned stand abrupt von seinem Barhocker auf und wandte sich zum Gehen. Doch Kell war noch nicht fertig mit ihm.
»Was bekomme ich von Euch«, fragte er, »wenn ich Euch den Dreck besorge?«
Der Enthusiast blieb wie angewurzelt stehen. »Nennt mir Euren Preis.«
»Meinen Preis?« Kell schmuggelte Gegenstände nicht wegen des Geldes von einer Welt in die andere. In jeder Welt gab es eine andere Währung; was sollte er im Roten London mit Schillingen anfangen? Oder mit Pfundmünzen? Genauso gut könnte er versuchen, das Geld im Ofen zu verfeuern, als damit im Weißen London irgendetwas zu kaufen. Hier in der Grauen Stadt hätte er zwar irgendetwas damit erstehen können, aber was? Nein, Kell hatte etwas ganz Anderes im Sinn. »Behaltet Euer Geld«, sagte er. »Ich möchte etwas haben, was Euch wichtig ist. Was Ihr nicht verlieren wollt.«
Ned nickte hastig. »Gut. Wartet hier, und ich …«
»Nicht heute Abend«, unterbrach ihn Kell.
»Wann dann?«
Kell zuckte mit den Achseln. »Im Laufe des Monats.«
»Ich soll also hier herumsitzen und warten?«
»Ihr sollt überhaupt nichts«, antwortete Kell mit einem erneuten Achselzucken. Er wusste, wie grausam das von ihm war, aber er wollte herausfinden, wie weit der Enthusiast gehen würde. Und sollte Ned tatsächlich in einem Monat noch hier auf ihn warten, dann könnte er eine ganze Tüte voll Erde von ihm haben. »Und nun fort mit Euch.«
Ned öffnete und schloss den Mund, schnaubte und stapfte davon, wobei er in der Tür fast mit einem kleingewachsenen, bebrillten Mann zusammengestoßen wäre.
Kell griff nach dem schwebenden Knochenstück und steckte es zurück in die Vertiefung, während sich der Brillenträger dem frei gewordenen Barhocker näherte.
»Was war denn hier los?«, fragte er und setzte sich.
»Nichts Besonderes«, sagte Kell.
»Ist das für mich?«, fragte der Mann und deutete mit dem Kopf auf das Spiel.
Kell nickte und reichte es dem Sammler, der es ihm behutsam aus der Hand nahm. Dieser spielte eine Weile daran herum, bevor Kell ihm zeigte, wie das Kästchen zu öffnen war. Die Augen des Mannes leuchteten. »Ausgezeichnet, ganz ausgezeichnet.«
Er griff in seine Jackentasche und zog ein verknotetes Taschentuch heraus, das er mit einem dumpfen Geräusch auf der Theke absetzte. Kell löste den Knoten und erblickte ein silbern schimmerndes Kästchen mit einer winzigen seitlichen Kurbel.
Eine Spieluhr! Kell lächelte in sich hinein.
Natürlich gab es auch im Roten London Musik; auch Spieluhren waren zu finden, doch die meisten wurden von Magie angetrieben, nicht von Walzen. Kell bewunderte den Einfallsreichtum, der in diesen kleinen Wunderwerken steckte. So vieles hier in der Grauen Welt war unbeholfen, doch bisweilen führte das Fehlen von Magie zu genialen Erfindungen. Wie zum Beispiel bei den zwar kompliziert aufgebauten, aber eleganten Spieluhren – so viele Einzelteile, so viel Aufwand, nur um eine kleine Melodie zum Leben zu erwecken.
»Soll ich Euch den Mechanismus erklären?«, fragte der Sammler.
Kell schüttelte den Kopf. »Nein, danke«, sagte er sanft. »Ich besitze schon ein paar davon.«
Der Mann runzelte die Stirn. »Sind wir trotzdem handelseinig?«
Kell nickte und verknotete die kleine Kostbarkeit wieder in das Taschentuch.
»Wollt Ihr sie nicht ausprobieren?«
Natürlich wollte Kell das, aber nicht hier in der schäbigen kleinen Schenke, wo er die Musik nicht genießen konnte. Zudem war es höchste Zeit, sich auf den Heimweg zu machen.
Er ließ den Sammler an der Theke zurück – dieser konnte seine Hände nicht von dem Spiel lassen, sich nicht daran sattsehen, wie das mittlerweile wieder geschmolzene Eis und der Sand, so heftig er das Kästchen auch schüttelte, in ihren Vertiefungen blieben – und trat hinaus in die Nacht. Kell ging zur Themse hinunter und lauschte den Geräuschen der Stadt, dem nahen Rattern der Fuhrwerke und den fernen Schreien der Freude und des Schmerzes (die jedoch mit den durch das Weiße London gellenden Schreien nicht zu vergleichen waren). Als er den nächtlichen Fluss wie ein schwarzes Band vor sich liegen sah, hörte er von einer Kirche in der Ferne acht Glockenschläge.
Höchste Zeit aufzubrechen!
Kell blieb im Schatten der Ziegelmauer eines Ladens stehen, dessen Fassade zum Fluss hinausging, und schob den Ärmel zurück. Obwohl sein Arm noch von den ersten beiden Schnitten schmerzte, zog er das Messer erneut aus der Scheide und führte es ein drittes Mal über seine Haut; mit seinem Finger berührte er die blutende Wunde und anschließend die Wand.
An einer der Schnüre um seinen Hals baumelte ein roter Lin, genauso einer wie der, den König George ihm am Nachmittag zurückgegeben hatte. Er nahm die Münze und drückte auch sie gegen die blutverschmierten Ziegel.
»Na dann«, sagte er, »höchste Zeit, nach Hause zu gehen.« Er ertappte sich häufig dabei, wie er mit der Magie sprach – nicht etwa befehlend, sondern im Plauderton. Jeder wusste, dass Magie eine lebendige Kraft darstellte; für Kell war sie jedoch weit mehr – ein Freund, sogar ein Familienmitglied. Schließlich war sie ein Teil von ihm (er war noch viel enger mit ihr verbunden als die meisten anderen), und er spürte unwillkürlich, dass sie seine Worte und auch seine Gefühle ganz genau verstand. Nicht nur, wenn er sie heraufbeschwor, sondern immer, bei jedem Herzschlag und jedem Atemzug.
Schließlich war er ein Antari.
Und daher beherrschte er die Sprache des Blutes, des Lebens sowie der Magie. Des ersten und letzten der Elemente, das allem innewohnte und doch ganz für sich stand.
Er spürte, wie die Magie zum Leben erwachte und der Ziegel unter seiner Handfläche zugleich warm und kalt wurde; Kell wartete, ob die Magie ihm ohne Aufforderung antworten würde. Doch sie schwieg und erwartete seinen Befehl. Die elementare Magie mochte alle Sprachen beherrschen, doch die wahre Magie des Blutes, der Antari, hörte nur auf eine einzige. Kell spreizte seine Finger.
»As Travars«, sagte er. Durchreise.
Diesmal gehorchte ihm die Magie aufs Wort. Die Welt erbebte und Kell schritt durch die Tür, in die Dunkelheit hinein – und ließ sich das Graue London wie einen Mantel von den Schultern gleiten.
ZweiIm Reich des Roten Königs
I
»Sankt!«, verkündete Gen mit einem triumphierenden Grinsen und warf eine Spielkarte auf den offenen Kartenstapel; diese zeigte eine verhüllte Gestalt mit gesenktem Haupt, die eine Rune wie einen Kelch emporhielt.
Parrish, der andere Wachposten, zog eine Grimasse und warf seine restlichen Karten auf den Tisch. Er hätte Gen des Falschspiels bezichtigen können, doch wozu? Schließlich hatte er selbst eine knappe Stunde lang nach Strich und Faden betrogen, ohne einen einzigen Stich zu bekommen. Parrish schob seine Münzen murrend über den schmalen Tisch zu dem ansehnlichen Haufen hinüber, der sich vor Gen auftürmte. Der wiederum strich seinen Gewinn ein und machte sich daran, die Karten erneut zu mischen. »Na, noch ein Spielchen gefällig?«, fragte er.
»Ohne mich«, antwortete Parrish und sprang auf die Beine. Sein schwerer, rot-golden gestreifter Mantel fächerte sich wie ein Strahlenkranz um ihn herum aus, und die Metallplatten seines Brustpanzers und der Beinschützer klirrten leise, als er sich streckte.
»Ira chas era«, sagte Gen und wechselte vom Königlichen Englisch ins Arnesische.
In die gemeine Sprache.
»Ich bin nicht sauer«, schnauzte Parrish ihn an. »Nur pleite.«
»Na los«, stachelte Gen ihn an. »Beim dritten Mal hast du vielleicht mehr Glück.«
»Ich muss pinkeln«, sagte Parrish nur und rückte sein Kurzschwert zurecht.
»Worauf wartest du dann noch?«
Parrish zögerte und ließ den Blick durch die Halle schweifen. Alles war ruhig, weit und breit regte sich nichts. Dafür fiel sein Auge auf all die Kostbarkeiten, mit denen der Raum gefüllt war: Porträts der königlichen Familie, Trophäen und Tische (einschließlich dem, an dem sie gerade gespielt hatten). Am anderen Ende der Halle befand sich eine prächtige Flügeltür, auf deren glänzendem Kirschholz das Wappen der Könige von Arnes – ein Kelch vor der aufgehenden Sonne – eingraviert und mit flüssigem Gold verziert worden war; über dem Wappen formten sich die metallisch glänzenden Lichtstrahlen zu einem »R«.
Die Türen führten zu den Privatgemächern von Prinz Rhy; und als Mitglieder seiner Leibgarde hatten Gen und Parrish die Aufgabe, sie zu bewachen.
Parrish mochte den Prinzen – zwar war dieser verwöhnt wie jeder andere Königssohn auch (zumindest vermutete Parrish das, schließlich hatte er bisher noch keinem anderen Mitglied der königlichen Familie gedient), dabei aber gutmütig und äußerst nachsichtig, was seine Wachen anging (zum Teufel nochmal, der Prinz hatte Parrish immerhin das wunderschöne Kartenspiel mit dem Goldschnitt höchstpersönlich geschenkt); und manchmal ließ er nach einer durchzechten Nacht das königliche Englisch mit dem dazugehörigen Dünkel beiseite und unterhielt sich mit dem Wachposten in der gemeinen Sprache (Rhys’ Arnesisch war einwandfrei). Manchmal schien es sogar, als würde der Prinz von einem schlechten Gewissen geplagt, weil die Wachen so viel Zeit damit vergeuden mussten, vor seiner Tür herumzustehen und auf ihn aufzupassen (wobei das in den meisten Nächten eher eine Frage der Diskretion als der Wachsamkeit war).
Am glücklichsten war Parrish, wenn Prinz Rhy und Meister Kell nachts die Stadt unsicher machten und Gen und er den beiden mit kleinem Abstand folgen oder ihnen einfach so Gesellschaft leisten durften (jeder wusste, dass Kell besser auf den Prinzen aufpassen konnte als sämtliche Soldaten zusammengenommen). Doch Kell war noch immer nicht zurückgekehrt – weshalb der ewig ruhelose Rhy sich schlechtgelaunt frühzeitig in seine Gemächer zurückgezogen hatte. Seither standen die beiden Wachen in der Vorhalle, und Gen hatte Parrish fast seinen ganzen Sold aus der Tasche gezogen.
Parrish schnappte sich den Helm vom Tisch und ging hinaus, um seine Blase zu leeren, begleitet vom Klirren der Münzen, die Gen gerade zählte. Parrish ließ sich Zeit, da er das Gefühl hatte, aufgrund der vielen verlorenen Lin eine kleine Pause verdient zu haben. Und als er schließlich gemächlich in die Halle zurückspazierte, fand er diese zu seiner Bestürzung leer vor; von Gen fehlte jede Spur. Die Nachsicht des Hauptmanns hatte ihre Grenzen: Kartenspielen während des Dienstes würde er noch verzeihen; doch ganz gewiss würde er außer sich sein vor Wut, wenn er herausfand, dass die Gemächer des Prinzen unbewacht gewesen waren.
Parrish runzelte die Stirn und machte sich daran, die Karten zusammenzupacken, die noch immer auf dem Tisch herumlagen. Er hielt inne, als die Stimme eines Mannes aus dem Schlafzimmer des Prinzen an sein Ohr drang. Das war an und für sich nicht ungewöhnlich, da Rhy immer wieder Gäste empfing – der Prinz machte schließlich keinen Hehl aus seiner Leidenschaft für Männer und Frauen, und Parrish war wohl der Letzte, der sich ein Urteil darüber erlauben durfte.
Diese unverkennbare Stimme gehörte jedoch nicht einer von Rhys Eroberungen; sie sprach Englisch, doch mit einem leichten Akzent, der rauer klang als der eines Arnesiers.
Es war die Stimme eines durch die Wälder huschenden, nächtlichen Schattens. Leise, dunkel und kalt.
Sie gehörte Holland, dem anderen Antari.
Parrish erblasste ein wenig. Sosehr er Meister Kell verehrte (womit Gen ihn ständig aufzog), sosehr machte Holland ihm Angst. Ob nun aufgrund seiner monotonen Stimme, seiner eigenartig verblichenen Erscheinung oder aber wegen seiner unheimlichen Augen, einem magischen schwarzen und einem milchig grünen. Vielleicht aber auch, weil er nicht wie ein Wesen aus Fleisch und Blut schien, sondern seelenlos, als wäre er aus Wasser und Stein geschaffen. Warum auch immer – der fremde Antari jagte Parrish eine Heidenangst ein.
Einige der anderen Wachen gaben dem Antari hinter seinem Rücken den Spitznamen »Hohlkopf« – doch Parrish fürchtete sich viel zu sehr, um sich ihnen anzuschließen.
»Warum stellst du dich so an?«, zog Gen ihn dann auf. »Der kann dich durch die Wand, die die Welten trennt, doch nicht hören.«
»Bist du dir da so sicher?«, pflegte Parrish im Flüsterton zu antworten. »Vielleicht ja doch!«
Und jetzt befand sich Holland im Zimmer des Prinzen. Durfte er das überhaupt? Und: Wer hatte ihn eingelassen?
Wo zum Teufel ist Gen?, fragte sich Parrish und stellte sich vor der Tür auf. Er hatte nicht die Absicht zu lauschen, doch zwischen den beiden Türflügeln war ein kleiner Spalt, und wenn er den Kopf ganz leicht drehte, konnte er die Unterhaltung mitverfolgen.
»Bitte verzeiht, dass ich einfach so hereinplatze«, konnte er Hollands ruhige und leise Stimme hören.
»Kein Problem«, antwortete Rhy unbekümmert. »Was bringt Euch zu mir? Hattet Ihr nicht etwas mit meinem Vater zu besprechen?«
»Bei ihm war ich bereits«, antwortete Holland. »Euch suche ich aus einem anderen Grund auf.«
Parrish errötete, als er den verführerischen Ton in Hollands Stimme hörte. Vielleicht sollte er sich lieber aus dem Staub machen, anstatt die beiden hier zu belauschen! Aber er hielt die Stellung und konnte hören, wie Rhy sich in einen Polstersessel fallen ließ.
»Und was könnte das sein?«, fragte der Prinz ebenfalls neckisch flirtend.
»Wenn ich richtig informiert bin, habt Ihr in Kürze Geburtstag?«
»Ganz richtig«, antwortete Rhy. »Kommt doch zu den Feierlichkeiten, vorausgesetzt, Euer König und Eure Königin können Euch entbehren.«
»Ich fürchte nicht«, antwortete Holland. »Doch meine Gebieter sind der Grund, warum ich Euch aufsuche. Sie baten mich, Euch ein Geschenk zu übergeben.«
Parrish hörte, wie Rhy zögerte. »Holland«, sagte der Prinz dann, und die Polster raschelten leicht, als er sich aufsetzte. »Ihr kennt die Gesetze doch ganz genau. Sie verbieten mir …«
»Ich kenne die Gesetze, junger Prinz«, sagte Holland beschwichtigend. »Was das Geschenk anbelangt – ich habe es auf Geheiß meiner Gebieter hier in Eurer Stadt ausgesucht.«
Beide schwiegen lange; dann stand Rhy auf und sagte: »Also gut.«
Parrish hörte, wie Holland dem Prinzen etwas übergab, gefolgt vom Rascheln von Papier.
Wieder herrschte langes Schweigen, dann fragte der Prinz: »Was macht man damit?«
Holland gab ein seltsames Geräusch von sich, etwas zwischen einem Lachen und Grinsen, was Parrish nie zuvor bei dem Antari erlebt hatte. »Es verleiht Kraft.«
Rhy wollte gerade weiterreden, als mehrere Uhren die Stunde verkündeten und das weitere Gespräch zwischen Holland und dem Prinzen übertönten. Die Schläge dröhnten immer noch durch die Halle, als die Tür aufging und Holland heraustrat. Seine zweifarbigen Augen richteten sich sogleich auf Parrish.
Mit einem resignierten Seufzer schloss er die Tür sorgfältig und fuhr sich mit der Hand durch das dunkelgraue Haar.
»Kaum ist man eine Wache losgeworden«, murmelte er, halb an sich selbst gerichtet, »steht schon eine andere vor der Tür.«
Während Parrish noch nach einer Antwort suchte, kramte der Antari eine Münze aus der Tasche und warf diese der Wache lässig zu.
»Du hast mich nicht gesehen«, sagte Holland, während das Geldstück durch die Luft wirbelte. Als die Münze in Parrishs Hand landete, befand sich dieser wieder allein in der Halle. Er betrachtete das Geldstück verwundert. Wo mochte die wohl herkommen? Er wusste, dass er irgendetwas Wichtiges vergessen hatte. Seine Finger umklammerten die Münze, als könnte er dadurch die Erinnerung noch festhalten.
Doch vergeblich.
II
Der Fluss leuchtete sogar nachts purpurrot.
Als Kell das Ufer des einen London verließ und das des anderen betrat, lag statt der schwarzglänzenden Oberfläche der Themse der warme, stete Lichtschein der Isle vor ihm. Gleich einem Edelstein wurde der Fluss von einem inneren Strahlen erhellt, das sich wie ein leuchtendes Band langsam und unablässig über die gesamte Stadt ausbreitete.
Die Isle war eine Quelle.
Eine Ader, durch die Macht strömte.
Manche behaupteten, die Magie habe ihren Ursprung im Geist, andere wiederum ordneten sie der Seele zu, dem Herzen oder der Willenskraft.
Kell aber wusste, dass sie dem Blut innewohnte.
Denn das Blut selbst war Magie. Und diente ihr als Nährboden – den sie zugleich vergiftete. Kell hatte beobachten können, wie sich die Magie gegen diejenigen richtete, die sie korrumpiert hatte, bis das Blut in ihren Adern nicht mehr purpurn, sondern schwarz floss. Wenn Rot die Farbe der Magie war, bei der sich Machtwille und Menschlichkeit die Waage hielten, stand Schwarz für die aus dem Gleichgewicht geratene Macht, die keine Ordnung oder Zurückhaltung mehr kannte.
Antari wie Kell trugen beides in sich, Harmonie und Chaos. Das Blut in seinen Adern leuchtete in demselben gesunden Rot wie die Isle im Roten London, während sein rechtes Auge im Schwarz vergossener Tinte schillerte.
Kell wollte glauben, dass sich die Kräfte nur aus seinem Blut speisten, doch konnte er den Stempel dunkler Magie, der sein Gesicht entstellte, nicht gänzlich ignorieren. Denn mit jedem Blick in den Spiegel und jedem gewöhnlichen Augenpaar, das ihn erschrocken oder angsterfüllt anstarrte, sah er genau diese Schwärze. Und jedes Mal, wenn er seine blutverschmierte Hand gegen die Wand presste und die Macht anrief, erklang auch diese dunkle Seite der Magie mit einem dumpfen Summen in seinem Kopf.
Sein Blut floss jedoch stets in hellem, gesundem Rot. So wie die Isle.
Über dem Fluss erhob sich der königliche Palast gleich einer Brücke aus Glas, Bronze und Stein; er wurde Soner Rast genannt, »Schlagendes Herz« der Stadt. Seine himmelwärts geschwungenen Türme gleißten, als seien sie mit unzähligen Lichtperlen übersät.
Tag und Nacht strömte das Volk dorthin, manche, um eine Angelegenheit vor die Herrscher zu bringen, andere wiederum suchten die Nähe der unter dem Palast hindurchströmenden Isle. Magier kamen, um an ihrem Ufer zu meditieren und in der Hoffnung, an ihrer Macht teilzuhaben, während Besucher aus den ländlichen Gegenden Arnesiens sich nur am Anblick von Fluss und Schloss erfreuen wollten und Blumen – Lilien, Götterblumen, Azaleen und Mondblumen – am Ufer verstreuten.
Kell hielt sich im Schatten eines Ladens an der Uferstraße und blickte zum Palast hinüber. Der Soner Rast hing wie eine ewig im Aufgehen begriffene Sonne über der Stadt. Einen Moment lang sah er ihn mit den Augen der zahlreichen Besucher. Und staunte.
Ein schmerzhaftes Stechen in seinem Arm brachte Kell wieder zu sich. Er zuckte zusammen und zog sich die Schnur mit der Münze, die er für den Durchgang benutzt hatte, wieder über den Kopf. Dann machte er sich auf den Weg zum Fluss, an dessen Ufer sich unzählige Menschen drängten.
Auf dem Nachtmarkt herrschte reges Treiben.
Im Purpurschimmer des Flusses, im Schein des Mondes und zahlreicher Laternen boten Händler vor bunten Zelten ihre Waren feil, verkauften Essen und andere Kleinigkeiten – mit und ohne magische Eigenschaften – an Pilger und Einheimische. Eine junge Frau hielt einen riesigen Strauß Sternblumen, die sie an Besucher verteilte, damit diese sie auf den Stufen des Palastes ablegen konnten. Am Arm eines alten Mannes baumelten unzählige Halsketten, jede mit einem auf Hochglanz polierten Kieselstein, der dem Träger angeblich bessere Kontrolle über die Elemente verlieh.