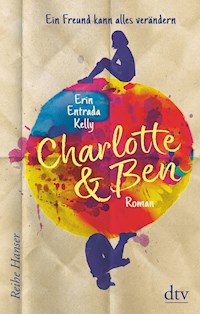8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dtv Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Reihe Hanser
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2018
Über Sehnsucht, Freundschaft, Vertrauen und Meerschweinchen - Ausgezeichnet mit dem Deutschen Jugendliteraturpreis VIRGIL ist schüchtern und fühlt sich in seiner lauten Familie komplett fehl am Platz. VALENCIA ist taub, intelligent und schrecklich einsam. KAORI ist eine Lebensberaterin mit hellseherischen Fähigkeiten und ihrer kleinen Schwester GEN im Schlepptau. Und da ist CHET, eine wahre Plage für die anderen Kinder. Nein, Freunde sind sie nicht, zumindest nicht bis zu dem Tag, als CHET VIRGIL und sein Meerschweinchen GULLIVER angreift und die beiden in einem alten Brunnen feststecken. Was für ein Unglück! Oder was für ein Glück! Denn das führt zu einer beispiellosen Suchaktion von VALENCIA, KAORI und GEN. Mit Glück, Köpfchen und Mut – und einer kleinen Hilfe vom Universum natürlich – werden ein Junge gerettet, ein Bully in seine Schranken gewiesen und Freundschaften geschmiedet.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 229
Ähnliche
Erin Entrada Kelly
Vier Wünsche ans Universum
Aus dem Englischen von Birgitt Kollmann
dtv Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG, München
Für Carolanne, meine wunderbar vielfacettige Wassermannfrau, und für Jen Breen – Zwilling, Phönix, Visionärin
1 Riesenversager
Der elfjährige Virgil Salinas dachte schon jetzt mit Schrecken an seine restliche Mittelschulzeit, dabei hatte er gerade erst die sechste Klasse abgeschlossen, also sein erstes Jahr in dieser Schule, und noch zwei weitere vor sich. Er stellte sich diese Zeit wie eine lange Reihe von Hürden vor, jede höher, dicker und schwieriger zu nehmen als die vorige. Und vor diesen Hürden stand er, Virgil, auf seinen schwachen, mageren Beinen. Hürdenlauf war überhaupt nicht sein Ding. Das hatte er leidvoll im Sportunterricht erfahren, wo er als der Kleinste leicht übersehen und immer als Letzter in eine Mannschaft gewählt wurde.
Eigentlich sollte er bester Laune sein: Der letzte Schultag! Ein ganzes Schuljahr überstanden! Er hätte nach Hause hüpfen sollen, voller Vorfreude auf einen leuchtend hellen Sommer. Stattdessen betrat er das Haus wie ein geschlagener Athlet – mit gesenktem Kopf und hängenden Schultern, und die Enttäuschung lag ihm wie ein schwerer Stein auf der Brust. Denn seit heute war es amtlich: Virgil war ein Riesenversager.
»Ay, Virgilio«, sagte seine Großmutter – seine Lola –, als er in die Küche kam. Sie war gerade dabei, eine Mango zu schälen, und schaute nicht auf. »Komm her, nimm dir eine. Deine Mutter hat mal wieder viel zu viele gekauft. Ein Sonderangebot, natürlich, also kauft sie gleich zehn Stück. Wozu, frage ich dich, brauchen wir zehn Mangos? Außerdem kommen sie nicht einmal von den Philippinen, sondern aus Venezuela. Deine Mutter geht hin und kauft zehn venezolanische Mangos! Wozu? Diese Frau würde sogar Judasküsse kaufen – Hauptsache, sie wären im Sonderangebot.« Sie schüttelte den Kopf.
Virgil stellte sich etwas gerader hin, damit Lola nicht gleich Verdacht schöpfte und fragte, ob irgendetwas los sei. Dann nahm er sich eine Mango aus der Obstschale. Sofort trafen sich Lolas Augenbrauen in der Mitte. Richtige Augenbrauen waren das allerdings nicht, die hatte sie sich längst ausgezupft.
»Was ist los? Was machst du für ein Gesicht?«, fragte sie.
»Was für ein Gesicht denn?«, fragte Virgil zurück.
»Du weißt schon.« Lola gab nicht gerne Erklärungen ab. »Hat dieser Junge mit dem Boxergesicht dich wieder geärgert in der Schule?«
»Nein, Lola.« Ausnahmsweise einmal bereitete ihm dieser Mitschüler die geringsten Sorgen. »Alles in Ordnung.«
»Hmm«, machte Lola. Sie wusste, dass eben nicht alles in Ordnung war. Sie durchschaute Virgil immer. Zwischen ihnen beiden gab es ein geheimes Band. Das war schon so seit dem Tag, als Lola von den Philippinen hergekommen war, um bei Virgil und seiner Familie zu leben. Am Morgen ihrer Ankunft hatten sich Virgils Eltern und die eineiigen Zwillinge, seine Brüder, sofort auf Lola gestürzt, um sie zu begrüßen und zu umarmen. So waren sie nun mal in der Familie Salinas, mit Ausnahme von Virgil – lauter Menschen mit großen, übersprudelnden Herzen, die an überkochende Suppe erinnerten. Neben ihnen fühlte Virgil sich stets wie eine trockene Scheibe Toast.
»Ay, Herr Jesus«, hatte Lola gesagt und sich die Fingerspitzen an die Schläfen gedrückt, »meine ersten Minuten in Amerika, und ich habe rasende Kopfschmerzen!« Sie hatte Virgils ältere Brüder zu sich gewinkt, die schon damals groß und schlank und muskulös waren. »Joselito, Julius, geht und bringt mir meine Koffer, ja? Währenddessen möchte ich erst einmal meinem jüngsten Enkel Guten Tag sagen.«
Joselito und Julius waren gleich losgeflitzt – hilfsbereit wie immer –, und Virgils Eltern hatten der Großmutter ihren Jüngsten vorgestellt, so als wäre er ein seltenes Ausstellungsstück, das sie nicht so richtig verstanden.
»Und das ist Turtle«, hatte seine Mutter gesagt.
So nannten seine Eltern ihn nämlich: Turtle, wie die Schildkröte. Weil er »nie unter seinem Panzer hervorkommt«. Jedes Mal, wenn sie das sagten, zerbrach etwas in ihm.
Lola hatte sich vor ihn gehockt und ihm etwas ins Ohr geflüstert: »Du bist mein Liebling, Virgilio.« Dann hatte sie sich einen Finger auf die Lippen gelegt und hinzugefügt: »Aber kein Wort davon zu deinen Brüdern!«
Sechs Jahre war das jetzt her, aber Virgil wusste, er war noch immer Lolas Liebling, auch wenn sie das nie mehr gesagt hatte.
Lola konnte er vertrauen. Vielleicht würde er ihr irgendwann sein Geheimnis anvertrauen, das Geheimnis, das ihn zu diesem Riesenversager machte. Aber nicht jetzt. Nicht heute.
Lola nahm ihm die Mango aus der Hand.
»Gib her, ich schneide sie für dich auf«, sagte sie.
Virgil stellte sich neben sie und sah zu. Lola war schon alt, und die Haut ihrer Finger fühlte sich wie Papier an, doch im Aufschneiden von Mangos war sie eine Künstlerin. Sie fing langsam an und ließ sich Zeit. »Weißt du was?«, begann sie. »Letzte Nacht habe ich wieder von dem Steinjungen geträumt.«
Seit Tagen träumte sie jetzt schon von diesem Steinjungen, immer denselben Traum: Ein schüchterner Junge – ein bisschen so wie Virgil – fühlt sich schrecklich einsam. Eines Tages geht er im Wald spazieren und bittet einen Fels, ihn zu verschlingen. Dieser Fels, der größte im Wald, öffnet auch wirklich seinen finsteren Mund, der Junge springt hinein und wird nie wieder gesehen. Als seine Eltern den Stein finden, können sie nichts tun. Virgil war sich sowieso nicht sicher, wie sehr seine eigenen Eltern sich anstrengen würden, um ihn aus dem Stein herauszuholen, doch Lola, das wusste er, würde den Fels notfalls mit einem Steinmeißel von Hand zerlegen.
»Ich verspreche dir, dass ich nicht in irgendwelche Felsen springe«, sagte Virgil zu Lola.
»Ich seh dir doch an, dass etwas nicht stimmt mit dir. Du machst ein Gesicht wie Federico der Kummervolle.«
»Wer ist das denn – Federico der Kummervolle?«
»Das war ein König, der noch ein Junge war und immerfort traurig. Aber niemand sollte wissen, dass er traurig war, alle sollten ihn für einen starken König halten. Eines Tages jedoch konnte er seinen Kummer nicht mehr in sich behalten, und alles sprudelte aus ihm heraus wie bei einem Springbrunnen.«
Lola hob beide Hände in die Luft, um das hochsprudelnde Wasser nachzumachen. In der einen Hand hielt sie noch immer das Obstmesser. »Federico weinte und weinte, bis das ganze Land unter Wasser stand und alle Inseln voneinander wegtrieben. Am Ende war Federico ganz allein auf einer Insel. Irgendwann kam ein Krokodil und fraß ihn.«
Lola hielt Virgil eine köstlich aussehende Mangoscheibe hin. »Hier.«
Virgil nahm sie. »Lola, kann ich dich was fragen?«
»Nur heraus damit.«
»Wie kommt es, dass in so vielen von deinen Geschichten Jungen von irgendwas gefressen werden, von Felsen oder Krokodilen?«
»Es sind gar nicht immer Jungen, die gefressen werden. Manchmal sind es auch Mädchen.«
Lola warf ihr Messer ins Spülbecken und zog ihre nicht mehr vorhandenen Augenbrauen hoch. »Wenn du je beschließen solltest, dass du reden willst, dann komm zu deiner Lola. Nicht dass du noch platzt wie ein Springbrunnen und wegfließt.«
»Okay«, sagte Virgil. »Aber jetzt gehe ich erst mal in mein Zimmer. Mal sehen, ob es Gulliver gut geht.«
Gulliver, sein Meerschweinchen, freute sich immer, ihn zu sehen. Virgil wusste: Sobald er die Tür aufmachte, würde Gulliver anfangen zu zwitschern. Vielleicht würde Virgil sich dann nicht mehr ganz so sehr wie ein Versager fühlen.
»Wieso sollte es ihm nicht gut gehen?«, rief Lola ihm nach, als er die Küche verließ. »Meerschweinchen haben selten Probleme, anak[1].«
Lolas Lachen hallte in Virgil noch nach, während er durch den Flur ging und sich die Mangoscheibe in den Mund schob.
2 Valencia
Ich habe keine Ahnung, wie Gott aussieht. Ich weiß auch nicht, ob es im Himmel einen ganz großen Gott gibt oder zwei oder drei oder dreißig oder vielleicht auch einen für jeden Menschen auf der Welt. Ich bin mir nicht sicher, ob Gott ein Junge ist oder ein Mädchen oder ein alter Mann mit einem weißen Bart. Aber das macht auch nichts. Ich fühle mich einfach sicher, wenn ich weiß, dass mir jemand zuhört.
Meistens rede ich mit dem heiligen Renatus. Sein richtiger Name war René Goupil. Er war ein französischer Missionar in Kanada. Als er über den Köpfen indianischer Kinder das Kreuzzeichen schlug, dachten die Erwachsenen, er wolle die Kinder verhexen, und so nahmen sie ihn gefangen und töteten ihn.
Das alles weiß ich überhaupt nur deshalb, weil ich zu meinem zehnten Geburtstag von dieser Roberta ein Buch bekommen habe, das Berühmte gehörlose Menschen in der Geschichte hieß. Umgekehrt hätte ich Roberta ja niemals ein Buch geschenkt mit dem Titel Berühmte Blondinen oder Berühmte Menschen, die zu viel quasselten oder Berühmte Menschen, die versucht haben, beim Diktat abzuschreiben – obwohl das alles auf Roberta zutraf. Aber ein Gutes hatte das Buch immerhin: Dadurch habe ich vom heiligen Renatus oder, wie ich ihn nenne, dem heiligen René erfahren.
Ich beherrsche die Zeichensprache nicht, aber wenigstens das Alphabet dazu habe ich mir beigebracht, und so habe ich mir einen Namen in Zeichensprache für den heiligen René ausgedacht. Dabei kreuze ich den Mittel- und den Zeigefinger – das Zeichen für R – und tippe mir dreimal auf die Lippen. Das ist so ziemlich das Erste, was ich abends tue, wenn ich meine Hörhilfen herausgenommen habe und ins Bett gehe. Dann schaue ich zur Decke hoch und stelle mir vor, wie meine Gebete aufsteigen, immer höher, und noch eine Weile über meinem Bett schweben, bevor sie schließlich durchs Dach entschwinden. Dann stelle ich mir vor, wie sie auf einer Wolke landen, wo sie sich niederlassen und darauf warten, dass sie erhört werden.
Als ich noch jünger war, glaubte ich, irgendwann würde die Wolke so schwer werden, dass all meine Gebete zurück auf die Erde fallen würden. Dann hätte ich alles, was ich mir je gewünscht hätte. Aber jetzt bin ich elf und weiß es besser. Trotzdem stelle ich mir immer noch vor, wie sie zur Decke segeln. Schadet ja nicht, so ein Gedanke.
Ich bete nur abends, denn das ist die Tageszeit, die ich am wenigsten mag. Dann ist alles still und dunkel, und ich habe zu viel Zeit zum Nachdenken. Ein Gedanke führt zum nächsten, und auf einmal ist es zwei Uhr morgens, und ich habe noch kein Auge zugetan. Und wenn ich doch geschlafen habe, dann nicht gut.
Das war nicht immer schon so, dass ich die Nächte gehasst habe.
Früher habe ich mich ins Bett gelegt, und schon war ich eingeschlafen. Ohne Probleme.
Mit der Dunkelheit hat das nichts zu tun. Die hat mir sonst nie was ausgemacht. Mit meinen Eltern war ich mal in einer riesigen unterirdischen Höhle, den Crystal Caves oder Kristallhöhlen. Da konnte man nicht die Hand vor Augen sehen, aber Angst hatte ich keine. Im Gegenteil, ich fand’s toll. Wie eine Forscherin habe ich mich gefühlt. Zum Schluss hat mein Dad mir so eine Schneekugel gekauft, nur dass keine Flocken herumwirbelten, wenn man das Ding schüttelte, sondern Fledermäuse. Die Kugel steht ganz nah bei mir, auf meinem Nachttisch; bevor ich ins Bett gehe, schüttele ich sie immer. Einfach so.
Es ist also nicht die Dunkelheit, die mich wach hält.
Es ist der Albtraum.
Dieser Albtraum geht so:
Ich stehe am Rand einer Wiese, einer, auf der ich noch nie gewesen bin. Das Gras unter meinen Füßen ist gelb und braun, und ich bin umgeben von einer riesigen Menschenmenge. Im Traum weiß ich, wer die Leute sind, dabei sehen sie niemandem ähnlich, den ich im wirklichen Leben kenne. Alle sehen mich aus runden schwarzen Augen an. Augen ohne das kleinste bisschen Weiß darin. Dann tritt ein Mädchen in einem blauen Kleid aus der Menge heraus. Sie sagt nur ein einziges Wort: »Sonnenfinsternis.« Ich weiß, was sie sagt, dabei habe ich meine Hörhilfen nicht an, und sie bewegt auch nicht die Lippen beim Sprechen. In Träumen ist das manchmal so.
Das Mädchen zeigt zum Himmel hinauf.
Mein Albtraum-Ich schaut hoch, aufmerksam, noch nicht ängstlich. Ich verrenke mir den Hals, so wie alle anderen auch. Wir schauen zu, wie der Mond sich vor die Sonne schiebt. Der leuchtend blaue Himmel wird erst grau, dann ganz dunkel, und mein Albtraum-Ich denkt, das sei das Erstaunlichste, was es je gesehen hat.
Aber etwas ist merkwürdig an solchen Träumen.
Irgendwie weiß mein Albtraum-Ich, dass die Sache nicht gut ausgeht. Sobald der Mond an der Sonne vorbeigezogen ist, rauscht das Blut in meinen Ohren, und meine Handflächen sind feucht von Schweiß. Ich senke den Blick – langsam, ganz langsam, ich will es nicht sehen –, und es ist, wie ich es vermutet hatte: Alle sind weg. Die Menschenmenge, auch das Mädchen im blauen Kleid. Nichts bewegt sich mehr, nicht einmal ein Grashalm. Die Wiese erstreckt sich meilenweit. Der Mond hat alle weggezogen. Alle außer meinem Albtraum-Ich.
Ich bin der einzige Mensch auf der Erde.
Ich weiß nicht, wie spät es ist, aber spät auf jeden Fall. Nach Mitternacht. Ich hab mir ganz fest vorgenommen, nicht an den Albtraum zu denken, und was tue ich? Ich liege im Bett und denke an nichts anderes. Ich schüttele meine Glaskugel aus den Kristallhöhlen und sehe zu, wie die Fledermäuse darin herumschwirren. Dann versuche ich, mich auf die klumpigen Farbkleckse an der Zimmerdecke zu konzentrieren. Popcornfarben nennt mein Dad das. Als ich noch klein war, haben wir uns immer vorgestellt, die ganze Decke wäre aus Popcorn. Wir haben den Mund weit aufgerissen und uns das Zeug nur so hineinfallen lassen.
»Nächstes Mal male ich dir eine Lakritzdecke«, sagte er oft. Lakritzstangen gehörten zu seinen Leibspeisen, behauptete er, doch ich schüttelte nur den Kopf und sagte: »Schokolade, Schokolade, Schokolade.«
Das war ein Spiel zwischen uns. Aber so was machen wir nicht mehr.
Ich glaube, er weiß einfach nicht, was man so macht als Vater einer Elfjährigen. Ein Mädchen von elf Jahren kann man sich nicht einfach mehr auf die Schultern setzen, schon gar nicht, wenn sie vor allem aus Knien und Ellenbogen besteht und einsfünfundsechzig groß ist. Man kann auch nicht mehr Kakao für sie kochen oder Bilderbücher vorlesen oder mit ihr zusammen auf den Weihnachtsmann warten.
Trotzdem war es schön, sich an die Popcorn-Lakritz-Schokolade-Decke zu erinnern.
Auf jeden Fall besser, als an einen Albtraum zu denken.
Ich mache die Augen zu und spüre den Windhauch des Deckenventilators im Gesicht. Dann gebe ich mir selbst ein Versprechen: Wenn ich heute Nacht wieder einen Albtraum habe, dann rede ich mit jemandem und bitte um Hilfe. Mit wem, weiß ich noch nicht. Aber mit irgendwem ganz bestimmt. Nur nicht mit meiner Mutter.
Versteh mich nicht falsch. Manchmal kann man ganz vernünftig mit ihr reden. Wenn man einen guten Tag erwischt, an dem sie nicht allzu gluckenhaft drauf ist. Aber ich weiß vorher nie, in welcher Verfassung sie gerade ist. Manchmal ist sie überbeschützend, übermächtig, überalles. Irgendwann habe ich sie ganz direkt gefragt, ob sie mich deswegen so behandelt, weil ich gehörlos bin. Denn so fühlt es sich für mich an.
»Ich bin nicht überbeschützend, weil du gehörlos bist. Ich bin überbeschützend, weil ich deine Mutter bin«, sagte sie.
Aber etwas in ihrem Blick sagte mir: Das war nicht die Wahrheit. Jedenfalls nicht die ganze.
Ich bin gut darin, Blicke zu lesen. So wie ich auch Lippen lesen kann.
Meine Mutter darf auf keinen Fall von meinen Albträumen erfahren. Sie würde sofort anfangen, mich jeden Morgen und jeden Abend auszufragen, und darauf bestehen, dass ich zu einem Psychiater gehe oder so.
Andererseits: Vielleicht wäre das nicht das Schlechteste.
Vielleicht könnte ich dann endlich schlafen.
Augen auf. Augen zu.
Denk an was Nettes.
An den Sommer, der gerade beginnt. Also gut, daran werde ich jetzt denken. Das sechste Schuljahr ist vorüber, und ein schöner, fauler Sommer liegt vor mir. Okay, ich habe vielleicht nicht eine Million Freunde, mit denen ich abhängen könnte. Na und? Ich mach mir mein eigenes Unterhaltungsprogramm. Ich werde den Wald erkunden und mir in meinem zoologischen Tagebuch Notizen machen. Vielleicht ein paar Vögel zeichnen.
Es gibt jede Menge zu tun.
Ich brauche keine Million Freunde.
Nicht mal einen Freund brauche ich.
Ich brauche nur mich selbst, stimmt’s?
Solo – das ist überhaupt das Beste.
Erspart einem viel Ärger.
3 Hilfe anderer Art
Gulliver war ein guter Freund, Meerschweinchen hin oder her. Virgil konnte ihm alles erzählen, ohne dass Gulliver eine Meinung dazu äußerte. Das tat Virgil gut, aber er brauchte mehr. Er brauchte ganz praktische Ratschläge.
Er brauchte Hilfe anderer Art.
Lola hatte Virgil einmal eine Geschichte erzählt, die von einer Frau namens Dayapan handelte. Diese Frau hatte sieben Jahre lang Hunger gelitten, da ihr Volk nicht wusste, wie man Lebensmittel anbaut. Eines Tages weinte Dayapan, denn sie wünschte sich so sehr etwas zu essen, und wenn es nichts weiter als ein Reiskörnchen und eine Erbsenschote wäre. Um sich die Tränen abzuwaschen, nahm sie ein Bad in einer Quelle. Da erschien ein großer Geist und brachte ihr so viel Reis und Zuckerrohr, wie sie nur tragen konnte. Er erklärte ihr genau, was sie tun müsse, um bald mehr davon zu ernten. So kam es, dass Dayapan nie mehr Hunger litt.
Virgil wünschte sich, er hätte auch so einen großen Geist, der ihm genau sagte, was er tun sollte, doch er hatte nur Kaori Tanaka.
Virgil fütterte Gulliver und ging dann zum Frühstück. Auf dem Weg durch den Flur schrieb er eine SMS an Kaori. Normalerweise würde er niemandem morgens um Viertel vor acht schreiben, schon gar nicht am ersten Tag der Sommerferien, aber an Kaori war nichts normal. Davon abgesehen schien sie zu jeder Tageszeit wach zu sein.
Brauche Termin heute Nachmittag, falls o.k.
Virgil steckte sein Handy in die Pyjamatasche und folgte den unverwechselbaren Morgengeräuschen seiner Eltern und seiner Brüder. Joselito und Julius waren Frühaufsteher, denn irgendwie hatten sie andauernd Fußballtraining. Alle waren sie daher schon in der Küche, tranken Orangensaft und ließen ihr Temperament übersprudeln, während Virgil versuchte, sich einen Weg durch das donnernde Leben zu bahnen, um sich Obst zu nehmen oder ein Ei zu kochen.
»Guten Morgen, Virgil!«, sagte Joselito.
»Guten Morgen, Turtle«, sagten seine Eltern fast wie aus einem Munde.
Schließlich noch Julius: »Maayong buntag[2], Brüderchen.«
Virgil brummelte etwas, das nach Hallo klang. Seine Eltern saßen an der Küchentheke auf Hockern mit hohen Rückenlehnen. Lola saß am Frühstückstisch und las die Zeitung.
»Deine Mutter hat zu viele Clementinen gekauft, also iss, so viel du kannst«, sagte sie, ohne aufzublicken, und schnalzte wegen dieser Verschwendung mit der Zunge. Virgil nahm zwei Clementinen in jede Hand und passte gut auf, dass ihm bloß keine runterfiel, als er sich neben Lola setzte. Im selben Moment surrte das Handy in seiner Schlafanzugtasche.
»Was liest du da, Lola?«, fragte Virgil. Er ordnete die Clementinen in einer vollkommen geraden Reihe an, bevor er auf sein Telefon schaute.
Ich hab Zeit. Sei um zwölf hier. Pünktlich!
Virgil legte das Telefon mit der Vorderseite nach unten auf den Tisch, gleich neben die Clementinen.
»Tod und Zerstörung im ganzen Universum«, sagte Lola. »Gottlosigkeit hinter jeder Ecke.«
Julius drehte sich zu ihnen um. »Also echt, Lola, sei nicht so eine Spaßbremse!«
Virgil hegte schon lange den Verdacht, dass seine Brüder aus einer Fabrik stammten, die perfekte, supersportliche, von früh bis spät glückliche Kinder produzierte, während er selbst aus irgendwelchen übrig gebliebenen Bauteilen zusammengesetzt war. Der einzige Hinweis darauf, dass eine Kleinigkeit schiefgegangen war bei seinen Brüdern, waren die kleinen Finger der beiden, die leicht nach innen gebogen waren.
Während Virgil sich eine Clementine schälte, musterte er genau seine eigenen Hände. Seine Finger waren schlank und ganz gerade. Keiner war nach innen gebogen.
»Lola, kennst du dich mit Händen aus?«, fragte er mit einem vorsichtigen Seitenblick zu seinen Brüdern hinüber, doch die waren schon wieder in ein Gespräch über Fußball vertieft. Auch ihr Vater war kürzlich in einen Fußballverein für Erwachsene eingetreten. Alle Welt war verrückt nach Fußball. Nur Virgil nicht.
Lola ließ ihre Zeitung sinken. »Ich weiß, dass sie fünf Finger haben, meistens.«
»Wie meinst du das – meistens?«
»In meinem Dorf gab’s mal ein Mädchen mit zwei Daumen an einer Hand.«
»Wirklich? Und was hat man mit ihr gemacht? Ist sie zum Arzt gegangen, und er hat ihr den zweiten Daumen abgehackt?«
»Nein, ihre Familie war arm. Einen Arzt konnten die sich nicht leisten.«
»Ja, aber – was haben sie dann gemacht?«
»Nichts. Der zweite Daumen blieb dran.«
»Hat sie sich wie ein Monster gefühlt?«
»Vielleicht. Aber ich habe ihr gesagt, dass Gott sicher etwas weiß, was sie selbst nicht weiß, deshalb hätte er das so gemacht.«
»Vielleicht wollte er, dass sie gut per Anhalter fahren konnte.«
»Vielleicht. Oder sie war wie Ruby San Salvador.«
»Wer war das?«
»Auch ein Mädchen aus meinem Dorf. Sie hatte sieben Schwestern. Jedes der Mädchen wurde nach seiner Geburt von den Eltern zu einer Hellseherin gebracht, die ihm die Zukunft vorhersagen sollte. Aber als Ruby San Salvador an der Reihe war, konnte niemand ihre Zukunft voraussehen. Alle, die es versuchten, sahen nur ein leeres Bild vor sich. Niemand verstand, was das zu bedeuten hatte, und Ruby ging überall herum und fragte alle Leute: ›Wie sieht mein Schicksal aus? Wie sieht mein Schicksal aus?‹ Irgendwann sagte ich zu ihr: ›Keiner weiß es, aber du machst uns noch wahnsinnig.‹«
Virgil dachte an die arme Ruby San Salvador, die zusehen musste, wie alle ihre Schwestern etwas bekamen, was sie nicht haben konnte.
»Und was ist aus ihr geworden?«, wollte Virgil wissen.
»Sie ist fortgegangen, um es selbst herauszufinden. Im Dorf war es jedenfalls sehr viel ruhiger ohne ihre dauernde Fragerei.« Lola kniff die Augen zusammen. »Was hast du nur, Virgil? Wieso fragst du ausgerechnet nach Händen?«
»Mir ist nur eben aufgefallen, dass meine Finger schön gerade sind. Findest du nicht?«
Er legte die Clementinenschalen beiseite und beide Hände flach auf den Tisch, um sie Lola zu zeigen.
Lola nickte. »Stimmt, du hast sehr schöne Hände. Die Hände eines begnadeten Pianisten. Du solltest Klavierstunden bekommen. Li!«, rief sie. Li war der Name von Virgils Mutter. »Li!«
»Ja, manang[3]?«, antwortete Virgils Mutter, die gerade laut über etwas lachte. Sie schien immer zu lachen.
»Wieso bekommt Virgil eigentlich keinen Klavierunterricht? Er hat die Hände eines Pianisten.«
Virgils Vater antwortete anstelle seiner Frau. »Weil Jungen nun mal Sport treiben und nicht auf so einem albernen Klavier rumklimpern. Stimmt’s, Turtle?«
Virgil schob sich eine halbe Clementine in den Mund.
Mr. Salinas hob sein Glas mit dem Orangensaft. »Er muss nur endlich ein bisschen Speck auf die Rippen kriegen.«
Lola schaute weiter auf Virgils Hände und schüttelte den Kopf. »Ay, Herr Jesus«, murmelte sie. »Du solltest wirklich Klavier spielen, anak. Mit deinen Händen könntest du Konzerte im Madison Square Garden geben! Ganz sicher!«
»Vielleicht fang ich wirklich mit Klavier an«, sagte Virgil mit vollem Mund.
»Ja! Mach das! Gute Idee!«, sagte Lola. Dann wanderte ihr Blick zu Virgils Gesicht hoch, und sie betrachtete es aufmerksam. »Geht’s dir heute besser, anak?«
Virgil schluckte die halbe Clementine hinunter und nickte.
»Hm«, machte Lola. »Wie geht’s deinem Tierchen?«
»Dem geht’s gut. Aber gestern Abend habe ich im Internet gelesen, dass Meerschweinchen sehr soziale Tiere sind und nicht allein leben sollten.«
»Und?«
»Und – Gulliver ist allein.«
»Ist es das, was dir Sorgen macht?«
Gulliver hatte mit Virgils großem Versagen gar nichts zu tun. Normalerweise log Virgil auch nicht. Aber dies war eine Situation, in der man mit dem Wörtchen Ja zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen konnte (oder zwei Vögel mit einem Samenkorn füttern, wie Kaori gern sagte). Vielleicht würde er ein zweites Meerschweinchen bekommen, und Lola würde endlich aufhören, ihn danach zu fragen, weshalb er ein so trauriges Gesicht machte.
Also sagte er: »Ja.«
Lola nickte. Sie verstand zwar nicht, wieso irgendjemand sich ein Meerschweinchen wünschte. Aber was Einsamkeit war, das wusste jeder.
»Ich spreche mit deiner Mutter«, sagte sie.
4 Glocken eines buddhistischen Klosters
Die zwölfjährige Kaori Tanaka – ihrem Sternzeichen nach Zwilling und stolz darauf – behauptete gern, dass ihre Eltern aus Japan stammten, aus einem Samurai-Dorf im Nebel eines Hochgebirges. In Wirklichkeit kamen sie aus einer japanisch-amerikanischen Familie, die in zweiter Generation in Ohio lebte. Egal. Kaori spürte es in ihren Knochen, dass ihren Eltern die Berge als Geburtsort vorherbestimmt waren. Das passierte eben manchmal, dass Menschen am falschen Ort zur Welt kamen. Wie sonst sollte Kaori sich ihre eigenen hellseherischen Fähigkeiten erklären? Die konnten doch nur von einem magischen Ort auf sie gekommen sein.
Kaori war gelinde überrascht, als sie am ersten Ferientag, dazu noch morgens um Viertel vor acht, eine SMS von einem ihrer Kunden bekam. (Ihrem einzigen Kunden, um ehrlich zu sein.) Doch dann fiel ihr wieder ein, dass sie am Vorabend, als sie fast schon eingeschlafen war, eine Vision gehabt hatte: Sie hatte einen Habicht gesehen, der auf einem riesigen Zaunpfosten saß. Möglich, dass es auch ein Geier gewesen war. Auf jeden Fall war es ein Vogel gewesen, und Vogel begann mit einem V, genau wie der Name Virgil. Der Zusammenhang hätte nicht deutlicher sein können.
Sie war schon wach gewesen – sie wachte am liebsten gleich mit der Morgendämmerung auf –, als auf einmal die Glocken eines buddhistischen Klosters zu läuten begannen. Das war der Klingelton ihres Telefons, der ihr eine SMS meldete. Sofort griff sie nach ihrem Handy und las Virgils Nachricht.
»Scheint eilig zu sein«, sagte sie noch vom Bett aus. Sie redete gern laut, wenn sie allein war, für den Fall, dass irgendwelche Geister gerade zuhörten.
Als sie ihre Antwort abgeschickt hatte, zündete sie ein Räucherstäbchen an, lief über ihren runden Sternzeichenteppich und trat in den Flur. Leise klopfte sie an die Zimmertür ihrer jüngeren Schwester. Noch war außer Kaori niemand auf, schon gar nicht die siebenjährige Gen. Gens Sternzeichen war Krebs, und Krebse waren bekanntermaßen Nachteulen. Der Morgen war nicht ihre beste Tageszeit.
»Klopfen ist völlig zwecklos«, sagte sich Kaori und öffnete die Tür.
Sofort traf es sie wieder wie ein Schlag: die knallrosa Kommode ihrer Schwester, die knallrosa Vorhänge, der knallrosa Teppich und die knallrosa Bettdecke – für Kaoris Augen war das alles fast eine Beleidigung. Es war das typische Zimmer einer Zweitklässlerin, mit lauter Teddybären, die über den Boden verstreut waren, dem Teegeschirr aus Plastik, das im Zimmer verteilt war. Gen war grauenvoll unordentlich. Außerdem hatte sie die Eigenschaft, sich ständig ein neues Hobby zuzulegen. Sie war fest entschlossen, eines Tages Weltmeisterin in irgendwas zu werden. Erst drehte sich alles um Himmel und Hölle, dann um Klettergerüste, dann ums Damespiel. Am Boden lagen eine Flöte, auf der Gen es mal zur großen Meisterin hatte bringen wollen, und ein Buch über Abraham Lincoln, noch aus der Zeit, als Gen Amateurhistorikerin werden wollte. Ein rosa Springseil lag zusammengerollt wie eine Schnecke dicht am Fuß von Gens schmalem Bett – ein klarer Hinweis auf ihre neueste Besessenheit.
»Die wird auch noch mal groß«, sagte Kaori zu den Geistern. Auf dem Weg zum Bett kickte sie das Springseil aus dem Weg und seufzte dabei genervt. Schon seit einer ganzen Woche sprang Gen unablässig mit dem Seil durchs Haus und brachte jeden damit zur Verzweiflung. Schon drei Wassergläser waren seither zu Bruch gegangen.
»Gen«, sagte Kaori und pikste ihre Schwester in die Schulter. »Wach auf. Heute kommt ein Kunde, wir müssen alles vorbereiten.«
Gens Augenlider flatterten leicht, öffneten sich aber nicht.
»Gen!« Kaori bohrte den Finger etwas fester in den Kaninchenpyjama. Kaninchen! Also wirklich! »Aufstehen!«
Gen brummte irgendetwas und zog sich die Decke über den Kopf.
Kaori strich sich ihr eigenes Schlafanzugoberteil glatt – kohlschwarz mit roter Borte – und sagte: »Gut, dann bereite ich die Geistersteine eben alleine vor.«
Gen schlug die Decke zurück. Die Augen hatte sie jetzt weit aufgerissen. Ihr dunkles Haar stand in alle Richtungen ab. »Du benutzt die Geistersteine?«
»Ich habe Grund zur Annahme, dass ich sie brauchen werde. Aber da du noch so mit Schlafen beschäftigt bist …«
»Ich stehe schon auf.« Und das tat sie tatsächlich.
»Wir treffen uns im Geisterzimmer«, sagte Kaori. »Aber komm bloß nicht mit diesen Kaninchen!«